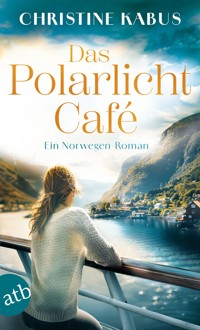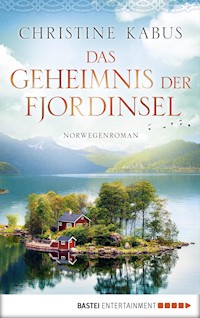9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die große Estland-Saga
- Sprache: Deutsch
Die Birken des Nordens.
Oldenburg, 1914: Luise reist nach Estland, wo die adelige Wilhelmine einen jungen deutschbaltischen Baron heiraten soll. Nicht wissend, dass es sich um den Zukünftigen ihrer Herrin handelt, trifft Luise auf Julius und verliebt sich in ihn. Die beiden Frauen fassen einen verwegenen Plan, aber ihr Glück steht auf Messers Schneide, denn schon bald bricht der Erste Weltkrieg aus ...
Estland, 1989: Bislang hat sich Merike stets ihrem tyrannischen Großvater gefügt, doch jetzt schließt sie sich gegen seinen Willen nicht nur der Unabhängigkeitsbewegung an, sondern kommt auch hinter streng gehütete Geheimnisse der Familie – und entdeckt ihre deutschen Wurzeln.
Vor der wildromantischen Kulisse Estlands beschreiten drei Frauen neue Wege auf der Suche nach Freiheit und Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 708
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Livland, 1914: Nie hätte Luise gedacht, dass sie einmal die Welt bereisen dürfe, doch hier ist sie: im Baltikum an der Seite ihrer neuen Herrin, die einen deutschbaltischen Baron heiraten soll. Kurz vor ihrer Ankunft auf dem Rittergut, wo ihre Freundin ihren Zukünftigen kennenlernen soll, verliebt sich Luise Hals über Kopf in einen Fremden – der sich ausgerechnet als jener Julius entpuppt, dem Wilhelmine versprochen ist.
Estland, 1989: Ein paar Tage im Ferienlager ohne ihren herrischen und linientreuen Großvater zeigen Merike, dass sie allzu lang ihre Augen vor der Realität verschlossen hat. Als die 19-Jährige sich der Volksfrontgruppe anschließt, wird ihr jedoch klar, dass die Antworten auf ihre Fragen nicht allein in der Souveränität Estlands von der UdSSR liegen, sondern auch tief in der Vergangenheit ihrer Familie.
Über Christine Kabus
Christine Kabus, 1964 in Würzburg geboren und in Freiburg aufgewachsen, arbeitete nach ihrem Studium der Germanistik und Geschichte zunächst einige Jahre als Dramaturgin und Lektorin bei verschiedenen Film- und Theaterproduktionen, bevor sie sich 2003 als Drehbuchautorin selbstständig machte. 2013 wurde ihr erster Roman veröffentlicht.
Im Aufbau Taschenbuch ist bereits ihr Roman »Die Zeit der Birken« erschienen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Christine Kabus
Die Birken der Freiheit
Roman
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Motto
Prolog
Oldenburg, Frühling 1914: Kapitel 1
Lahemaa / Estland, Sommer 1989 : Kapitel 2
Oldenburg, Frühling 1914 : Kapitel 3
Lahemaa / Estland, Sommer 1989 : Kapitel 4
Lübeck, Frühling 1914 : Kapitel 5
Lahemaa / Estland, Sommer 1989 : Kapitel 6
Estland, Frühling 1914: Kapitel 7
Lahemaa / Estland, Sommer 1989: Kapitel 8
Reval / Estland, Frühling 1914: Kapitel 9
Lahemaa / Estland, Sommer 1989: Kapitel 10
Dorpat / Livland, Frühsommer 1914: Kapitel 11
Otepää / Estland, Sommer 1989: Kapitel 12
Dorpat / Livland, Frühsommer 1914: Kapitel 13
Otepää / Estland, Sommer 1989: Kapitel 14
Dorpat / Livland, Frühsommer 1914: Kapitel 15
Otepää / Estland, Sommer 1989: Kapitel 16
Kirchspiel Oberpahlen / Livland, Sommer 1914: Kapitel 17
Otepää / Estland, Sommer 1989: Kapitel 18
Kirchspiel Oberpahlen / Livland, Sommer 1914: Kapitel 19
Otepää / Estland, Sommer 1989: Kapitel 20
Kirchspiel Oberpahlen / Livland, Sommer 1914: Kapitel 21
Otepää / Estland, Sommer 1989: Kapitel 22
Kirchspiel Oberpahlen / Livland, Sommer 1914: Kapitel 23
Otepää / Estland, Sommer 1989: Kapitel 24
Kirchspiel Oberpahlen / Livland, Sommer 1914: Kapitel 25
Otepää / Estland, Sommer 1989: Kapitel 26
Kirchspiel Oberpahlen / Livland, Sommer 1914: Kapitel 27
Otepää / Estland, Sommer 1989: Kapitel 28
Kirchspiel Oberpahlen / Livland, Sommer 1914 : Kapitel 29
Otepää / Estland, Sommer 1989: Kapitel 30
Kirchspiel Oberpahlen / Livland, Sommer 1914: Kapitel 31
Otepää / Estland, Sommer 1989 : Kapitel 32
Kirchspiel Oberpahlen / Livland, Sommer 1914 : Kapitel 33
Otepää / Estland, Sommer 1989: Kapitel 34
Kirchspiel Oberpahlen / Livland, Sommer 1914: Kapitel 35
Otepää / Estland, Sommer 1989: Kapitel 36
Kirchspiel Oberpahlen / Livland, Sommer 1914 : Kapitel 37
Otepää / Estland, Sommer 1989: Kapitel 38
Kirchspiel Oberpahlen / Livland, Sommer 1914 : Kapitel 39
Otepää / Estland, Sommer 1989 : Kapitel 40
Livland, Sommer 1914: Kapitel 41
Otepää / Estland, Sommer 1989 : Kapitel 42
Livland, Sommer 1914: Kapitel 43
Otepää / Estland, Sommer 1989: Kapitel 44
Livland, Sommer 1914 : Kapitel 45
Otepää / Estland, Sommer 1989: Kapitel 46
Estland, Sommer 1914 : Kapitel 47
Otepää / Estland, Sommer 1989 : Kapitel 48
Otepää / Estland, Sommer 1989 : Kapitel 49
Epilog
Anmerkungen
Danksagung
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Für Christiane, möge unsere Freundschaft weitere 40 Jahre bestehen!
1914
1989
Targa vaatave tuuma pääle, rumala koore pääle. Die Klugen sehen auf den Kern, die Dummen auf die Schale.
Prolog
»Bitte, seid doch vernünftig. Bleibt hier!«
Das Flehen in der Stimme seiner Mutter schnitt dem jungen Mann ins Herz, die Sorge in ihren Augen ließ ihn den Blick abwenden. »Unsere Entscheidung steht fest.« Er griff nach der Hand seiner Frau, die neben ihm auf dem Sofa saß. »Heute Nacht gehen wir in die Wälder und bringen den Männern Proviant und Verbandszeug.« Er deutete mit dem Kinn auf zwei prall gefüllte Segeltuchrucksäcke, die neben der Tür standen.
»Es ist viel zu gefährlich!« Seine Mutter beugte sich über den niedrigen Tisch zu dem Paar. »Erst vorgestern haben sie drüben bei Pühajärve ein Versteck ausgeräuchert und alle, die darin waren, sofort ersch…«
»Das wird uns nicht passieren«, fiel er ihr ins Wort. »Wir werden sehr vorsichtig sein, versprochen.«
»Wartet doch wenigstens bis zum Frühling. Wenn der Schnee weg ist, kann man die Spuren besser verwischen.«
»Dann sind die Leute da draußen längst verhungert«, wandte die junge Frau ein. »Sie brauchen unsere Hilfe jetzt. Nicht erst in ein, zwei Monaten.«
»Aber ihr habt keine Chance!«, brach es aus ihrer Schwiegermutter heraus. »Es ist ein aussichtsloser Kampf.«
Sie dachte an die zunehmende Kollektivierung der Landwirtschaft, die den Waldbrüdern schwer zusetzte. Die Bauern, die ihnen zuvor Unterschlupf gewährt und sie versorgt hatten, verloren ihre kleinen Höfe und konnten ihnen nicht länger helfen. Außerdem gelang es dem Geheimdienst immer öfter, Agenten in die Untergrundgruppen einzuschleusen und diese auffliegen zu lassen.
»Das meinst du nicht ernst!« Der junge Mann sah seine Mutter ungläubig an. »Hast du nicht selbst an Vaters Seite jahrelang die Partisanen unterstützt?«
»Das waren andere Zeiten. Das kann man nicht vergleichen.«
»Wir bekommen sicher bald Unterstützung«, sagte die junge Frau. »Die USA und Großbritannien werden nicht zulassen, dass sich Stalin das Baltikum auf Dauer einverleibt.«
Ihre Schwiegermutter presste die Lippen aufeinander. Sie kannte die Hoffnung vieler Esten auf das valge laev – das weiße Schiff – am Horizont, das aus dem Westen kommen und sie retten würde. Sie selbst glaubte schon lange nicht mehr daran. Das kleine Land war wieder einmal auf sich selbst gestellt.
»Ich war immer stolz darauf, so mutige Eltern zu haben«, sagte der junge Mann. »Jetzt kann ich beweisen, dass ich euch ein würdiger Sohn bin.«
»Niemand zweifelt an deinem Mut«, sagte seine Mutter leise. »Du musst nichts beweisen.« Sie fasste ihn am Arm. »Bitte!«
»Würde Vater auch wollen, dass ich mich wegducke? Würde er nicht erwarten, dass ich kämpfe?«
»Es ist schwer, für die Toten zu sprechen«, antwortete seine Mutter. »Mag sein, dass du recht hast. Schließlich bist du ihm sehr ähnlich. Heißblütig und geradeheraus. Aber es ist auch möglich, dass er an deiner Stelle anders handeln würde. Vielleicht hätte er sich damals sogar anders entschieden und wäre früher nach Hause zurückgekehrt.«
»Wie kommst du denn darauf?« Der junge Mann runzelte die Stirn.
»Er wusste nicht, dass er Vater wird. Ihr dagegen habt bereits ein Kind.« Sie drehte sich zu ihrer Schwiegertochter. »Soll die Kleine wirklich als Waise aufwachsen, wenn sie euch erwischen?«
»Soll sie in einer Diktatur aufwachsen?« Die junge Frau sprang auf. »Ich möchte mir nicht irgendwann die Frage stellen, warum wir nicht für unsere Freiheit gekämpft haben. Es nicht zumindest versucht haben. Es geht schließlich auch um die Zukunft unserer Kinder.«
Ihre Schwiegermutter erhob sich ebenfalls. »Aber soll eure Tochter das gleiche Schicksal erleiden wie ihr Vater? Oder ein noch schlimmeres und beide Elternteile verlieren?«
»Jetzt male den Teufel nicht an die Wand«, sagte der junge Mann. »Uns wird schon nichts passieren.« Er stand auf und nahm seine Mutter in den Arm. »Wir wollen ja fürs Erste nur diese eine Aktion durchziehen. Dann kommen wir zurück und halten die Füße still.«
Seine Mutter unterdrückte ein Seufzen und erwiderte seine Umarmung. Etwas Ähnliches hatte sein Vater gesagt, als sie ihn das letzte Mal gesehen hatte. Damals, vor über zwanzig Jahren.
Lieber Gott, betete sie stumm. Beschütze meinen Sohn! Bitte mach, dass es heute Nacht nach seinem Aufbruch schneit, damit ihn seine Spuren nicht verraten können.
Oldenburg, Frühling 1914
Kapitel 1
Pünktlich um halb acht schloss der Platzanweiser die Tür zur Loge im ersten Rang, in der Luise Gerdes neben ihrer Schwester Ella saß. Das Licht im Zuschauerraum erlosch, die Gespräche verstummten, und das Publikum richtete seine Aufmerksamkeit auf die Bühne, wo der schwere Samtvorhang aufgezogen wurde und den Blick auf die erste Szene des Stücks Alt-Heidelberg freigab, mit dem die Spielzeit Ende April vor der langen Sommerpause beendet wurde.
Das Großherzogliche Theater war nach einem verheerenden Brand zwanzig Jahre zuvor im neubarocken Stil wiederaufgebaut worden. Es war das erklärte Anliegen der oldenburgischen Herzogsfamilie, auch weniger begüterten Bürgern und Angehörigen der unteren Stände den Zugang zu Kunstgenuss und gehobener Unterhaltung zu ermöglichen. Aus diesem Grund stand stets ein Kontingent an erschwinglichen Karten zur Verfügung, und seit 1901 fanden zudem regelmäßig verbilligte Volksvorstellungen statt.
Luise und ihre fünf Jahre jüngere Schwester Ella verabredeten sich häufig im Schauspielhaus, wo sie meistens auf Stehplätzen in der Galerie zu fünfzig Pfennigen Dramen von Shakespeare, Schiller und Goethe, aber auch Komödien und Operetten verfolgten. An diesem Abend erlebten sie das Theater jedoch aus einer ganz neuen Perspektive. Die Loge der Baronin Beulwitz befand sich im ersten Rang auf der rechten Seite dicht neben der Bühne und bot sowohl auf das dortige Geschehen als auch auf die anderen Logen und die Stuhlreihen im Parkett eine gute Sicht. Die mit rotem Samt bezogenen Sessel machten den Abend deutlich komfortabler, während das Stehen bei längeren Vorstellungen zur Qual werden konnte. Dafür hatten sie mit drei Mark zwanzig einen Preis, der für die Schwestern unerschwinglich war. Für diese Summe konnte man in einem guten Hotel ein Zimmer buchen, ein einfach broschiertes Buch oder ein Kilogramm Bohnenkaffee erwerben. Luises Etat gab solche Ausgaben nicht her, sie erhielt als Dienstmädchen 250 Mark im Jahr. Ella verdiente als Arbeiterin in der Warpsspinnerei, in der Baumwollgarne hergestellt wurden, zwar mehr, musste davon aber Ausgaben für Kleidung und Verpflegung sowie die Miete für ihre Unterkunft bestreiten – Posten, die bei ihrer älteren Schwester wegfielen, da freie Kost und Logis Teil ihrer Entlohnung waren.
Luise schaute ein letztes Mal auf den Theaterzettel, auf dem eine längere Pause nach dem dritten Aufzug angekündigt wurde. Ihr blieb eine gute Stunde Galgenfrist, bevor sie Ella von dem Angebot erzählen würde, das die Baronin ihr unterbreitet hatte.
»Ich weiß, wie nah Sie beide sich stehen und dass Ihnen die Trennung nicht leichtfällt«, hatte die alte Dame einige Stunden zuvor gesagt. »Aber Sie fahren ja nicht ans Ende der Welt. Und Sie können selbstverständlich jederzeit zurückkehren.« Baronin Beulwitz hatte sie freundlich angelächelt. »Für mich wäre es ein beruhigendes Gefühl, Sie gut versorgt zu wissen. Wobei ich natürlich keinen Zweifel hege, dass Sie auch ohne meine Hilfe eine gedeihliche Stelle finden würden.« Sie hatte Luises Arm getätschelt und ihr die Theaterkarten gegeben. »Genießen Sie den Abend mit Ihrer Schwester und machen Sie sich nicht so viele Gedanken. Ella ist schließlich kein Kind mehr, für das Sie die Verantwortung tragen.«
Aber sie ist die einzige nahe Verwandte, die mir geblieben ist, dachte Luise. Wird sie sich nicht von mir im Stich gelassen fühlen? Sie musterte verstohlen das Gesicht der Neunzehnjährigen, die auf die Kante ihres Sessels vorgerutscht war und mit leuchtenden Augen das Geschehen auf der Bühne verfolgte. Luise kannte den Inhalt des Schauspiels von Wilhelm Meyer-Förster bereits, das sich ungeachtet der verächtlichen Kritiken einer ständig wachsenden Beliebtheit erfreute. Sie war eine regelmäßige Besucherin der Öffentlichen Bibliothek zu Oldenburg sowie der Lese- und Bücherhalle, wo sie oft ihre freien Stunden verbrachte und sich stapelweise Bücher auslieh – darunter auch die Erzählung Karl-Heinrich, auf der das Theaterstück basierte.
Alt-Heidelberg handelte vom jungen Prinzen Karl-Heinrich, der nach dem frühen Tod seiner Eltern am Hof seines strengen, gefühlskalten Onkels eine freudlose Jugend verbrachte. Da er auserkoren war, dereinst dessen Regierungsgeschäfte zu übernehmen, wurde er nach Heidelberg geschickt, um dort ein Jahr lang Jura zu studieren. Sein ehemaliger Hauslehrer sollte ihn begleiten und darüber wachen, dass er fleißig lernte und sich nicht ablenken ließ. Da Doktor Jüttner jedoch einst selbst in der Stadt am Neckar die Universität besucht und diese Zeit als die glücklichste seines Lebens in Erinnerung hatte, ermutigte er seinen Schützling, sich den Freuden des Studentendaseins hinzugeben und die Freiheit fern des höfischen Zeremoniells auszukosten. Karl-Heinrich fand rasch Anschluss in einer Burschenschaft, genoss das gesellige Treiben und verliebte sich Hals über Kopf in Käthie, die Nichte des Gastwirts, bei dem er logierte.
Luise lehnte sich in ihrem Sessel zurück und ließ sich bereitwillig von den Schauspielern in eine andere Welt entführen. Sie war froh, sich eine Weile nicht mit der von ihr zu treffenden Entscheidung beschäftigen zu müssen und den Veränderungen, die in ihrem Leben bevorstanden.
Der dritte Akt bereitete dem unbeschwerten Studentenleben von Karl-Heinrich ein jähes Ende. Ein Minister überbrachte dem Prinzen die Nachricht von der schweren Krankheit seines Onkels sowie die Aufforderung, unverzüglich die Heimreise anzutreten und die Regentschaft zu übernehmen. Nachdem er sich in Heidelberg zum ersten Mal frei gefühlt, Freundschaften geknüpft und nicht zuletzt Seligkeit in den Armen seiner geliebten Käthie gefunden hatte, stürzte Karl-Heinrich die Aussicht, das alles aufgeben zu müssen und an den als trostlosen Kerker empfundenen Fürstenhof zurückzukehren, in Verzweiflung.
Luise war beeindruckt von dem jungen Schauspieler, der den Stimmungswechsel und inneren Kampf des Prinzen sehr glaubwürdig vermittelte. Verzweifelt hob er soeben seine Arme und rief: »Also ich habe keinen Willen, keine Freiheit, keine Selbstbestimmung – ich bin ein Gefangener?!«
Der Minister zeigte sich unbeeindruckt. »Das ist mehr oder weniger, Durchlaucht, unser aller Los.«
Nach einem letzten Gespräch mit Doktor Jüttner, der ihn eindringlich bat, ein Mensch zu bleiben und sich nicht verbiegen zu lassen, endete der dritte Aufzug mit dem Abschied von Käthie.
»So ein Blödmann«, zischte Ella, während der Vorhang fiel, die Lichter im Saal angingen und Applaus aufbrandete. Ihre Wangen waren vor Empörung gerötet, ihre hellblauen Augen blitzten, und zwischen ihren Brauen hatte sich eine steile Falte gebildet. »Wie kann er Käthie so mir nichts, dir nichts verlassen?«
Sie wird unserer Mutter immer ähnlicher, dachte Luise. Sie ist ihr nicht nur wie aus dem Gesicht geschnitten, sondern hat auch ihr Temperament geerbt. Luise hingegen kam mehr nach ihrem Vater. Das sagten zumindest alle, die ihn gekannt hatten. Sie selbst konnte sich kaum noch an sein Gesicht erinnern. Dabei waren er und ihre Mutter erst vor sechs Jahren gestorben. Hatte er wirklich auch so runde Wangen, die gleiche schmale Nase und gerade Augenbrauen gehabt? Und welche Farbe hatten seine Haare, bevor sie grau wurden? Waren sie dunkelbraun wie Luises eigene? Auf dem schwarz-weißen Hochzeitsfoto von ihren Eltern konnte man das nicht erkennen.
»Findest du nicht auch, dass er seinem Herzen folgen sollte?«
Die Ungeduld in Ellas Stimme riss Luise aus ihren Grübeleien. »Äh … wer?«
»Dieser Karl-Heinrich, wer sonst.« Ella sah sie vorwurfsvoll an.
»Ach so … hm … dazu hat er wahrscheinlich zu wenig Selbstvertrauen«, antwortete Luise. »Schließlich hat man ihm sein ganzes Leben eingetrichtert, welche Pflichten er als Erbprinz einmal haben wird. Sich dagegen aufzulehnen erfordert sehr viel Mut.«
»Warum?« Ella schob die Unterlippe vor. »Der Minister hat doch selbst gesagt, dass niemand ihn zwingen kann, in die Fußstapfen seines Onkels zu treten.«
»Aber er hat ihm auch vor Augen geführt, dass er eine große Verantwortung hat und man von ihm …«
»Warum musst du immer so schrecklich vernünftig sein?«, brach es aus Ella heraus. »Regt dich diese Schicksalsergebenheit nicht auf? Was ist Karl-Heinrich seinem Onkel denn schuldig? Der ist ein grässlicher Mensch, der nie ein gutes Wort für seinen Neffen hatte. Käthie dagegen hat ihm ihre Liebe geschenkt, das wiegt doch viel schwerer.«
»Du machst es dir sehr einfach«, sagte Luise. »Ich denke, dass sich der Prinz nicht so sehr seinem Onkel gegenüber verpflichtet fühlt, sondern dem Amt und den Untertanen des Fürstentums.«
»Das sind doch nur Ausreden!« Ella stand auf. »Ich glaube, seine Liebe ist einfach nicht groß genug. Sonst würde er sich gegen diese Fremdbestimmung auflehnen und sein Leben selbst in die Hand nehmen.« Sie zupfte die geraffte Schärpe ihres knöchellangen Kleides zurecht und sah Luise auffordernd an.
Diese blieb sitzen und krampfte die Hände um den gestrickten Beutel, der auf ihrem Schoß lag. Sie trug einen schmalen, dunkelblauen Rock, kombiniert mit einer weit geschnittenen, über die Hüfte fallenden Tunika mit einem tiefen Spitzausschnitt und einem breiten Kragen aus glänzendem Seidensatin. Beides hatte sie sich nach Schnittmustern aus der Zeitschrift »Die Große Modenwelt« geschneidert.
»Wollen wir uns nicht ein wenig die Beine vertreten?«, fragte Ella, ließ die Schultern kreisen und massierte sich den Nacken, über dem sie ihr Haar zu einem lockeren Dutt aufgesteckt hatte. »Die Sessel sind zwar gut gepolstert, aber nach dem langen Stillsitzen brauche ich Bewegung.« Sie wandte sich zur Tür und griff nach der Klinke.
»Bitte bleib. Ich muss etwas mit dir besprechen.« Luises Stimme klang belegt. Sie räusperte sich. »Und hier sind wir ungestört.«
Ella sah sie überrascht an. »Du klingst so ernst«, stellte sie fest. »Was ist los?« Sie nahm wieder Platz.
»Ähm, also … ich werde …. Die Baronin hat …«, begann Luise und verfluchte ihr Gestammel. Warum konnte sie nicht kurz und bündig sagen, worum es ging?
»Hat sie dir etwa gekündigt?«, fragte Ella.
Luise nickte.
»Weil sie jetzt in dieses Damenstift geht?«, fuhr Ella fort. »Das hat sie doch schon seit einer Weile vor, nicht wahr?«
Wieder nickte Luise.
»Und nun weißt du nicht, wie es für dich weitergeht?« Ella zuckte mit den Schultern. »Du musst dir doch wirklich keine Sorgen machen, wieder eine Arbeit zu finden. Du hast doch die besten …«
»Darum geht es nicht«, fiel ihr Luise ins Wort.
»Worum dann? Bist du enttäuscht, weil sie dich nicht mitnimmt?« Ella zog die Stirn kraus. »Sei doch froh. Du würdest in einem abgeschiedenen Kaff landen, umgeben von alten Schachteln, die auf ihr Ende warten.«
Luise zuckte zusammen. Ihre Schwester hatte zuweilen eine Neigung, Dinge unverblümt beim Namen zu nennen, die sie befremdete.
»Nein, das hatte ich gar nicht erwartet«, versuchte Luise, sich zu erklären. »Wobei ich mir nicht vorstellen kann, je wieder eine so gütige und sympathische Herrin wie die Baronin zu treffen.«
»Ehrlich gesagt, verstehe ich nicht, was du daran findest, als Dienstmädchen zu schuften.«
»Für die Baronin bin ich viel mehr als das«, unterbrach Luise sie. »Im Grunde bin ich ihre Gesellschafterin. Sie vertraut mir rückhaltlos und hat …«
»Dich trotzdem entlassen«, rief Ella. »Du kannst sagen, was du willst. Für sie bist und bleibst du eine Untergebene. Oder bildest du dir ernsthaft ein, dass sie in dir eine Gleichgestellte sieht?«
»Das wohl nicht«, antwortete Luise.
Ich glaube vielmehr, dass ich für sie eine Art Tochter bin, fuhr sie im Stillen fort. Sie hat nicht nur einmal angedeutet, wie sehr sie sich Kinder gewünscht hätte und mir so manchen mütterlichen Rat gegeben. Luise verzichtete darauf, Ella in diese Erkenntnis einzuweihen und eine längere Diskussion über adlige Arroganz, Standesdünkel und unüberbrückbare Gräben zwischen den verschiedenen Gesellschaftsschichten vom Zaun zu brechen.
»Jetzt verrate mir endlich, was dich bedrückt«, bat Ella.
»Gute Bekannte der Baronin würden mich gern als Zofe für ihre Tochter anstellen«, sagte Luise. »Familie von Rahden. Der Graf ist Offizier im Dragoner-Regiment. Seine Frau engagiert sich im Wohlfahrtsverein, der jüngere Sohn tritt in die Fußstapfen seines Vaters. Wilhelmine, die Tochter, ist derzeit bei einer Tante in England.«
»Klingt alles sehr gediegen«, sagte Ella. »Wo wohnen sie denn? Hoffentlich nicht weit weg?«
»Nein, hier in Oldenburg. Am Caecilienplatz, im Dobbenviertel.«
»Noble Adresse. Und viel näher bei meiner Pension. Wir könnten uns öfter …« Ella unterbrach sich, als Luise den Kopf schüttelte. »Nicht? Ist das der Pferdefuß? Gibt es bei denen weniger Freizeit?«
»Das weiß ich nicht.« Luise holte tief Luft. »Ich würde Oldenburg verlassen. Die Tochter soll nämlich unmittelbar nach ihrer Rückkehr nach Russland fahren. Und ich soll sie begleiten.« Sie sah ihre Schwester unsicher an.
»Aber das ist doch wunderbar!« Ella rutschte auf ihrem Sessel nach vorn und strahlte Luise an. »Du kommst endlich raus und wirst etwas von der Welt sehen. Ach, was würde ich darum geben, mit dir reisen zu können!« Sie stutzte. »Warum soll diese Wilhelmine denn nach Russland? Wenn sie doch gerade erst einen langen Aufenthalt im Ausland hinter sich hat?«
»Sie soll dort ihren zukünftigen Ehemann kennenlernen«, antwortete Luise.
»In Russland?« Ellas Augen weiteten sich. »Wieso um alles in der Welt soll sie einen Russen heiraten?«
»Der Bräutigam stammt aus einer deutschbaltischen Familie, die schon seit vielen Generationen in Livland ansässig ist. Das ist so wie Finnland ein Gouvernement des Zarenreiches.«
»Aha. Trotzdem verstehe ich nicht, wieso …«
»Diese Ehe wurde wohl schon vor langer Zeit verabredet.«
»Das ist ja entsetzlich!«, rief Ella. »Ich dachte, so etwas gäbe es heutzutage nicht mehr. Diese von Rahdens scheinen ja noch im finstersten Mittelalter zu leben.« Ellas Augen funkelten vor Empörung.
»Ich finde das auch seltsam«, gab Luise zu. »Aber wenn ich die Baronin richtig verstanden habe, soll die Tochter selbst entscheiden dürfen, ob sie den Auserkorenen dann tatsächlich heiratet oder nicht.«
»Wenn man sie so bearbeitet hat wie den armen Karl-Heinrich in dem Theaterstück, wird sie sich den Erwartungen ihrer Eltern wohl kaum widersetzen.« Ella schnaubte. »Wahrscheinlich ist sie eines dieser blutarmen Fräulein, die gar keinen eigenen Willen haben und brav das tun, was von ihnen verlangt wird. Um nur ja keinen Anstoß zu erregen oder althergebrachte Traditionen zu verletzen.«
Luise waren ähnliche Gedanken durch den Kopf gegangen, als Baronin Beulwitz ihr davon erzählt hatte. Die Vorstellung, einen völlig Fremden zu heiraten und den Rest des Lebens an seiner Seite zu verbringen – noch dazu in einem anderen Land, weit entfernt von der eigenen Familie und Freunden –, kam ihr ebenso abwegig vor wie ihrer Schwester.
»Na ja, dir kann das egal sein«, fuhr Ella fort. »Du bekommst eine Gelegenheit, ein fremdes Land kennenzulernen. Und im Gegensatz zu der unglücklichen Wilhelmine kannst du jederzeit weggehen, wenn es dir dort nicht gefällt.«
»Ich bin so froh, dass du das positiv aufnimmst«, sagte Luise. »Ich hatte befürchtet, dass du …«
»Dass ich dir böse bin, wenn du dir einen lang gehegten Wunsch erfüllst? Ich bitte dich! Du hast in den letzten Jahren so viel für mich getan.« Ella fasste nach Luises Hand und drückte sie. »Natürlich wirst du mir furchtbar fehlen. Aber vor allem freue ich mich für dich. Ich weiß doch, wie gern du mal all die Orte und Landschaften sehen würdest, von denen in deinen geliebten Büchern die Rede ist. Und gerade die russischen Romane haben es dir doch angetan. Dieses Stellenangebot ist wie für dich gemacht!«
»Danke, du bist sehr lieb.« Luise streichelte Ellas Hand.
Die Gelegenheit, zum ersten Mal in ihrem Leben mehr als ein paar Kilometer aus Oldenburg herauszukommen, hatte das Angebot der Baronin für Luise auf Anhieb verlockend gemacht. Wie oft hatte sie sich beim Lesen in andere Städte und auf ferne Kontinente entführen lassen und sich nichts sehnlicher gewünscht, als wenigstens ein paar davon eines Tages mit eigenen Augen sehen zu können?
»Und wer weiß, vielleicht tun sich in Livland ja ungeahnte Möglichkeiten auf«, sagte Ella mit Begeisterung in der Stimme. »Wenn es dir dort gut gefällt, könnte ich doch nachkommen. Vielleicht können wir uns dort den Traum von einem gemeinsamen Geschäft erfüllen.«
Das erste Klingeln, mit dem das Ende der Pause angekündigt wurde, unterbrach das Gespräch.
»Entschuldige mich.« Ella sprang auf. »Ich muss noch rasch auf die Toilette.« Sie eilte aus der Loge.
Luise ließ sich gegen die Lehne ihres Sessels sinken. In die Erleichterung über die unerwartet wohlmeinende Reaktion ihrer Schwester mischten sich Wehmut und Sorge. Zwar lag Ella richtig, was ihre Sehnsucht nach fremden Ländern anging. Die Aussicht, ihre Heimat und ihre Schwester auf unbestimmte Zeit zu verlassen, bedrückte sie dennoch. Dazu kam die Ungewissheit, wie sie sich mit Wilhelmine von Rahden verstehen und wie sich das Zusammenleben mit einer Unbekannten gestalten würde. Was, wenn sich ihre neue Herrin als launische Tyrannin entpuppte, die sie spüren ließ, dass sie nur eine Dienstbotin war?
Jetzt mach dich nicht verrückt, ermahnte sich Luise. Dein Erspartes reicht auf jeden Fall aus für eine Rückfahrkarte. Im Gegensatz zu dem armen Erbprinzen auf der Bühne da unten bist du ein freier Mensch und kannst zum Glück in einem gewissen Rahmen selbst entscheiden, welche Verhältnisse zu ertragen du bereit bist.
Sie setzte sich aufrechter und lächelte ihrer Schwester zu, die kurz nach dem dritten Pausenklingeln in die Loge zurückkam.
In der zweiten Hälfte fiel es Luise schwer, sich auf das Schauspiel zu konzentrieren, das zwei Jahre nach den Heidelberger Tagen von Karl-Heinrich wiedereinsetzte. In der Zwischenzeit war aus dem fröhlichen Studenten ein gesetzter, resignierter Landesherr geworden, der in Kürze eine noch von seinem inzwischen verstorbenen Onkel arrangierte standesgemäße Ehe eingehen sollte. Zuvor leistete er sich einen letzten Ausbruch aus den vorgeschriebenen Bahnen und besuchte Käthie, die er nie hatte vergessen können – nur um sie dann für immer aus seinem Leben zu verbannen.
Luises Gedanken schweiften immer wieder zu ihrer bevorstehenden Reise und der Frage, was die nächsten Wochen und Monate für sie bereithalten würden. Während die Bühnenfigur dort unten genau wusste, was sie erwartete, schritt sie einer unbekannten Zukunft entgegen.
Lahemaa / Estland, Sommer 1989
Kapitel 2
Merike stand vor dem Mast und entfaltete die rote Fahne, in deren Mitte das Profil Lenins auf einem gelb umrandeten fünfzackigen Stern prangte, hinter dem eine Flamme emporloderte. Darunter stand in kyrillischen Buchstaben das Motto der Lenin-Pioniere: Всегда готов! – Immer bereit! Nachdem sie das Tuch befestigt hatte, drehte sie sich zu den zweiundzwanzig Viert- bis Sechstklässlern um, die in drei Reihen auf dem Rasenplatz zwischen den einstöckigen, weiß getünchten Holzbaracken zum Appell angetreten waren. Es war zehn vor acht. Die Sonne war seit ihrem Aufgang kurz nach vier Uhr schon ein gutes Stück den Himmel hinaufgewandert und ließ die Tauperlen an den Gräsern glitzern. Zwanzig Minuten zuvor war Merike durch den Schlafsaal der ihr anvertrauten Mädchen gegangen, hatte diese geweckt und zum Waschen geschickt. Marten, der andere Gruppenleiter, hatte das Gleiche bei den Jungen getan und war anschließend zu einer Kolchose bei Kunda gefahren, um die bestellten Kartoffeln, Gemüse, Eier und andere Lebensmittel zu holen, die nicht wie geplant am Vorabend geliefert worden waren. Marten hoffte, wieder zum Frühstück zurück zu sein, das es in einer guten Stunde geben würde – nach Fahnenappell, Bettenmachen und Zimmeraufräumen.
Merike nickte Enna zu. Die Neunjährige war die Kleinste der Gruppe und hatte in der Nacht vor Heimweh lange nicht einschlafen können. Merike hatte sie getröstet und schließlich ihre Tränen mit dem Versprechen, sie dürfe gleich beim ersten Morgenappell die Fahne hissen, zum Versiegen gebracht.
Enna trat vor. Wie ihre Mitschüler trug sie ein rotes Dreieckstuch um den Hals, das mit einem speziellen Knoten gebunden war. Die drei Ecken symbolisierten die enge Verbundenheit zwischen Schule, Elternhaus und Pionierorganisation, der Knoten stand für die feste Einheit dieser Eckpunkte im Leben eines sowjetischen Kindes. Zwei Jungen schlugen auf kleine Trommeln, die sie vor ihre Bäuche geschnallt hatten, während das Mädchen an den Schnüren zog. Enna hatte die Zungenspitze in den Mundwinkel geklemmt und schaute konzentriert auf die Fahne, die Stück für Stück in die Höhe kletterte. Merike folgte ihrem Blick und fühlte sich an jenen Tag zurückversetzt, an dem sie selbst zum ersten Mal die Flagge der Pioniere hatte hochziehen dürfen.
Lange hatte sie auf diesen Moment gewartet und schon fast die Hoffnung aufgeben, jemals das feierliche Ritual ausführen zu dürfen. Mit zunehmender Verzweiflung hatte sie sich gefragt, warum sie als Einzige in ihrer Klasse dieser Ehre nicht für wert befunden wurde. An ihren Noten konnte es nicht liegen, sie gehörte zu den drei Jahrgangsbesten. Auch ihr Engagement bei Arbeitseinsätzen, zu denen die Pioniere gelegentlich gerufen wurden, war immer vorbildlich gewesen. Nie hatte sie sich als Erntehelferin, Müllaufsammlerin oder bei anderen Tätigkeiten gedrückt, mit denen die Kinder und Jugendlichen ihren Beitrag für die Gemeinschaft leisten sollten. Als dann endlich der ersehnte Tag gekommen war – eine Feierstunde an Lenins Todestag –, war die damals dreizehnjährige Merike vor Nervosität fast ohnmächtig geworden. Mit zitternden Händen hatte sie die Flagge im Hof der Schule von Otepää nach oben gezogen und voller Stolz beobachtet, wie der Wind sie entfaltete und hin und her wehte.
Dem Hochgefühl war kaltes Entsetzen gefolgt. In ihrer Aufregung hatte Merike vergessen, die Schnüre um den Befestigungshaken zu wickeln. Sie ließ sie los – und einen Atemzug später sauste das rote Tuch wieder nach unten. Nie zuvor hatte sich Merike so geschämt wie an jenem Morgen, an dem sie sich am liebsten in Luft aufgelöst hätte. Zu ihrer Überraschung war keine Strafpredigt gefolgt. Die Lehrerin hatte die Schüler, die hämisch kicherten, mit einem strengen Blick zurechtgewiesen und Merikes beste Freundin Talvi aufgefordert, beim erneuten Hissen zu helfen.
Der Trommelwirbel brach ab. Merike straffte sich.
»Võitluseks Nõukogude kodumaa eest – ole valmis! Zum Kampf für die Sache der Kommunistischen Partei der Sowjetunion – seid bereit!«, rief sie.
»Alati valmis! – Immer bereit!«, schallte ihr die Antwort der Kinder entgegen, die den rechten Arm zum Gruß vor den Kopf gehoben hatten: Die flache Hand mit dem Daumen zur Stirn und dem kleinen Finger gen Himmel weisend.
Anschließend stimmte die Gruppe ein beliebtes Pionierlied auf Russisch an, in dem es um das Bild eines kleinen Jungen ging, auf das er seine Mutter und die Sonne gemalt hatte. In den Strophen wurde daran appelliert, den Kindern zuliebe diese heile Welt zu bewahren und den Frieden zu sichern.
Merikes ließ ihre Augen über die Umgebung schweifen. Das Ferienlager Lainela befand sich am Finnischen Meerbusen auf der Halbinsel Käsmu einige Hundert Meter nördlich vom Kern des gleichnamigen Dorfes. Hinter ein paar Bäumen lag der Strand. Das Plätschern der Wellen auf dem kiesigen Ufer wurde fast zur Gänze vom Rauschen des Windes in den Blättern überlagert. Die herbe Salznote, in die sich der würzige Geruch von Tang mischte, war jedoch auch hier deutlich wahrzunehmen. Merike holte tief Luft und schmeckte dem fremden Duft nach. Sie hob den Kopf und strich sich eine dunkelblonde Haarsträhne hinters Ohr, die ihr die frische Brise ins Gesicht geweht hatte. Der Himmel wölbte sich blassblau über ihr, ein Wolkenband zog langsam am westlichen Horizont vorüber, und über dem Wasser kreisten einige Möwen, die ab und zu ihre schrillen Schreie ausstießen. Wie wunderbar, dachte Merike. Ich bin endlich, endlich am Meer!
Nach ihrer Ankunft am Vorabend war keine Gelegenheit mehr für einen Spaziergang zum Ufer gewesen. Später als geplant waren sie von Otepää losgekommen, hatten unterwegs eine Reifenpanne gehabt und waren schließlich vom russischen Wachposten am Eingang zur gesperrten Zone, in der sich das Küstengebiet befand, auf das Gründlichste überprüft worden. Merike hätte es nie für möglich gehalten, dass die Kontrolle von Pässen und Zugangsberechtigungsscheinen sowie das Inspizieren des Gepäcks so viel Zeit in Anspruch nehmen konnten. Erst kurz nach Sonnenuntergang um Viertel nach zehn waren sie endlich im Pionierlager eingetroffen und nach einem raschen Imbiss erschöpft in ihre Betten gefallen. Merike, die bis zum Schrillen ihres Weckers tief geschlafen hatte, fühlte sich gut erholt und voller Tatendrang. Sie konnte es kaum erwarten, die Ostsee von Nahem zu sehen, in ihre Fluten zu tauchen und am Strand spazieren zu gehen.
In ihrer Kindheit war Merike im Sommer fast ausschließlich in Ferienlager in der Nähe ihrer Vaterstadt Otepää geschickt worden. Am besten hatte es ihr immer im Schloss von Sangaste gefallen, einem ehemaligen Herrenhaus deutschbaltischer Adliger, in dem ein Jugendlager untergebracht war. Der einstige Besitzer hatte es Ende des 19. Jahrhunderts als detailgetreues Abbild des englischen Windsor Castle errichten lassen, was die Phantasie der kleinen Merike immer aufs Neue beflügelt hatte. Mit zunehmendem Alter aber wuchs ihre Sehnsucht, über den Tellerrand von Valgamaa, dem südlichen Randgebiet Estlands, hinauszuschauen und andere Gegenden, Länder und Kulturen kennenzulernen. Sie beneidete ihre Freundin Talvi, die mit ihren Eltern mehrmals im Seebad Pärnu an der Westküste Urlaub gemacht, Städtetrips nach Riga, Vilnius und Leningrad unternommen und im vergangenen Jahr sogar zwei Wochen am Schwarzen Meer verbracht hatte.
Bei ihrer Familie, die nie weite Reisen unternahm und im Sommer lediglich Ausflüge an den Peipussee machte oder in den Wäldern der Umgebung wandern ging, war Merike mit ihrem Wunsch auf taube Ohren oder vage Vertröstungen gestoßen. Einmal, als sie mit sechzehn Jahren aufbegehrt und sich beschwert hatte, sie sei des Ewiggleichen überdrüssig und würde gern wie ihre Klassenkameraden Urlaub am Meer machen oder in andere Sowjetrepubliken fahren, hatte ihr Großvater sie derart abgekanzelt, dass Merike das Thema fortan tunlichst gemieden hatte. Als undankbares Gör hatte er sie beschimpft, das sich glücklich schätzen sollte, in einer der schönsten Landschaften Estlands zu leben. »Zu meiner Zeit waren wir schon froh, wenn wir einen halben Tag freinehmen und an den See zum Baden fahren konnten«, hatte er geschrien und sich über die Anspruchshaltung der heutigen Jugend im Allgemeinen und die Vergnügungssucht seiner Enkelin im Speziellen echauffiert.
Immer lebe die Sonne,
immer lebe der Himmel,
immer lebe die Mutti,
und auch ich immerdar!
Die Kinder hatten ein letztes Mal den Refrain des Liedes angestimmt und schauten Merike erwartungsvoll an, nachdem der letzte Ton verklungen war.
»Um halb neun gibt’s Frühstück«, verkündete diese. »Bis dahin macht ihr bitte eure Betten und räumt auf.«
Ihre Schützlinge stürmten unter Gelächter und Geschrei zu der Baracke mit den beiden Schlafsälen, die von ihnen belegt waren. Die anderen Holzhäuser standen noch leer, andere Pioniergruppen würden erst gegen Ende ihres Aufenthaltes auf der Halbinsel eintreffen. Merike war erleichtert, dass ihre Premiere als Ferienleiterin in diesem überschaubaren Rahmen stattfand. So konnte sie in Ruhe und vor allem ohne fremde Beobachter, die ihre Nervosität beflügelt hätten, in ihre neue Aufgabe hineinwachsen und die Kinder kennenlernen, die ihr bis auf wenige Ausnahmen noch unvertraut waren. Sie war zudem froh, Marten an ihrer Seite zu haben. Bei ihm hatte sie die Schulung zur Pionierleiterin erhalten und mit ihm gemeinsam im Frühjahr einen Freizeitkurs für eine Schar der sogenannten Oktoberkinder gestaltet, in der sieben- bis neunjährige Grundschüler zusammengeschlossen waren, bevor sie in der vierten Klasse bei den Lenin-Pionieren aufgenommen wurden.
Merike begab sich zu einem kleineren Gebäude, in dem die Küche untergebracht war. Es hatte Fenster zu zwei Seiten hinaus und war mit einem riesigen Gasherd, einer Spüle, einem Geschirrschrank und einem großen Arbeitstisch möbliert. Sie setzte zwei Pfeifkessel auf, füllte einen großen Topf mit Wasser und stellte ihn ebenfalls auf den Herd. Anschließend schnitt sie einen Laib Brot in Scheiben, drapierte geräucherte Heringe und saure Gurken auf Tellern und bestückte zwei ausladende Tabletts mit Geschirr, Besteck, Marmeladengläsern sowie Butter- und Zuckerdosen. In der Zwischenzeit begann das Wasser zu sieden. Merike goss den Inhalt der Kessel in bauchige Blechkannen, in die sie Beutel mit Pfefferminztee hängte. In den Topf gab sie Salz und Zucker, rührte Roggen-, Hafer- und Gerstenflocken hinein und kochte das Ganze zwei Minuten lang auf, bevor sie die Flamme ausschaltete und den Brei quellen ließ.
Während sie das Frühstück vorbereitete, kreisten ihre Gedanken um die Ungereimtheiten, die ihren Werdegang in den Jugendorganisationen von jeher belasteten. Immer wieder hatte sie in den vergangenen Jahren ein unterschwelliges Misstrauen gespürt, das ihr von höheren Funktionären entgegengebracht wurde. Es gab keine ausdrücklichen Vorwürfe, keine Erklärungen oder konkrete Hinweise. Im Gegenteil. Merikes Bemühen, eine vorbildliche Kommunistin zu sein und sich den Regeln der sozialistischen Gemeinschaft zu fügen, wurde durchaus gelobt. Umso weniger verstand sie die Vorbehalte, mit denen ihren Wünschen nach verantwortungsvolleren Aufgaben begegnet wurde.
Marten gehörte zum Glück zu den Ausnahmen. Er war bereits seit acht Jahren beim Komsomol, dem Nachwuchsverband der Kommunistischen Partei Russlands für Jugendliche zwischen vierzehn und achtundzwanzig Jahren. In seiner ruhigen, zurückhaltenden Art hatte er Merike niemals spüren lassen, dass ihr Einstieg in diese Organisation holprig gewesen war. Nach ihrer Zeit als Pionierin hatte Merike wie die meisten ihrer Mitschüler zum Komsomol übertreten wollen. Nicht zuletzt, weil sie sich von einer Mitgliedschaft bessere Chancen für die Erfüllung ihres großen Traums versprochen hatte: eines Biologiestudiums in Tartu. Im Gegensatz zu ihren Klassenkameraden wurde ihr Antrag jedoch zunächst auf Eis gelegt mit der Begründung, in ihrem Fall sei eine »eingehende Prüfung« nötig. Außerdem würden derzeit nicht so viele Biologen benötigt. Wenn überhaupt, könne sie sich für ein Ingenieurstudium bewerben.
Talvi, die mit ihr gemeinsam um Aufnahme beim Komsomol ersucht und sofort einen positiven Bescheid erhalten hatte, war außer sich über diese Ungerechtigkeit gewesen. »Das ist verrückt«, hatte sie gerufen. »Ich kenne niemanden, der sich bei den Pionieren mehr ins Zeug gelegt hat. Das muss ein Missverständnis sein!« Merike hatte Talvis Anteilnahme sehr zu schätzen gewusst. Von deren Vorhaben, den zuständigen Funktionären gehörig die Meinung zu geigen, hatte sie ihre Freundin jedoch abgehalten. »Es reicht, dass ich – aus welchen Gründen auch immer – in Ungnade gefallen bin. Du sollst dir meinetwegen auf keinen Fall die Zukunft verbauen.«
Es hatte den Anschein, dass Talvi mit ihrer Vermutung, es müsse sich um ein Missverständnis handeln, richtiggelegen hatte. Einige Tage später war Merike doch noch zur feierlichen Aufnahmezeremonie eingeladen worden. Gemeinsam mit den anderen Bewerbern war sie zu der Prüfung angetreten, bei der ihrem Wissen um die wichtigsten Personen und Daten der Russischen Revolution und des Großen Vaterländischen Kriegs sowie über die Grundsätze der sozialistischen Ideologie auf den Zahn gefühlt worden war, bevor ihnen ein hochrangiger Komsomolze die Mitgliedsbücher ausgehändigt hatte.
Merikes Gefühl, auf einem speziellen Prüfstand zu stehen, war dennoch geblieben. Länger als die anderen hatte sie auf ihre Schulung zur Gruppenleiterin warten müssen, und erst in diesem Jahr war sie endlich als Begleiterin in ein Ferienlager geschickt worden – was sie im Grunde einem Zufall verdankte. Noch drei Tage zuvor hatte sie sich damit abgefunden, auch in diesem Sommer bei der Einteilung übergangen worden zu sein und sich damit zu begnügen, Freizeitangebote für daheim gebliebene Kinder zu organisieren. Doch Talvi, die eigentlich mit Marten an die Ostsee hätte fahren sollen, war mit dem Fahrrad gestürzt und lag nun mit einem gebrochenen Bein im Krankenhaus. Ihre verletzte Freundin hatte Merike als Ersatz für sich ins Spiel gebracht, was zu deren Überraschung auf offene Ohren gestoßen war.
Merike probierte einen Löffel Brei und stellte zufrieden fest, dass er genau die richtige Konsistenz hatte: Die Flocken waren weich, hatten aber noch etwas Biss. Sie rührte gemahlenen Zimt und Milch unter. Aus den Augenwinkeln nahm sie eine Bewegung wahr und wandte sich zu dem Fenster, das auf den Rasenplatz hinausging. Zwei Jungen rannten – sich immer wieder verstohlen umschauend – in Richtung Meer. Merike steckte den Kopf hinaus.
»He! Wartet mal!«, rief sie laut.
Die beiden hielten an und drehten sich mit schuldbewussten Mienen zu ihr um.
»Bitte, wir wollen nur kurz gucken«, sagte der Größere, dessen Gesicht mit Sommersprossen übersät war.
Merike zögerte einen Augenblick. Ach, was soll’s?, dachte sie und rief: »In Ordnung. Aber geht nicht ins Wasser!«
»Danke!« Vergnügt winkten sie ihr zu und rannten weiter.
Merike sah ihnen mit einem Lächeln nach. Sie konnte es immer noch nicht so ganz glauben, dass sie tatsächlich hier war. Als sie vor zwei Tagen bei Ott Mänd geklopft hatte, um ihn um Urlaub zu bitten, damit sie für Talvi einspringen konnte, hatte sie sich kaum Hoffnungen auf seine Einwilligung gemacht. Der Vorarbeiter der Brotfabrik, in der Merike, seitdem ihr Traum von einem Studium geplatzt war, eine Ausbildung machte, saß im Vorstand der Komsomolbrigade in Otepää. Merike hatte so fest mit seiner Ablehnung gerechnet und glaubte daher im ersten Moment, sich verhört zu haben, als er ohne Umschweife ihre spontane Urlaubsanfrage bewilligte.
»Es gefällt mir, wie du dich in unserer Organisation einbringst«, hatte er gesagt und angedeutet, dass es an der Zeit sei, Merikes Engagement zu belohnen – auch wenn manche da wohl anderer Ansicht seien.
»Mitglieder auf dem Papier haben wir mehr als genug«, hatte er gemeint. »Du solltest endlich nach deinen Taten beurteilt und entsprechend gefördert werden.«
Ott Mänd hatte ihr freundlich zugenickt und sie mit der Bemerkung verabschiedet, sie könne es »trotz ihres Hintergrunds« in der Partei weit bringen.
Merike, die eben den Getreidebrei in eine große Schüssel füllte, runzelte bei der Erinnerung an diesen Satz die Stirn. Was hatte er mit »ihrem Hintergrund« gemeint? Im Büro des Vorarbeiters war sie so überwältigt von der Freude über sein Entgegenkommen gewesen, dass sie seine Ausführungen nur mit halbem Ohr verfolgt hatte. Erst jetzt wurde ihr klar, dass Ott Mänd ihr indirekt eine Antwort auf die Frage gegeben hatte, die sie schon so lange umtrieb: Es hatte offenbar nie an ihr oder ihrem Verhalten gelegen, dass sie strenger als andere unter die Lupe genommen worden war. Es lag an ihrer Familie!
Die Erkenntnis durchfuhr Merike wie ein Blitz. Sie stellte den leeren Topf mit einem Scheppern in den Spülstein, drehte den Hahn auf und starrte auf das Wasser, das sich schäumend mit den Resten des Breis zu einer trüben Plörre vermischte.
Warum bin ich nicht schon viel früher darauf gekommen?, fragte sie sich. Weil es total abwegig ist, gab sie sich zur Antwort. Einen hundertprozentigeren Genossen als Opa Andrus gab es wohl in ganz Otepää nicht. Seit sie denken konnte, bläute er seiner Enkelin ein, wie wichtig es war, eine gute Kommunistin zu sein und aktiv am Gelingen der sozialistischen Gesellschaft mitzuwirken. Merike konnte noch nicht laufen, da hatte er sie schon zu Aufmärschen und Feierstunden mitgenommen. Und Oma Kadri ließ auch keine Sitzung des Frauenverbandes aus, strickte jedes Jahr Dutzende Socken für den Wohltätigkeitsbasar der Komsomolzen und hat noch nie ein kritisches Wort über die Partei verloren.
Erneut wurde Merike von den zwei Jungen abgelenkt, die mit hängenden Köpfen über den Rasen schlurften. Sie stellte den Wasserhahn ab und lehnte sich aus dem Fenster.
»Was ist los?«, fragte sie. »Ist der Strand nicht schön?«
»Doch, schon«, antwortete der Große mit den Sommersprossen. »Aber er ist mit Stacheldraht abgesperrt.«
»Was nützt uns ein Lager am Meer, wenn wir gar nicht ans Ufer dürfen?«, maulte der Kleinere.
Gute Frage, gab Merike ihm im Stillen recht. »Es gibt hier auf jeden Fall irgendwo einen Strand, an dem wir baden dürfen«, versuchte sie ihre Schützlinge aufzumuntern. »Jetzt frühstücken wir erst einmal. Ihr könnt bitte schon anfangen, die Klapptische und Bänke aus dem Schuppen zu holen und auf der Wiese aufzustellen.«
Die Jungen nickten und trollten sich. Merike schrubbte den Topf mit einer Bürste und zermarterte sich erneut den Kopf. Was ist mit Mama und Papa? Sind sie überzeugte Kommunisten? Verdutzt stellte sie fest, dass sie nicht wirklich über die Einstellung der beiden Bescheid wusste. Sie war stets davon ausgegangen, dass zumindest ihre Mutter die Meinung ihrer Eltern teilte, da sie ebenfalls in der Partei war und ihrem Vater nie widersprach, wenn er seine Enkelin anspornte, sich noch mehr ins Zeug zu legen.
Ob Raivo derselben Überzeugung war, konnte Merike erst recht nicht sagen. Ihr Vater war selten daheim, er arbeitete als Fernfahrer und war oft wochenlang unterwegs. Wenn er nach Hause kam, drehten sich die Gespräche überwiegend um private Dinge. Seine Frau berichtete, was sich in seiner Abwesenheit ereignet hatte, Merike erzählte von der Schule und fragte nach seinen Erlebnissen. Schon als Kind hatte sie seine Geschichten geliebt und zusammen mit ihrer Mutter an seinen Lippen gehangen. Aus dem Mund ihres Vaters klangen selbst alltägliche Vorkommnisse abenteuerlich; er hatte ein Talent, Menschen und Situationen so plastisch darzustellen, dass seine Zuhörer das Gefühl hatten, die Szenen selbst erlebt zu haben. Erst jetzt fiel Merike auf, dass sich ihre Eltern weder untereinander noch mit Opa Andrus und Oma Kadri über politische Themen unterhielten, geschweige denn stritten.
Sie ließ die Bürste sinken, hob den Kopf und begegnete dem Blick ihres Spiegelbilds im Fenster über dem Spülbecken, hinter der ein dicht belaubter Busch wuchs und die Glasscheibe verdunkelte. Ihre tiefblauen Augen schauten sie unter den zusammengezogenen Brauen fragend an, zwischen denen sich eine steile Falte gebildet hatte. Seltsam, dass ich das nicht schon früher bemerkt habe, dachte Merike. Lag das wirklich daran, dass sie alle derselben Überzeugung waren? Dabei gäbe es Gesprächsstoff genug. Schließlich war seit Gorbatschows Regierungsantritt viel in Bewegung geraten. Wenn Merike es sich recht überlegte, war ihre Familie sogar peinlich darauf bedacht, politische Themen zu vermeiden. Als hätten sie eine stille Vereinbarung getroffen.
Die ich übrigens auch einhalte, stellte Merike verblüfft fest. Sie kratzte sich an der Schläfe. Warum gab es dieses Tabu bei ihnen? Warum würgte vor allem Opa Andrus jeden sofort ab, der zum Beispiel die Forderungen der baltischen Republiken nach mehr Unabhängigkeit ansprach?
Merike sah das grimmige Gesicht ihres Großvaters vor sich, mit dem er dieses und ähnliche Ansinnen als gefährliche Hirngespinste abtat. Ich glaube, er hat Angst, schoss es ihr in den Sinn. Der Gedanke hakte sich in ihr fest. Das würde vieles erklären, überlegte sie. Aber wovor fürchtete er sich? Und auch Merikes Eltern und Oma Kadri? Wollten sie nicht an dem rühren, was Ott Mänd als ihren »Hintergrund« bezeichnet hatte? Es musste etwas sein, das weit zurück in der Vergangenheit lag, vielleicht noch vor ihrer eigenen Geburt. Merike spürte, wie sich ihr Puls beschleunigte. Ich muss unbedingt herausfinden, was es damit auf sich hat. Schließlich beeinflusst es mein Leben.
Motorengeräusch riss Merike aus ihren Gedanken. Sie schaute aus dem anderen Fenster und sah Marten, der eben mit einer Holzkiste beladen aus dem Bus stieg, den er am Rand des Rasenplatzes geparkt hatte. Er forderte die Kinder, die ihm entgegenliefen, auf, ihm beim Entladen der übrigen Kästen und Säcke zu helfen, und ging Richtung Küchenbaracke. Merike stellte den Topf zum Abtropfen auf die Ablage neben dem Spülbecken, eilte zur Tür und öffnete sie ihm.
»Jetzt sind wir bestens versorgt«, sagte Marten und trat ein. »Ich habe sogar einen großen Korb Erdbeeren ergattert.« Er lächelte Merike zu und bat sie, die Luke zum Erdkeller zu öffnen, in dem er die Vorräte verstauen wollte.
»Kannst du mir sagen, was gegen meine Familie vorliegt?« Die Frage brach aus Merike heraus, bevor sie nachdenken konnte.
»Wie kommst du denn jetzt darauf?« Marten sah sie verdutzt an.
»Weil Ott Mänd so seltsame Andeutungen gemacht hat.«
»Hm, also …« Marten stockte.
»Bitte, wenn du etwas weißt …« Merike hielt unwillkürlich den Atem an.
»Ich fürchte, ich kann dir nicht groß weiterhelfen«, antwortete Marten und wich ihrem Blick aus. »Ich habe nur mal gehört, dass es einen Vorfall gab, als deine Eltern in Tartu studiert haben.« Er zuckte die Achseln. »Aber das ist doch Schnee von gestern. Ich glaube nicht, dass das heute noch jemanden juckt.« Er beugte sich wieder über den Erdkeller.
»Wahrscheinlich hast du recht«, nuschelte Merike und verzichtete auf weitere Fragen. Es war offensichtlich, dass Marten nicht alles preisgab, was er wusste. Sie griff nach einem Tablett und verließ die Küche. Fester denn je war sie entschlossen, Licht ins Dunkel der Abgründe zu bringen, die sich in der Geschichte ihrer Familie auftaten.
Oldenburg, Frühling 1914
Kapitel 3
»Baronin Beulwitz hat stets in den höchsten Tönen von Ihnen gesprochen. Und da sie nicht zu überschwänglichem Lob oder Übertreibungen neigt, sehe ich keinen Grund, ihr Urteil anzuzweifeln.«
Elvira von Rahden bedachte Luise, die ihr auf einem von vier lederbezogenen Stühlen im kleinen Salon gegenübersaß, mit einem wohlwollenden Blick. Die Gräfin war ohne Umschweife zum Punkt gekommen, nachdem ein Hausdiener Luise den Mantel abgenommen, sie in das Empfangszimmer geführt und aufgefordert hatte, Platz zu nehmen. Im selben Moment war Gräfin Rahden hereingekommen und hatte Luise einer eingehenden Musterung unterzogen, während sie ihre Röcke ordnete und sich ebenfalls niederließ. Sie war eine füllige Mittvierzigerin mit einer aufwendigen Steckfrisur, die ihrer Zofe einiges an Geschick und Geduld abverlangt haben musste. Der Pony war zu kleinen Löckchen geformt, die auf der Stirn drapiert waren. Auch die sorgfältig manikürten Fingernägel, die zu akkuraten Bögen gezupften Brauen und der rosige Teint sprachen dafür, dass Elvira von Rahden großen Wert auf ein gepflegtes Äußeres legte.
Ob das bei ihrer Tochter Wilhelmine ebenso ist?, fragte sich Luise und dachte mit Wehmut an Baronin Beulwitz, die in dieser Hinsicht unkompliziert war. Im Grunde hatte sie Luise in den fünf Jahren ihrer Anstellung selten klassische »Zofenarbeit« abverlangt. Ihr war es wichtiger, dass Luise ihr vorlas, ihre Korrespondenz erledigte, sich mit ihr unterhielt und sie auf ihren Spaziergängen begleitete. Für Luise war die Vorstellung nicht sehr verlockend, ihrer neuen Herrin jeden Tag eine halbe Ewigkeit beim Einkleiden und der Körperpflege behilflich sein, stundenlang ihre Haare bürsten und mithilfe von Brenneisen in Form bringen und mit unzähligen Klammern und Nadeln zu komplizierten Frisuren auftürmen zu müssen.
»Ich finde es natürlich sehr bedauerlich, dass die Baronin Oldenburg verlässt. Ich gebe jedoch freimütig zu, dass mich ihr Entschluss, in ein Damenstift zu ziehen, aus einer misslichen Lage befreit«, sprach die Gräfin weiter. »Ich hatte nämlich die Hoffnung schon fast aufgegeben, für meine Tochter eine geeignete Zofe zu finden.«
Elvira von Rahden deutete mit einer einladenden Geste auf das Tischchen zwischen ihnen, auf dem kleine Silberschalen mit verschiedenen Plätzchen, Konfekt sowie kandierten Früchten standen, und nahm sich selbst ein Marzipanpraliné. Die Kleidung der Gräfin – über dem bodenlangen lilafarbenen Taftrock waren mehrere Lagen aus durchsichtiger Spitze drapiert, der Kragen der weit geschnittenen Tunika war mit Seidenröschen bestickt, und im Dekolletee schimmerte ein dreireihiges Perlenkollier – passte in Luises Augen nicht zu dem Raum, der sie in seiner düsteren Strenge an das Innere einer Burg erinnerte.
Die Wohnung der von Rahdens nahm die gesamte Beletage eines dreistöckigen Hauses am Caecilienplatz ein, der mit Bäumen, Büschen und einem großen Rosenbeet Anfang der 1880er Jahre zusammen mit dem Theaterneubau im Dobbenviertel westlich der Altstadt angelegt worden war. Seither hatte er sich nebst den breiten Straßen, die auf ihn zuführten, zu einer beliebten Wohngegend adliger und großbürgerlicher Oldenburger entwickelt. Das Haus, in dem Familie von Rahden lebte, war im spätklassizistischen Stil gebaut und strahlte mit seiner weiß getünchten Fassade und den hohen Fenstern eine heitere Eleganz aus, die sich im großzügig geschnittenen Treppenhaus mit Marmorgeländer und Blumenstuck fortsetzte. Umso größer war der Kontrast zur Einrichtung in der von Rahden’schen Wohnung.
Als Luise den geräumigen Flur betreten hatte, von dem mehrere Türen in die Zimmer und den Küchentrakt abgingen, hatte sie sich um Jahrhunderte zurück ins späte Mittelalter versetzt gefühlt. Gegenüber dem Eingang ragte ein massiver Schrank aus Eichenholz empor, der mit Pilastern, Säulen und Schnitzwerk verziert war und einen Aufsatz in Giebelform hatte. An den Wänden zwischen den Türrahmen hingen über Gemälden mit Darstellungen von Schlachtszenen gekreuzte Säbel, Streitäxte, Morgensterne oder Schwerter. Neben der Garderobe war auf einem Ständer eine vollständige Ritterrüstung platziert, die dem Besucher einen Teller für die Visitenkarten hinhielt. Ein alter Messingeimer diente als Schirm- und Stockständer.
Im kleinen, holzgetäfelten Salon herrschte dieselbe mittelalterliche Anmutung. Neben der Sitzecke mit den Lederstühlen standen linker Hand ein gekachelter Kamin, rechts eine mit breiten Eisenbändern beschlagene Truhe. Eine Wand war fast vollständig von einem Gobelin bedeckt, auf dem ein geharnischter Ritter mit einem Drachen kämpfte, an den anderen hingen Darstellungen von Burgen, Ruinen und Festungsanlagen. Schwere Vorhänge aus dunklem Samt rahmten die Fenster ein, hinter denen an diesem ersten Montag im Mai das Grau eines verregneten Spätnachmittags waberte. Erleuchtet wurde der Raum von einem mittig in der Decke verankerten fünfarmigen Kronleuchter, der allerdings nicht mit Kerzen, sondern mit Glühbirnen bestückt war.
»Meine Tochter kann sich glücklich schätzen, dass Sie bereit sind, sie zu begleiten«, fuhr die Gräfin fort.
»Wo ist sie denn?«, rutschte es Luise heraus. »Also, ich meine … wann lerne ich sie kennen?«, stotterte sie. Schon die ganze Zeit wunderte sie sich, wo die junge Gräfin blieb. Schließlich sollte Luise ihre Zofe werden.
»Wilhelmine will vor der Abreise nach Livland noch ein paar Besuche bei Verwandten absolvieren«, antwortete Elvira von Rahden. »Am zweckmäßigsten wird es sein, wenn Sie am Freitag in Lübeck kurz vor der Abfahrt des Dampfschiffs zu ihr stoßen.« Sie schürzte die Lippen. »Oder spricht Ihrerseits etwas dagegen?«
Luise schüttelte automatisch den Kopf und bemühte sich um ein unbefangenes Lächeln. Ihre Schwester hatte offenbar mit ihrer Vermutung, Wilhelmine sei eine jener braven Töchter, die keinen eigenen Willen hatten und das taten, was von ihnen verlangt wurde, ins Schwarze getroffen. Luise fand es befremdlich, dass die junge Gräfin nicht einmal bei der Auswahl ihrer Zofe ein Wörtchen mitreden wollte. War es ihr gleichgültig, wer die nächsten Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre ihr Leben teilen und Einblick in dessen intimste Winkel haben würde? Oder gehörte sie zu den Leuten, die in Dienstboten keine »echten« Menschen sahen, sondern eine Art belebtes Mobiliar, das möglichst unsichtbar und geräuschlos seinen Pflichten nachzugehen hatte? Luise presste bei dem Gedanken, für so jemanden arbeiten zu sollen, die Lippen aufeinander.
»Ich habe keinen Zweifel daran, dass Sie und Wilhelmine wunderbar miteinander auskommen werden«, sagte Elvira von Rahden. »Und ich habe Baronin Beulwitz zugesagt, Ihnen jederzeit die Rückfahrt nach Deutschland zu bezahlen, sollten Sie den Dienst kündigen und nach Hause kommen wollen.«
Luise zupfte verlegen am Bündchen ihres Blusenärmels. Konnte die Gräfin ihre Gedanken lesen?
»Mir ist durchaus bewusst, dass ich Ihnen einiges abverlange«, fuhr diese fort. »Schließlich ist es eine Reise ins Unbekannte.« Sie beugte sich zu Luise. »Umso wichtiger ist es mir, eine zuverlässige, umsichtige Person an der Seite meiner Tochter zu wissen.« Sie sah Luise in die Augen. »Ich vertraue Ihnen meinen kostbarsten Schatz an. Geben Sie gut auf mein Kind acht. Wilhelmine ist sehr behütet aufgewachsen und wäre allein nicht …«
»Sie können sich auf mich verlassen«, sagte Luise leise.
»Danke!« Die Gräfin erhob sich. »Um die Formalitäten müssen Sie sich nicht kümmern.«
»Was ist mit dem Gepäck Ihrer Tochter?«, fragte Luise und stand ebenfalls auf.
»Zwei Reisetruhen sind bereits auf dem Weg nach Oberpahlen, genauer nach Algulfer«, antwortete Elvira von Rahden. »Das ist der Gutshof der Familie von Uexküll.« Sie läutete mit einer Tischglocke nach dem Hausdiener. »Ihre Zugfahrtkarte nach Lübeck und einen Scheck für Ihre Auslagen lasse ich Ihnen dieser Tage bringen. Ebenso die übrigen Reisedokumente.« Sie zeigte auf den Pappdeckel, in dem sich Luises Unterlagen befanden. »Ihre Geburtsurkunde habe ich ja. Mehr wird nicht nötig sein, um ein Visum für Russland ausstellen zu lassen.«
Bevor Luise etwas sagen konnte, verabschiedete sich die Gräfin von ihr und bat den Diener, sie hinauszugeleiten. Ehe es sich Luise versah, stand sie in Mantel und Hut auf dem Gehweg und sah verdattert zu dem Haus hinauf, das sie kaum eine Viertelstunde zuvor betreten hatte. Sie hatte damit gerechnet, von Wilhelmines Mutter auf Herz und Nieren geprüft zu werden, Auskunft über ihren Werdegang geben und ihre Kenntnisse und Fähigkeiten als Friseuse, Modistin oder bei der Kleiderpflege unter Beweis stellen zu müssen. Luise schickte einen stummen Dank an ihre Dienstherrin, deren Fürsprache sie zweifellos dieses unkomplizierte Einstellungsgespräch zu verdanken hatte.
Nach kurzem Zögern machte Luise sich auf den Weg zur Öffentlichen Bibliothek. Die Baronin erwartete sie frühestens in einer Stunde zurück. Zeit genug für einen Besuch des Lesesaals, in dem unter anderem verschiedene Enzyklopädien und Lexika standen. Luise wollte sich wenigstens einen oberflächlichen Einblick in das Land verschaffen, in das sie in wenigen Tagen fahren sollte. Im Bücherschrank der Baronin gab es zwar auch ein Nachschlagewerk, die Artikel im Kleinen Brockhaus konnten Luises Wissensdurst jedoch kaum stillen.
Im Grunde beschränkten sich ihre Kenntnisse über Russland auf die Zarenfamilie. Baronin Beulwitz verfolgte mit Interesse alles, was das »Haus Oldenburg« anging, und sprach von seinen Mitgliedern wie von engen Freunden. Sie zählten seit Jahrhunderten zur Crème de la Crème des europäischen Hochadels und stellten auch gegenwärtig eine Reihe von Regenten – angefangen bei Großherzog Friedrich August ihrer Heimatstadt über den König von Schweden bis hin zum russischen Zaren Nikolaus II, der außerdem mit dem deutschen Kaiser verwandt war. Luise hatte die Ausführungen ihrer Dienstherrin meist nur mit halbem Ohr verfolgt. Zwar fand sie die Verflechtungen der adligen Familien durchaus spannend, sich all die Namen, Verwandtschaftsgrade, Haupt- und Nebenlinien zu merken erschien ihr jedoch müßig. Es gab für sie wesentlichere Dinge, die sie gern eingehender studieren wollte.
Der Regen war zu einem feinen Nieseln abgeflaut. Die Feuchtigkeit legte sich wie ein Schleier um Luise, die ihre Schritte beschleunigte, den Kragen hochschlug und mit einer Hand unterm Kinn zusammenhielt. Von der Caecilienstraße bog sie links in die Roonstraße ein, von der nach zweihundert Metern der Theaterwall abging, der zuerst in den Schlosswall und schließlich in den Damm mündete, an dem sich die Bibliothek befand, untergebracht in einem imposanten Bau mit massiven Steinquadern und Rundbogenfenstern.
»Ah, welch eine Freude, das Fräulein Luise!« Der Mann hinter dem Empfangstresen, ein hagerer Mittfünfziger mit Goldrandbrille und einem sorgfältig gestutzten Backenbart, nickte Luise freundlich zu.
»Guten Abend, Herr Moser.«
»Sie sind spät dran«, fuhr er fort. »Wir schließen in einer halben Stunde.«
»Das ist mir bewusst«, antwortete Luise. »Ich muss nur rasch etwas nachschlagen.«
»Darf ich erfahren, was heute das Objekt Ihrer Wissbegier ist?«
»Livland.«
»Das russische Ostseegouvernement?« Der Bibliothekar hob die Augenbrauen. »Sie erstaunen mich immer wieder aufs Neue. Letztens wollten Sie alles lesen, was unser Haus zum Brahmanismus der Balinesen zu bieten hat.«
Luise lächelte. Ein kurzer Absatz über die Götzenbilder auf der Insel Bali hatte einige Wochen zuvor in der »Gartenlaube« ihre Aufmerksamkeit erregt. Wie so oft in den vergangenen Jahren hatte ihr Herr Moser geholfen, die Bestände der Bibliothek zu durchforsten und sich über ihre Neugier gefreut, mit der sie ein weiteres unbekanntes Wissensgebiet erkundete.
»Was genau interessiert Sie denn an Livland?«, fragte der Bibliothekar. »Es hat ja eine sehr bewegte Geschichte. Genau wie Estland und Kurland, die beiden anderen Baltischen Provinzen des Zarenreichs.« Herr Moser rieb sich die Hände – für Luise das untrügliche Zeichen, dass er umfassend über das Thema informiert war und darauf brannte, sein Wissen zu teilen.
»Eigentlich alles«, antwortete sie. »Ich muss gestehen, dass ich bis vor Kurzem gar nicht gewusst habe, wo Livland überhaupt liegt und dass es ein Teil Russlands ist. Und auch über das russische Reich habe ich nur eine vage Vorstellung.« Sie schaute Herrn Moser zerknirscht an. Ihre Kenntnisse speisten sich aus den Romanen russischer Autoren und gelegentlichen Artikeln in der »Gartenlaube«, die die Baronin abonniert hatte. Im aktuellen Heft der Illustrierten gab ein kurzer Beitrag Auskunft über eine Passstraße im Kaukasus, der Luises Bild von einer weitgehend menschenleeren, unkultivierten Wildnis bestätigte, aus der das östliche Riesenland mit Ausnahme von Städten wie Moskau oder Petersburg zu bestehen schien.
»Nun, die drei Gouvernements gehören zwar zu Russland, nehmen aber eine Sonderstellung ein«, begann Herr Moser. »Das liegt unter anderem daran, dass sie jahrhundertelang unter der Herrschaft des deutschbaltischen Adels standen. Außerdem ist die Selbstverwaltung der Städte viel weiter entwickelt als im übrigen Zarenreich. Und die Leibeigenschaft ist bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts abgeschafft worden.«
»Was hat die Deutschen denn so weit nach Osten verschlagen?«, fragte Luise. »Hat es etwas mit der Hanse zu tun?«
»Richtig!« Herr Moser bedachte Luise mit einem zufriedenen Blick. »Sowohl Riga, von dem aus Livland heutzutage verwaltet wird, als auch Reval, die Hauptstadt Estlands, waren wichtige Stützpunkte der Hanseaten.« Herr Moser strich sich über den Bart. »Aber die Gegend hatte schon früher Begehrlichkeiten geweckt. Im Ostseeraum verlief nämlich eine wichtige Handelsroute, die bis zur Seidenstraße führte. Nicht nur der dänische König und die benachbarten russischen Fürsten hatten ein Auge auf dieses Land der heidnischen Esten, Liven, Kuren und Letten geworfen. Auch aus Deutschland kamen immer mehr Kaufleute an die Ufer der Düna. Sie alle wollten das Gebiet unter ihre Kontrolle bringen. Und da die dort lebenden Völker keine Christen waren, wurde die Region nach damaligem Verständnis als Niemandsland betrachtet.«
»Das von den Ordensrittern erobert und bekehrt wurde«, erinnerte sich Luise, die erst wenige Wochen zuvor ein Buch über die Kreuzzüge ausgeliehen hatte.
Herr Moser nickte. »Frühere Missionierungsversuche waren in Livland kläglich gescheitert«, erklärte er. »Die Neugetauften wurden nämlich von ihren Nachbarn und Verwandten, die den alten Göttern treu geblieben waren, verfolgt und getötet. Daher hielt man es für geboten, den christlichen Glauben mit Waffengewalt durchzusetzen.«
»Und anschließend siedelten sich Deutsche in Livland an?«
»Genau. Die eroberten Regionen wurden teils direkt vom Schwertbrüderorden verwaltet, teils von Vasallen der Bischöfe. Und hier kamen vor allem jüngere Söhne aus westfälischen und norddeutschen Adelsfamilien ins Spiel, die zu Hause nicht erbberechtigt waren. Sie nutzten die einmalige Gelegenheit, eigenen Besitz zu erhalten.«