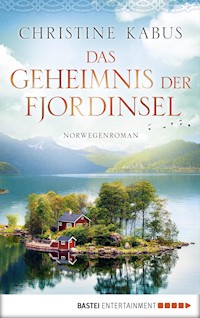6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Familien im Schatten eines dunklen Geheimnisses ...
Norwegen, 1895. Im Bergbaustädtchen Røros begegnen sich zwei junge Frauen, deren Schicksal kaum unterschiedlicher sein könnte. Die Deutsche Clara ist ihrem Ehemann in dessen Heimatstadt gefolgt. Doch die Ordals begegnen Clara und ihrem kleinen Sohn Paul mit unverhohlener Ablehnung. Als wenig später ein furchtbares Unglück geschieht, ist Clara plötzlich auf sich allein gestellt. Unerwartete Hilfe erfährt sie ausgerechnet durch Sofie, die Tochter des mächtigen Bergwerksbesitzers, dem die Ordals schon lange ein Dorn im Auge sind. Während Clara und Sofie zu Freundinnen werden, kommen sie einem Geheimnis auf die Spur, das ihre Familien seit Jahrzehnten überschattet ...
Große Gefühle vor atmosphärischer Kulisse - ein opulent erzählter Roman voller bewegender Einblicke in eine der spannendsten Epochen der norwegischen Geschichte.
Weitere Norwegen-Romane von Christine Kabus: Töchter des Nordlichts. Das Lied des Nordwinds. Das Geheimnis der Fjordinsel. Im Land der weiten Fjorde. Insel der blauen Gletscher.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 853
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Norwegen-Romane der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Zitat
Figuren der Handlung
Karten
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Vielen Dank!
Weitere Norwegen-Romane der Autorin
Das Lied des Nordwinds
Töchter des Nordlichts
Insel der blauen Gletscher
Im Land der weiten Fjorde
Das Geheimnis der Fjordinsel
Über dieses Buch
Zwei Familien im Schatten eines dunklen Geheimnisses …
Norwegen, 1895. Im Bergbaustädtchen Røros begegnen sich zwei junge Frauen, deren Schicksal kaum unterschiedlicher sein könnte. Die Deutsche Clara ist ihrem Ehemann in dessen Heimatstadt gefolgt. Doch die Ordals begegnen Clara und ihrem kleinen Sohn Paul mit unverhohlener Ablehnung. Als wenig später ein furchtbares Unglück geschieht, ist Clara plötzlich auf sich allein gestellt. Unerwartete Hilfe erfährt sie ausgerechnet durch Sofie, die Tochter des mächtigen Bergwerksbesitzers, dem die Ordals schon lange ein Dorn im Auge sind. Während Clara und Sofie zu Freundinnen werden, kommen sie einem Geheimnis auf die Spur, das ihre Familien seit Jahrzehnten überschattet …
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Christine Kabus, 1964 in Würzburg geboren, arbeitete nach ihrem Studium der Germanistik und Geschichte als Dramaturgin und Lektorin bei verschiedenen Film- und Theaterproduktionen, bevor sie sich 2003 als Drehbuchautorin selbstständig machte. Schon als Kind faszinierte sie der hohe Norden. Vor allem die ursprüngliche, mythische Landschaft Norwegens beflügelte ihre Phantasie. Sie begann, die Sprache zu lernen und sich intensiv mit der Geschichte Norwegens zu beschäftigen – auch mit den dunklen Seiten wie in »Töchter des Nordlichts«. Insgesamt liegen bei Bastei Lübbe sechs Norwegen-Romane von Christine Kabus vor.
CHRISTINE KABUS
DAS GEHEIMNISDERMITTSOMMERNACHT
Norwegen-Roman
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2016/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Ulrike Brandt-Schwarze, Bonn
Covergestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, München, unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock/Cheryl Hill; shutterstock/Galyna Andrushko; shutterstock/Galyna Andrushko
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-1627-7
be-ebooks.de
lesejury.de
Bak skyene er himmelen alltid blå.
Figuren der Handlung
DIE FAMILIE ORDAL
Olaf Ordal, Rechtsanwalt
Clara Ordal, seine Frau
Paul Ordal, ihr Sohn
Sverre Ordal, ehemaliger Sägewerksbesitzer, Olafs Vater
Trude Ordal, seine Frau
Gundersen, ehemaliger Angestellter von Sverre Ordal
FAMILIE SVARTSTEIN
Røros, Norwegen
Ivar Svartstein, Direktor des Kupferwerks
Ragnhild Svartstein, Tochter von Roald und Toril Hustad, seine Frau
Sofie Svartstein, ihre jüngere Tochter
Silje Svartstein, ihre ältere Tochter
Randi Skogbakke, geb. Svartstein, Ivars ältere Schwester
Ullmann, Kammerdiener von Ivar Svartstein
Britt, Siljes Zofe
Eline, Hausmädchen
DIE FAMILIE HUSTAD
Trondheim, Norwegen
Roald Hustad, Vater von Ragnhild Svartstein
Toril Hustad, seine Frau
Sophus Hustad, ihr Sohn, Papierfabrikant
Malene Hustad, seine Frau
Bonn
Professor Dr. jur. Dahlmann und seine Frau
Ottilie, Clara Ordals beste Freundin, Hausmädchen bei den Dahlmanns
Røros und Umgebung
Bodil, beste Freundin von Paul Ordal
Nils Jakupson, genannt »Fele-Nils«, ihr Vater
Fredrik Lund, Bankierssohn aus Trondheim
Moritz von Blankenburg-Marwitz, dt. Offizier
Major von Rauch, sein Begleiter
Mathis Hætta, Ingenieur
Siru, Hirtin
Frau Olsson, Pensionswirtin
Ole Guldal (1852–1922), Schuldirektor, Vorsitzender des Arbeitervereins
Per Hauke, Zimmermann, Mitglied des Arbeitervereins
Olaf Olsen Berg (1855–1932), Verleger der Zeitung »Fjell-Ljom«
Elmer Blomsted, Küster, Organist
Doktor Pedersen, Arzt
Berntine Skanke, Frau des Schneidermeisters
Gudrid Asmund, Frau des Bankdirektors
Ida Krogh, Frau des Postmeisters
Prolog
Røros, Herbst 1893
Nie, nie, nie! Niemals will ich so enden!!! Lieber friste ich mein Dasein als Gouvernante!
Beim Setzen des letzten Ausrufezeichens stieß das Mädchen den Füllfederhalter so heftig auf die Seite ihres Tagebuchs, dass die Tinte herausspritzte. Das Mädchen verzog kurz den Mund, zuckte die Achseln und schrieb weiter.
Da sagen sie immer, wir sollen dankbar sein für das gute Leben, das wir haben. Dankbar, dass uns ein Schicksal wie das der Arbeiterfrauen erspart bleibt, die den ganzen Tag schuften müssen, um die hungrigen Mäuler ihrer unzähligen Kinder zu stopfen. Die ständig in Sorge um ihre Männer sind, ob sie am Ende der Woche gesund aus den Gruben zurückkehren und unterwegs nicht den mageren Lohn vertrinken – wenn er ihnen denn überhaupt ausgezahlt wurde. Und die ihre schwieligen Hände allenfalls beim Kirchgang am Sonntag in den Schoß legen können, wenn sie sich auf der Galerie neben ihre Leidensgenossinnen quetschen.
Aber ist dieses Los wirklich immer so viel härter als das der Damen der sogenannten besseren Gesellschaft? Wenn ich mir unsere Mutter ansehe, bezweifle ich das. Sie lebt zwar in einem behaglichen Heim, muss sich nie sorgen, dass die Vorräte ihrer gut gefüllten Speisekammer je zur Neige gehen könnten, beschäftigt Dienstboten und hat als Gattin eines der wichtigsten Männer der Stadt das Anrecht auf einen Sitzplatz ganz vorn in einer der Logen neben dem Altar.
Zugleich ist sie aber die unglücklichste Person, die ich kenne. Wenn ich die tiefen Sorgenfalten und den gequälten Ausdruck ihres lieben Gesichts sehe, krampft sich mir das Herz zusammen. Sie wagt ja vor Scham kaum noch, den Blick zu heben. Und jeden Monat schleicht sie aufs Neue wie ein geprügelter Hund durchs Haus, wenn wieder einmal ihre Hoffnung zerschlagen ist: dass ihr Leib endlich mit dem ersehnten Stammhalter gesegnet wurde. So abwegig es klingen mag, manchmal denke ich, dass Mutter ein Leben in Armut vorziehen würde. Vorausgesetzt natürlich, wenn sie dafür endlich den Wunsch unseres Vaters nach einem Sohn erfüllen könnte.
Wieso tut er ihr das an? Warum kann er nicht akzeptieren, dass Gott ihm nur Töchter geschenkt hat?
Erneut hielt das Mädchen inne und las den letzten Satz. Es schüttelte den Kopf, runzelte die Stirn und fuhr langsamer fort.
Warum dieses »nur«??? Warum sind Mädchen nicht ebenso wertvoll wie Jungen? Ist es nicht gotteslästerlich, diesen Unterschied zu machen? Wer sind wir, dem Allmächtigen zu unterstellen, er würde die Hälfte der Menschheit als minderwertig ansehen? Heißt das nicht, die Vollkommenheit seiner Schöpfung in Zweifel zu ziehen?
Sich nähernde Schritte ließen die Schreiberin zusammenzucken. Rasch klappte sie das Tagebuch zu und versteckte es hinter den Büchern, die auf einem schmalen Bord über ihrem Bett standen.
1
Bonn, Mai 1895 – Clara
Clara Ordal spürte, wie sich eine kleine Hand in ihre schob. Paul war neben sie getreten und schmiegte sich gegen ihre Hüfte. Sie umschloss die feingliedrigen Finger des Sechsjährigen und zog seinen schmalen Körper, der in einem frisch gebügelten Matrosenanzug steckte, näher an sich. Er hob den Kopf und suchte ihre Augen.
»Dauert das noch lang?«, flüsterte er kaum hörbar und deutete mit dem Kinn auf einen älteren Herrn mit ergrautem Backenbart, der vor wenigen Augenblicken begonnen hatte, eine Ansprache zu halten. Clara strich ihrem Sohn eine blonde Locke aus der Stirn, die unter seiner runden Matrosenmütze mit dem versteiften Teller hervorlugte, und zuckte mit einem bedauernden Lächeln die Schultern. Wenn Professor Dahlmann die Gelegenheit bekam, eine Rede zu halten, nutzte er dies weidlich aus. Pauls Geduld würde auf eine harte Probe gestellt werden.
Sie befanden sich auf der Veranda des schwimmenden Bootshauses, das der Bonner Ruderverein unweit der Fährgasse am Rheinufer sein Eigen nannte. Es war ein geräumiger Bau, der nicht nur dem umfangreichen Bootspark des Klubs Platz bot, sondern auch einem Saal für Festlichkeiten, in dem sich die Mitglieder, die großen Wert auf gesellige Zusammenkünfte legten, regelmäßig versammelten. An diesem Nachmittag hatte das schöne Wetter die kleine Gesellschaft, die sich zu Ehren von Olaf Ordal eingefunden hatte, nach draußen gelockt. Später würde man im Festsaal speisen, der Sektempfang und die Reden fanden jedoch unter freiem Himmel statt.
Eine auffrischende Brise ließ die blauen Dreieckswimpel mit weißem Stern flattern, die an einer Girlande an der Front des Vereinshauses befestigt waren. Clara schloss kurz die Augen und sog tief die Luft ein, die nach feuchter Erde und dem Tang roch, der auf die vom Wasser umspülten Steine des Uferdamms angeschwemmt worden war. In diesen herben Geruch mischte sich die süße Note einer violett und weiß blühenden Fliederhecke, die einen Garten nahe des Flusses umgab. Der Mai ließ sich in diesem Jahr ungewöhnlich mild an. Die Bäume der Uferpromenade waren von zartem Grün bedeckt, und in den Blumenrabatten hatte man die verblühten Tulpen und Narzissen längst gegen Pelargonien, Fuchsien und Löwenmäulchen ausgetauscht. Der Schrei einer Möwe, die über das Bootshaus flog, ließ Clara aufblicken. Die Sonnenstrahlen zauberten Lichtreflexe auf die Wellen des träge dahinfließenden Flusses und wurden von den glänzenden Seidenstoffen und den polierten Knöpfen der Damenkleider und den Perlen und Edelsteinen der Halsketten und Armbänder reflektiert.
Clara hatte sich für einen bodenlangen dunkelblauen Rock mit einer gestickten Zierborte entschieden und für eine hochgeschlossene Bluse mit aufgepufften Ärmeln, die wegen ihrer Form Hammelkeulen genannt wurden. Bei manchen Damen waren diese so aufgebauscht, dass sie an Ballons erinnerten. Einige Frauen trugen leichte Capes oder kurze Umhänge, die bis zu den stark betonten Wespentaillen der trichterförmigen Röcke reichten. Die Herren waren teils in Uniform erschienen, ansonsten sah man viele graue und schwarze Anzugjacketts oder Gehröcke, vereinzelt auch modische Cutaways mit den typischen abgerundeten Vorderschößen. Die melonenförmigen Hüte und hohen Zylinder der Männer bildeten in ihrer Nüchternheit einen auffälligen Kontrast zu der mit Seidenblumen und Federn geschmückten Pracht, die die Damen auf ihren Köpfen balancierten.
Clara, die sich an den Rand der Plattform hinter die rund zwei Dutzend Gäste gestellt hatte, suchte den Blick ihres Mannes, der neben dem Redner vor dem Eingang des Bootshauses stand. Olaf Ordal überragte den Professor um Haupteslänge. Wie sein Sohn Paul hatte er eine schmale Statur, die gleichen hellblauen Augen und blonden Haare, die sich bei Olaf jedoch bereits merklich lichteten und eine hohe Stirn freigaben. Gepaart mit dem nachdenklichen Gesichtsausdruck ließ sie ihn älter wirken als seine dreißig Jahre. Er schaute über die Köpfe der Anwesenden hinweg ins Leere, ohne Claras Blick zu bemerken. Was er wohl gerade dachte? Eine Frage, die sie sich oft stellte. Und auf die sie fast nie eine Antwort erhielt. Olaf Ordal pflegte die Dinge mit sich selbst abzumachen.
Am Anfang ihrer Ehe hatte Clara ihn manchmal gefragt, was ihn beschäftige, wenn er mit ernster Miene vor sich hin schwieg. Gab es Probleme bei der Arbeit? Hatte er Schwierigkeiten mit einem Kollegen? Drückten ihn Geldsorgen? Oder plagte ihn die Sehnsucht nach seiner Familie im fernen Norwegen? Wem, wenn nicht seiner Frau, hätte er seine Sorgen und Kümmernisse anvertrauen sollen? Olaf hatte jedes Mal freundlich geantwortet, dass alles in Ordnung sei und sie sich nicht unnötig den Kopf zerbrechen solle. Clara hatte ihre Versuche eingestellt und sich damit abgefunden, dass ihr Mann sie offensichtlich nicht ins Vertrauen ziehen wollte. Ihre Freundin Ottilie, der sie ihre Verunsicherung darüber gestanden hatte, fand das nicht weiter erstaunlich. Sie beruhigte Clara damit, dass die meisten Männer nicht mit ihren Ehefrauen über geschäftliche oder andere Probleme sprachen – teils aus Angst, als Schwächlinge dazustehen, teils aus der Überzeugung heraus, Frauen würden ohnehin nichts von Angelegenheiten außerhalb ihres häuslichen Dunstkreises verstehen.
»Warum machst du dir Sorgen?«, hatte Ottilie wissen wollen. »Dein Olaf ist doch grundsolide. Er begegnet dir mit Achtung, sorgt gut für euch und scheint keine Laster zu haben. Er ist eben einer von den Stillen. Und glaub mir, das sind nicht die Schlechtesten.«
Clara hatte ihrer Freundin nicht widersprochen, zumal diese damals gerade eine geplatzte Verlobung mit einem Schreinergesellen hinter sich hatte, der dem Alkohol verfallen war. Ottilie hatte im Münster eine dicke Kerze gespendet und ihrem Schutzengel gedankt, der ihr rechtzeitig die Augen geöffnet und sie vor einer Ehe mit einem Trunkenbold bewahrt hatte.
»Und so lassen wir ihn denn mit einem weinenden und einem lachenden Auge ziehen.«
Die tiefe Stimme von Professor Dahlmann drang in Claras Gedanken. Sie straffte sich und sah nach vorn.
»Mit einem weinenden Auge, weil wir mit ihm einen geschätzten Kollegen, tüchtigen Ruderer und treuen Freund verlieren. Es ist wohl nicht vermessen, wenn ich sage, dass er hier eine schmerzliche Lücke hinterlassen wird.«
Paul zupfte an Claras Ärmel. Sie beugte sich zu ihm hinunter.
»Warum flunkert er?«, flüsterte er. »Seine Augen sehen gleich aus. Keines von beiden weint!«
»Das ist eine Redensart. Das sagt man, wenn man gleichzeitig froh und traurig ist«, erklärte Clara.
Paul runzelte die Stirn. »Das verstehe ich nicht.«
»Das ist dir doch selber vor ein paar Wochen so ergangen. Weißt du noch? Als es immer wärmer wurde und die Sonne deinen schönen Schneemann weggeschmolzen hat«, sagte Clara. »Da warst du traurig. Gleichzeitig hast du dich aber gefreut, weil nun der Frühling kam und du wieder mit deinem Freund Karli draußen mit euren Reifen und Murmeln spielen konntest.«
Paul nickte und schaute sehnsuchtsvoll zu den Booten, die ein paar Schritte entfernt von ihnen am Anlegesteg vertäut waren. Clara konnte seine Gedanken förmlich hören. Seit sie beim Vereinshaus angekommen waren, fieberte Paul der Fahrt auf dem Rhein entgegen, die ihm sein Vater in Aussicht gestellt hatte. Seit Wochen lag er diesem in den Ohren, ihn einmal in dem schnittigen Renn-Vierer mitzunehmen, mit dem Olaf und seine Sportsfreunde regelmäßig trainierten. Paul stellte es sich herrlich vor, wie ein Pfeil übers Wasser zu schießen.
Aus diesem Traum würde auch an diesem Tag nichts werden. Stattdessen hatte Olaf seinem Sohn eine gemeinsame Runde in einem der breiteren Zweier-Skiffs versprochen, in denen man nebeneinandersitzen konnte. Die Freude über ein paar Augenblicke ganz allein mit dem vergötterten Vater überwog die Enttäuschung, wie Paul seiner Mutter versichert hatte, als sie ihn wegen der erneuten Verschiebung der Fahrt im Renn-Vierer trösten wollte. Angesichts seiner Reaktion hatte sich Clara nicht zum ersten Mal gefragt, ob ihr Sohn nicht zu ernst und abgeklärt für sein Alter war. Sie konnte sich nicht erinnern, in so jungen Jahren bereits ähnlich besonnen und vernünftig gewesen zu sein.
»Aber nicht nur Olaf Ordal werden wir sehr vermissen«, sagte der Professor und zog Claras Aufmerksamkeit auf sich, als er innehielt und eine galante Verbeugung in ihre Richtung machte.
»Auch seine liebe kleine Frau ist uns in all den Jahren ans Herz gewachsen.«
Clara spürte, wie ihr das Blut in die Wangen stieg. Es war ihr unangenehm, dass sich die Köpfe der anderen Gäste nach ihr umdrehten und so viele Augen auf ihr ruhten. Dazu nagte die Formulierung »liebe kleine Frau« an ihr. Schwang da Herablassung mit? Wohlwollende zwar, aber eben doch Herablassung? Clara schlug die Augen nieder. Nein, bei einem anderen hätte der Verdacht vielleicht standgehalten, nicht aber bei Professor Dahlmann. Er und seine Frau hatten Clara immer respektvoll behandelt und ihre Verwandlung vom mittellosen Dienstmädchen in die Ehefrau eines aufstrebenden Juristen mit aufrichtiger Freude begrüßt.
Die Erinnerung daran ließ Clara lächeln. Sie selbst hätte es vermutlich nie bemerkt, dass der norwegische Student ein Auge auf sie geworfen hatte. Gemeinsam mit einigen seiner Kommilitonen hatte sich Olaf zu den Debattierstunden eingefunden, zu denen der Professor jede Woche ausgewählte Studenten in seine Poppelsdorfer Villa einlud. Clara hatte es sich schlicht nicht vorstellen können, dass sie von den jungen Akademikern überhaupt als Person wahrgenommen würde. Sie war es gewohnt, weitgehend unsichtbar als dienstbarer Geist Mäntel und Hüte entgegenzunehmen, einen Imbiss zu servieren und dafür zu sorgen, dass das Feuer im Kamin der Bibliothek, in der der Professor seine Gäste um sich versammelte, nicht erlosch. Es war dem ebenso beherzten wie taktvollen Eingreifen der Frau des Hauses zu verdanken, dass aus dem schüchternen achtzehnjährigen Mädchen und dem zurückhaltenden Norweger vor sieben Jahren ein Paar geworden war. Frau Professor Dahlmann hatte es sich denn auch nicht nehmen lassen, für ihre ehemalige Angestellte als Trauzeugin aufzutreten und ihr bei der Einrichtung ihrer Wohnung in einem der schmucken neuen Mietshäuser, die rund um die Universität gebaut wurden, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Clara hob den Kopf und konzentrierte sich erneut auf die Worte des Professors.
»Nun verlässt Olaf Ordal mit seiner Familie das liebliche Rheinland mit seinen fruchtbaren Rebenbergen, den sagenumwobenen Burgen und ruhmreichen Städten, die sich in den Fluten des herrlichen Stromes spiegeln. Und bricht auf zu fernen Gestaden in der Südsee.«
Der Professor räusperte sich, hob eine Hand und zitierte einige Zeilen eines Gedichts, das den kolonialen Träumen in Übersee gewidmet war:
»Kreuz des Südens, deine SterneGlänzen ihm am Himmelszelt,Und in weiter ErdenferneWinkt ihm eine neue Welt.«
Der Professor lächelte, ließ die Hand sinken und sprach in normalem Ton weiter.
»Vor allem winkt ihm eine neue, bedeutende Aufgabe. Dies ist auch der Grund, aus dem wir ihn mit einem lachenden Auge ziehen lassen. Wir sind stolz, dass er von unserer Kanzlei abgeworben wurde, um fürderhin die rechtlichen Interessen der Deutschen Handels- und Plantagen-Gesellschaft der Südsee-Inseln auf Samoa zu vertreten.«
Einige Herren klatschten Beifall und nickten Olaf Ordal zu, der der Ansprache mit unbewegtem Gesicht lauschte. Einem Außenstehenden mochte er arrogant oder unbeteiligt erscheinen. Clara ahnte, dass ihm höchst unbehaglich zumute war. Es genierte ihn, in aller Öffentlichkeit gelobt zu werden. Zumal er nicht der Ansicht war, etwas Besonderes geleistet zu haben. Er bemühte sich nach Kräften, seine Aufgaben so gut wie möglich zu erfüllen, und rechnete es sich nicht als sein Verdienst an, dass man ihn für den Posten in Übersee ausgewählt hatte. Clara vermutete, dass diese Haltung seiner protestantischen Erziehung geschuldet war. Im Lauf der gemeinsamen Jahre hatte sich immer wieder gezeigt, wie tief sie in ihm verwurzelt war. Auch wenn er keinen großen Wert auf die Ausübung seines Glaubens legte, selten einen Gottesdienst besuchte und sich nicht daran störte, dass seine Frau der katholischen Kirche angehörte – dass der Beruf eine von Gott gestellte Aufgabe sei und der Mensch gehalten, seine Arbeit mit Fleiß auszuführen, war eine Überzeugung, an der es in den Augen von Olaf Ordal nichts zu rütteln gab. Einzig durch die Erfüllung der irdischen Pflichten konnte man das Wohlgefallen des Allerhöchsten erringen.
Nachdem der Beifall verklungen war, sprach der Professor weiter.
»Wir sind also sehr stolz auf die neue Stellung, die unser talentierter Kollege einnehmen wird. Denn – wie unser verehrter Kaiser kürzlich betonte: ›Das Deutsche Reich ist ein Weltreich geworden. Überall in fernen Teilen der Erde wohnen Tausende unserer Landsleute, deutsche Güter, deutsches Wissen, deutsche Betriebsamkeit gehen über den Ozean.‹ Olaf Ordal wird fortan seinen Teil dazu betragen, diese fruchtbaren Beziehungen auszubauen und zu festigen. Darum lasst uns nun die Gläser erheben und auf sein Wohl anstoßen!«
Mit diesen Worten beendete Professor Dahlmann seine Ansprache. Er faltete das Blatt zusammen, auf dem er sich Stichworte zu seiner Rede notiert hatte, steckte es in eine Tasche seines maßgeschneiderten Fracks und lächelte in die Runde. Seine etwa zwei Dutzend Zuhörer kamen der Aufforderung nach, traten näher und prosteten Olaf zu, der dem Professor die Hand schüttelte.
Frau Professor Dahlmann, die die Rede ein paar Schritte seitlich von ihrem Mann stehend verfolgt hatte, winkte Clara zu und ging zu ihr. Sie war fast ebenso alt wie ihr Gatte, wirkte aber mit ihren raschen Bewegungen, den wachen Augen und ihrem fröhlichen Naturell um einiges jünger als sechzig Jahre.
»Kommen Sie, meine Liebe, seien Sie nicht so schüchtern! Ihr Platz ist an der Seite Ihres Mannes, nicht hier hinten! Wir wollen doch auch auf Ihr Wohl trinken!«
Clara lächelte verlegen. Es fiel ihr nach all den Jahren immer noch schwer, sich unbefangen und selbstverständlich als Teil der »besseren« Gesellschaft zu sehen, in die sie durch die Heirat aufgestiegen war. Sie schluckte und nahm Paul an der Hand.
Frau Professor Dahlmann tätschelte ihm die Wange.
»Freust du dich schon auf die Südsee?«
Paul sah sie an und nickte mit leuchtenden Augen.
»Oh ja! Man kann das ganze Jahr im Meer schwimmen. Es gibt dort nämlich keinen Winter, nur eine Regenzeit. Deshalb wächst dort auch ein dichter Dschungel. Mit Kokospalmen und riesigen Farnen.« Paul unterbrach sich, runzelte die Stirn und fügte mit Bedauern hinzu: »Aber leider ohne Tiger.«
Frau Professor Dahlmann lachte.
»Na, das beruhigt mich aber. Und deine Mutter ist sicher auch froh, dass es auf der Insel keine wilden Tiere gibt.«
Während Paul voraus zu seinem Vater sprang, hakte sie Clara unter und folgte ihm langsam.
»Manchmal beneide ich die Kinder um ihre unbedarfte Furchtlosigkeit. Aber wie steht es mit Ihnen? Wie blicken Sie Ihrem Umzug entgegen?«
Clara hob die Schultern.
»Schwer zu sagen. Es fühlt sich so unwirklich an. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sich unser Leben dort gestalten wird.«
»Wie sollten Sie auch. Es ist ja doch eine ganz fremde Umgebung.« Frau Professor Dahlmann stockte und musterte Clara aufmerksam. »Ehrlich gesagt, bewundere ich Sie.«
Clara zog die Augenbrauen hoch.
»Doch, wirklich. Ich weiß nicht, ob ich den Mut hätte, mein komfortables Heim zu verlassen und ans andere Ende der Welt zu ziehen. Allein das Klima dort stelle ich mir anstrengend vor.« Sie schüttelte den Kopf. »Und Sie mit Ihren rötlichen Haaren und dem zarten Teint müssen sich besonders vor der Sonne in Acht nehmen.«
Clara zuckte mit den Achseln. Dass sie bislang noch keinen Gedanken an ihre Haut verschwendet hatte und an den Schaden, den diese in den Tropen erleiden konnte, musste sie wohl als weiteren Beweis nehmen, wie wenig damenhaft sie war. Für sie gab es wichtigere Dinge. An erster Stelle stand die Frage, ob die Gesundheit ihrer kleinen Familie dort durch gefährliche Seuchen oder Unwetter bedroht war. Wie 1889, als auf Samoa ein furchtbarer Orkan gewütet und zwei deutsche Kriegsschiffe im Hafen von Apia samt Besatzung vernichtet hatte. Dazu kam die Ungewissheit, ob Paul, der nach Ostern eingeschult worden war, auf der abgelegenen Insel eine angemessene Bildung erhalten konnte.
»Ah, die holde Weiblichkeit!«, unterbrach Professor Dahlmanns Stimme Claras Überlegungen. »Sie kommen gerade im rechten Augenblick. Denn meine kleine Gabe ist für Sie beide gedacht«, fuhr er fort und hielt Clara und Olaf ein in rotes Leder eingebundenes Buch hin.
»Zur Einstimmung auf Ihre neue Heimat.«
Clara las die goldgeprägte Aufschrift auf dem Buchdeckel: Samoa – Die Perle der Südsee von Otto E. Ehlers.
Olaf kniff die Augen zusammen.
»Ehlers? … Der Name kommt mir bekannt vor…«
»Ja, natürlich!«, rief Clara. »Wir haben neulich einen Artikel in der Zeitung über ihn gelesen. Er ist mir in Erinnerung geblieben, weil er Jura studiert hat wie du.«
»Das ist richtig«, sagte der Professor. »Aber anders als Ihr Mann hat Ehlers meines Wissens nach nie als Anwalt gearbeitet, sondern sich schon früh auf die abenteuerlichsten Reisen in alle möglichen Teile der Welt begeben.«
Seine Frau nickte. »Er ist Erbe eines ansehnlichen Vermögens, das ihm diese Freiheit erlaubt. Zuletzt hat er in Südostasien versucht, den gesamten Bramaputra flussaufwärts zu fahren.«
»Ah, jetzt erinnere ich mich.« Olaf nickte Clara zu.
»Er musste die Expedition vorzeitig abbrechen«, erklärte Professor Dahlmann. »Ich glaube, er ist verwundet worden. Jedenfalls verbrachte er anschließend einige Monate auf Samoa und schrieb dort seine Eindrücke von Land und Leuten nieder.«
Der Professor tippte mit einem Finger auf das Büchlein. »Er schreibt sehr unterhaltsam und mit Liebe zum Detail. Sie erlauben?«, fragte er, nahm es Olaf aus der Hand, blätterte in den Seiten und las eine Stelle vor: »Alle Versuche, die Samoaner an regelmäßige Arbeit zu gewöhnen, scheiterten an der diesen liebenswürdigen Menschen angeborenen Trägheit. Sie verlangten unverhältnismäßig hohe Löhne für außerordentlich geringe Leistungen und zeigten sich außerdem in jeder Hinsicht als unzuverlässig.«
»Oh weh«, sagte seine Frau mit einem Lächeln. »Ich weiß nicht, ob solche Lektüre dazu angetan ist, Herrn Ordal positiv auf seine neue Aufgabe einzustimmen.«
Clara pflichtete ihr insgeheim bei. Wie würde Olaf mit Menschen zurechtkommen, deren Arbeitsmoral sich so grundlegend von der seinen unterschied – sofern man dem Bericht des reiselustigen Autors Glauben schenken konnte? Zu ihrer Überraschung verzog sich der Mund ihres Mannes zu einem Lächeln. »Keine Sorge, gnädige Frau, es bedarf schon mehr als ein paar träge Eingeborene, um meine Vorfreude auf unser neues Leben zu schmälern«, sagte er und deutete eine Verbeugung gegen Frau Professor Dahlmann an.
Er kniff Paul, der dem Gespräch der Erwachsenen stumm zugehört hatte, zärtlich in die Wange und legte den anderen Arm um Clara. Die ungewohnte Geste trieb ihr erneut die Röte ins Gesicht. Es kam selten vor, dass Olaf Ordal ihr in aller Öffentlichkeit seine Zuneigung bekundete. Sie lehnte sich gegen ihn. Ein Gefühl der Zuversicht durchströmte sie. Alle Ängste und Zweifel fielen von ihr ab. Das neue Leben in der Südsee mochte unwägbare Strapazen und Widrigkeiten für sie bereithalten. Wenn Olaf dem so gut gelaunt entgegensah, wollte sie das alles gern ertragen. Die Aussicht, Europa zu verlassen, schien ihren Mann zu beflügeln. Selten hatte sie ihn so vergnügt erlebt – er war befreit von der Schwermut, die ihn sonst wie ein Schatten begleitete.
2
Røros, Mai 1895 – Sofie
Mit einem leisen Klacken fiel die Tür der Löwenapotheke hinter Sofie ins Schloss, gleichzeitig erklang die Ladenglocke. Sie hatte einen ungünstigen Zeitpunkt erwischt. Der kleine Verkaufsraum war voll. Vor ihr warteten bereits drei Damen darauf, an die Reihe zu kommen. Sie waren ins Gespräch vertieft und würdigten Sofie kaum eines Blickes. Vorne am Tresen wurde Küster Blomsted bedient. Die Neunzehnjährige unterdrückte ein Seufzen. Sie mochte den alten Herrn, der stets liebenswürdig und zuvorkommend war. In diesem Augenblick wünschte sie ihn jedoch weit weg. Seine umständliche Art hatte schon geduldigere Menschen als sie an den Rand der Verzweiflung gebracht.
»Sie meinen also, ich sollte es einmal mit Salbeitee versuchen?«, fragte er. Seine Stimme klang heiser.
»Das kann sicher nicht schaden«, antwortete der Apothekergehilfe. »Außerdem würde ich Ihnen empfehlen zu gurgeln. Mit ein paar Tropfen Propolistinktur, die Sie in lauwarmes Wasser geben.«
Er holte ein Fläschchen von dem Regal, das als Raumteiler hinter ihm bis zur Decke reichte.
»Hm, hm«, machte der Küster und wiegte nachdenklich den Kopf. »Ich weiß nicht so recht … Heiße Milch mit Honig soll ja auch nicht schlecht…«
»Gewiss«, sagte der Gehilfe. »Auch warme Halswickel helfen.«
Der Küster kratzte sich am Kinn und ließ seinen Blick über die Flaschen und Porzellandosen schweifen.
Sofie wippte von einem Bein auf das andere. Das konnte noch ewig so weitergehen. Am liebsten hätte sie sich nach vorne gedrängt und dem alten Blomsted die Entscheidung abgenommen, mit welchem Mittel er seinen Halsschmerzen am besten zu Leibe rücken sollte.
Die drei Damen, die wie eine Wand vor ihr standen, schien die Warterei dagegen nicht zu stören. Sofie hatte sie im Verdacht, dass sie die Gelegenheit begrüßten, sich ausführlich über den neuesten Klatsch austauschen zu können.
Sie stellte sich vor einen Vitrinenschrank neben der Tür, in dem eine Sammlung getrockneter Heilpflanzen mit kleinen Erklärungstafeln ausgestellt war, und tat so, als ob sie in deren Betrachtung vertieft sei. Dabei lockerte sie den Schal, den sie sich mehrfach um den Hals gewickelt hatte, und knöpfte den obersten Knopf ihres mit Lammfell gefütterten Mantels auf. Nach dem schnellen Gehen in der Kälte war es ihr in dem gut beheizten Raum zu warm. Unten in den Tälern und an den Fjorden der Westküste hatte der Frühling gewiss schon längst Einzug gehalten. Hier oben auf der kahlen Hochebene mitten in den Skanden nahe der schwedischen Grenze war man dagegen den rauen Winden schutzlos ausgeliefert, die noch im Mai für frostige Nächte sorgten.
Sofie konnte verstehen, warum ihre Mutter sich oft nach ihrer alten Heimatstadt Trondheim sehnte und von den üppigen Gärten schwärmte, in denen es bereits Ende März grünte und blühte. Sie selbst konnte es kaum noch erwarten, bis es endlich milder wurde und sie nicht länger den größten Teil der Zeit im Haus verbringen musste. Wobei es sich in den Augen ihrer Eltern nicht gehörte, wenn sie ohne Begleitung draußen unterwegs war. Vorbei waren die Zeiten, in denen sie als kleines Mädchen stundenlang unbeaufsichtigt umhergestreift war oder es sich mit einem Buch am Ufer des Hitterelva gemütlich gemacht hatte, der das Zentrum von Røros umfloss. Seit ihrer Konfirmation wurde großer Wert darauf gelegt, dass sie sich in der Öffentlichkeit schicklich verhielt und alles unterließ, was einem jungen Fräulein aus gutem Hause nicht ziemte. Sofie fügte sich diesem Gebot, nutzte aber jeden Vorwand, um sich allein auf den Weg zu machen. Den Gang in die Apotheke hatte sie Eline, dem damit beauftragten Dienstmädchen abgenommen, das dankbar zu dem riesigen Berg Bügelwäsche zurückgekehrt war, den es zu bewältigen hatte.
Sofie tastete nach dem Rezept in ihrer Manteltasche und fragte sich nervös, ob sie es rechtzeitig nach Hause zurückschaffen würde, bevor man dort ihre Abwesenheit bemerkte. Sie fürchtete nicht die Schelte, die ihr drohte, sondern machte sich Sorgen um Eline, der man Pflichtvergessenheit vorwerfen und vielleicht als Strafe ihren freien Nachmittag streichen würde. Nun, das würde sie nicht zulassen. Sie würde klarstellen, dass sie allein die Schuld trug. Der Gedanke war beruhigend. Sofie entspannte sich, richtete sich auf eine längere Wartezeit ein und fächelte sich mit dem Rezept Luft zu. Der stickige Raum wurde von den unterschiedlichsten Gerüchen durchzogen. Aromatische Kräuterdüfte mischten sich mit den scharfen Noten der ätherischen Öle und Desinfektionsmittel, dem säuerlichen Aroma von Borwasser und einem süßlichen Parfüm, das eine der drei Damen aufgelegt hatte.
Diese schienen ihre Anwesenheit schon wieder vergessen zu haben. Sie tratschten in unverminderter Lautstärke weiter und nahmen den Leichtsinn einer jungverheirateten Frau aufs Korn, die das Haushaltsgeld nicht – wie es sich gehörte – zusammenhielt und sparsam verwaltete, sondern mitten unter der Woche eine Torte gekauft hatte, um ihren Mann nach einer Geschäftsreise mit einer süßen Überraschung zu verwöhnen.
Sofie verstand die Aufregung nicht. Was war so verwerflich daran, wenn eine Ehefrau ihrem Mann eine Freude bereiten wollte? Es war doch ein schönes Zeichen ihrer Verliebtheit. Sie starrte auf die Spitzen ihrer Schnürstiefel, die unter dem Saum ihres Mantels hervorlugten, und überlegte weiter. War es vielleicht genau das, was den Unmut oder vielmehr den Neid der Tratschtanten erregte? Die Vorstellung, dass in einer Ehe Zuneigung und zärtliche Gefühle herrschen konnten? Sofie zog sich der Magen zusammen. Waren Liebesheiraten tatsächlich nur eine romantische Utopie, die den Anforderungen des Alltags kaum standhielten? Warum geisterten sie dann aber seit Jahrhunderten durch die Literatur? Und warum hätte Gott dem Menschen die Fähigkeit zu tiefer Liebe verleihen sollen, wenn diese angeblich unnütz oder gar schädlich war? Sie hatte schon länger den Verdacht, dass es vor allem enttäuschte Leute waren, die diese Überzeugung vertraten. Leute wie diese Klatschbasen, die die Liebe wohl nie kennengelernt hatten.
Während Sofie noch über diese leicht durchschaubare Missgunst nachdachte, bearbeiteten die drei Damen ein neues Opfer mit ihren spitzen Zungen. Ihre verschwörerisch gedämpften Stimmen ließen Sofie aufhorchen.
»Stellt Euch vor, wenn er nicht binnen vier Wochen seine Schulden begleicht, verliert er alles«, sagte Gudrid Asmund, eine knochige Mittfünfzigerin mit bleichem Teint und scharfen Falten, die ihrem Gesicht einen strengen Ausdruck verliehen.
So stellte sich Sofie die ausgemergelten Gesichter asketischer Fakire vor. Vor einigen Wochen war im Kirchenblatt ein Artikel über die norwegische Missionsstation beim Santal-Volksstamm im Nordosten Indiens erschienen. Die Berichte über die Arbeit und Erfolge der Missionare hatte Sofie nur überflogen, die anschaulichen Schilderungen eines Lehrers, der eine Reise durch dieses exotische Land unternommen hatte, dagegen regelrecht verschlungen und sich später mithilfe des Lexikons im Arbeitszimmer ihres Vaters weitere Informationen über Indien verschafft.
»Das ist ja furchtbar«, hauchte die Frau von Postmeister Krogh und jüngere Schwester von Frau Asmund.
Wie diese hatte sie eine schmale Figur, ihrem Gesicht fehlte aber deren Strenge. Blassblaue Augen, die oft in Tränen schwammen und blinzelnd in die Welt schauten, betonten ihr verhuschtes Wesen.
»Kann denn dein Mann nicht etwas für ihn…«
Der Anblick der finsteren Miene ihrer Schwester ließ sie verstummen.
»Wo denkst du nur hin, Ida?«, zischte Frau Asmund.
»Ich dachte … nun, äh … als Bankdirektor hätte er schließlich die Möglichkeit…«, antwortete Frau Krogh leise und verstummte.
»Als Bankdirektor hat er vor allem eine große Verantwortung gegenüber seinen Kunden!«, sagte ihre Schwester. »Er würde diese sträflich vernachlässigen, wenn er gegen jede Vernunft ihr Erspartes an einen Mann verleihen würde, der es mit beiden Händen zum Fenster hinauswirft. Mehr noch, er würde sich versündigen, wenn er diesem Treiben weiterhin Vorschub leistete.«
Sofie zog die Augenbrauen zusammen. Die Selbstgerechtigkeit von Frau Asmund stieß ihr bitter auf. Wie konnte man nur so hart und unbarmherzig urteilen? Und woher nahm sie überhaupt die Gewissheit, es handele sich um mutwillige Geldverschwendung? Auch unbescholtene Menschen konnten unversehens in Not geraten. Ihre eigenen Großeltern wären in den Achtzigerjahren um ein Haar in den Abgrund gerissen worden, als in Trondheim eine Konkurswelle Dutzende Kaufleute und Unternehmer überrollte, die gegenseitig füreinander gebürgt hatten und die hohen Wechsel der Banken nicht mehr bezahlen konnten. Der Vater ihrer Mutter, der selber nie Schulden gemacht hatte, sah sich von einem Tag auf den anderen am Rande des Ruins, weil er als Bürge für andere unterschrieben hatte.
»Seine Frau tut mir aufrichtig leid«, mischte sich die Gattin von Schneidermeister Skanke ins Gespräch und zupfte am Pelzbesatz ihres Umhangs, der ihre füllige Erscheinung wie ein Zelt umgab. Der zufriedene Ton ihrer Stimme strafte diese Behauptung Lügen. Sofie hatte Berntine Skanke im Verdacht, dass es nur ein einziges Wesen gab, das ihr weiche Gefühle entlocken konnte: ihr Zwergpinscher Tuppsi, den sie wie gewohnt in einer eigens dafür genähten Tasche unter dem Arm bei sich trug.
Frau Krogh nickte und seufzte. »Ja, die arme Trude. Der Herr hat ihr wahrlich ein schweres Schicksal aufgebürdet.«
»Nun, mag sein. Aber bei allem Mitgefühl, letzten Endes hat sie sich das selbst zuzuschreiben«, sagte Frau Skanke und zuckte die Achseln.
»Wie meinst du das?«, fragte Frau Krogh.
Frau Skanke hob belehrend eine Hand. »Es ist nicht recht, den Platz, der uns zugewiesen wurde, zu verlassen. Da sieht man wieder einmal, wie wahr der Bibelspruch ist: Hochmut kommt vor dem Fall. Wäre Trude bei ihresgleichen geblieben, hätte sie heute gewiss ein gutes, wenn auch bescheidenes Auskommen. Aber sie musste ja unbedingt dem Sohn des Sägewerkbesitzers den Kopf verdrehen. Schlimm genug, dass er nicht mit Geld umgehen kann. Zur Katastrophe wurde es, weil sie den Anforderungen eines gehobenen Haushalts offenbar nicht gewachsen ist und nicht vernünftig wirtschaftet. Wenn er eine standesgemäße Partie gewählt hätte, eine Frau, die wie wir sorgfältig darauf vorbereitet wurde…«
Ein Quietschen unterbrach ihren Redefluss. In ihrem Eifer hatte Frau Skanke die Umhängetasche, in der Tuppsi steckte, an sich gepresst und ihrem Liebling ein schmerzerfülltes Jaulen entlockt.
»Ach, mein armer Tuppsi!«, rief sie und wandte sich ab, um den Pinscher zu beruhigen.
In diesem Moment hatte sich Küster Blomsted zu einer Entscheidung durchgerungen und ließ sich je eine Tüte Salbeitee und Kamillenblüten, ein Fläschchen Propolistinktur und eine Dose mit Hustenpastillen einpacken. Mit einer förmlichen Verbeugung zu den Damen hin und einem freundlichen Lächeln in Sofies Richtung verließ er die Apotheke.
Sofie nutzte die Gelegenheit, trat einen Schritt nach vorn und reichte dem Gehilfen das Rezept, das sie für ihre Mutter einlösen sollte. Ihre Hoffnung, sofort bedient zu werden und ohne weitere Verzögerung nach Hause zurückkehren zu können, erfüllte sich nicht.
»Sofie! Gute Güte, warum schleichst du dich denn so an?«, rief Frau Asmund.
Es klang vorwurfsvoll. Als sei es Sofies Schuld, dass man ihre Anwesenheit ignoriert oder vergessen hatte. Frau Asmund räusperte sich und fuhr fort: »Nun, du kommst gerade recht. Ich hatte schon überlegt, später bei euch vorbeizuschauen, um mich nach dem Befinden deiner Mutter zu erkundigen. Aber nun kannst du mir ja Auskunft geben.«
»Es ist doch bald so weit, nicht wahr?«, setzte sie ungeduldig nach, als Sofie keine Anstalten machte zu antworten.
Bevor Sofie etwas sagen konnte, deutete Frau Krogh auf den Apothekergehilfen, der eben mit dem Rezept den Regalschrank, der als Raumteiler fungierte, umrundete und in den hinteren Bereich des Ladens entschwand.
»Eine Arznei für deine Mutter?«, fragte sie. »Ich hoffe, das ist kein schlechtes Zeichen! Wenn es irgendetwas gibt, das wir für sie tun können…«
Sofie schüttelte energisch den Kopf. Das hatte gerade noch gefehlt, dass diese menschlichen Hyänen bei ihnen zu Hause aufkreuzten und sich unter dem Vorwand, ihr behilflich sein zu wollen, auf ihre Mutter stürzten und ihr den letzten Nerv raubten.
»Wie freundlich von Ihnen«, sagte sie. »Aber das ist nicht nötig! Meiner Mutter geht es gut. Sie ist nur ein wenig erschöpft. Und mit dem Rezept hat es nichts Beunruhigendes auf sich. Doktor Pedersen hat ihr lediglich eine Venensalbe verschrieben.«
»Ah, die Arme hat Krampfadern!«, rief Frau Skanke, die ihren Hund mit einem Keks getröstet hatte und sich nun wieder zu den anderen gesellte. »Die haben mir auch zu schaffen gemacht, als ich seinerzeit meine Kinder unter dem Herzen trug.« Sie schüttelte den Kopf. »Gott, wie lang ist das her! Nicht auszudenken, diese Strapazen in so hohem Alter noch einmal auf sich nehmen zu müssen.«
Sie warf den beiden anderen Damen einen vielsagenden Blick zu. Frau Asmund erwiderte ihn mit einem verständnisinnigen Nicken. Ihre Schwester schaute zu Sofie und biss sich auf die Unterlippe. Das Unbehagen über die Richtung, die das Gespräch nahm, war ihr deutlich anzusehen. Ihre Begleiterinnen schien das nicht anzufechten, sie redeten unbeirrt weiter.
»Ich bin auch froh, dieser Bürde entledigt zu sein«, verkündete Frau Asmund.
»Nun, wir haben unsere Aufgabe ja auch erfüllt«, sagte Frau Skanke.
Frau Asmund streckte ihren Brustkorb heraus. »Das kann man wohl sagen! Drei gesunde Jungen habe ich meinem Mann geschenkt. Dafür ist er nun so rücksichtsvoll, mir keine weiteren ehelichen Pflichten abzuverlangen.«
Frau Krogh hüstelte, stieß ihre Schwester in die Seite und deutete mit dem Kopf auf Sofie. »Gudrid, mäßige dich! Das ist nichts für so junge Ohren!«
Sofie senkte rasch die Augen und hoffte, dass das Gurgeln, das ihr in der Kehle steckte, als Zeichen mädchenhafter Verlegenheit gedeutet und nicht als das Kichern entlarvt wurde, das sie krampfhaft zu ersticken suchte. Die Vorstellung, dass der Bankdirektor seine Frau aus liebevoller Rücksichtnahme nicht mehr zur Erfüllung ihrer ehelichen Pflichten drängte – was auch immer man sich genau darunter vorzustellen hatte –, war zu komisch. Die ganze Stadt wusste, dass sich Herr Asmund vor seiner ebenso knochigen wie streitsüchtigen Gattin fürchtete und dankbar jede Gelegenheit ergriff, ihrer Gegenwart zu entfliehen und ausgedehnte Geschäftsreisen nach Trondheim und Christiania zu unternehmen. Sofie ahnte, dass die getuschelten Andeutungen, er würde sich dort und anderswo als Mann schadlos halten, etwas mit den verruchten Etablissements zu tun hatten, gegen die der Pastor in seinen Predigten regelmäßig wetterte.
Sofie hätte einiges darum gegeben, mehr über diese Orte der Sünde zu erfahren. Vor allem aber beschäftigte sie die Frage, was es mit den Trieben der Männer auf sich hatte, die eine Frau im Handumdrehen ins Verderben stürzen konnten. Wie vertrug sich das mit der Behauptung, die Herren der Schöpfung seien vernünftiger und intelligenter als das sogenannte schwache Geschlecht, das angeblich seinen Emotionen hilflos ausgeliefert war, weil es ihm an Verstand und kühler Sachlichkeit mangelte? War das nicht ein Widerspruch? Einerseits Respekt und Gehorsam gegenüber Männern einzufordern, weil sie Autoritätspersonen mit mehr Rechten waren, und gleichzeitig vor denselben Männern als triebhaften Wesen zu warnen, vor denen man sich in Acht nehmen sollte. Und warum glaubte alle Welt, junge Frauen wie rohe Eier behandeln und vor schädlichem Wissen behüten zu müssen? Wäre es nicht besser, die Gefahren klar zu benennen und darauf zu vertrauen, dass die vermeintlich unsicheren und leicht beeinflussbaren Mädchen ihnen selbst aus dem Weg gingen? Führte nicht gerade diese Heimlichtuerei und Tabuisierung zu verhängnisvoller Ahnungslosigkeit?
»Fräulein Svartstein?«
Die Stimme des Apothekergehilfen riss Sofie aus ihren Gedanken. Sie hatte weder den halblaut gezischten Schlagabtausch zwischen Frau Krogh und ihren Begleiterinnen verfolgt, die sich über späten Kindersegen stritten, noch die Rückkehr des Gehilfen an den Verkaufstresen bemerkt. Er reichte ihr einen Glastiegel.
»Damit kann sich Ihre Mutter die Beine drei Mal täglich einreiben«, erklärte er. »Soll ich den Betrag auf die Rechnung setzen?«
Sofie nickte. »Vielen Dank, das wäre sehr freundlich. Mein Vater begleicht sie dann wie immer am Ende des Monats.«
Sofie verstaute das Salbentöpfchen in ihrer Manteltasche, murmelte ein »Auf Wiedersehen« zu den Damen hin und schlüpfte aus der Tür, bevor diese sie mit weiteren Fragen löchern konnten. Sie sprang die drei Stufen hinab, die vom Eingang der Apotheke auf die Straße führten. Über der Tür des Eckhauses, das wie fast alle Gebäude des Städtchens aus Holz gezimmert war, prangte ein vergoldeter Löwe. Linkerhand ging es hinunter in die Hyttegata, eine der beiden parallelen Hauptstraßen von Røros, die hier an der Kreuzung zur Rau-Veta in die Mørktstugata überging, die Dunkle-Hütte-Straße, benannt nach dem Arresthaus weiter oben, einem fensterlosen Kasten.
Sofie hielt kurz inne und starrte, ohne etwas zu sehen, vor sich hin. Die Begegnung mit den Klatschbasen hatte sie in gemischte Gefühle gestürzt. Einerseits waren ihr diese Damen, die sich viel auf ihren gehobenen Gesellschaftsstatus einbildeten, ein steter Quell der Belustigung. Ihre bigotten Ansichten, Eifersüchteleien und Eitelkeiten amüsierten sie. Andererseits lösten ihre scharfzüngigen Verurteilungen und engstirnigen Normvorstellungen ein vages Unbehagen in ihr aus. In einer kleinen Stadt wie Røros konnte solches Getratsche einen guten Ruf vernichten und dem Betroffenen das Leben zur Hölle machen. Die Vorstellung, beständig auf der Hut sein zu müssen und keinen Anlass zu übler Nachrede zu geben, war beklemmend.
Sofie schüttelte sich und atmete tief ein – was sie im nächsten Augenblick bereute. Ein starker Hustenreiz trieb ihr die Tränen in die Augen. Die kühle Luft war geschwängert vom schwefeligen Gestank, den der auffrischende Wind in dichten Schwaden aus der nahegelegenen Schmelzhütte heranwehte. Sofie zog ihren Schal über ihre Nase, steckte ihre Hände in die Manteltaschen und lief die Storgata – die Große Straße, wie die Hyttegata im Volksmund genannt wurde – hinunter zum Haus ihrer Eltern.
In Gedanken war sie noch bei den drei Damen, die sie mit ihrem abrupten Aufbruch gewiss vor den Kopf gestoßen hatte. Sie malte sich aus, wie sie sich über ihr Betragen ereiferten, das sie bestenfalls mit Schüchternheit entschuldigen, wohl eher aber als ungezogen und schroff tadeln würden. Erst am vergangenen Sonntag hatte sie nach dem Gottesdienst eine Bemerkung aufgeschnappt, die die Frau des Pastors einer Bekannten zuraunte, als Sofie und ihre sieben Jahre ältere Schwester Silje an ihnen vorbeiliefen.
»Kaum zu glauben, dass die beiden Schwestern sind«, hatte sie gesagt. »Sie sind so unterschiedlich.« Ihre Gesprächspartnerin hatte diesen Eindruck bestätigt und die beiden Svartstein’schen Töchter als heiteren Sonnentag und finstre Nebelnacht bezeichnet.
Sofie hatte keine Sekunde gezweifelt, auf wen letzteres Bild gemünzt war. Seit sie denken konnte, wurden das gefällige Wesen ihrer Schwester, deren Sittsamkeit und Wohlerzogenheit gelobt. Sie selbst dagegen galt als verschlossen, grüblerisch und widerborstig. Was in den Augen ihrer Kritiker seinen äußeren Niederschlag in ihrer schlaksigen Figur, ihren widerspenstigen dunklen Locken, einer markanten Nase und den einen Tick zu weit auseinanderstehenden Augen fand. Siljes weibliche Rundungen, ihr ebenmäßiges Gesicht mit dem Kirschmund, ihr feines weizenblondes Haar und ihre kleinen Hände waren denselben Leuten ein Beweis dafür, das innere Schönheit sich sehr wohl im Aussehen eines Menschen spiegeln konnte. In den Chor der Bewunderer mischten sich allerdings zunehmend Stimmen, die diese Perfektion kritisch sahen und darüber diskutierten, ob sie vielleicht der Grund war, warum Silje Svartstein mit ihren sechsundzwanzig Jahren noch immer unverheiratet war. Weil sie und ihre Eltern zu hohe Ansprüche hatten, was einen passenden Ehemann betraf.
Sofie verzog das Gesicht. Wie konnte man sich nur über solche Nichtigkeiten den Kopf zerbrechen? Wo es doch so viel wichtigere Dinge gab. Zum Beispiel die bevorstehende Niederkunft ihrer Mutter. Sofies Behauptung, diese sei nur ein wenig erschöpft, davon abgesehen aber wohlauf, war die Version, die sie ihrer Mutter zuliebe nach außen verbreitete. In Wahrheit setzte die Schwangerschaft Ragnhild Svartstein sehr zu – auch wenn sie das nie zugeben würde. Sofie ließ sich von der Munterkeit, die sie an den Tag legte, nicht täuschen. Sie spürte die Angst ihrer Mutter so deutlich, als sei es ihre eigene. Wobei sie nicht hätte sagen können, wovor sich diese mehr fürchtete: noch ein Mädchen zu bekommen und endgültig als Versagerin vor ihrem Mann dazustehen. Oder vor der Geburt. Für Sofie stand fest, dass sie um das Leben ihrer Mutter bangte und den Tag verfluchte, an dem diese ihr unter Freudentränen eröffnet hatte, dass Gott ihren Leib nach all den Jahren vergeblichen Hoffens endlich wieder gesegnet hatte.
3
Bonn, Mai 1895 – Clara
Drei Wochen nach dem Empfang des Rudervereins waren Clara und Paul erneut auf dem Weg zum Rhein. Ihr Ziel war an diesem Nachmittag nicht das Bootshaus, sondern die weiter nördlich gelegene Anlegestelle der Fähre an der Josefstraße. Sie bot die einzige Möglichkeit, die Gemeinde Vilich und andere Ortschaften auf der anderen Flussseite zu erreichen. Seit einigen Jahren wurden im Bonner Stadtrat Pläne zum Bau einer Brücke gewälzt. Nicht nur, um des ständig wachsenden Verkehrsaufkommens zwischen den Ufern Herr zu werden, sondern auch, um künftig unbehindert von Nebel, Dunkelheit, Hoch- und Niedrigwasser oder Eisschollen im Winter den Strom überqueren zu können. Doch ein erbitterter Rechtsstreit mit den Fährleuten, die drastische finanzielle Einbußen befürchteten, verzögerte die Grundsteinlegung.
Clara war nicht traurig darüber. Sie liebte die gemächliche Passage über den Rhein auf dem flachen Boot, das an einer am Flussgrund verankerten Stahltrosse befestigt war. Diese wurde von einer Reihe mehrerer kleiner Boote an der Oberfläche gehalten. Auf diese Weise machte sich der Fährmann, der am Heck mit einem Steuerruder den Kurs korrigierte, den Druck des strömenden Wassers zunutze, um Passagiere und Lasten zum anderen Ufer zu befördern.
»Mama, fliegen wir jetzt los?«, fragte Paul aufgeregt, als sie ablegten, und zupfte an Claras Ärmel.
»Fliegen? Aber nein, wie kommst du denn darauf?«, entgegnete Clara und sah ihren Sohn überrascht an.
»Der Lehrer hat gesagt, dass das hier eine fliegende Brücke ist.«
Paul sah unsicher zu ihr auf. Es war ihm sichtlich unangenehm, dass der Lehrer etwas behauptete, von dem seine Mutter nichts wusste.
Clara stutzte und lachte auf. »Ach so, jetzt verstehe ich. Man nennt solche Seilfähren fliegende Brücken, weil sie sozusagen übers Wasser fliegen, ohne ein Segel oder einen Motor zu benötigen. Aber sich wie ein Vogel in die Luft schwingen, das können sie nicht.«
Paul schob die Unterlippe vor. »Schade. Ich wär so gern geflogen.«
Clara streichelte seine Wange. »Ich bin mir sicher, dass du das eines Tages tun wirst. Die Leute erfinden ständig die unglaublichsten Maschinen. Es dauert gewiss nicht mehr lange, bis sie ein Fluggerät bauen. In Berlin gibt es einen Mann, der Segelapparate konstruiert. Lilienthal heißt er, glaube ich.«
Pauls Augen leuchteten auf. »Oh ja! Der Mann, der sich Flügel gebaut hat. Papa hat mir Bilder davon gezeigt. Er hat versprochen, mir ein kleines Modell zu basteln. Wenn er mal Zeit hat.« Er ließ die Schultern hängen und fügte leise hinzu: »Er hat aber nie Zeit. Er hat immer sooo viel zu tun.«
»Das stimmt«, sagte Clara. »Vor unserer Abreise muss er noch einiges erledigen. Aber wenn wir erst einmal auf dem Dampfer sind, wird er mehr Zeit für dich haben. Wir werden nämlich viele Wochen unterwegs sein. Und während der Fahrt muss dein Vater nicht arbeiten.«
Mittlerweile hatte die Fähre das andere Ufer erreicht. Clara nahm Paul bei der Hand und lief mit ihm zur Hauptstraße, die sich durch Vilich zog. Paul zeigte auf einen stattlichen Kirchturm mit einem Helmdach, der in einiger Entfernung linker Hand von ihnen lag.
»Gehen wir dorthin?«, fragte er.
»Zur Pfarrkirche Sankt Peter? Nein, das hatte ich eigentlich nicht vor«, antwortete Clara. »Warum fragst du?«
»Da war ich schon mal mit Papa. In der Nähe ist eine alte Wasserburg. Die haben wir uns angesehen. Und danach sind wir auf einen großen Platz gelaufen. Da gab es ein Karussell. Und ein Puppentheater. Und Papa hat mir gebrannte Mandeln gekauft.«
»Du meinst Pützchens Markt. Dass du das noch weißt«, sagte Clara und zog die Augenbrauen hoch. »Das ist fast ein Jahr her.«
Paul hüpfte neben ihr auf und ab. »Darf ich wieder mit dem Karussell fahren?«
Clara schalt sich innerlich, dass sie nicht auf die Idee gekommen war, Paul könnte sich erinnnern. Nun würde sie ihn enttäuschen müssen. Sie fand es immer wieder erstaunlich, wie genau er sich Dinge merkte, die er mit Olaf unternommen hatte. Vermutlich, weil es stets etwas Besonderes für ihn war, wenn sich sein Vater ihm widmete.
»Es tut mir leid, aber der Jahrmarkt findet erst Anfang September statt. Da sind wir schon längst auf Samoa.«
»Gibt es da auch so einen Jahrmarkt?«
»Hm, also, äh … nein, ich glaube nicht«, antwortete Clara und schob rasch nach: »Aber wir werden dort einen großen Garten haben mit Palmenbäumen. Da hängen wir dir eine Schaukel auf.«
Clara war froh, ihrem Sohn die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches in Aussicht stellen zu können.
»Au ja!«, rief Paul und strahlte sie an.
Schweigend setzten sie ihren Weg fort. Paul summte eine Melodie vor sich hin, Clara ging im Stillen die Dinge durch, die sie vor ihrer Abreise noch erledigen musste. Je näher diese rückte, desto unwirklicher kam ihr der Gedanke vor, in vierzehn Tagen ihrer Heimat den Rücken zu kehren. Sie hatte die Rheinprovinz noch nie verlassen. Bevor sie Olaf kennengelernt hatte, war ein Ausflug mit der Schulklasse nach Köln die weiteste Fahrt gewesen, die sie je unternommen hatte. Auch mit ihrem Mann war sie nie verreist. Das Gehalt des jungen Anwalts hatte ihnen ein gutes Auskommen und ein schönes Heim gesichert – für sommerliche Aufenthalte in einem der beliebten Seebäder oder gar einen Urlaub im Ausland reichte es nicht. Als Hochzeitsgeschenk hatte Professor Dahlmann ihnen eine Dampferfahrt rheinaufwärts nach Bingen spendiert, wo sie eine Nacht in einem Gasthof verbrachten, bevor es am nächsten Tag mit der Eisenbahn zurückging. Seither hatte Clara jede Nacht im eigenen Bett geschlafen.
Ob sie Bonn wohl jemals wiedersähe? Selbst wenn Olaf nach einigen Jahren einen anderen Posten annehmen und Samoa wieder verlassen würde, war es unwahrscheinlich, dass er mit seiner Familie in dieses Städtchen zurückkehrte. Für einen ehrgeizigen Juristen gab es interessantere Orte, an denen er seine Karriere vorantreiben konnte. Und je weiter diese von seinem Herkunftsland entfernt waren, desto anziehender waren sie für Olaf.
Clara hatte sich nie getraut, in ihn zu dringen, was in Norwegen vorgefallen war. Die Mischung aus Schmerz und Wut, mit der er sie angesehen hatte, als sie sich kurz vor der Trauung nach seiner Familie erkundigte, hatte sie zum Schweigen gebracht. Sie hatte das Thema nie wieder angeschnitten und sich die Frage verkniffen, ob sie seinen Eltern nicht wenigstens ein Bild von ihnen als Brautpaar schicken und sie über die Hochzeit ihres Sohnes informieren sollten. Ihre Enttäuschung über ihren geplatzten Traum hatte sie für sich behalten. Sie hatte sich so sehr danach gesehnt, durch die Ehe Teil einer richtigen Familie zu werden – selbst wenn diese weit entfernt in einem anderen Land lebte.
Mittlerweile hatten sie die Hauptstraße verlassen und die Gleise der rechtsrheinischen Eisenbahn überquert. Nun liefen sie auf der Hardtstraße nach Pützchen, dem Ziel ihres Ausflugs. Die zwei- bis dreistöckigen Gebäude des Vilicher Ortskerns wurden von kleineren Wohnhäusern abgelöst, die inmitten großer Gärten zu beiden Seiten der Straße lagen. Der Himmel spannte sich wolkenlos über ihnen, Bienen summten in blühenden Obstbäumen und Blumenbeeten, und der süße, an Vanille erinnernde Duft frisch gemähten Grases lag in der Luft. Es waren nur wenige Fußgänger unterwegs, ab und zu rumpelte ein Pferdefuhrwerk vorbei, und eine Schar Spatzen, die sich um eine Brotrinde zankte, stob zeternd davon, als sie sich näherten. Nach einer guten Viertelstunde bogen sie auf den Adelheidisplatz ab, an dessen oberem Ende sich ein quadratischer Gebäudekomplex befand, dessen Flanke zur Straße hin von einer großen Kirche eingenommen wurde.
»So, da wären wir«, sagte Clara.
Paul folgte ihrem Blick und meinte: »Sie sieht ganz neu aus.«
»Das ist sie auch. Die alte Kirche ist zusammen mit dem ehemaligen Kloster vor ein paar Jahren abgebrannt. Danach hat man sie wieder aufgebaut.«
»Gehen wir hinein?«, fragte Paul.
»Nein, mein Schatz. Ich möchte dir etwas anderes zeigen«, antwortete Clara.
Sie hielt auf eine Öffnung in der Mauer zu, die das Gelände umgab, und lief in einen abgelegenen Teil des Grundstücks.
»Als ich ungefähr so alt war wie du, hat mich Schwester Gerlinde zum ersten Mal hierher mitgenommen«, sagte Clara und deutete auf eine kleine Kapelle in der Mauer.
Davor stand ein großes Kreuz aus dunklem vulkanischem Gestein. Im Sockel steckte ein kleines Rohr, aus dem Wasser in ein Becken floss.
»Das ist der Adelheidisbrunnen«, erklärte Clara. »Adelheid war eine Heilige, die vor vielen hundert Jahren hier gelebt und viel Gutes getan hat. Kennst du ihre Geschichte?«
Paul schüttelte den Kopf und sagte zögernd: »Der Lehrer hat gesagt, dass Cassius und Florentius die Heiligen von Bonn sind.«
»Ja, vollkommen richtig. Das sind die Schutzpatrone der Stadt.«
Paul legte seine Stirn in Falten. »Ich verstehe das nicht. Wie können sie die Stadt beschützen, wenn sie sich selber nicht schützen konnten?«
»Was meinst du?«, fragte Clara.
»Sie wurden doch von einem bösen Mann getötet, weil sie ihm nicht gehorcht haben.«
Clara nickte. »Genau. Das war der römische Kaiser Maximian. Er war Heide und hat ihnen befohlen, Christen zu verfolgen, weil…«, sie unterbrach sich. »Weißt du, was ein Heide ist?«
»Ja, Heiden hassen Jesus und kommen in die Hölle«, antwortete Paul.
Clara lächelte über diese knappe Definition und fuhr fort: »Ich glaube, dieser Kaiser hat sich vor allem darüber geärgert, dass die Christen, also die Menschen, die an Jesus glauben, ihn nicht als Gott verehrt haben. Und deshalb hat er sie verfolgt. Und als Cassius und Florentius ihm nicht dabei helfen wollten, hat er sie töten lassen.«
»Aber wieso haben sie sich denn nicht gewehrt?«, fragte Paul. »Sie waren doch Soldaten und hatten Waffen. Warum haben sie nicht gekämpft?«
Er verstummte und sah Clara ratlos an. Sie erwiderte seinen Blick und suchte nach einer Antwort. Wie erklärte man einem Kind, was ein Märtyrer war? Und warum manche Menschen bereit waren, für ihren Glauben zu sterben?
»Du weißt doch, dass man Versprechen halten muss«, begann sie langsam.
Paul nickte.
»Cassius und Florentius hatten Jesus versprochen, dass sie ihn und ihren Glauben an ihn nie verraten würden. Aber genau das hat dieser böse Kaiser von ihnen verlangt. Um ihre Treue zu Jesus zu beweisen, haben sie sich lieber töten lassen, als ihren Eid zu brechen.«
Pauls Miene erhellte sich. »So wie bei den Soldaten. Die schwören dem Kaiser Wilhelm, dass sie ihm immer treu dienen und alles tun, damit ihm nichts Schlimmes passiert. Das hat mir Karli erzählt. Sein älterer Bruder wird bald Soldat und hat den Eid auswendig gelernt, damit er ihn nicht falsch aufsagt.«
Zu Claras Erleichterung war Paul mit dieser Erklärung zufrieden.
»Erzählst du mir jetzt die Geschichte von Adelheid? Wurde sie auch getötet, weil sie an Jesus geglaubt hat?«, fragte er und zeigte auf die Kapelle.
»Nein, sie ist ganz friedlich gestorben. Sie war Äbtissin, also die oberste Nonne in einem Kloster, und hat sich viel um die Armen gekümmert. Man erzählt sich, dass sie hier an dieser Stelle ein Wunder bewirkt hat.«
»Ein Wunder?«
Pauls Augen weiteten sich. Er hing förmlich an Claras Lippen.
»Damals wurde die Gegend von einer furchtbaren Dürre heimgesucht. Es regnete monatelang nicht, die Felder der Bauern vertrockneten, und das Vieh verdurstete. Die verzweifelten Menschen flehten Adelheid an, ihnen zu helfen. Sie betete und stieß ihren Stab in die Erde – hier, an dieser Stelle. Und siehe da, ein Wasserstrahl schoss aus dem Boden und…«
»Und die Menschen konnten ihre Felder gießen und den Tieren zu trinken geben«, beendete Paul den Satz und klatschte in die Hände.
»Seither heißt der Ort Pützchen«, sagte Clara. »Das stammt von dem lateinischen Wort puteus und bedeutet Brunnen oder Wasserquelle.« Sie griff nach Pauls Hand. »Und jetzt sagen wir Adelheid Guten Tag.«
Sie lächelte zu ihm hinunter und sah sich selbst vor knapp zwanzig Jahren neben der vom Alter gebeugten Schwester Gerlinde herlaufen, die ihr mit fast denselben Worten von der Heiligen erzählt hatte. Als Clara damals wissen wollte, ob solche Wunder auch heute noch passierten, hatte die Ordensschwester ihr zugezwinkert.
»Wer weiß. Ich möchte gewiss nicht leugnen, dass es göttliche Wunder gibt. Aber Adelheid war eine sehr gebildete und kluge Frau. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie nicht zufällig ausgerechnet am Fuße des Ennert nach Wasser gesucht hat. Der Boden ist hier nämlich sehr lehmig, also wasserundurchlässig. Vielleicht hat Adelheid geahnt, dass sich das Wasser, das unterirdisch von den Hängen des Ennerts herabströmt, über dieser Tonschicht sammelt.«
Diese Vermutung hatte Clara in einen Zwiespalt gestürzt. Einerseits war sie ernüchtert über die Entzauberung des Wunders, andererseits imponierte ihr die Klugheit von Adelheid. Im Lauf der folgenden Jahre überwog dieser Aspekt. Die Äbtissin wurde Claras Vorbild. Adelheid hatte nicht nur Kranke gepflegt, den Mädchen in der Stiftschule Unterricht gegeben und zwei Klöster verwaltet, sondern auch stets ein offenes Ohr für alle gehabt, die sich mit ihren Sorgen und Nöten an sie wandten.
Clara erkor sie zu ihrer persönlichen Schutzpatronin, mit der sie innere Zwiesprache hielt, wenn sie nicht weiterwusste. In ihrer kindlichen Fantasie verschmolz das Bild der mittelalterlichen Nonne mit dem von Schwester Gerlinde, die wenige Monate nach ihrem Ausflug nach Pützchen gestorben war.
Sooft es ihr möglich war, suchte Clara die Adelheidiskapelle auf. An diesem Ort hatte sie das Gefühl, der geliebten Toten nahe zu sein – sehr viel mehr als in der Wallfahrtskirche oder gar der großen Kirche von Sankt Peter, in der der Sarkophag der Heiligen stand. Nur im September, wenn während des Jahrmarkts die Gläubigen zu Hunderten zum Adelheidisbrunnen pilgerten, dessen Wasser Heilkräfte gegen Augenleiden nachgesagt wurde, mied sie den Kirchhof. Auch wenn sie sich eingestehen musste, dass es unchristlich war und sie die tadelnde Stimme von Schwester Gerlinde zu hören meinte, mit der diese ihre Schützlinge bei selbstsüchtigen Anwandlungen zurechtgewiesen und sie zu Großzügigkeit und tätiger Nächstenliebe angehalten hatte: Clara wollte »ihre« Heilige nicht mit Fremden teilen.
An diesem Tag mitten unter der Woche hatten sie und Paul die Kapelle für sich allein. Durch die Seitenfenster strömte Sonnenlicht und tauchte den kleinen Raum in ein warmes Gelb. Clara benetzte ihre Finger mit dem Weihwasser in einem Schälchen neben der Tür, bekreuzigte sich und beugte ein Knie vor dem Altar. Paul sah ihr aufmerksam zu und tat es ihr nach. Gemeinsam traten sie vor die Figur der Heiligen, die in einer Nische über dem Altartisch auf ihren Äbtissinenstab gestützt stand und mit mildem Lächeln auf einen Teller mit einem kleinen Brotlaib blickte, den sie in der anderen Hand hielt.
»Sie sieht freundlich aus«, flüsterte Paul nach kurzem Schweigen. »Hat sie das Brot selbst gebacken?«
»Ich glaube nicht. Dazu hatte sie zu viel anderes zu tun. Aber sie und ihre Nonnen haben es den Armen gegeben. Noch heute wird Adelheidisbrot zu ihrem Andenken gebacken und an die Wallfahrer verteilt, die hierherkommen.«
»Darf ich eine Kerze anzünden?«, fragte Paul und deutete auf einen Ständer, in den man dünne Opferkerzen stecken konnte.
»Natürlich«, sagte Clara. »Das wollte ich auch gerade vorschlagen.«
Sie steckte ein paar Münzen in den Opferstock und ließ Paul zwei Kerzen nebeneinander aufstellen. Ihre Hand zitterte ein wenig, als sie sie anzündete.
»Mama? Bist du traurig?«, fragte Paul und sah ihr aufmerksam ins Gesicht.
»Ein bisschen«, murmelte Clara.
Paul nahm ihre Hand. »Wir können doch ein Bild von Adelheid mit nach Samoa nehmen. Dann ist sie immer bei dir, auch wenn du sie hier nicht besuchen kannst.«
Clara legte einen Arm um seine Schultern und zog ihn an sich. Tiefe Dankbarkeit erfüllte sie. Es war einer dieser Momente, in denen sie es kaum fassen konnte, mit einem so einfühlsamen und liebevollen Kind beschenkt worden zu sein.
Sie sah zu der Statue und betete stumm: Ich werde alles tun, damit Paul glücklich wird. Halte deine Hand über ihn, und gib mir die Kraft, ihn vor Gefahren und Unbill zu schützen. Darum bitte ich dich von Herzen. Amen.
Claras Hals wurde eng. Erst in diesem Augenblick wurde der Abschied, der ihr bevorstand, wirklich spürbar. Sie würde die Erinnerung an Schwester Gerlinde in ihrem Herzen überallhin mitnehmen ebenso wie die tiefe Verbundenheit zur heiligen Adelheid. Diese unscheinbare Kapelle, die ihr wie kein anderer Ort das Gefühl von Geborgenheit vermittelte, würde ihr dennoch fehlen. Die Vorstellung, zum letzten Mal hier zu stehen, ließ ihre Augen feucht werden.
4
Røros, Mai 1895 – Sofie
Unter dem Geläut der Glocken versammelte sich die Trauergemeinde an der Mauer im unteren Teil des Friedhofs, der den betuchten und angesehenen Bürgern der Stadt vorbehalten war. Auch nach dem Tod blieben die Angehörigen ihrer jeweiligen Schicht unter sich: die Reichen wenige Schritte vom Portal der Kirche entfernt, die Ärmeren oberhalb des eigentlichen Kirchhofs auf einer mit Birken bestandenen Wiese.