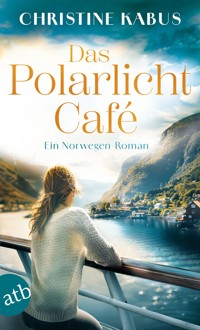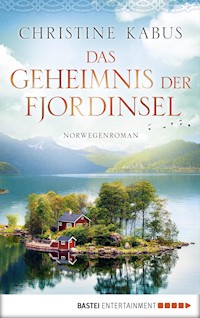6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Frauen, eine atemberaubende Landschaft und ein dunkles Geheimnis, das hundert Jahre unter dem Eis verborgen lag ...
Spitzbergen, 2013. Um für eine Reisereportage zu recherchieren, begibt sich die Journalistin Hanna auf den einsamen Archipel jenseits des Polarkreises. Dort lernt sie den Polarforscher Kåre Nybol kennen. Gemeinsam erkunden sie die einzigartige Landschaft Spitzbergens und kommen sich dabei allmählich näher. Doch als sie eine längst verlassene Bergbausiedlung am Kongsfjord besichtigen, macht Hanna im geschmolzenen Gletschereis einen grausigen Fund. Zusammen mit Kåre taucht sie tief in die Vergangenheit des entlegenen Archipels ein ...
Ruhrgebiet, 1907. Statt dem Wunsch ihrer Eltern zu folgen und sich einen Ehemann zu suchen, schließt die burschikose Emilie einen Pakt mit ihrem jüngeren Bruder Max: Sie wird an seiner Stelle an der geplanten Arktisexpedition teilnehmen - verkleidet als Mann. Doch schon bald ahnt sie, dass sie nicht die einzige ist, die etwas zu verbergen hat. Mindestens einer der Männer hütet ein dunkles Geheimnis, dessen Aufdeckung er um jeden Preis zu verhindern sucht ...
Eine abenteuerliche Reise durch die herrliche Landschaft Spitzbergens - begleitet von großen Gefühlen und dunklen Geheimnissen.
"Ein wunderschönes Lesevergnügen." Frankfurter Stadtkurier
Weitere Norwegen-Romane von Christine Kabus: Töchter des Nordlichts. Das Lied des Nordwinds. Das Geheimnis der Fjordinsel. Das Geheimnis der Mittsommernacht. Im Land der weiten Fjorde.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 790
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Norwegen-Romane der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Zitate
Personen
Karten
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Danke
Fußnote
Weitere Norwegen-Romane der Autorin
Das Lied des Nordwinds
Töchter des Nordlichts
Das Geheimnis der Mittsommernacht
Im Land der weiten Fjorde
Das Geheimnis der Fjordinsel
Über dieses Buch
Zwei Frauen, eine atemberaubende Landschaft und ein dunkles Geheimnis, das hundert Jahre unter dem Eis verborgen lag …
Spitzbergen, 2013. Um für eine Reisereportage zu recherchieren, begibt sich die Journalistin Hanna auf den einsamen Archipel jenseits des Polarkreises. Dort lernt sie den Polarforscher Kåre Nybol kennen. Gemeinsam erkunden sie die einzigartige Landschaft Spitzbergens und kommen sich dabei allmählich näher. Doch als sie eine längst verlassene Bergbausiedlung am Kongsfjord besichtigen, macht Hanna im geschmolzenen Gletschereis einen grausigen Fund. Zusammen mit Kåre taucht sie tief in die Vergangenheit des entlegenen Archipels ein …
Ruhrgebiet, 1907. Statt dem Wunsch ihrer Eltern zu folgen und sich einen Ehemann zu suchen, schließt die burschikose Emilie einen Pakt mit ihrem jüngeren Bruder Max: Sie wird an seiner Stelle an der geplanten Arktisexpedition teilnehmen – verkleidet als Mann. Doch schon bald ahnt sie, dass sie nicht die einzige ist, die etwas zu verbergen hat. Mindestens einer der Männer hütet ein dunkles Geheimnis, dessen Aufdeckung er um jeden Preis zu verhindern sucht …
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Christine Kabus, 1964 in Würzburg geboren, arbeitete nach ihrem Studium der Germanistik und Geschichte als Dramaturgin und Lektorin bei verschiedenen Film- und Theaterproduktionen, bevor sie sich 2003 als Drehbuchautorin selbstständig machte. Schon als Kind faszinierte sie der hohe Norden. Vor allem die ursprüngliche, mythische Landschaft Norwegens beflügelte ihre Phantasie. Sie begann, die Sprache zu lernen und sich intensiv mit der Geschichte Norwegens zu beschäftigen – auch mit den dunklen Seiten wie in »Töchter des Nordlichts«. Insgesamt liegen bei Bastei Lübbe sechs Norwegen-Romane von Christine Kabus vor.
CHRISTINE KABUS
INSELDER BLAUENGLETSCHER
Norwegen-Roman
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2015/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Ulrike Brandt-Schwarze, Bonn
Covergestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign unter Verwendung von Motiven von © shutterstock/BMJ; © shutterstock/Rigamondis
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-1626-0
be-ebooks.de
lesejury.de
Für Traute
»Eigentlich sollte ein Jahr in der Arktis für jedermannobligatorisch sein! Dort würde jeder erfahren,was in der Welt wichtig ist und was nicht.Was zählt und worauf es im Leben ankommt.Jeder würde auf sein natürliches Maß reduziert werden!«
(Christiane Ritter, Autorin von Eine Frau erlebt die Polarnacht, 1938)
»Selbst einem gottbegnadeten Dichter fehlen die Worte,diese Natur zu schildern. Denn über dem Ganzen ruht etwas,was sich durch die Sprache nicht vermitteln läßt.«
(aus: Adolf Miethe, Mit Zeppelin nach Spitzbergen, 1911)
Personen
1907
FAMILIE BERGHOFF
Gustav Berghoff (59) ∞Irmhild (48) geb. Hardenrath
Emilie (21)
Friedrich (26) verheiratet mit Klothilde (23)
Maximilian (Max) (19)
Tante Franziska (Fanny) (52), geb. Hardenrath ∞ Adrian (Addy) von Spilow (55)
Großmutter Hedwig Hardenrath (73)
TEILNEHMERDER SPITZBERGEN-EXPEDITION
Beat Späni (50), Geologe aus Basel
Antonio Lancetta (40), Meteorologe aus Bologna
William Lewis (25), Ornithologe aus Newcastle
Leonid (52), ein schweigsamer Russe
Ottokar Poske (30), ein deutscher Leutnant Feldwebel Kuhn (45)
Arne Koldvik (27), Trapper auf Spitzbergen
2013
FAMILIE KELLER
Hanna (45), geb. Vogel, Reisereporterin
Mia (20), ihre Tochter, Studentin
Lukas (18), ihr Sohn, Abiturient
Thorsten (48), ihr Ehemann, Manager
Kåre Nybol (54), Polarforscher
Leif (60) und Line (58), Geobiologen; ihr Sohn Bengt (30), Meteorologe und Pilot
Prolog
Der Vorhang hob sich und gab den Blick frei auf mehrere Paare, die zu den Klängen eines Walzers unter einem riesigen Kristallkronleuchter tanzten. Dem Bühnenbildner war es gelungen, mit sparsamsten Mitteln die festliche Stimmung eines Ballsaals des Fin de Siècle heraufzubeschwören. Im warmen, an Kerzenschein erinnernden Licht leuchteten goldfarbene Wandverzierungen und die Kordeln der schweren Samtvorhänge, die die großen Fenster im Hintergrund einrahmten. Die Tänzer trugen Fräcke und Zylinder, ihre Partnerinnen stark taillierte Kleider, lange Handschuhe und mit Federn und Blumen verzierte Hüte auf hochtoupierten Frisuren. Fasziniert betrachtete Hanna, die im ersten Rang des Nürnberger Staatstheaters saß, die eleganten Bewegungen, schwerelosen Sprünge und Pirouetten der Paare, die den Boden kaum zu berühren schienen.
Nach einer Weile mischten sich die Schläge eines Metronoms in die Musik, was den abgezirkelten Schrittfolgen eine statische Note verlieh und in Hanna ein vages Gefühl der Beklemmung hervorrief. Auch eine Tänzerin in einem hellblauen Kleid schien genug von der zeremoniellen Choreografie zu haben, denn sie löste sich von ihrem Partner, befreite sich von Hut und Handschuhen, öffnete ihren Dutt und schüttelte ihre langen Locken. Anmutig schwebte sie auf den Zehenspitzen kreuz und quer durch den Raum, versuchte hüpfend die geschliffenen Glasscheiben des Leuchters zu berühren und imitierte neckend das förmliche Gebaren der anderen Tänzer.
Die Bühne drehte sich, und der Platz vor dem Gebäude mit dem Ballsaal war zu sehen. Hinter hell erleuchteten Fenstern zeichneten sich wie Schattenrisse die Silhouetten der tanzenden Paare ab. Die Szenerie davor war in ein dämmriges Blau getaucht. In die spätromantische Musik, die gedämpft aus dem Festsaal drang, mischten sich expressionistische Klänge und eigenwillige Rhythmen. Ein zierlicher Tänzer in einem eng anliegenden dunklen Trikot und einer Kappe, die seine Haare verbarg, erschien. Er wirbelte so intensiv und dynamisch umher, dass Hanna sich unwillkürlich straffte und aufrecht auf der Kante ihres Sessels sitzend seine ausdrucksstarken Bewegungen und raumgreifenden Sprünge verfolgte. Er strahlte eine Lebensfreude und Sinnlichkeit aus, die sie in ihren Bann zogen und eine Sehnsucht in ihr erweckten, die sie nicht in Worte fassen konnte.
Erneut drehte sich die Bühne – zurück zum Ball, wo die Paare nun zu einem Gesellschaftstanz Aufstellung genommen hatten. Der warme Lichtton war einem fast unerträglichen Gleißen gewichen, das jeden Winkel erhellte. Wieder büxte die lockige Tänzerin aus, doch dieses Mal wurde sie von ihrem Partner eingefangen und an ihren Platz zurückgezwungen. Auch die anderen Tänzer achteten nun darauf, dass sie sich nicht aus der Reihe entfernte. Die zunehmende Panik, mit der sie sich freikämpfen und zu den Fenstern fliehen wollte, ging Hanna ans Herz. Sie musste an die Amsel denken, die sich einmal in ihr Schlafzimmer verirrt hatte und auf der Suche nach einem Ausweg aufgeregt herumgeflattert war, bis es Hanna endlich gelang, sie zum offenen Fenster zu dirigieren.
Während Hanna noch mit der Tänzerin litt und ihr das Gelingen ihrer Flucht wünschte, wendete sich die Bühne wieder zum blauen Platz, auf dem sich die Stimmung ebenfalls änderte. Das Licht wurde kälter und erzeugte eine unwirtliche, bedrohliche Atmosphäre. Der zierliche Tänzer wirkte zunehmend verloren und schutzlos. Dissonante Töne und abrupte Tempiwechsel verstärkten diesen Eindruck und sorgten dafür, dass sich Hannas Herzschlag beschleunigte. Die Einsamkeit des Tänzers, der immer wieder sehnsüchtige Blicke in den Ballsaal warf, rührte sie unmittelbar an.
Wieder drehte sich die Bühne zurück ins Innere des Gebäudes. Auf dem Fest hatten die Paare aufgehört zu tanzen und sich wie eine Mauer vor die Fenster gestellt, um die lockige Ballerina von ihnen fernzuhalten. Wie bei einem Spießrutenlauf trieben sie sie einander in die Arme.
Ein letzter Szenenwechsel führte auf den Platz, auf dem der Tänzer der Ballerina zu Hilfe kommen wollte und begann, die Hausfassade zu erklimmen. Sie war zu glatt. Er rutschte ab, ging zu Boden, rappelte sich wieder auf und versuchte mit immer waghalsigeren Sprüngen, die Fenstersimse zu erreichen. Mit angehaltenem Atem verfolgte Hanna seine wachsende Verzweiflung, die sie körperlich nachempfand.
Schließlich griff er nach einem großen Stein und warf ihn in eine Scheibe. Es klirrte. Die Bühne wurde schlagartig dunkel. Die Musik setzte ein paar Takte lang aus. Auch im Zuschauerraum herrschte atemlose Stille.
Zaghaft fragend erklang eine Violine. Ein Lichtkegel glomm auf, irrte suchend über den Boden und verharrte auf einem hellblauen Kleid. Der zierliche Tänzer eilte aus dem Dunkel herbei und hob es auf, drückte es an seine Brust und drehte sich mit glücklichem Lächeln um sich selbst. Das Orchester setzte ein, eine Melodie voll lyrischer Poesie schwoll an. Der Tänzer fand zu seinen kraftvollen Bewegungen zurück. Immer schneller wirbelte er um seine Achse und riss sich schließlich mit einem triumphierenden Lachen die Kappe vom Kopf. Lange Locken wallten über seinen Rücken.
Hanna sog scharf die Luft ein und blinzelte verdutzt. Erst in diesem Augenblick begriff sie, dass die beiden Rollen von ein und derselben Ballerina getanzt worden waren. Noch ganz benommen von der aufwühlenden Darbietung fiel sie in den aufbrandenden Applaus ein, in den sich viele Bravo-Rufe mischten.
1
Elberfeld, Mai 1907
Das erste Ständchen an ihrem einundzwanzigsten Geburtstag bekam Emilie frühmorgens von der Mönchsgrasmücke, die ihr Nest auch in diesem Jahr wieder in der Fliederbuschlaube hinterm Haus gebaut hatte. Sie öffnete die Augen und lauschte ein paar Atemzüge lang der fröhlichen Melodie, die von den Glockenschlägen einer Kirche unten in der Nordstadt untermalt wurde. Sechs Uhr. Emilie schlug die Daunendecke zurück und schwang die Beine über den Bettrand. Mit zwei Schritten war sie am Fenster, zog die schweren Samtvorhänge zurück und beugte sich hinaus.
Der Garten unter ihr lag noch im Dämmer, während die aufgehende Sonne den Himmel erhellte und die Knospen an den oberen Ästen des Magnolienbaums, der inmitten eines Rasenrondells wuchs, rosig aufleuchten ließ. Über Nacht hatte es geregnet. In der kühlen Luft lag der Geruch nasser Erde, in den sich ein Hauch von Fliederduft und das würzige Raucharoma eines Holzfeuers mischten, das vermutlich gerade vom Küchenmädchen angeschürt worden war.
Emilie wandte sich vom Fenster ab, zog das Nachthemd aus, streifte sich das Hauskleid aus hellgrauem Kattun über, das sie sich vor dem Schlafengehen zurechtgelegt hatte, und schlüpfte in ein Paar ausgetretene Halbschuhe. Die Morgentoilette musste warten. Sie fuhr sich mit beiden Händen durch die dunkelbraunen Haare, die ihr bis zur Mitte des Rückens reichten, und band sie mit einer Schleife zu einem lockeren Pferdeschwanz. Auf dem Weg zur Tür warf sie einen flüchtigen Blick in den Spiegel der Frisierkommode, die an der Wand gegenüber dem Bett stand. Wie alle Möbel in ihrem Zimmer war sie weiß gestrichen und mit einem blassblauen Blumenmuster verziert – ein Dekor, das sie vor zehn Jahren wunderschön gefunden hatte. Ebenso wie die mit Schmetterlingen bemalte Tapete, mit der auch die Zimmer in dem Puppenhaus beklebt waren, das in einer Ecke stand und samt seinen kleinen Bewohnern seit Jahren vergeblich darauf wartete, dass jemand mit ihm spielte.
Für eine junge Frau, die an diesem Tag volljährig wurde, war die Einrichtung entschieden zu kindlich. Emilies Vater, dem sie deswegen seit Wochen in den Ohren lag, war derselben Meinung. Eine angemessene Neumöblierung wollte er allerdings nicht in Angriff nehmen. Wenn es nach Gustav Berghoff ginge, würde seine Tochter in Kürze heiraten, selbst einen Hausstand gründen und ausreichend Gelegenheit haben, sich nach ihrem Geschmack einzurichten.
Emilie zog bei dem Gedanken die Brauen zusammen, die sich zum Leidwesen ihrer Mutter nicht in feinen Bögen wölbten, sondern gerade und buschig über den Augen wuchsen. Auch die roten Wangen, die ebenmäßigen, ein wenig kantigen Gesichtszüge und die sportlich-muskulöse Statur Emilies entsprachen nicht gerade dem Idealbild einer höheren Tochter, das Irmhild Berghoff vorschwebte: einem anmutigen Geschöpf mit zierlicher Figur, herzförmigem Gesichtchen und blassem Teint. Einzig die seelenvollen Augen, die goldbraun schimmerten, und die dichten, glänzenden Haare versöhnten die Mutter mit dem Aussehen ihrer Tochter. Emilie streckte ihrem Spiegelbild die Zunge heraus, griff nach einem wollenen Schultertuch, öffnete vorsichtig die Tür und schaute in den Gang.
Zu dieser frühen Stunde herrschte in der ersten Etage der Berghoffschen Villa Ruhe. Ihr Vater, dessen Schlafzimmer am Ende des Flurs lag, würde gegen sieben Uhr aufstehen und sich nach einem kurzen Frühstück direkt in seine Fabrik kutschieren lassen. Mit ihrer Mutter war nicht vor neun Uhr zu rechnen. Emilie war dennoch auf der Hut. Es brauchte niemand zu wissen, dass sie nicht in ihrem Bett lag. Sie huschte zur Treppe, die in einem Halbbogen an einer Wand entlang nach unten in die Halle führte, und hielt am unteren Absatz inne, um erneut zu lauschen. Leises Geklapper aus dem Haushaltstrakt rechts neben der Eingangstür verriet ihr, dass die Vorbereitungen für das Frühstück im Gange waren. Der Duft frisch gemahlenen Bohnenkaffees stieg ihr in die Nase. Einen Moment lang war sie versucht, sich in der Küche eine Tasse zu genehmigen und sich von Else, der Köchin, eine dicke Scheibe Blatz, Hefezopf mit Rosinen, geben zu lassen. Nein, besser nicht. Die Gefahr, dabei dem Kammerdiener ihres Vaters oder – schlimmer noch – der Zofe ihrer Mutter zu begegnen, war zu groß. Während Else und das Küchenmädchen dichthalten und der Herrschaft nichts vom morgendlichen Ausflug des gnädigen Fräuleins verraten würden, war Emilies Geheimnis bei den beiden anderen nicht gut aufgehoben. Zumindest die Kammerfrau würde es sich nicht nehmen lassen, Irmhild Berghoff die neueste Eskapade ihrer unbotmäßigen Tochter zusammen mit dem Frühstück, das sie ihr unter der Woche ans Bett brachte, brühwarm zu servieren – begleitet von Naserümpfen und missbilligendem Kopfschütteln. Ihre Vorstellung, wie sich eine junge Dame aus besseren Kreisen zu verhalten habe, war noch strenger und dünkelhafter als die ihrer Arbeitgeberin.
Emilie durchquerte die Halle und öffnete die Tür zum Raucherkabinett, dessen Fenster wie die des benachbarten Speisezimmers zum Garten hinausging, während der große Salon zur Straßenseite hin gelegen war. Die Bibliothek, wie ihre Mutter das kleine Zimmer mit den holzvertäfelten Wänden gern nannte – wegen des Regals mit Klassikern der deutschen Literatur, die dort ihr unbeachtetes Dasein fristeten –, wurde selten genutzt. Seiner eigentlichen Bestimmung diente dieser Raum nur an Abenden, an denen die Berghoffs Gäste hatten. Aus Rücksicht auf seine Frau, der der Geruch kalten Zigarrenrauchs Kopfschmerzen bescherte, genoss Gustav seine Havannas außer Haus – in seinem Büro am Ende eines langen Arbeitstages oder bei Gesprächen mit Geschäftsleuten, die er gern im Restaurant vom Hotel Kaiserhof führte, der ersten Adresse Elberfelds, einer prosperierenden Industriemetropole im Bergischen Land. Emilie war die Einzige, die die Bibliothek regelmäßig aufsuchte. Nicht, weil sie eine ausgesprochene Leseratte gewesen wäre. Sondern wegen des Schiebefensters, das ihr bereits als Kind die unbemerkte Flucht in den Garten und den angrenzenden Park ermöglicht hatte.
Bevor sie nach draußen kletterte, umrundete Emilie die Ledersessel in der Mitte des Raums, um zu dem Vitrinenschrank zu gelangen, der dem Regal gegenüber an einer Wand stand. Hinter den blank geputzten Scheiben der oberen Hälfte funkelten geschliffene Gläser und Karaffen, in denen der Hausherr seinen Gästen nach festlichen Diners Portwein, Sherry oder Cognac servieren ließ. Emilie zog eine Schublade im Unterschrank auf und entnahm einer Holzkiste eine dicke Zigarre, die sie in die Tasche ihres Kleides steckte. Einen Augenblick später rannte sie durch den Garten zu den Rhododendronbüschen, die im hinteren Teil wuchsen. Sie bog ein paar Zweige beiseite und schlüpfte hinter die Blätterwand. Ein kaum wahrnehmbarer Trampelpfad führte zu einem mannshohen Bretterzaun, mit dem das Grundstück umgeben war. Vor vielen Jahren hatte Emilie beim Spielen im Schutz der immergrünen Sträucher eine lose Latte entdeckt und damit die Möglichkeit, sich heimlich aus dem Garten zu entfernen. Sie schob das Brett beiseite, zwängte sich durch den Spalt auf die andere Seite und lief in den lichten Wald hinein, der sich vor ihr erstreckte.
Die Berghoffsche Villa lag am oberen Rand des Briller Viertels direkt am Stadtpark, der die Kuppe des knapp dreihundert Meter hohen Nützenbergs bedeckte. An dessen östlichem Hang hatten in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Industrielle ihre Domizile errichtet, nachdem das dicht besiedelte Flusstal der Wupper keinen Raum mehr für großzügig geschnittene Privathäuser samt Gartengrundstücken bot. Das Bedürfnis, den Abgasen der unzähligen Fabrikschlote zu entfliehen, und der Wunsch nach Ruhe hatten die Stadtväter veranlasst, ein neues Wohnquartier für das Elberfelder Großbürgertum zu schaffen. Die Lage am Nützenberg erwies sich als ideal: Hier befand man sich sowohl in der Nähe einer großen Grünanlage als auch im Schatten des Westwindes, der die Ausdünstungen der großen chemischen Industrieanlagen und Textilfabriken transportierte.
Gustav Berghoff hatte seine Villa, die mit ihren Türmchen, Erkern und Balkonen an eine mittelalterliche Burg erinnerte, kurz nach Emilies Geburt erbauen lassen. An das alte Haus unten im Tal, in dem sie ihr erstes Lebensjahr verbracht hatte, konnte sie sich nicht mehr erinnern. Es hatte neben der Maschinenbaufirma gestanden, in der ihr Vater als Lehrling angefangen hatte, als sie noch eine kleine Werkzeugmanufaktur gewesen war. Zehn Jahre später hatte Gustav den Betrieb übernommen und binnen weniger Jahre zu einem florierenden Unternehmen ausgebaut. Das alte Wohnhaus hatte längst neuen Werkshallen weichen müssen.
Das Morgenkonzert unzähliger Meisen, Rotkehlchen, Dompfaffen und anderer Singvögel begleitete Emilie auf ihrem Weg zum Gipfel des Nützenberges. Bald wichen die Bäume des Waldes zurück und machten einer Parkanlage Platz, die der Elberfelder Verschönerungsverein in den 1870er Jahren angelegt hatte. In den Zweigen einer mächtigen Buche jagten sich zwei Eichhörnchen, im welken Laub des Vorjahres raschelte eine Spitzmaus, und hoch über den Baumkronen kreisten zwei Bussarde, deren Schreie Emilie mit einer unbestimmten Sehnsucht erfüllten. Sie raffte den Rock ihres Kleides hoch und rannte los. Sie genoss die schnelle Bewegung, die sie ihren Körper spüren ließ und ihren Kreislauf in Schwung brachte. Sie verließ den gekiesten Weg und überquerte eine Wiese. Der Tau an den Gräsern durchnässte ihre Schuhe. Übermütig sprang sie über die niedrige Hecke am Ende der Rasenfläche und erreichte wenige Momente später ihr Ziel: die Kaiserhöhe, auf der sich ein Aussichtsturm erhob. Ihm gegenüber stand ein kleines Haus, auf das Emilie zuhielt.
Kurz bevor sie es erreichte, wurde die Tür geöffnet, und ein Mann mittleren Alters mit Schiebermütze und langer Schürze trat heraus. Als er Emilie entdeckte, breitete sich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus, das von einem gewaltigen Backenbart eingerahmt wurde. Sie winkte ihm zu, froh, den Parkgärtner noch erwischt zu haben, bevor er zu seinem morgendlichen Rundgang aufbrach, Abfälle einsammelte, Hecken beschnitt, die Kieswege fegte und andere Arbeiten erledigte. Später würde er Schürze und Schiebermütze gegen eine schlichte Dienstuniform tauschen und in seiner zweiten Funktion als Turmwächter seinen Dienst versehen.
»Mo’n, Mo’n, Frollein Emilie«, sagte er in breitem Elberfelder Platt und lüftete seine Mütze.
»Guten Morgen, Anton«, antwortete sie. »Wie geht’s?«
Er brummte etwas Unverständliches. Seinem entspannten Gesicht und der Tonlage entnahm sie, dass er zufrieden war. Anton war kein Mann der großen Worte. Er deutete auf den Turm und sah Emilie fragend an. Sie nickte, holte die Zigarre hervor und überreichte sie ihm. Antons Augen leuchteten auf. Er schnupperte mit einem genießerischen Lächeln daran, bevor er sie in die Tasche seiner Arbeitsschürze steckte. Als er die Hand wieder herauszog, lag ein Schlüssel darin, den er Emilie hinhielt.
»Vielen Dank. Ich leg ihn nachher unter den mittleren Blumentopf«, sagte sie und zeigte auf ein Fensterbrett, auf dem einige Tonschalen standen.
Anton zwinkerte ihr mit einem verschwörerischen Lächeln zu, schulterte einen Rechen, der an der Hauswand lehnte, griff nach einem Eimer und stapfte davon.
Emilie lief zu dem aus grauem Stein gemauerten Turm und sprang die Stufen der Treppe hinauf, die in einem Bogen zum Eingang auf der Rückseite führten. Im Vorbeigehen warf sie einen Blick auf das aus rotem Sandstein gefertigte Stadtwappen Elberfelds mit dem zweischwänzigen Löwen, das über der Inschrift des Stifters thronte. Zehn Jahre zuvor hatte der Knopffabrikant Emil Weyerbusch, der wie Gustav Berghoff im Stadtrat saß, seinen Mitbürgern diesen Aussichtsturm errichten lassen. Die frühere Version aus Holz war baufällig gewesen und abgerissen worden. Wegen ihres schaurigen Geklappers in stürmischen Nächten hatte man ihr den Namen »Teufelsturm« gegeben, und nur wenige hatten sich getraut, sie zu besteigen.
Emilie war als Kind fest davon überzeugt gewesen, dass er von Werwölfen bewohnt war. Mit wohligem Gruseln hatte sie an den Lippen ihrer Oma, der Mutter ihres Vaters, gehangen, wenn diese ihr Legenden und Sagen aus der Gegend erzählte und die Welt ihrer Enkelin mit allerlei Kobolden, weißen Frauen, Zwergen und Ungeheuern bevölkerte. Sehr zum Unbehagen von Gustav und Irmhild Berghoff, die es nicht gern sahen, dass die ohnehin ausgeprägte Fantasie ihrer Tochter noch mehr angeregt wurde. Am meisten hatten Emilie die Werwölfe fasziniert. Die Vorstellung, sich in ein Tier zu verwandeln, war verlockend.
Der steinerne Nachfolger des Spukturms hingegen erfreute sich bei den Bürgern und Ausflüglern großer Beliebtheit – ebenso wie sein Stifter, der sich damit ein dauerhaftes Denkmal gesetzt hatte. Emilie erinnerte sich noch gut an das verkniffene Gesicht ihrer Mutter, mit der diese der Eröffnungsfeier beigewohnt hatte. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätten die feierlichen Reden der Großzügigkeit ihres Mannes gegolten. Nachdem sie ihn vergeblich gebeten hatte, sich mit einer ähnlichen Spende zu verewigen, hatte sie ihn tagelang mit vorwurfsvollen Blicken und eisigem Schweigen für seine Weigerung bestraft – zunehmend irritiert, Gustav nicht zum Einlenken bewegen zu können.
Eine Erfahrung, die Irmhild nur selten machen musste. Die Tochter eines angesehenen Kölner Kaufmanns war es gewohnt, ihren Willen durchzusetzen – notfalls mithilfe schwerer Migräneanfälle. Emilie verfolgte immer wieder mit einer Mischung aus ungläubigem Staunen und Faszination, wie ihr Vater sich dadurch weichklopfen ließ. Sie hatte bislang nicht herausgefunden, ob er tatsächlich an die Kopfschmerzen seiner Frau glaubte – die sie regelmäßig heimsuchten, wenn sie mit ihrer Überredungskunst an ihre Grenzen stieß – oder nachgab, um den häuslichen Frieden wiederherzustellen. Umso bemerkenswerter waren die seltenen Gelegenheiten, bei denen Irmhilds Leiden nicht zum Ziel führten. Ein – in seinen Augen – nutzloses Bauwerk zu stiften, nur um seinen Namen zu verewigen, kam für Gustav Berghoff nicht in Frage. Er zog es vor, sein Geld, sofern er es nicht in seine Firma reinvestierte, in gut ausgestattete Wohnungen für seine Arbeiter zu stecken oder sozialen Einrichtungen zu spenden. Er hielt es für seine Pflicht, Benachteiligten zu helfen oder seinen Untergebenen ein gutes Leben zu ermöglichen. Sich dafür öffentlich ehren zu lassen widerstrebte ihm zutiefst.
Emilie schloss die Tür auf und stieg im Innern die Wendeltreppe hinauf zur Turmstube und weiter zur Aussichtsplattform, über der sich ein schlankes, rundes Türmchen mit Kupferdach erhob. So hatte sie sich als Kind das Gemäuer vorgestellt, in dem Rapunzel auf ihren Prinzen wartete, und sich ausgemalt, wie es sich wohl mutterseelenallein lebte, hoch über den anderen Menschen, umgeben nur von Bäumen und dem Himmel. An manchen Tagen war ihr diese Vorstellung verlockend erschienen – wenn sie wieder einmal gescholten wurde, weil sie sich beim Bäumeklettern einen Strumpf zerrissen hatte, die Liste der deutschen Könige und Kaiser seit Karl dem Großen nicht fehlerfrei hersagen konnte oder dabei ertappt worden war, wie sie Else in der Küche half und dabei das verpönte Platt sprach.
Emilie setzte sich auf die Brüstung zwischen zwei Zinnen und schaute hinunter. An klaren Tagen konnte man bis zum Rhein sehen, dessen Tal heute jedoch im Dunst lag. Sie atmete tief durch. Der vertraute Anblick der Höhenzüge, von denen ihre Heimatstadt umgeben war, ließ sie zur Ruhe kommen. Während sie ihre Augen in die Ferne schweifen ließ, kreisten ihre Gedanken um die Frage, die sie in den letzten Wochen immer wieder beschäftigt hatte: Wie würde sich ihr weiteres Leben gestalten? Nach dem Ende ihrer Schulzeit hatte sie die letzten Jahre wie in einen Kokon versponnen zu Hause verbracht – zu weitgehender Untätigkeit verdonnert, da es sich in den Augen ihrer Eltern für sie nicht ziemte, eine Berufsausbildung zu machen oder eine höhere Bildung zu erwerben. Ihr ganzes Dasein war darauf ausgerichtet, eine gute Partie zu machen und in den Hafen einer soliden Ehe zu steuern.
Als ihr jüngerer Bruder Maximilian vor einigen Wochen Elberfeld verlassen hatte, um in Berlin zu studieren, war Emilie bewusst geworden, dass auch ihre Tage im elterlichen Nest gezählt waren. Nicht, weil man sie daraus hätte vertreiben wollen. Besonders ihrer Mutter lag nichts ferner. Die Vorstellung, nach ihren beiden Söhnen auch ihre Tochter gehen zu lassen, war Irmhild unerträglich. Sie war nicht der Meinung, dass es bereits an der Zeit war, Emilie unter die Haube zu bekommen. Dementsprechende Andeutungen ihres Mannes überhörte sie geflissentlich. Für sie stand es zwar auch außer Frage, dass Emilie heiraten sollte – aber doch nicht so bald. In ihren Augen war sie dafür noch zu kindlich und unreif. Emilie ärgerte sich einerseits über diese Einschätzung, war andererseits aber dankbar für die Haltung ihrer Mutter. Bislang hatte sie Gustav daran gehindert, sich ernsthaft nach einem Schwiegersohn umzusehen. Emilie ahnte, dass mit Beginn ihrer Volljährigkeit die Schonzeit ihrem Ende entgegenging. Ihr Vater würde sie gewiss nicht auf Biegen und Brechen in eine Ehe zwingen. Dass er aber nicht lockerlassen würde, bis sie einem geeigneten Mann das Ja-Wort gab, stand ebenso fest.
Und was willst du?, fragte eine leise Stimme in ihr. Du bist jetzt erwachsen. Ist es nicht dein gutes Recht, selbst zu bestimmen, wie dein Leben aussehen soll? Es gibt doch genug junge Frauen, die auf eigenen Beinen stehen. Die eine Ausbildung machen oder gar studieren. Emilies Gedanken wanderten zu Paula, einer ihrer Mitschülerinnen, die nach Karlsruhe auf eines der wenigen Mädchengymnasien gewechselt hatte, um dort Abitur zu machen und anschließend an der Freiburger Universität Medizin zu studieren, die als eine der ersten Hochschulen im Kaiserreich Frauen zuließ. Emilie hatte Paula beneidet. Sie stellte es sich herrlich vor, fern der Familie in einer anderen Stadt zu wohnen, selbst zu bestimmen, wie sie ihre Tage verbrachte, und vor allem etwas zu tun, das ihr Freude bereitete und sie zugleich in die Lage versetzen würde, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen.
»Emilie hat ein Talent, das man meiner Meinung nach unbedingt fördern sollte. Ich lege Ihnen sehr ans Herz, sie auf die hiesige Kunstgewerbeschule, besser noch auf eine Akademie zu schicken.«
Die Worte ihrer Lehrerin, die sie tief in sich begraben hatte, klangen ihr in den Ohren, als stünde Fräulein Otterbruch neben ihr und wiederholte ihren Appell, den sie auf der Abschlussfeier von Emilies Schulklasse vor drei Jahren an ihren Vater gerichtet hatte. Gustav Berghoff hatte ihr höflich zugehört, unverbindlich gelächelt, seiner Tochter die Wange getätschelt und gesagt:
»Ich danke Ihnen für Ihr freundliches Urteil. Emilie kann in der Tat ganz hübsch zeichnen. Aber Flausen sollte man dem Kind deswegen nicht in den Kopf setzen.«
Mit einer leichten Verbeugung hatte er Fräulein Otterbruchs Versuch, weiter in ihn zu dringen, beendet und sich empfohlen. Emilies Hoffnung, ihre Lehrerin könnte erreichen, was ihr selbst nicht gelungen war, hatte sich nicht erfüllt. Ganz im Gegenteil. Der zusammengepresste Mund, mit dem ihr Vater der Lehrerin den Rücken kehrte, hatte ihr gezeigt, dass für ihn allein das Ansinnen, seiner Tochter den Weg in ein Dasein als Künstlerin zu ermöglichen, einen Affront darstellte.
Die Erinnerung daran ließ Emilie die Augen schließen. Sie biss sich auf die Zungenspitze. Denk nicht mehr dran, befahl sie sich. Was bringt es, einem Traum nachzuhängen, der sich nie erfüllen wird? Zumindest nicht, wenn sie nicht mit ihren Eltern brechen und sich von der Familie lossagen wollte.
2
Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz, Juli 2013
Hanna sah ihrem Sohn nach, der eben die Sicherheitskontrolle verlassen und sich ein letztes Mal zum Winken zu ihr umgedreht hatte, bevor er zum Abflugterminal lief und ihren Blicken entschwand. Sie unterdrückte den Impuls, ihm hinterherzurennen, seinen Namen zu rufen, ihn zurückzuholen. Die Zweifel, die sie ihm gegenüber verschwiegen hatte, um ihn nicht zu verunsichern, übermannten sie: Wie soll er allein zurechtkommen? Tausende Kilometer von daheim entfernt? Unter lauter Fremden? In einem Land, in dem Entführungen und Raubüberfälle an der Tagesordnung sind, jederzeit soziale Unruhen ausbrechen können und gefährliche Krankheiten grassieren? Wie konnte ich nur zulassen, dass er sich auf dieses Abenteuer einlässt? Er ist doch mein Kleiner. Sie verschränkte die Unterarme, umfasste ihre Ellenbogen und presste sie an sich. Ist er nicht, wies sie sich zurecht. Schon lange nicht mehr. Und er wird bestens klarkommen. Die Frage ist doch eher, wie das bei dir aussieht.
Als Lukas Anfang des Jahres den Wunsch geäußert hatte, nach dem Abitur ins Ausland zu gehen und sich bei einem Kinderhilfsprojekt zu engagieren, war sie stolz gewesen. Die Zielstrebigkeit und Umsicht, mit der Lukas seinen Plan verfolgte, hatte sie beeindruckt. Tagelang hatte er im Internet nach einer passenden Organisation gesucht, Erfahrungsberichte und Blogs von anderen Freiwilligen gelesen und sich Unterlagen schicken lassen. Nachdem seine Wahl auf ein bolivianisches Waisenhaus gefallen war, das dringend Helfer benötigte, hatte er eine Bewerbung geschrieben, die notwendigen Bescheinigungen beschafft, ein Visum beantragt, sich gegen Gelbfieber impfen lassen und an vorbereitenden Seminaren teilgenommen. Mit einer Mischung aus Aufregung und Abenteuerlust hatte er seiner Abreise entgegengefiebert.
Hanna hatte sich mit ihm gefreut und sich gleichzeitig gegrämt, dass ihm der Abschied scheinbar so leichtfiel. Als ihn am Abend vor seinem Abflug nach Cochabamba doch noch die Angst vor der eigenen Courage packte, war sie – so sehr sie sich schämte, das zuzugeben – ein wenig erleichtert. Als er mit hängenden Schultern in seinem Zimmer vor seinem Koffer und dem Trekkingrucksack gestanden, sie mit geröteten Augen angesehen und gemurmelt hatte: »Was, wenn ich das nicht packe?«, war er mit einem Mal wieder der kleine Junge gewesen, der bei ihr Trost suchte und ihr das Gefühl gab, gebraucht zu werden. Sie hatte der Versuchung widerstanden und ihm nicht vorgeschlagen, das Ganze abzublasen. In jenem Moment wäre es ihr ein Leichtes gewesen, ihn dazu zu bewegen. Stattdessen hatte sie ihn kurz an sich gedrückt und ihm versichert, dass sie an ihn glaube und er diese einmalige Chance unbedingt wahrnehmen solle. Und dass sie ihm jederzeit helfen würde, falls er doch vorzeitig nach Deutschland zurückkehren wolle. Als er sie mit einem heiseren »Danke, Mama« fest umarmte, wusste sie, dass sie das Richtige getan hatte.
Hanna atmete tief aus und machte sich auf den Weg zu den Parkdecks des Nürnberger Flughafens. Sie fischte ihr Mobiltelefon aus der Handtasche. Es war ein älteres Gerät mit Tasten – nach Meinung ihrer Kinder ein Relikt aus dem Pleistozän, das schon lange gegen ein Smartphone ausgetauscht gehörte. Deren Bedürfnis, sich jederzeit und überall ins Internet einloggen zu können, war Hanna fremd. Ihr reichte es aus, zu Hause einen Zugang dazu zu haben. Sie drückte die Kurzwahltaste, unter der sie die Nummer ihres Mannes gespeichert hatte. Wenn sie seinen Terminplan richtig im Kopf hatte, war er jetzt auf dem Rückweg von einem Kunden. Das Freizeichen ertönte, gefolgt von der Ansage, dass der Teilnehmer derzeit nicht erreichbar sei. Hanna runzelte die Stirn. Normalerweise wurden Anrufe, die Thorsten nicht entgegennehmen konnte, auf die Mailbox umgeleitet. Vielleicht steckte er ja in einem Funkloch? Mit einem Achselzucken steckte sie das Telefon zurück in die Tasche.
Zwanzig Minuten später steuerte sie die Familienkutsche, einen geräumigen Combi, auf die A3 Richtung Oberpfalz. Nachdem der Juni in diesem Jahr mit Dauerregen und kalten Temperaturen aufgewartet hatte, schien der Juli endlich den ersehnten Sommer zu bringen. Die gewittrigen Schauer, die die Besucher des Altstadtfestes von Sulzbach am Wochenende fröstelnd Schutz unter den Schirmen der Würstelbuden und Imbissstände hatten suchen lassen, waren weitergezogen, und es wurde täglich wärmer und sonniger.
Hanna blinzelte und fischte mit einer Hand nach ihrer Sonnenbrille, die leicht angestaubt auf der Ablage neben dem Fahrersitz lag. Das Durcheinander aus Bonbonpapieren, leeren Getränkedosen und Chipstüten, einer zerbrochenen CD-Hülle und zerknüllten Taschentüchern, das den Boden vor dem Beifahrersitz, die Rückbank und die Ablageflächen bedeckte, ließ sie innerlich seufzen. Hatte sie den Wagen nicht erst zwei Wochen zuvor entrümpelt und durchgesaugt? Seitdem hatte Lukas ihn in Beschlag genommen, um die diversen privaten Abiturfeiern und Abschiedsfeste in seinem Bekanntenkreis mit Getränken und Essen zu beliefern, Ausflüge mit seinem besten Freund zu unternehmen und seine Schwester zu besuchen, die in Weihenstephan bei Freising studierte.
Hanna nutzte das Auto selten. Es war ihr zu sperrig. Sie war froh, die meisten Einkäufe mit dem Fahrrad erledigen zu können. Von Gallmünz, einem ruhigen Wohnviertel im Norden von Sulzbach-Rosenberg, brauchte sie eine Viertelstunde ins Zentrum. Mit dem Zug gelangte man von dort – zumal in den Stoßzeiten – schneller nach Nürnberg, Regensburg oder München als mit dem Wagen. Hanna hasste es, sich von Rasern drängeln zu lassen oder im Stau zu stehen, stundenlang auf der Suche nach einer Parklücke herumzukurven oder den Combi durch enge Gassen zu manövrieren. Wenn es nach ihr gegangen wäre, hätten sie sich schon längst ein kleineres Auto angeschafft. Die Zeit der wöchentlichen Großeinkäufe und gepäckreichen Familienausflüge war längst vorbei. Diesbezügliche Diskussionen hatten bislang jedoch immer damit geendet, dass ihr Mann Thorsten, der mit einem schnittigen Coupé zur Arbeit fuhr, den Verbleib des Zweitwagens durchsetzte. Dessen Stauraum war in seinen Augen unverzichtbar für den Transport seiner Einkäufe in Baumärkten und Gartencentern, die er regelmäßig aufsuchte, um ihr Heim zu verschönern.
Hanna beschloss, die Autobahn zu verlassen und über die B14 durch die Hersbrucker Alb nach Hause zu fahren. Die bewaldeten Hügel, aus denen immer wieder steile Kalksteinfelsen aufragten, wechselten sich mit den Äckern und Wiesen der Gehöfte ab, die versprengt in der Landschaft lagen. Sie schaltete die Stereoanlage ein und zuckte zusammen, als ihr der ohrenbetäubende Sound einer Metal-Band entgegenschallte, die ihr Sohn zuletzt gehört hatte. Rasch drehte sie die Lautstärke leiser, wechselte vom CD-Player zum Radio und suchte nach ihrem Lieblingssender, der vorwiegend Songs aus den achtziger und neunziger Jahren spielte. Sie öffnete das Seitenfenster und genoss die laue Brise, die den Duft frisch gemähten Heus hereinwehte und ihr durch die schulterlangen Haare fuhr. Sie strich sich eine rotbraune Strähne hinters Ohr und lauschte dem Cat-Stevens-Song, der gerade anmoderiert worden war. Die beschwingte Melodie vertrieb die trübe Stimmung, in die der Abschied am Flughafen sie versetzt hatte. Sie umfasste das Lenkrad fester und sang das Lied laut mit:
»Well, if you want to sing out, sing outAnd if you want to be free, be free,’Cause there’s a million things to be,You know that there are …«
Nach sechzig Kilometern Fahrt erreichte Hanna am späten Nachmittag Sulzbach-Rosenberg. Schon von Weitem grüßte die imposante Schlossanlage, die auf einer Anhöhe über dem historischen Stadtkern thronte. In früheren Jahrhunderten hatten die Burgherren an diesem wichtigen Verkehrsknotenpunkt die Handelswege von Würzburg nach Regensburg und ins ferne Böhmen kontrolliert und ihren Wohlstand mit den Wegezöllen vermehrt. Hanna parkte den Wagen an der Bayreuther Straße, schnappte sich ihre Handtasche, zog einen Einkaufszettel heraus und lief in die verwinkelten Straßen und Gassen der Altstadt.
Beladen mit zwei Anzügen, die sie von einer Reinigung für Thorsten abgeholt hatte, diversen Drogerieartikeln, Prospekten aus einem Reisebüro, einigen Lebensmitteln und einer Flasche Rotwein erreichte sie eine Stunde später den Luitpoldplatz. Das Zentrum der bereits im neunten Jahrhundert gegründeten Stadt wurde im Norden von einer gotischen Pfarrkirche, im Westen von der Frontseite der Burg und dem lang gestreckten Bau eines Klosters und im Osten von der leuchtendroten Fassade des Rathauses eingerahmt.
Die Sonne stand hoch am Himmel. Hanna hielt auf Thorstens und ihr Lieblingscafé in der Nähe des Löwenbrunnens zu. Unter den aufgespannten Sonnenschirmen erspähte sie ein freies Tischchen, an dem sie sich mit einem Aufatmen niederließ. Sie verstaute ihre Einkäufe auf und unter dem Stuhl gegenüber und warf einen Blick auf die Tafel mit der Spezialität des Tages: Eistee mit Limettensaft und frischem Ingwer.
Genau das Richtige zum Abkühlen. Dazu einen kleinen Becher gemischtes Eis, das im Sommer täglich von der Besitzerin des Cafés aus frischen Zutaten hergestellt wurde. Hoffentlich war das dunkle Schokoladeneis mit siebzig Prozent Kakaoanteil noch nicht ausverkauft. Dazu eine Kugel Walnusseis … Die Vorstellung ließ Hanna unwillkürlich schlucken. Nach der ganzen Hetzerei hatte sie sich eine Belohnung verdient. Und deine Hüften freuen sich über Zuwachs, lästerte die strenge Stimme in ihr, die sich immer meldete, wenn Hanna im Begriff war, sich etwas zu gönnen oder etwas Unvernünftiges zu tun. Halt die Klappe, alte Miesmacherin, brachte sie die interne Kritik zum Schweigen. Ein wenig Polsterung schadet nicht. Ich bin schließlich kein zwanzigjähriges Magermodel, sondern eine zweifache Mutter von fast fünfundvierzig Jahren. Laut ihrer Frauenärztin waren ein paar zusätzliche Pfunde sogar gesund. Und da Hanna sich gern und viel bewegte, war ihre etwas untersetzte Figur bislang nicht aus dem Leim gegangen.
Als Teenager hatte sie darunter gelitten, dass ihre Beine in den modischen Röhrenjeans nicht die gleiche Wirkung entfalteten wie bei einigen ihrer Klassenkameradinnen, denen die Jungs nachschauten und bewundernd von »Beinen bis zum Hals« sprachen. Im Vergleich mit ihnen war sie sich stämmig vorgekommen. Auch über ihren kleinen Busen war sie unglücklich gewesen. Ganz zu schweigen von den Augen, die einen Tick zu weit auseinanderstanden, und den Sommersprossen auf ihrem Nasenrücken. Nein, sie hatte sich lange schwer damit getan, ihr Äußeres zu akzeptieren. Als Thorsten bei ihrem ersten Date von ihren grau-grünen Augen schwärmte, hatte sie geglaubt, er nehme sie auf den Arm. Der Ernst, mit dem er ihr das Gegenteil versicherte, hatte sie in ihn verliebt gemacht. Zum ersten Mal hatte sie sich mit ihrem Aussehen versöhnt gefühlt.
Nachdem Hanna bestellt hatte, holte sie ihr Mobiltelefon aus der Handtasche und wählte Thorstens Nummer. Erneut war er nicht erreichbar. Sie verzog enttäuscht das Gesicht und tippte rasch eine SMS.
Freu mich auf heut Abend. Lass uns Urlaubspläne schmieden. Hab eine Flasche Roten geholt. Bringst du Antipasti von Da Gianni mit? Kuss, Hanna
Während sie auf ihren Tee und das Eis wartete, las Hanna in den Prospekten aus dem Reisebüro. Die Seiten mit den Zielen in Asien und Südamerika überblätterte sie rasch. Der Traum von einer langen Tour durch ein fernes Land, den sie und ihr Mann seit Ewigkeiten hatten, würde sich auch in diesem Jahr nicht erfüllen. Thorsten hatte erst vor Kurzem als leitender Ingenieur eine neue Abteilung in seinem Betrieb übernommen. An eine längere Abwesenheit des frischgebackenen Chefs war nicht zu denken. Aber ein Kurztrip sollte, nein, musste möglich sein. Thorsten schuftete viel zu viel. Hanna hatte aufgehört, die Überstunden zu zählen, die er angehäuft hatte. Abends kam er selten vor sieben Uhr aus dem Büro. Wenn er nicht aufpasste, endete er noch so wie einer seiner Kollegen, der mitten in einem Meeting kollabiert und noch auf dem Weg ins Krankenhaus an einem schweren Herzinfarkt gestorben war. Hanna schüttelte sich und starrte auf die aufgeschlagene Seite, auf der drei- bis viertägige Reisen angeboten wurden. Vielleicht konnten sie ein paar Tage ins Elsass fahren. Wandern, das Straßburger Münster besichtigen, Weingüter besuchen, eine Dampferfahrt auf dem Rhein machen …
»Ah, so ist es richtig. Ein Tapetenwechsel ist in Ihrer Situation das einzig Wahre.«
Hanna sah auf. Vor ihr stand nicht die junge Bedienung, bei der sie bestellt hatte, sondern Frau Schrader, die Eigentümerin des Cafés. Wie sie selbst war sie keine gebürtige Oberpfälzerin. Obwohl sie bereits doppelt so lange wie Hanna hier lebte, war sie nach fünfunddreißig Jahren noch immer die Zougrouste. Ein Etikett, das auch Hanna und ihrem Mann anhaftete. Ihre Kinder dagegen, die mühelos zwischen dem Hochdeutschen und dem Dialekt der Gegend wechselten und mit ihren Freunden nur oberpfälzisch sprachen, wurden nicht als Zugereiste wahrgenommen.
Frau Schrader stellte das Glas mit dem Tee und den Eisbecher auf das Tischchen und fuhr fort:
»Sie machen das richtig. Sich nicht zu Hause vergraben, sondern sich etwas Gutes tun. Das haben Sie sich mehr als verdient nach all den Jahren, die Sie für ihn geopfert haben.«
Hanna runzelte die Stirn. »Geopfert? Ich würde es nicht so nennen. Ich habe es gern getan und würde es jederzeit wieder …«
»Sicher«, fiel ihr Frau Schrader ins Wort. Sie sah sie forschend an. »Ich finde es wirklich bewundernswert, wie Sie damit umgehen, dass er nun weg ist.«
Hanna hob die Schultern. »Naja, ehrlich gesagt, ist es mir schon ziemlich schwergefallen, ihn gehen zu lassen. Aber es war ja abzusehen. Und für ihn ist es wichtig, seinen eigenen Weg zu finden. Es wäre doch sehr egoistisch von mir gewesen, ihn daran zu hindern.«
Frau Schrader schluckte eine Bemerkung, die ihr offensichtlich auf der Zunge lag, herunter, nickte Hanna zu und entfernte sich Richtung Café, wobei sie etwas murmelte, das sich anhörte wie: »So tapfer …«
Hanna sah ihr irritiert nach. Schließlich wurden Kinder irgendwann flügge. Sie hätte nicht vermutet, dass Frau Schrader, deren beiden Töchter schon vor vielen Jahren von zu Hause ausgezogen waren, das Thema so an die Nieren gehen würde. Auf sie hatte die gebürtige Bremerin bisher einen eher unterkühlten Eindruck gemacht. Da sah man mal wieder, wie man sich täuschen konnte.
Hanna legte den Reiseprospekt zur Seite und begann das Eis zu löffeln, das cremig auf der Zunge zerging. Die Vorstellung, bald mit Thorsten in einem dieser malerischen Dörfchen im Elsass zu sitzen, Flammkuchen zu essen und sich treiben zu lassen ohne Zeitdruck und Verpflichtungen, ließ sie lächeln. Hoffentlich kann er spontan Urlaub nehmen, dachte sie. Dann könnten wir eigentlich in den nächsten Tagen losfahren. Sie warf einen Blick auf ihr Telefon. Keine neue SMS. Ein mulmiges Gefühl keimte in ihr auf. Es war nicht Thorstens Art, sich nicht zurückzumelden. Ob ihm etwas zugestoßen war?
3
Elberfeld, Mai 1907
Emilies Geburtstag wurde am Nachmittag in kleinstem Kreis gefeiert. Abends war der Besuch einer Operette im Thalia Theater am Wupperufer geplant, das erst im Dezember des Vorjahres eröffnet worden war. Friedrich, ihr fünf Jahre älterer Bruder, und seine Frau Klothilde, die vor einigen Monaten ein paar Straßen weiter im Briller Viertel eine Villa im neubarocken Stil bezogen hatten, wollten zu Fuß herüberspazieren. Die Großmutter aus Köln reiste mit der Eisenbahn an und wurde von Gustavs Kutscher vom Bahnhof abgeholt. Ihr Mann ließ sich wegen dringender Geschäfte entschuldigen, die seine Anwesenheit in seinem Handelskontor unverzichtbar machten. Emilie vermutete, dass eher die Aussicht auf eine kurze Zeit als Strohwitwer der Grund war, und er die Gelegenheit nutzte, sich dem strengen Regiment seiner Gattin zu entziehen. Sie nahm ihm die Ausrede nicht übel. Sie hätte gern auf den Besuch ihrer Großmutter verzichtet. Ihr hatte sie es zu verdanken, dass Irmhild ihre Zofe Agathe beauftragte, ihrer Tochter bei der Toilette behilflich zu sein und ihr Korsett ordentlich zu schnüren. Emilie ließ die Prozedur klaglos über sich ergehen. Eine Lehre aus der Vergangenheit. Agathe pflegte Bitten, die Bänder nicht allzu stramm festzuzurren, mit besonders energischem Ziehen zu beantworten, um den Oberkörper ihres Opfers in die erwünschte S-förmige Haltung zu zwingen. Emilie hasste diese in ihren Augen unnatürliche Verbiegung, bei der der Busen nach vorn geschoben, der Bauch nach hinten gepresst und das Gesäß mithilfe eines starken Hohlkreuzes betont wurde. Nachdem die Zofe ihr geholfen hatte, die bestickte langärmelige Bluse und den bodenlangen Rock aus blaugrün changierender Seide anzuziehen, traktierte sie Emilies glattes Haar mit einer Brennschere, steckte die Locken zu einem weichen Knoten hoch und verließ mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck das Zimmer.
Emilie folgte ihr wenig später. Sie kam sich vor wie eine Puppe. Vorsichtig tippelte sie die Treppe hinunter. Schnelle Bewegungen verboten sich, nicht nur, weil tiefes Luftholen durch die enge Schnürung unmöglich war. Emilie ging in dieser Bekleidung ihr Körpergefühl abhanden, sie befürchtete, das Gleichgewicht zu verlieren, über den Rocksaum zu stolpern oder mit der langen Schleppe irgendwo hängen zu bleiben.
Pünktlich um drei Uhr betrat sie das Speisezimmer. Der ovale Tisch mit den gedrechselten Beinen, die auf Löwentatzen ruhten, war mit weißem Leinen und dem Meißner Porzellanservice mit dem Gestreute-Blümchen-Dekor eingedeckt, das nur zu besonderen Gelegenheiten aus dem Buffetschrank geholt wurde, der dem Fenster gegenüber an der Wand stand. Zwei Porzellanfigurinen – Blumenmädchen mit Körbchen voller Blüten – standen neben einer Platte mit einer Buttercremetorte, auf der mit winzigen roten Marzipanherzchen die Zahl einundzwanzig gebildet war. Eine dreistöckige Etagere präsentierte eine Auswahl an Petit Fours, Eclairs und feinem Teegebäck, die nicht aus Bertas Küche stammte, sondern zur Feier des Tages von der besten Konditorei der Stadt geliefert worden war. Kleine Eier-, Schinken- und Käse-Sandwiches für herzhaftere Gelüste waren auf zwei weiteren Platten angerichtet. Alles vom Feinsten. Wie es sich für einen gehobenen Haushalt, der auf sich hielt, gehörte.
Wäre es nach Emilie gegangen, hätte man ihren Geburtstag mit einer traditionellen Kaffeetafel met allem dröm on draan gefeiert. So wie früher bei ihrer Großmutter väterlicherseits, die mit den einfachsten Mitteln eine heimelige Atmosphäre schaffen konnte, in der man sich willkommen fühlte. Und der das leibliche Wohl ihrer Gäste und insbesondere ihrer Enkel am Herzen gelegen hatte. Die Erinnerung regte Emilies Appetit an. Den Beginn hätte eine dicke Schnitte Hefeblatz gemacht, bestrichen mit Butter und selbst eingekochtem Apfelkraut. Dazu sämigen Milchreis mit Zimt und Zucker. Danach eine Wurst- oder Käsestulle, Kräuterquark und Rührei. Zwischendurch frische Waffeln mit eingemachten Kirschen und zum Schluss Sandkuchen und Gusszwieback. Dazu Bohnenkaffee aus der Dröppelminna, einer bauchigen Zinnkanne mit Zapfkränchen, die auf drei Füßchen in der Mitte des Tisches stand und Oma Berghoffs ganzer Stolz gewesen war.
Wo das gute Stück wohl gelandet war? Vermutlich beim Trödelhändler wie der Rest des bescheidenen Haushalts. Emilie unterdrückte ein Seufzen bei dem Gedanken an ihre Großmutter, die kurz nach dem Tod ihres geliebten Mannes vor drei Jahren gestorben war. Die beiden hatten Emilie immer an Philemon und Baucis erinnert, jenes arme Paar aus der griechischen Sage, dessen Gastfreundlichkeit ihnen von den Göttern mit der Erfüllung ihres Herzenswunsches vergolten worden war: dass am Ende ihres gemeinsamen Lebens keiner des anderen Grab sehen musste.
Eben traten Emilies Vater und ihr Bruder ins Gespräch vertieft durch die Tür des benachbarten Raucherkabinetts. Beide trugen einen schwarzen Gehrock und eine hellgraue Weste, die sich bei Gustav Berghoff über einen stattlichen Bauch spannte, während Friedrich seine athletische Figur mit einer taillierten Version betonte. Abgesehen von seinen kurz geschorenen Haaren, dem geraden Mittelscheitel und dem schmalen Oberlippenbart war er seinem Vater, der fast kahl war, wie aus dem Gesicht geschnitten: runder Kopf, zur Röte neigende Wangen und eine markante Nase. Bei Gustav wucherte ein buschiger Schnauzbart um die vollen Lippen – wie bei seinem Idol, dem ehemaligen Reichskanzler Otto von Bismarck.
Friedrich bemerkte seine Schwester und nickte ihr förmlich zu. Bereits als Junge hatte er auf Emilie nie kindlich gewirkt, sondern wie ein zu klein geratener Erwachsener. Undenkbar, mit ihm durch den Park zu toben, Streiche auszuhecken oder sich eine Leckerei aus der Vorratskammer zu stibitzen. Der Berghoffsche Stammhalter hatte seine verantwortungsvolle Position von Kindesbeinen an verinnerlicht und keinen Sinn für die Faxen und fantasievollen Spiele seiner beiden jüngeren Geschwister, auf die er mit einer Mischung aus Herablassung und Unmut herabgeblickt hatte, sofern er sie nicht einfach ignorierte.
Emilies Mutter stand mit ihrer Schwiegertochter, einer schmächtigen Blondine mit durchscheinendem Teint und sorgfältig gezupften Augenbrauen, vor dem Buffetschrank und zeigte ihr ein kürzlich erworbenes silbernes Ensemble aus Salz- und Pfefferstreuern und Fingerschälchen. Emilies Augen wanderten zu einem kleinen Tisch, der in einer Ecke des Zimmers aufgestellt worden war. Unter einem Strauß mit Fliederzweigen aus dem Garten waren die Geschenke verteilt. Gerade hatte ihre Großmutter ein rechteckiges Paket dazugelegt. Emilie ging zu ihr und begrüßte sie mit einem Knicks.
»Ah, da ist ja unser Geburtstagskind.«
Hedwig Hardenrath kniff die dunkelgrauen Augen leicht zusammen und musterte ihre Enkelin, die sie um einen halben Kopf überragte. Ihre hochtoupierten Haare ließen ihre hagere Gestalt noch größer wirken, ihre aufrechte Haltung tat ein Übriges, ihr einschüchterndes Wesen zu verstärken. Emilie sah zu Boden und fühlte sich in Kindertage zurückversetzt. Es hätte sie nicht gewundert, im nächsten Moment ein Gedicht aufsagen oder ihre aktuelle Handarbeit herzeigen zu müssen. Es fiel ihr schwer, dem prüfenden Blick standzuhalten, der sie wie die vor einigen Jahren entdeckten X-Strahlen des Physikers Wilhelm Carl Röntgen zu durchleuchten schien. Die Tatsache, dass sie nicht die Einzige war, der es so ging, war ein schwacher Trost. In Hedwig Hardenraths Gegenwart erstarb jegliche Leichtigkeit und machte ängstlicher Sorge um das richtige Betragen, die Vermeidung heikler Themen und anstößiger Bemerkungen Platz. Die kommenden Stunden würden ein Spießrutenlauf. Emilie hatte ihre Großmutter im Verdacht, sich erst dann wohlzufühlen, wenn alle in ihrer Umgebung starr vor Befangenheit waren.
»Nun scheint ja doch noch halbwegs eine Dame aus ihr zu werden«, stellte diese fest und nickte ihrer Tochter zu, die die Musterung Emilies mit angehaltenem Atem verfolgt hatte. Irmhild Berghoff, die mit ihren weichen Gesichtszügen, der ins Mollige tendierenden Figur und den blassblauen Augen nach ihrem Vater kam, verzog das Gesicht zu einem gezwungenen Lächeln.
»Möchten Sie sich nicht setzen, Mutter?«, fragte sie. »Sie sind sicher erschöpft nach der langen …«
»Ich bitte dich!«, unterbrach Hedwig sie. »Ich bin doch nicht von Pappe.« Mit einem strengen Blick zu den männlichen Familienmitgliedern fuhr sie fort: »Aber da nun endlich alle anwesend sind, können wir Platz nehmen.«
Emilie beeilte sich, ihr den Stuhl am Kopfende des Tisches, auf dem gewöhnlich ihre Mutter saß, zurechtzurücken, bevor sie sich zu ihrem Platz in der Mitte einer der Längsseiten begab. Ihre Mutter nahm den Stuhl neben ihr ein. Vis-à-vis setzten sich Friedrich und Klothilde, der Herr des Hauses am anderen Ende der Tafel unter dem Porträt des Kaisers. Emilies Blick verweilte auf dem freien Platz direkt ihr gegenüber. Wo Max jetzt wohl gerade sein mochte? Vermutlich in einer Vorlesung an der Universität. Oder über ein Buch gebeugt in der Bibliothek. Oder er frönte dem Nichtstun, streifte durch die Berliner Straßen und erkundete ein ihm noch unbekanntes Viertel. Wie gern hätte sie mit ihm getauscht.
»Was hört ihr denn von eurem Jüngsten?«, fragte die Großmutter und bekräftigte Emilies Vermutung, sie könne Gedanken lesen. »Ich bin ja nach wie vor der Ansicht, dass es gerade für Maximilian wichtig gewesen wäre, an die Kandare genommen zu werden.« Sie nickte Friedrich zu. »Man sieht ja, wie günstig sich das auf die Entwicklung auswirkt.«
Emilie beobachtete, wie ihr älterer Bruder sich eine Handbreit von seinem Stuhl erhob und sich knapp verbeugte, um sich für das Kompliment zu bedanken. Ein leises Klacken verriet ihr, dass er dabei die Hacken zusammenschlug. Friedrich zeigte gern, wie sehr ihm das Soldatische in Fleisch und Blut übergegangen war, auch wenn seine Militärzeit einige Jahre zurücklag. Um sich in Form zu halten, ertüchtigte er sich jeden Morgen mit Leibesübungen und betonte bei jeder sich bietenden Gelegenheit seine Bereitschaft, als Reserveoffizier für Kaiser und Reich zur Verfügung zu stehen, sollten es die Umstände erfordern.
Seine Frau Klothilde himmelte ihn von der Seite an. Sie legte eine Hand auf seinen Unterarm und drückte ihn kurz. Das Gesicht von Gustav Berghoff verdüsterte sich, Irmhild schaute unbehaglich auf ihren Teller. Das Versagen ihres Jüngsten, der dem Drill und dem rauen Ton in der Kadettenschule nicht standgehalten hatte und von seinen Vorgesetzten nach wenigen Monaten wegen schwacher Nerven als untauglich entlassen worden war, war ein wunder Punkt, in dem die Großmutter immer wieder genüsslich herumbohrte.
Emilie biss sich auf die Lippe. Nicht auszudenken, wie Hedwigs selbstgerechte Tiraden ausgefallen wären, wenn sie die ganze Wahrheit gewusst hätte: dass Max versucht hatte, sich das Leben zu nehmen aus lauter Verzweiflung. Ihr Vater hatte die Familie zu eisernem Schweigen verpflichtet. Die Schmach der Entlassung seines Jüngsten lastete auch so schon schwer genug auf ihm, er empfand sie als persönliche Demütigung, die er seiner Frau zu verdanken hatte. Seiner Meinung nach hatte sie Maximilian verzärtelt, anstatt dessen verträumte Veranlagung mit der gebotenen Strenge zu korrigieren. Dass ihm dies selbst ebenso wenig gelungen war, machte die Sache nicht besser.
»Max hat sich in Berlin und an der Universität sehr gut eingelebt«, antwortete Emilie auf die Frage ihrer Großmutter. »Obwohl er erst im zweiten Semester ist, hält sein Biologieprofessor schon große Stücke auf ihn.«
Hedwig hob eine Augenbraue und öffnete den Mund. Bevor sie etwas sagen konnte, fuhr Emilie fort:
»Stellen Sie sich vor, er will Max in den Sommerferien als einzigen seiner Studenten auf eine Expedition von Forschern aus verschiedenen Ländern ins Polarmeer mitschicken, damit er dort für ihn Studien treibt.«
Hedwig versteifte sich und presste ihre Lippen zusammen.
Emilie verkniff sich ein Lächeln und dachte: Mit dieser Antwort hast du wohl nicht gerechnet, du alter Drachen. Sie fing einen Blick ihres Vaters auf, der ihr unmerklich zunickte. Für dieses Mal war die Klippe umschifft. Hedwig nahm sich mit einer Kuchenzange ein mit Moccacreme gefülltes Eclair von der Etagere und stach mit ihrer Gabel in das zarte Gebäck, als wolle sie es erlegen.
»Unser Max nimmt an einer Expedition teil? Davon weiß ich ja gar nichts«, sagte Friedrich zu seinem Vater. In seiner Stimme schwang ein vorwurfsvoller Unterton. Seit er als Juniorpartner in die Firma eingestiegen war, erwartete er – in seinem Selbstverständnis als zukünftiges Familienoberhaupt –, über alles Geschäftliche und Private umgehend in Kenntnis gesetzt zu werden.
»Er hat es Emilie in seinem Geburtstagsbrief geschrieben«, sagte Irmhild. »Dein Vater hat auch erst heute Mittag davon erfahren.«
Friedrichs Miene entspannte sich. »Verstehe. Nun, es wird Max guttun, ein paar Wochen ohne die Annehmlichkeiten der Zivilisation in der Gesellschaft erfahrener Männer zu verbringen und eine verantwortungsvolle Aufgabe zu haben. Das wird ihn stählen.«
Emilie bemerkte, wie ihre Mutter neben ihr unruhig auf ihrem Stuhl nach vorn rutschte. Vermutlich befürchtete sie, das heikle Thema könnte erneut auf den Tisch kommen.
»Darf ich meine Geschenke auspacken?«
Emilie beugte sich zu ihrer Großmutter. »Ich bin sooo gespannt, was in Ihrem Paket steckt.«
Sie schlug mit gespielter Verlegenheit die Augen nieder. Die Röte, die ihr vor Anstrengung, ein Prusten zu unterdrücken, in die Wangen stieg, verfehlte ihre Wirkung nicht. Hedwig lächelte geschmeichelt und gab mit einem Kopfnicken ihre Einwilligung.
Klothilde musterte ihre Schwägerin mit einem blasierten Gesichtsausdruck und sagte halblaut zu Friedrich: »Kaum zu glauben, dass deine Schwester volljährig ist. Sie benimmt sich wie ein unreifer Backfisch.«
Sie schüttelte den Kopf und knabberte weiter an einem winzigen Sandwich, das Emilie mit zwei Bissen vertilgt hätte. Diese tat so, als hätte sie nichts gehört, stand auf und ging zu dem Gabentisch. Mit der Frau ihres Bruders, die nur wenig älter war als sie selbst, wurde sie nicht warm. Zu unterschiedlich waren ihre Temperamente und Interessen. In den zwei Jahren, die Klothilde nun zur Familie gehörte, war es Emilie nicht gelungen herauszufinden, was diese bewegte, was für Träume sie hatte und ob sie glücklich war. Sie könnte die große Schwester der beiden Blumenmädchen sein, schoss es ihr durch den Kopf. Sie ist ebenso blass, zierlich und adrett wie diese Porzellanfigürchen. Obwohl, so ganz stimmt das nicht. Die zwei sehen viel fröhlicher aus. Einen Augenblick lang stellte sie sich vor, wie die beiden zum Leben erwachten und auf dem Tisch Fangen spielten oder sich hinter Kannen und Kuchen voreinander versteckten.
Emilie griff nach dem Geschenk ihrer Großmutter. Es war kantig und schwer. Sie widerstand der Versuchung, das Papier einfach aufzureißen. Langsam zog sie die Schleife auf und wickelte sie auf, bevor sie den Inhalt auspackte: ein in goldenes Leinen gebundener Wälzer mit marmoriertem Schnitt und einer rotgeprägten Zeichnung, die eine Hand darstellte, die einen runden Spiegel hielt. Darunter standen der Titel: Das goldene Buch der Sitte und der Name des Verlegers: W. Spemann. Emilie kannte die Reihe. In der Bibliothek nebenan standen weitere Werke des Herausgebers, der zu verschiedenen Bereichen aus Kultur und Gesellschaft Hauskunden für Jedermann veröffentlicht hatte. Sie schlug den Deckel auf und blätterte zum Inhaltsverzeichnis. Auf achthundert Seiten konnte man alles Wissenswerte über sittlich einwandfreies Verhalten in allen Lebenslagen erfahren – vom perfekten Führen des eigenen Haushaltes und die angemessene Bekleidung zu verschiedenen Anlässen über das einwandfreie Benehmen in Gesellschaften aller Art, bei Besuchen, Einladungen, auf Reisen und kulturellen Veranstaltungen, bei Festen und Familienfeiern bis hin zu Ratschlägen für das korrekte Verhalten bei Ehrenhändeln und bei Hofe.
Emilie verdrehte die Augen. Ihre Hoffnung, einen weiteren Band von Brehms Tierleben zu erhalten, hatte sich nicht erfüllt. Dabei war es seit zwei Jahren der einzige Wunsch, den sie regelmäßig äußerte. Noch fehlte ihr die Hälfte der zehnbändigen Allgemeinen Kunde des Tierreichs.
Sie holte tief Luft, was ihre Rippen schmerzhaft gegen das enge Mieder drückte, und drehte sich zu den anderen. Sie zwang sich zu einem Lächeln, hielt das Buch hoch und verneigte sich leicht gegen ihre Großmutter.
»Vielen Dank!«
Gustav nickte seiner Schwiegermutter zu.
»Ein sehr sinniges Präsent. Es wird unserer Emilie sehr hilfreich sein. Nicht zuletzt, wenn sie als Ehefrau und Mutter in einem eigenen Haushalt mehr Verantwortung tragen und gesellschaftliche Pflichten haben wird.«
Klothilde zog die Stirn kraus und schob die Unterlippe ihres kleinen Mundes vor. Bevor sich Emilie fragen konnte, was ihre Schwägerin verärgerte, hatte sich diese wieder gefasst. Sie straffte sich und wandte sich an Hedwig.
»Oh, der Gedanke lag wohl in der Luft. Wir hatten nämlich eine ähnliche Idee. Ihr Geschenk ist natürlich viel umfassender und grundlegender.«
Sie deutete auf ein Päckchen, das in blaues Seidenpapier eingeschlagen war, und machte Emilie gegenüber eine auffordernde Bewegung.
Emilie griff danach und wickelte ein kleines Buch mit dem Titel Der gute Ton aus. Auf der ersten Seite las sie, dass es sich um ein Handbuch der feinen Lebensart und guten Sitte handelte, das nach den neuesten Anstandsregeln von Emma Kallmann geschrieben war.
Hedwig lächelte Klothilde wohlwollend zu.
»Eine hervorragende Wahl. Emilie wird es bald gebrauchen können. Für unterwegs ist mein Buch denn doch zu unhandlich. Da ist die Kallmann eine vorzügliche Ergänzung.«
Sie drehte sich zu Emilie, die gerade ein paar Satinhandschuhe und ein dazu passendes Täschchen auspackte.
»Klothildes Büchlein wird dir in Berlin gute Dienste leisten.«
Emilie zog die Augenbrauen hoch.
»In Berlin?«
»Ja, bei deiner Tante Franziska.«
»Entschuldigung, aber ich verstehe nicht …«
»Soll das heißen, dass meine Schwester wieder in Deutschland ist?«, fragte Irmhild.
Hedwig runzelte die Stirn. »Hat sie sich denn nicht bei euch gemeldet? Ihr Mann wurde ins Reichskolonialamt berufen. Die beiden werden nun in der Hauptstadt leben. Ich habe ihr vorgeschlagen, dass Emilie ein paar Wochen bei ihnen verbringt. Eine wunderbare Gelegenheit, sie in die große Gesellschaft einzuführen. Dort wird sie den letzten Schliff erhalten. Und in Franziskas Kreisen dürfte es ein Leichtes sein, eine gute Partie für sie zu finden.«
Emilies Magen zog sich zusammen. Die Aussicht, mehrere Wochen bei ihrer Tante verbringen zu müssen, war beängstigend. Franziska kam nicht nur äußerlich nach ihrer Mutter Hedwig, sondern teilte auch deren Wertvorstellungen, die sie womöglich noch rigider auslegte als diese. Emilie hatte sie vor neun Jahren zum letzten Mal gesehen und sich mit einer Mischung aus Faszination und Befremden gefragt, wie man so steif und streng sein konnte. Anschließend hatten sie und Max tagelang ›Tante Franziska kommt zu Besuch‹ gespielt und sich gegenseitig darin überboten, deren gestelzte Sprache, abgezirkelten Bewegungen und strafenden Blicke nachzuahmen.
Emilie stieß unterm Tisch ihre Mutter leicht mit dem Fuß an und raunte ihr zu: »Muss ich dahin?«
Irmhild senkte die Augen und strich ihr über die Hand. Eine Geste des Mitleids. Ein Hüsteln am Ende der Tafel ließ sie zusammenzucken, die Hand wurde zurückgezogen. Emilie hob den Kopf und begegnete dem eisigen Blick ihrer Großmutter.
4
Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz, Juli 2013
Kurz nach sieben Uhr abends bog Hanna in die einseitig bebaute Straße am Rand des Wohnviertels ein, in dem Einfamilienhäuser in großzügig geschnittenen Gärten standen. Ihr Grundstück lag am Ende des Sträßchens und grenzte direkt an eine Wiese und ein Waldstück. Das dunkelblaue Coupé von Thorsten stand in der Einfahrt. Hanna lächelte. Was für eine schöne Überraschung. Er war bereits zu Hause. Sie parkte den Combi auf dem Gehweg vor dem Gartenzaun und beeilte sich, mit ihren Einkäufen ins Haus zu gelangen. Sie stutzte, als sie den Schlüssel ins Schloss steckte und zweimal umdrehen musste, bevor die Tür aufging.
»Thorsten? Bist du da?«, rief sie und lauschte in die Stille.
Keine Antwort. Vermutlich war er direkt in den Garten gegangen. Hanna stellte die Tüten ab, legte die Anzüge über das Geländer der Treppe, die ins obere Stockwerk führte, stellte den Wein in die Küche und lief in den hinteren Teil des Erdgeschosses, in dem sich der offene Wohn-Ess-Bereich befand. Bevor sie die Fensterfront mit der Glastür erreichte, die auf die Terrasse und in den Garten führte, wurde ihr Blick auf den niedrigen Tisch abgelenkt, der linker Hand inmitten einer Sitzgruppe aus zwei Sofas und mehreren Sesseln stand. Ein weißes Briefkuvert lag in seiner Mitte. Hanna hielt inne, beugte sich hinunter und las ihren Namen. Sie runzelte die Stirn, riss den Umschlag auf und entnahm ihm ein Blatt Papier, das mit Thorstens Handschrift bedeckt war.
Liebe Hanna,
ich weiß, dass ich es Dir persönlich hätte sagen müssen. Aber ich befürchte, dass ich es dann nicht durchziehen könnte. Und das würde ich mir – und letztendlich auch Dir – nie verzeihen.