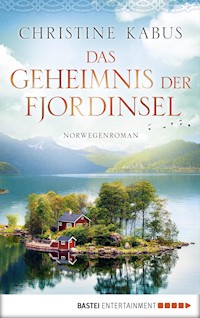10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Geheimnisse unter der Mitternachtssonne.
1941: Für Solveig ist das Leben im okkupierten Stavanger ein Balanceakt. Sie arbeitet als Übersetzerin für die Besatzer, doch als sie den jungen Ingenieur Roar kennenlernt, schließt sie sich dem Widerstand an. Dass sie damit nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Liebe in große Gefahr bringt, wird Solveig erst bewusst, als sie eine erschütternde Nachricht erhält.
1970: Als ihr Vater von seiner Ölbohrfirma aus den USA nach Norwegen geschickt wird, ahnt Lizzy noch nicht, dass in seiner alten Heimat ein Geheimnis aus seiner Vergangenheit schlummert, das auch ihr Leben durcheinanderwirbeln wird ...
Ein Familiengeheimnis vor der Kulisse der wildromantischen Fjordlandschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 682
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
1941: Seitdem Solveig als Schreibkraft und Übersetzerin für die deutschen Besatzer arbeitet, befindet sie sich immer wieder in einem Zwiespalt. Sie möchte sich dem Widerstand anschließen, doch erst, als sie den jungen Ingenieur Roar kennenlernt, erkennt sie, wie sie die geheimen Informationen nutzen kann, auf die sie im Reichskommissariat in Stavanger Zugriff erhält. Hals über Kopf verliebt sie sich in Roar, doch weder er noch sie ahnen, welche Gefahr ihnen und ihrer Liebe droht …
1970: Noch ehe Lizzy erstmals Fuß auf norwegischen Boden setzt, hat sie die Nase voll von dem Land, das ihr neues Zuhause werden soll. Warum hat ihr Vater das Angebot seines Arbeitsgebers angenommen, ihn nach dem Ölfund vor der Küste Stavangers zurück in seine alte Heimat zu versetzen? Anstatt mit ihrer besten Freundin in Kalifornien aufs College zu gehen, kommt sich Lizzy im beschaulichen Stavanger fehl am Platze vor – bis sie dem jungen Taucher Erik begegnet und immer mehr über die wahren Gründe erfährt, die ihren Vater zurück nach Norwegen geführt haben …
Über Christine Kabus
Christine Kabus, 1964 in Würzburg geboren und in Freiburg aufgewachsen, arbeitete nach ihrem Studium der Germanistik und Geschichte zunächst einige Jahre als Dramaturgin und Lektorin bei verschiedenen Film- und Theaterproduktionen, bevor sie sich 2003 als Drehbuchautorin selbstständig machte. 2013 wurde ihr erster Roman veröffentlicht.
Im Aufbau Taschenbuch sind ihre Romane »Die Zeit der Birken« und »Die Birken der Freiheit« erschienen.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Christine Kabus
Das Licht der Fjorde
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Motto
Prolog
Kapitel 1 — Stavanger, Januar 1970
Kapitel 2 — Stavanger, Mai 1941
Kapitel 3 — Stavanger, Januar 1970
Kapitel 4 — Stavanger, Mai 1941
Kapitel 5 — Stavanger, Januar 1970
Kapitel 6 — Stavanger, Mai 1941
Kapitel 7 — Stavanger, Januar 1970
Kapitel 8 — Stavanger, Mai 1941
Kapitel 9 — Stavanger, Januar 1970
Kapitel 10 — Stavanger, Mai 1941
Kapitel 11 — Stavanger, Januar 1970
Kapitel 12 — Stavanger, Mai 1941
Kapitel 13 — Stavanger, Januar 1970
Kapitel 14 — Stavanger, Mai 1941
Kapitel 15 — Stavanger, Januar 1970
Kapitel 16 — Stavanger, Mai 1941
Kapitel 17 — Stavanger, Januar 1970
Kapitel 18 — Stavanger, Mai 1941
Kapitel 19 — Stavanger, Januar 1970
Kapitel 20 — Oslo, Mai 1941
Kapitel 21 — Stavanger, Januar 1970
Kapitel 22 — Oslo, Mai 1941
Kapitel 23 — Stavanger, Januar 1970
Kapitel 24 — Oslo, Mai 1941
Kapitel 25 — Stavanger, Februar 1970
Kapitel 26 — Stavanger, Mai 1941
Kapitel 27 — Stavanger, Februar 1970
Kapitel 28 — Stavanger, Mai 1941
Kapitel 29 — Oslo, Februar 1970
Kapitel 30 — Stavanger, Juni 1941
Kapitel 31 — Oslo und Stavanger, Februar – März 1970
Kapitel 32 — Stavanger, Juli 1941
Kapitel 33 — Stavanger, März 1970
Kapitel 34 — Stavanger, Juli 1941
Kapitel 35 — Stavanger, März 1970
Kapitel 36 — Stavanger, Juli 1941
Kapitel 37 — Stavanger, März 1970
Kapitel 38 — Stavanger, August 1941
Kapitel 39 — Stavanger, Frühling 1970
Kapitel 40 — Stavanger, Juli 1941
Kapitel 41 — Stavanger, Frühling 1970
Kapitel 42 — Stavanger, August 1941
Kapitel 43 — Stavanger, Frühling 1970
Kapitel 44 — Stavanger, Herbst 1941
Kapitel 45 — Stavanger, Frühling 1970
Kapitel 46 — Stavanger, Winter 1941
Kapitel 47 — Stavanger, Frühling 1970
Lizzy
Solveig
Lizzy
Solveig
Lizzy
Solveig
Epilog
Anmerkungen
Vielen Dank – tusen takk!
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Für Shahnaz Du wirst immer einen Platz in meinem Herzen haben.
Det er det du gjør og ikke det du sier som viser hvem du egentlig er.
Was du machst und nicht, was du sagst, zeigt, wer du eigentlich bist.
Prolog
Sie stand in einigen Metern Entfernung zwischen den Baumstämmen und winkte ihn zu sich. »Ich komme!«, rief er. Er konnte es kaum erwarten, sie in seine Arme zu schließen und ihre Lippen auf den seinen zu spüren. Doch als er zu ihr laufen wollte, verweigerten ihm seine Füße den Dienst. Sie stemmten sich tief und unbeweglich in den weichen Waldboden, während die vertraute Gestalt sich umdrehte und langsam entfernte. Er zerrte an seinen Beinen. »Bitte, bleib! Warte auf mich!« In seine Worte mischte sich höhnisches Gelächter. Er spürte, wie er von hinten an der Schulter gepackt wurde. Er bot all seine Kraft auf, um sich aus dem Griff zu winden, sich loszureißen und der entschwindenden Gestalt zu folgen. Vergebens. Es gab kein Entrinnen.
Mit einem Aufschrei fuhr der junge Mann hoch, stieß mit dem Kopf gegen etwas Hartes und riss die Augen auf. Er rieb sich die Stirn und brauchte einen Atemzug lang, um sich zurechtzufinden. Graues Dämmerlicht sickerte durch das Fenster am Ende des Ganges. Schnarchen, Stöhnen und Husten erfüllten die Baracke, in der rund siebzig Männer in dreietagigen Pritschenbetten untergebracht waren. Er sank zurück auf das seinige und starrte zur Holzplanke hoch, auf der der Häftling über ihm lag. In wenigen Augenblicken würde ein Kapo die Tür aufstoßen und sie zum Morgenappell hinaustreiben. Er schloss die Augen und versuchte, das Bohren des Hungers in seinem Bauch und das Jucken der Flohbisse zu ignorieren, von denen sein ausgemergelter Körper übersät war. Welchem Kommando er an diesem Tag wohl zugeteilt werden würde? Er verzog den Mund. Sowohl das Steinehauen und -schleppen als auch die Erdarbeiten waren Schwerstarbeit. Die Hoffnung, für vergleichsweise leichtere Dienste eingesetzt zu werden, hatte er schnell begraben. Als einer der NN-Gefangenen gehörte er zu den Insassen, die als besonders widerständig galten. Sie sollten komplett »verschwinden« – was nichts anderes bedeutete, als sie durch Knochenarbeit zu töten. Aus diesem Grund wurden sie nicht in der Küche, dem Krankenrevier, der Wäscherei oder in einer der Werkstätten eingesetzt. Erst recht blieben ihnen »privilegierte« Tätigkeiten in der SS-Verwaltung als Schreiber, Übersetzer, Friseure, Reinigungskräfte oder als Musiker im Lagerorchester verwehrt. Der Plan ging auf. Tag für Tag forderte die Plackerei im Steinbruch oder beim Ausheben der Stollen mehrere Todesopfer unter den von Unterernährung, Krankheiten und Verletzungen geschwächten Männern, die obendrein von den Kapos immer wieder mit Knüppeln malträtiert wurden.
Er biss die Zähne aufeinander. Nein, mich kriegen die nicht klein, versprach er sich. Ich werde das hier überleben!
Zwei Dinge ließen ihn durchhalten und auch in dunkelsten Stunden an ein Ende des Horrors glauben: Erstens der Wunsch, seine Liebste wiederzusehen und endlich das Leben mit ihr zu beginnen, von dem sie beide so oft geträumt hatten. Und zweitens, und dieses Gefühl gab ihm fast noch mehr Antrieb: glühender Hass. Weniger auf seine unmittelbaren Peiniger, die SS-Wachmänner und ihre Schergen, die Kapos. Auch wenn der junge Mann diese zutiefst verabscheute, so galt sein Hass vor allem dem oder den Menschen, denen er seine trostlose Lage verdankte. Seit seiner Festnahme beherrschte ihn eine Frage: Wie war er ins Visier der Deutschen geraten? Warum hatten sie ihm an jenem Abend aufgelauert?
War es möglich, dass er das Opfer einer Verwechslung war? Etwa zur gleichen Zeit wie er waren landesweit mehrere Personen wegen des Hortens von Waffen, Munition und Sprengstoff gefangen genommen und einige Monate später zusammen mit ihm als sogenannte Nacht-und-Nebel-Häftlinge in Natzweiler eingeliefert worden. Dazu passten die Vorwürfe, die die deutsche Sicherheitspolizei gegen ihn erhoben hatte. In den endlosen Verhören in Grini, dem Polizeihäftlingslager in der Nähe von Oslo, war er zu seiner Überraschung bezichtigt worden, sich als Schmuggler von Gewehren, Pistolen und anderen Handfeuerwaffen betätigt zu haben, die von England heimlich nach Norwegen gebracht wurden, um die dortigen Widerstandskämpfer auszustatten. Auch am Tag seiner Verhaftung sei er in dieser Mission unterwegs gewesen. Die Revolver samt Munition, die man in seiner Unterkunft gefunden hatte, waren seinen Anklägern Beweis genug gewesen. Für eine Verwechslung sprach, dass die Nazis nichts von seiner eigentlichen Tätigkeit im Widerstand wussten.
Je mehr er darüber nachdachte, umso weniger überzeugte ihn allerdings diese These. Nicht zuletzt, weil er noch nie eine Waffe besessen hatte. Mittlerweile gab es für ihn nur eine stichhaltige Erklärung: Jemand hatte ihn angeschwärzt und ihm die Revolver untergeschoben. Aber wer? Und warum? War es der Vorarbeiter gewesen? Der Mann hatte sich einen schweren Patzer geleistet und versucht, die Sache einem anderem in die Schuhe zu schieben – was er verhindert hatte. Gut möglich, dass der Vorarbeiter aus Rache zur Staatspolizei gelaufen war. Zumal er kein Geheimnis daraus machte, dass ihn die Ideologie der Nazis begeisterte. Als Anhänger Vidkun Quislings war er kurz nach der Besatzung Norwegens in dessen nationalsozialistische Partei Nasjonal Samling eingetreten. Ihm waren eine solche Verleumdung und die dazu nötige Skrupellosigkeit zuzutrauen.
Hundegebell und das Schrillen einer Trillerpfeife rissen ihn aus seinen Überlegungen. Seine Hand tastete unwillkürlich nach dem Steinchen, das er in den Saum seiner zerschlissenen Jacke eingenäht hatte. Wie durch ein Wunder war es bei all den Verlegungen und Transporten nie verloren gegangen oder bei einer der unzähligen Durchsuchungen seiner Sachen konfisziert worden. In den Augen der Deutschen war es gewiss nur ein wertloser Kiesel. Zum Glück ahnten sie nicht, welche Bedeutung der unscheinbare rötlich-orangene Stein für ihn hatte. Er war das Unterpfand ihrer Liebe, das Einzige, was ihm von ihr geblieben war, nachdem man ihm das Amulett mit ihrem Porträt abgenommen hatte.
Er atmete tief durch, kletterte aus seiner Koje und folgte den anderen Häftlingen nach draußen, wo ein weiterer Tag in dieser von Menschen erschaffenen Hölle auf ihn wartete.
1
Stavanger, Januar 1970
Lizzy fror. Sie zog die Schultern hoch und trottete mit gesenktem Kopf hinter ihrer Mutter her, die von der Gangway des Flugzeugs über die Landebahn zum Abfertigungsgebäude lief, auf dem in großen Lettern Stavanger Lufthavn stand. In den Pfützen auf dem Asphalt spiegelten sich die Positionsleuchten der Passagiermaschine der British European Airways und das Licht, das aus den Fenstern des Terminals und des Towers schien. Pünktlich um 15:30 Uhr waren sie in Sola gelandet, und Lizzy hatte zum ersten Mal in ihrem siebzehnjährigen Leben europäischen Boden betreten. Der kurze Aufenthalt im Heathrow Airport zählte für sie nicht. Eine Windböe, die ihr feine Graupelkörner ins Gesicht blies, ließ sie erschauern und ihre Schritte beschleunigen. Nur schnell ins Warme!
Ihr fünf Jahre jüngerer Bruder Chris sprang ihnen voraus. Bereits auf dem Flug über die Nordsee hatte es ihn kaum auf seinem Sitzplatz gehalten. Alle zehn Minuten hatte er sich erkundigt, wann sie endlich ankämen und sich die Stupsnase an dem kleinen Fenster platt gedrückt, um als Erster einen Blick auf ihre neue Heimat zu erhaschen.
Lizzy war genervt von seiner Begeisterung, die ihr schonungslos vor Augen führte, wie unglücklich und sauer sie selbst über diese Reise war. Wie konnte sich Chris nur so schnell mit dem Verlust seines bisherigen Lebens abfinden? Er ließ doch auch gute Freunde, vertraute Orte und nicht zuletzt die Los Angeles Rams zurück. Als glühender Fan der NFL-Footballmannschaft hatte er in den letzten drei Jahren kein einziges ihrer Spiele verpasst und trug auch in diesem Moment die navy-blaue Schirmmütze mit dem stilisierten gelben Widderkopf. Machte ihm der Abschied von alledem wirklich nichts aus? Oder verarbeitete er seinen Kummer nur anders als sie und tröstete sich mit den neuen Abenteuern, die auf ihn warteten?
Nachdem ihr Bruder hatte einsehen müssen, dass hinter der von Regentröpfchen bedeckten Scheibe nur das dunkle Grau der Wolken waberte, in die sie eine Stunde nach ihrem Start in London hineingeflogen waren, hatte er sich darauf verlegt, die Stewardess mit Fragen zu technischen Details der Maschine sowie über Flughöhe, Geschwindigkeit oder Außentemperatur zu löchern. Als die junge Frau von einem anderen Passagier gerufen worden war, hatte Chris sich von seiner Mutter Cathleen den Reiseführer Your Guide to Norway geben lassen und versucht, seine Schwester für das skandinavische Land zu begeistern: »Wusstest du, dass es in Norwegen Bären, Luchse und Wölfe gibt?« Oder: »Hättest du gedacht, dass zwischen dem nördlichsten und dem südlichsten Punkt 1752 Kilometer liegen? Das ist ungefähr die gleiche Entfernung wie zwischen …«
Lizzy hatte ihn mit eisigen Blicken zum Verstummen gebracht und sich demonstrativ hinter den Seiten der aktuellen Ausgabe des »Teen Magazine« verschanzt, einer der Jugend-Zeitschriften, mit denen sie sich vor dem Abflug in Denver eingedeckt hatte. Wer wusste schon, wann und ob überhaupt sie in diesem von Hinterwäldlern bevölkerten Norwegen die Gelegenheit bekommen würde, amerikanische Magazine zu erwerben.
Die Januarausgabe war dem Thema Stewardess gewidmet, und auf dem Cover war das Model Jill Twiddy zu sehen, das mit verzücktem Augenaufschlag gen Himmel blickte. Lizzy hatte nach dem Ende der Highschool im vergangenen Sommer kurz mit dem Gedanken gespielt, Flugbegleiterin zu werden. Seit sie als kleines Mädchen mit ihren Eltern von ihrem damaligen Zuhause in Florida nach Denver zu ihren Großeltern mütterlicherseits geflogen war, wollte sie Pilotin werden. Es schien ihr der herrlichste Beruf der Welt zu sein. Zum einen, weil er die Möglichkeit bot, die entlegensten Länder und Kulturen besuchen zu können, ohne teure Reisen dorthin unternehmen zu müssen. Nach Langstreckenflügen hatten die Flugzeugcrews meistens mehrere Tage Urlaub und so die Gelegenheit, die exotischsten Orte zu erkunden, wobei es Lizzy in erster Linie südliche Gefilde angetan hätten. Zum anderen aber – und das war für Lizzy der entscheidende Punkt – würde er ihren Traum vom Fliegen zumindest ein Stück weit erfüllen. Dieses wundervolle Gefühl der Schwerelosigkeit, sich in die Luft schwingen zu können und vom Wind tragen zu lassen – so, wie sie es aus ihren nächtlichen Träumen kannte. Ein Gefühl der Freiheit, das sie in ähnlicher Form im Wasser erlebte und das zu ihrer Leidenschaft fürs Schwimmen geführt hatte.
Als Lizzy mit der Zeit klar wurde, dass ihr als Frau eine Piloten-Karriere in der kommerziellen Luftfahrt verwehrt war, hatte sie sich damit getröstet, als Stewardess ihren Wunschtraum wenigstens teilweise verwirklichen zu können. Sie hatte die Idee jedoch schnell wieder verworfen. Abgesehen davon, dass sie direkt nach dem Schulabschluss ein Jahr zu jung für eine Bewerbung gewesen war, hatte Lizzy viele der zu erfüllenden Bedingungen abstoßend gefunden. Die Radio-Spots mit Jobangeboten für Flugbegleiterinnen hatten sich angehört, als ginge es um den Aufruf zu einer Miss-Wahl. Die Airline steckte ihre Flugbegleiterinnen nicht nur in pink-orangefarbene Miniröcke mit passenden Hotpants und halbhohen Stiefeln, sondern hielt sie auch dazu an, orangefarbenen Lippenstift, falsche Wimpern und Eyeliner zu tragen.
Lizzy war mit ihren ein Meter siebzig zwar in der vorgeschriebenen Größenskala, die geforderte sehr schlanke Linie mit schmaler Taille konnte sie dagegen nicht vorweisen. Sie war nicht dick, hatte jedoch einen stämmigen, und – dank ihres jahrelangen Schwimmtrainings – muskulösen Körper, der sich in den vorgeschriebenen figurbetonten Outfits nicht gut gemacht hätte. Lizzy hasste ohnehin eng anliegende Kleidung, in der sie kaum Bewegungsfreiheit hatte. Sie bevorzugte bequem sitzende Jeans, selbst gebatikte Blusen und weite Röcke.
Letztendlich aber waren es vor allem zahlreiche weitere Vorschriften, die Lizzy von diesem Berufswunsch abgebracht hatten. So wurde das weibliche Kabinenpersonal spätestens mit 35 Jahren zum Dienst am Boden verdonnert, während die männlichen Angestellten bis über das 60. Lebensjahr hinaus an Bord arbeiten durften. Viele Airlines hatten eine Vertragsklausel mit einem Heiratsverbot für Flugbegleiterinnen. Und bei den hawaiianischen Aloha Airlines mussten diese auch das In-Flight-Entertainment bestreiten und während des Flugs singen, Hula tanzen und Ukulele spielen.
Lizzy fand diese Gängelungen demütigend. Warum wurden Frauen nahezu immer auf dienende Tätigkeiten reduziert? Warum war ihnen der Zugang zu vielen Berufen gar nicht erst möglich? Und weshalb schien alle Welt zu glauben, dass Frauen nichts anderes erstrebenswert fanden, als die Herren der Schöpfung zu verwöhnen und zu beglücken? Sei es nun als Ehefrau, die sich um das Wohl der Familie und den Haushalt kümmerte, oder in Berufen, in denen Service und Betreuung in allen möglichen Facetten im Vordergrund standen. Es war so ungerecht! Warum waren – von wenigen Ausnahmen abgesehen – nur Männer Ingenieure, Wissenschaftler, Dirigenten oder eben Piloten?
»Dad ist nicht da!«
Mit diesem Ruf kam ihnen Chris entgegengerannt, als Lizzy und ihre Mutter gerade das Terminal betraten.
»Bist du sicher?«
Cathleen rückte das lachsfarbene Pillboxhütchen zurecht, das auf ihrer am Hinterkopf hochtoupierten Frisur thronte. Nach vorne liefen ihre schulterlangen Haare in einer sanften Außenwelle aus und umrahmten ihr ovales Gesicht mit den flächigen Zügen und dunklen Augen – ein Erbe der Cheyenne-Frau, die ihr Großvater einst geheiratet hatte. Lizzy hatte die gleichen glatten schwarzen Haare, die bei ihr bis zur Taille reichten. Die hellgrauen Augen mit der dunklen Umrandung dagegen waren ein Erbe ihres Vaters Roger. Ihr Bruder kam mit seinen rotblonden Locken, den grünen Augen und den Sommersprossen ganz nach seinem Großvater, dessen Wurzeln in Irland lagen.
»Seht mal«, sagte Lizzy mit Blick auf eine Handvoll Menschen, die hinter einer Absperrung standen. »Ich glaube, damit sind wir gemeint.« Sie zeigte auf einen Mann in dunklem Anzug, weißem Hemd, Krawatte und Schirmmütze, der ein Schild hochhielt und die ankommenden Passagiere musterte.
Family COLE stand auf der Pappe. Der Mann hob grüßend die Hand. Lizzy nickte ihm zu und stellte sich zu ihrer Mutter und Chris in die kurze Schlange, die sich vor der Passkontrolle gebildet hatte. Vor ihnen warteten zwei Damen, die bordeauxfarbene eingebundene Pässe in den Händen hielten. In der Mitte prangte in Goldprägung ein dreieckiges Wappen mit einem auf den Hinterbeinen stehenden, gekrönten Löwen, der mit den Vordertatzen eine langstielige Axt hielt. Auf der abgerundeten Spitze des Wappens thronte eine Krone. Lizzy beugte sich unauffällig nach vorn und las über dem Emblem die Worte NORGE, NOREG und NORWAY. Dabei ertappte sie sich, wie sie gebannt der Unterhaltung der Frauen lauschte. Sie verstand zwar kein Wort, fand die Sprache jedoch faszinierend. Sie klang melodisch, als würden die beiden eher singen als sprechen.
Wenige Minuten später passierten sie mit ihrem Handgepäck die Absperrung. Die großen Koffer mit ihrer Kleidung hatten sie vorausgeschickt, zusammen mit einigen Kisten, in denen Cathleen persönliche Gegenstände, Bücher, Schallplatten, Fotoalben und andere Dinge verstaut hatte, die sie in ihr neues Zuhause begleiten sollten.
Lizzy war es schwergefallen, ihr Zimmer aufzugeben und sich von ihren geliebten Möbeln trennen zu müssen. Erst zum letzten Geburtstag hatte sie den halbkugelförmigen Ball Chair mit roten Polstern bekommen, der schon lange auf ihrer Wunschliste gestanden hatte. Zusammen mit ihren anderen sperrigen Besitztümern lagerte er nun auf unbestimmte Zeit im Keller von Grandma und Grandpa, bis sich geklärt hätte, für wie lange die Coles ihre Zelte in Norwegen aufschlagen würden und ob es sich lohnte, die Sachen nachzuholen.
Es war das erste Mal, dass die Familie nicht innerhalb der Vereinigten Staaten umzog, und Roger Cole von seinem Arbeitgeber, der Phillips Petroleum Company, in ein anderes Land versetzt wurde. Während Roger bereits vor Silvester nach Stavanger aufgebrochen war, wo ihn dringende Aufgaben erwarteten, hatten seine Frau Cathleen und die beiden Kinder noch einen Abstecher nach Denver gemacht. Auch wenn ihre Großeltern nie in derselben Stadt gelebt hatten wie Lizzy, waren sie seit jeher ein wichtiger Teil ihres Lebens. Sie kamen oft zu Besuch und freuten sich, wenn zumindest die Kinder und Cathleen einen Großteil der Sommer- und Winterferien bei ihnen verbrachten. Die Vorstellung, dass nun ein ganzer Ozean zwischen ihnen lag, fand Lizzy beklemmend. Wann würden sie sich wiedersehen?
»Welcome, Mrs. Cole.«
Der Mann mit dem Pappschild trat zu ihnen und tippte mit der Hand an die Mütze, über deren Lackschirm das Emblem der Firma Phillips prangte: ein schwarz umrandetes Wappenschild mit dem Firmennamen in Großbuchstaben, darunter in einem roten Feld die Ziffer 66. »I am here to pick you and your children up and drive you to the hotel.«
Er hob den Ton am Ende der Sätze ein wenig an, was seinen Willkommensgruß wie eine Frage klingen ließ. Ansonsten war sein Englisch fehlerfrei. Lizzy, die ihn aus der Ferne wegen seines förmlichen Anzugs für einen gestandenen Mann gehalten hatte, erkannte, dass er wohl erst Anfang zwanzig war, also nur ein paar Jahre älter als sie.
»Ins Hotel?« Cathleen hob die Brauen.
Gleichzeitig erkundigte sich Chris, warum sein Vater nicht da war.
Lizzy hatte den Eindruck, dass dem Chauffeur die Fragen unangenehm waren. Er wich ihren Blicken aus und zog ein gefaltetes Papier aus seiner Brusttasche, das er Lizzys Mutter reichte. Gleich darauf griff er nach den Reisetaschen und lief rasch zu einer Glastür, hinter der ein Parkplatz lag. Cathleen überflog derweil die Zeilen auf dem Briefbogen. Lizzy, die sie aufmerksam beobachtete, sah, wie sie die Lippen zusammenpresste.
»Von Dad?«, fragte sie. »Was schreibt er?«
»Dass es ihm schrecklich leidtut, uns nicht persönlich abholen zu können«, antwortete ihre Mutter, sichtlich um einen entspannten Ton bemüht. »Er will versuchen, zum Abendessen im Hotel zu sein.«
»Wir wohnen in einem Hotel?« Chris’ Augen weiteten sich. »Hoffentlich hat es einen Swimmingpool.« Er rannte dem Chauffeur hinterher.
»Wieso gehen wir ins Hotel?«, fragte Lizzy. »Wollte Dad nicht eine möblierte Wohnung oder ein Haus für uns organisieren?«
»Das war der Plan.« Cathleen zuckte mit den Schultern. »Vermutlich war er da zu optimistisch. Schließlich hatte er ja nur wenige Tage Zeit für die Suche. Wenn er überhaupt dazu kam. Er scheint ja von seiner Arbeit voll in Beschlag genommen zu sein.« Sie straffte sich und ging zum Ausgang.
Lizzy runzelte die Stirn. Sie konnte sich nicht erinnern, dass ihr Vater sie jemals nicht persönlich in Empfang genommen hatte, wenn sie getrennt von ihm an einen neuen Wohnort gereist oder aus den Ferien bei den Großeltern zurückgekommen waren. Jedes Mal hatte er – mit einem großen Blumenstrauß für seine Frau und Süßigkeiten für die Kinder – am Flughafen, Bahnhof oder an einer Busstation gestanden und sie mit großem Hallo begrüßt. Vor allem aber hatte er stets vorab Bescheid gegeben, wenn sich an ihren Absprachen etwas Grundlegendes änderte.
Lizzy verengte die Augen. Warum hatte er Mom nicht angerufen und ihr gesagt, dass er noch keine dauerhafte Bleibe für uns gefunden hat? Zumindest ein Telegramm hätte er schicken können. Lizzy schluckte und fragte sich, ob das ein schlechtes Vorzeichen für ihren Aufenthalt in Norwegen war. Sei nicht albern, wies sie sich im selben Atemzug zurecht. Mom liegt sicher richtig. Dad hat einfach extrem viel um die Ohren. Lizzy rückte ihre Umhängetasche zurecht und folgte den anderen.
Draußen war die Dämmerung, in der sie gelandet waren, inzwischen in Dunkelheit übergegangen. Finsternis mitten am Tag. Lizzy schob die Unterlippe vor. In Los Angeles, wo es jetzt 7 Uhr war, ging gerade die Sonne auf. Sie würde erst um 17 Uhr wieder untergehen, während sie in Stavanger im Januar maximal sechseinhalb Stunden lang schien. Wenn man sie denn überhaupt zu Gesicht bekam. Dass die Winter in dieser Stadt an Norwegens Westküste lang sowie sehr windig wären, und der Himmel überwiegend wolkenverhangen, hatte Chris aus einem der Reiseführer vorgelesen. Außerdem sei es das ganze Jahr über nass.
So wie in diesem Moment, als sie über den Platz hinter dem Terminal lief. In ihre Nase stiegen der Gestank des Auspuffgases eines anfahrenden Pkws, dazu der harzige Rauchgeruch eines Holzfeuers sowie eine herbe Note, die sie nicht zuordnen konnte. Lizzy hielt kurz inne, fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und schmeckte bitteres Salz. Das muss vom Meer kommen, dachte sie und lief weiter. Auf dem Parkplatz standen nur wenige Autos. Vor einem schwarzen Wagen, den Lizzy an dem Stern auf der Motorhaube als Mercedes erkannte, standen Chris und der Chauffeur in ein lebhaftes Gespräch vertieft, ihre Mutter hatte bereits auf dem Beifahrersitz Platz genommen.
»Lizzy, sieh mal, was für ein tolles Auto die Firma Dad zur Verfügung stellt.« Ihr kleiner Bruder strahlte übers ganze Gesicht. »Das ist ein brandneuer 280 SE aus dem letzten Jahr, Baureihe W108.«
»Aha«, brummte Lizzy. »Ist mir egal. Hauptsache er fährt und ist geheizt.«
Der Chauffeur öffnete ihr die hintere Tür. Täuschte sie sich, oder verbiss er sich ein Grinsen? Unverschämter Bursche, dachte Lizzy, kniff die Lippen zusammen und stieg ein. Nachdem auch Chris auf der Rückbank saß, ließ der Chauffeur den Motor an und fuhr vom Parkplatz auf eine Straße, die Richtung Nordwesten führte. Im Wagen herrschte Schweigen.
»Möchten Sie vielleicht ein bisschen Musik hören?«, erkundigte sich der Chauffeur nach einer Weile bei Cathleen.
Diese nickte mit abwesendem Gesichtsausdruck. An was denkt Mom wohl gerade?, fragte sich Lizzy. Ist sie sauer auf Dad? Sie musterte ihre Mutter aufmerksam, konnte deren Miene jedoch nicht deuten. Aus dem Autoradio, in das ein Kassettenspieler integriert war, tönte der karibisch anmutenden Keyboard-Riff, der den Song »Sugar, Sugar« von den Archies einleitete. Die Firma lässt sich wirklich nicht lumpen, stellte Lizzy fest. Alles auf dem neuesten Stand der Technik. Chris gähnte herzhaft, kuschelte sich an ihre Schulter und nickte ein. Lizzy beneidete ihn um die Gabe, in fast jeder Lage sofort Schlaf zu finden. Sie legte einen Arm um ihn und sah aus dem Seitenfenster, hinter dem in der Dunkelheit schneebedeckte Wiesen und Felder schimmerten. Ab und zu schienen Lichtpunkte auf, die vermutlich von erleuchteten Fenstern vereinzelter Gehöfte und kleiner Siedlungen stammten. Als sie den Kopf wendete, um die andere Seite zu betrachten, bemerkte sie, dass der Chauffeur sie im Rückspiegel musterte.
Was glotzt der so? Lizzy senkte rasch die Augen, beugte sich über ihre Umhängetasche, die sie zu ihren Füßen abgestellt hatte, und zog eine Ausgabe des »YM Magazine« heraus, das sie bislang noch nicht gelesen hatte. Keine gute Idee. Das Covergirl, die Sängerin Jackie De Shannon, erinnerte sie mit ihren großen, dichtbewimperten Augen sowie der dunkelblonden Mähne und dem Pony, das bis zu den Brauen reichte, an ihre beste Freundin Shirley.
Und jetzt erklang auch noch die erste Strophe von John Denvers Folksong »Leaving on a Jet Plane«, dessen Einspielung durch das Trio Peter, Paul & Mary zum Jahreswechsel den ersten Platz in den US-Charts erreicht hatte. Und offensichtlich auch in Norwegen bekannt war.
All my bags are packed I’m ready to go
I’m standin’ here outside your door
I hate to wake you up to say goodbye
War wirklich erst eine knappe Woche vergangen, seit sie Shirley das letzte Mal gesehen hatte? Seit sie sich auf der Highschool angefreundet hatten, war in den vergangenen fünf Jahren kaum ein Tag vergangen, an dem sie sich nicht gesehen hatten. Ende Januar hatten sie ihre achtzehnten Geburtstage gemeinsam feiern wollen. Der Gedanke an die geplatzte Doppelparty verstärkte ihre Traurigkeit. Lizzy summte kaum hörbar die Melodie des Refrains mit und zwinkerte die Tränen weg, die ihr in die Augen gestiegen waren.
I’m leavin’ on a jet plane
I don’t know when I’ll be back again
Oh babe, I hate to go
2
Stavanger, Mai 1941
Die Glocke von St. Petri schlug zur halben Stunde, als Solveig von der Vinkelgata, in der sie mit ihren Eltern wohnte, in die Langgata einbog. Auch diese Straße war von Ein- bis Zweifamilienhäusern geprägt, die auf Steinsockeln ruhten und mit weiß getünchten Holzpaneelen verschalt waren. Die Sonne, die bereits um fünf Uhr aufgegangen war, strahlte am Himmel. Es versprach, ein heißer Tag zu werden, sobald sich der Wind wie an den vorigen Tagen am späten Vormittag legen würde. Solveig schaute zu den Wölkchen hinauf, die von einer frischen Brise vom offenen Meer her nach Osten getrieben wurden und atmete tief ein. Die Neunzehnjährige liebte den herben Geruch nach Salz und Tang, in den sich eine Rauchnote von den Fischfabriken am Hafen sowie der süße Duft eines blühenden Fliederbusches mischten, der über den Gartenzaun eines Grundstücks wucherte.
An der nächsten Kreuzung verharrte Solveig einen Moment lang, ließ ihre Augen die Pedersgata hinabwandern und hielt nach Kindern Ausschau, die von den Schulen des Viertels zum Nytorget liefen. Dort würden sie sich an die Spitze der Musikkapellen stellen und mit ihnen zum Marktplatz am Vågen, dem innerstädtischen Hafenbecken, marschieren, wo sie auf die Gruppen der anderen Stadtviertel treffen würden. Nach der Ansprache des Bürgermeisters, die den Verfassungstag um acht Uhr offiziell einläutete, würden alle zum Gottesdienst in die Domkirche St. Svithun strömen.
Die beiden Glockenschläge verklangen, erneut legte sich Stille über die Straßen. Erst in diesem Moment wurde Solveig bewusst, dass auch dieses Jahr keine hellen Kinderstimmen, Hurra-Rufe, Trommelwirbel und Blasmusik an ihre Ohren dringen würden. Die Deutschen hatten den 17. Mai zu einem gewöhnlichen Arbeitstag erklärt und sowohl den Umzug als auch die anschließenden Feierlichkeiten und insbesondere das Singen der Nationalhymne unter Androhung drakonischer Strafen untersagt. Immerhin hatte Reichskommissar Josef Terboven in diesem Jahr das Beflaggungsverbot teilweise gelockert.
Solveig setzte ihren Weg fort. Während sie die Straße hinunterlief, wanderten ihre Gedanken zum Mai 1939, wo sie zum vorläufig letzten Mal den Nationaltag gefeiert hatten. Wie sehr hatte sie sich damals auf das kommende Jahr gefreut, in dem sie und ihre Mitschüler sich als russ – frischgebackene Abiturienten – mit roten Mützen und schleifengeschmückten Bambusstöcken in den barnetog einreihen, in Kuhhörner blasen und grölen würden:
Chickelacke, chickelacke, show, show, show!
Bummelacke, bummelacke, bow, bow, bow!
Chickelacke, bummelacke, jazz bom bøh!
Julekake, julekake, hjembakt brød!
Wæææææ!
Der Überfall der Deutschen Wehrmacht am 9. April 1940 hatte ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber Solveig und ihren Klassenkameraden war ohnehin nicht nach ausgelassenem Feiern zumute gewesen. Der Schock, in den Krieg hineingezogen und besetzt zu werden, hatte nicht nur die Abiturienten in ein lähmendes Gefühlschaos aus Empörung, Angst und Ratlosigkeit gestürzt. Die meisten Norweger – sofern sie nicht Anhänger von Vidkun Quisling und seiner faschistischen Partei waren – waren in den ersten Tagen der Besatzung verunsichert gewesen. Anders als im ebenfalls neutralen Dänemark, das zur selben Zeit überrollt worden war, hatten sich der norwegische König und seine Regierung geweigert, mit den Deutschen zu kooperieren und einen Status des Landes als eine Art Musterprotektorat von Hitlers Tausendjährigem Reich anzuerkennen. Auch eine Abdankung lehnte Haakon VII. ab. Stattdessen waren er, seine Familie und die Staatsminister aus Oslo zunächst in den Norden des Landes und schließlich nach England geflohen. Seine Streitkräfte kämpften noch zwei Monate lang erbittert gegen die Invasoren, bevor sie am 10. Juni 1940 vor der erdrückenden deutschen Übermacht kapitulieren mussten. König Haakon VII. hatte derweil in London mit seinem Kabinett eine Exilregierung etabliert und propagierte seitdem unermüdlich den Widerstand gegen die Besatzer seines Vaterlandes.
Solveig überquerte den Nytorget, den ehemaligen Pferdemarkt. Gegenüber der im neoromanischen Stil gebauten Petrikirche verließ gerade ein Dutzend Polizisten ihr Revier, das sich seit ein paar Jahren in der ehemaligen Petrischule befand. Sie waren vermutlich von den Deutschen aufgefordert worden, für die Einhaltung der Verbote am Nationalfeiertag zu sorgen und Störenfriede dingfest zu machen. Die Ordnungshüter waren bei Weitem nicht die Einzigen, die mit oder für die Besatzer arbeiteten.
Aus Sicht ihrer im Exil lebenden Landsleute mochte es einfach sein, sie hatten eine genaue Vorstellung davon, wie sich »anständige« Norweger zu verhalten hatten: Wenn man sich nicht getraute, den Besatzern offen die Stirn zu bieten, sollte man wenigstens den Kontakt mit ihnen nach Möglichkeit vermeiden und keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass man den Tag herbeisehnte, an dem sie verschwinden würden. Der schien jedoch in weite Ferne gerückt. Die anhaltenden Erfolge der Wehrmacht an allen Fronten führten bei vielen Norwegern zu der Überzeugung, noch lange unter der deutschen Herrschaft leben und sich wohl oder übel mit ihr arrangieren zu müssen. Solveig fragte sich außerdem, wie man sich von den Deutschen fernhalten sollte, wenn sie einem buchstäblich an jeder Straßenecke, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Geschäften, im Kino, am Badestrand sowie anderen Freizeitstätten und vor allem bei der Arbeit begegneten.
Anfangs hatten sich Solveigs Familie sowie die meisten ihrer Freunde und Bekannten bemüht, sich nicht mit dem Feind »gemeinzumachen«. Auf Dauer war es schlechterdings unmöglich, diese Haltung beizubehalten. In Stavanger, dem Verwaltungszentrum der Provinz Rogaland, waren besonders viele Deutsche stationiert. Die Stadt, die seit 1937 über einen modernen Flughafen verfügte, war neben Oslo einer der fünf Orte gewesen, der im Zuge der »Weserübung« vom Wasser und aus der Luft angegriffen und binnen Stunden erobert worden war. Die Deutschen hatten umgehend die Kontrolle über die Infrastruktur der Stadt übernommen – vom Telefonamt, der Telegrafenzentrale sowie der Post über Hafen- und Zollbehörde bis hin zum Gaswerk. Später wurden Hunderte Soldaten sowie Verwaltungsbeamte dauerhaft in der Stadt stationiert. Trotz der unvermeidlichen Interessenkonflikte wurden sie mit der Zeit oft nicht mehr in erster Linie als Feinde wahrgenommen, sondern vor allem auch als Arbeitgeber, Kollegen, Kunden und Geschäftspartner, Mieter, Nachbarn, Bekannte und sogar als Freunde.
So wie Afra in den vergangenen sechs Monaten für mich zu einer Freundin geworden ist, dachte Solveig und sah das runde Gesicht mit den Grübchen und den zu Schnecken über den Ohren gerollten, dunkelbraunen Zöpfen vor sich. Die junge Bayerin war als »Blitzmädel« nach Norwegen geschickt worden. So nannten die Deutschen die Nachrichtenhelferinnen wegen des Blitz-Emblems, das auf deren schnittigen Schiffchen-Mützen und Uniformjacken gestickt war. Afra arbeitete in der Fernmeldezentrale der Wehrmacht-Stabstelle von Stavanger. War Solveig eine Verräterin, weil sie Afra in ihr Herz geschlossen hatte? Und wie vertrug sich das mit ihrem Bedürfnis, den Widerstand zu unterstützen? Diese Fragen hatten sie am Anfang umgetrieben. Auf die erste hatte Solveig mittlerweile eine eindeutige Antwort gefunden: In Bezug auf Afra zählten für sie nicht deren Nationalität, sondern einzig die Verbundenheit und Vertrautheit, die sie auf Anhieb verspürt hatte, als sie der drei Jahre Älteren zum ersten Mal begegnet war. Sie konnten schließlich nichts für die Umstände, unter denen sie sich kennengelernt hatten. Niemand wäre doch auf die Idee gekommen, Tante Märta zu verurteilen, die vierzig Jahre zuvor einen Deutschen geheiratet hatte. Genauso hätten sich Solveig und Afra zu Friedenszeiten über den Weg laufen können, ohne dass jemand daran Anstoß genommen hätte. Dass der Krieg für ein anderes Szenario gesorgt hatte, war nicht ihre Schuld.
Mittlerweile hatte Solveig den Marktplatz erreicht. Gegenüber der Domkirche, der ältesten Kathedrale des Landes, die ihre ursprüngliche Gestalt weitgehend beibehalten hatte, lag das Areal des Kongsgård. Vor den beiden Schilderhäuschen rechts und links der Einfahrt stand je ein Soldat mit umgehängtem Gewehr. Solveig blieb einige Schritte von ihnen entfernt stehen und kramte in ihrer Tasche nach dem Passagierschein, der sie berechtigte, das Gelände zu betreten. Obwohl die meisten der zur Torwache abkommandierten jungen Gefreiten keineswegs bedrohlich wirkten, löste ihr Anblick in Solveig nach wie vor ein Gefühl der Beklemmung aus. Allmorgendlich vergegenwärtigte er ihr, dass sich die Deutschen durchaus als das sahen, was sie in den Augen der meisten Norweger waren: unwillkommene Besatzer, die gut daran taten, wachsam zu sein.
Solveigs Jahrgang war vorerst der letzte gewesen, der in der Katedralskole unterrichtet worden war. Kurz nach ihrem Einmarsch hatten die Deutschen das Anwesen am Breiavatnet beschlagnahmt. Die Schüler mussten derweil in provisorische Klassenzimmer ausweichen, die im Kultur- und Naturgeschichtlichen Museum und dem Haus der Klubselskap für sie bereitgestellt worden waren. Solveigs alte Schule war nur eines von vielen Gebäuden, die sich die Deutschen unter den Nagel gerissen hatten. Das renommierte »Grand Hotel« diente ihnen zur Unterbringung illustrer Gäste und für Feierlichkeiten, das Zollamt am Hafen wurde vom Stab der Marine genutzt, die Geheime Feldpolizei und die Feldgendarmen waren nur einen Steinwurf entfernt in mehreren Häusern stationiert, Staffelunterkünfte befanden sich unter anderem in der Kampenskole, der Svithunskole und am Løkkeveien gegenüber dem Folkehuset, in der alten Turnhalle und dem Bethania Bethaus. Nur die 200 Mann starke Kompanie der Luftwaffe war weiter außerhalb in drei Kasernen untergebracht, die am Fuße des Ullandhaugen standen, auf dem die Deutschen eine Flugabwehrbatterie und Funkmasten installiert hatten.
Den Kongsgård, einen stattlichen Wirtschaftshof aus dem Mittelalter, in dem einst Könige, Bischöfe und Amtsleute residiert hatten, bevor er 1826 zur Schule umfunktioniert worden war, hatten die »Kommandatur Seeverteidigung« sowie die Wehrmachtsleitung für sich beansprucht. Auch die zivile Verwaltung, eine Außenstelle des Reichskommissariats in Oslo, hatte Büros zugeteilt bekommen – und in einem davon stand Solveigs Schreibtisch.
Das Thema »Arbeiten für die Deutschen« hatte in ihrer Familie zu hitzigen Diskussionen geführt. Es waren in erster Linie ihre Großeltern mütterlicherseits, die sich schwertaten mit dem Gedanken, Geschäfte mit den Besatzern ihres Vaterlandes zu machen. Für Solveigs Mutter Tuva, die von klein auf einen tief im Pietismus wurzelnden Arbeitsethos eingeimpft bekommen hatte, war es jedoch selbstverständlich, dass ihre Tochter nach dem Ende der Schule eine Stelle suchen sollte, um ihren Teil zum Haushalt beizutragen und für die Aussteuer zu sparen. Müßiggang kam im Weltbild von Tuva Lund nicht vor. Und da die neuen Herren im Lande ein schier unstillbares Verlangen nach helfenden Händen hatten, in der Regel anständige Löhne zahlten und der zuvor vielerorts darbenden Wirtschaft auf die Sprünge halfen, lag es auf der Hand, dass Solveig sich in das Heer der Norweger einreihte, die für die Deutschen arbeiteten.
Auch die Werft ihres Vaters, die in den letzten Jahren vor dem Krieg immer kurz am Konkurs vorbeigeschrammt war, erlebte einen Aufschwung. Die Auftragsbücher füllten sich dank der deutschen Marine, die ehemalige Walfänger und Fischkutter zu Vorpostenbooten und Minensuchschiffen umrüsten ließ. Erling Lund hatte seinen Abscheu, mit den Besatzern zu kooperieren, rasch mit dem ihm eigenen Pragmatismus überwunden. Im Gegensatz zu anderen Unternehmen würde er keine Zwangsarbeiter beschäftigen und vor allem sähe er es nicht ein, die lukrativen Aufträge der Konkurrenz zu überlassen, während er und die Seinen in kümmerlichen Verhältnissen darben müssten.
Solveig drückte die schwere Tür des Hauptgebäudes auf und schlüpfte in die Eingangshalle, von der aus eine große Treppe in die oberen Stockwerke sowie Flure in die Seitenflügel führten. Auch ein Dreivierteljahr nach ihrem ersten Arbeitstag mutete es sie noch immer seltsam an, wenn sie ihre ehemalige Schule betrat und dort nicht Kindergeschrei, Gelächter, Fußgetrappel und Pausenklingeln zu hören. Stattdessen herrschte auf den Gängen weitgehend Ruhe. Aus manchen der Büros drangen gedämpftes Schreibmaschinengeklapper, Telefonklingeln und Stimmen, ab und zu hörte man das Quietschen der mit Aktenordnern beladenen Rollwägelchen, die durch die Flure geschoben wurden. Nur der Geruch nach Bohnerwachs war noch der gleiche wie zu ihrer Schulzeit. War seither wirklich erst ein Jahr vergangen? Es fühlte sich viel länger an. Wie die Erinnerung aus einem anderen Leben in einer vergangenen Welt.
Im ersten Stock blieb Solveig kurz im Foyer stehen und betrachtete sich in der Spiegelung eines der dort aufgehängten verglasten Ölgemälde, auf denen die früheren Direktoren porträtiert waren – eine alte Angewohnheit aus Schultagen. Hatte sie damals geprüft, ob ihre Zopfschleifen nach dem wilden Fangenspielen in der Pause noch hielten oder in der Sonne weitere Sommersprossen auf Stirn und Nase dazugekommen waren, begutachtete sie nun ihren locker im Nacken aufgedrehten Dutt und steckte eine blonde Haarsträhne fest, die sich zu lösen drohte. Sie trug ein taubenblaues knielanges Kleid mit Faltenrock, aufgenähten Taschen und einem schmalen Gürtel.
Ihr Chef legte großen Wert auf das tadellose Äußere seiner Mitarbeiter, an dem sich seiner Meinung nach die innere Haltung ablesen ließ. Erst vor wenigen Tagen hatte er seinen Buchhalter vor versammelter Belegschaft zusammengestaucht, weil dieser mit einem zerknitterten Hemd zur Arbeit erschienen war. Der arme Mann hatte die Standpauke wie ein gemaßregelter Schuljunge über sich ergehen lassen. Dabei war er um einiges älter als der Dienststellenleiter.
»Fräulein Lund!«
Solveig zuckte zusammen. Wenn man vom Teufel spricht, fuhr es ihr durch den Kopf, als sie die Stimme ihres Vorgesetzten hörte, der ihren Namen auch nach neun Monaten nicht Lünn aussprach, sondern Lunt. Rasch drehte sie sich zu Herrn Möller um, einem drahtigen Mittdreißiger, der mit einem Meter fünfundsiebzig so groß wie sie selbst war. Sein schütteres Haar hatte er auch an diesem Morgen sorgfältig mit Pomade nach hinten gekämmt und mit einem – wie mit dem Lineal gezogenen – Seitenscheitel frisiert. Die glatt rasierten Wangen, die aufrechte Haltung sowie die unbewegte Miene vervollständigten in Solveigs Augen das Paradebild eines deutschen Soldaten – wenn er nicht Zivil getragen hätte.
»Ich erwarte Sie später in meinem Büro«, fuhr er fort. »Bis Dienstschluss um vier bin ich wieder zurück.« Er nickte ihr zu und entfernte sich in Richtung Treppe.
Solveig wandte sich zu einem Gang, über dessen Portal ein großes rotes Blechschild angebracht war. Unter einem weißen Adler mit ausgebreiteten Schwingen, der ein von einem Eichenlaubkranz umrahmtes Hakenkreuz in seinen Krallen hielt, war zu lesen:
Reichskommissariat
Für die besetzten norwegischen Gebiete
Dienststelle Stavanger
Solveig lief zu dem Zimmer, das sie sich mit Frau Sandvik teilte, einer weiteren norwegischen Schreibkraft. Ihre beiden Tische standen einander gegenüber, an drei Wänden umgeben von deckenhohen Regalen, in denen überwiegend Aktenordner untergebracht waren. Ein Drittel des ehemaligen Klassenraums hatten die neuen Herren mittels einer Wand aus Holzplatten abtrennen lassen. Es war das Reich der deutschen Sekretärin des Chefs, dessen Büro hinter einer dick gepolsterten Tür lag, die eigens für ihn in die Wand zum angrenzenden Eckzimmer eingebaut worden war, dem schönsten Raum der Abteilung. Drei Fenster boten Ausblicke in den Innenhof, zum Dom sowie auf den Marktplatz.
Solveig öffnete die Tür zur Schreibstube und stutzte. Sie hatte ihre vierzigjährige Kollegin erwartet, die beinahe jeden Morgen eine gute Viertelstunde vor Dienstbeginn erschien. Anfangs hatte Solveig geglaubt, Frau Sandvik wolle sich mit ihrer Überpünktlichkeit bei Herrn Möller einschmeicheln. Bald jedoch fand sie heraus, dass die Gute einfach nur ihrem ewig nörgelnden Ehemann entfliehen und im Büro in Ruhe frühstücken wollte – nicht zuletzt, weil es hier meist noch »echten« Kaffee gab und nicht das Gebräu, das unter anderem aus gerösteten Gerstenkörnern, Brotrinden oder Zichorien, den Wurzeln der Wegwarte, hergestellt wurde. Auch Solveigs Familie griff wie die meisten ihrer Landsleute auf solche Ersatzstoffe zurück, seit Kaffeebohnen wie viele andere Lebensmittel zur streng rationierten Mangelware zählten.
Der Raum war leer, durch die offen stehende Tür zum Vorzimmer drangen jedoch mehrere Stimmen. Neugierig folgte Solveig ihrem Klang und entdeckte im Büro des Dienststellenleiters Frau Sandvik inmitten eines Grüppchens Angestellter, von denen sie einige nur flüchtig vom Sehen kannte. Sie alle standen vor dem Fenster, von dem aus sich eine unverstellte Sicht auf den Marktplatz bot.
»Was gibt’s denn da Interessantes?«, erkundigte sich Solveig.
»Sie kriegen sie nicht nach oben.«
Frau Sandvik, eine untersetzte Brünette mit einer Vorliebe für gerade geschnittene wadenlange Röcke und gerüschte Blusen mit Puffärmeln, drehte sich zu ihr, trat beiseite und deutete auf den Fahnenmast. Er stand am oberen Ende des Torget neben dem Granitsockel mit der überlebensgroßen Bronzestatue des Stavanger Dichters Alexander Kielland, der mit dem Rücken zu ihnen über den Platz Richtung Hafenbecken schaute. Seine schriftstellerischen Werke waren geprägt von gesellschaftspolitischen Themen wie Generationenkonflikten, Frauenfragen, sozialer Ungleichheit, religiöser Heuchelei und bürgerliche Doppelmoral, die er mit satirischem Ton anprangerte.
Um ihn herum hatte sich ein Trupp von Mitgliedern des Hird versammelt, der paramilitärischen Kampforganisation der Nasjonal Samling, die sich am Vorbild der deutschen Sturmabteilungen orientierte. Offensichtlich waren sie angetreten, um die norwegische Fahne zu hissen – wie jedes Jahr am 17. Mai, an dem 1933 die NS, die Nationale Vereinigung, gegründet worden war. Seitdem wurde der Nationaltag von Vidkun Quisling und seinen Anhängern genutzt, die eigene Bedeutsamkeit mit Aufmärschen, Fackelzügen, Reden und militärischen Schauübungen zu feiern.
Irgendetwas schien den geregelten Ablauf zu stören. Die Flagge hing auf halber Höhe und ließ sich augenscheinlich weder weiter nach oben noch zurück zum Boden ziehen. Der Anführer fuchtelte hektisch mit den Armen und bellte Befehle. Vergebens versuchten die Uniformierten, die Schaulustigen zum Weitergehen zu bewegen, die sich um sie scharten. Auch Solveig verspürte Schadenfreude. Verstohlen schielte sie zu dem deutschen Buchhalter, den sie unter den Anwesenden am Fenster ausgemacht hatte. Mit finsterer Miene verfolgte er das Geschehen auf dem Marktplatz und knurrte etwas, das wie »verdammte norskes« und »Sabotage« klang. Solveig wechselte einen Blick mit Frau Sandvik, die ihr kaum merklich zublinzelte. Solveig senkte rasch den Kopf und kämpfte gegen das Glucksen an, das ihr in die Kehle stieg. Es war einfach zu komisch, dass ausgerechnet überzeugte Nazis an diesem Tag die Fahne auf halbmast setzten und damit dem ausdrücklichen Verbot des Reichskommissars zuwiderhandelten, der aufmüpfige Norweger daran hindern wollte, ihren Widerwillen gegen die Besatzung ihres Vaterlandes mit diesem Trauerzeichen zu demonstrieren.
»Darf ich erfahren, was hier vorgeht?«
Nicht nur Solveig zuckte zusammen. Auch die anderen drehten sich mit schuldbewussten Mienen um. Fräulein Schmitt, die deutsche Sekretärin, stand auf der Schwelle zum Vorzimmer, schaute streng von einem zum anderen und machte eine scheuchende Handbewegung. Solveig warf einen letzten Blick aus dem Fenster und fragte sich, wer so mutig gewesen war, die Fahnenstange am wichtigsten Platz der Stadt zu manipulieren. Ich würde mich das nie getrauen, stellte sie fest. Es muss ein gutes Gefühl sein, sich nicht von seinen Ängsten kleinhalten zu lassen und das zu tun, was man für richtig hält. Ob ich je diesen Mut aufbringen werde?
3
Stavanger, Januar 1970
»Wach auf!«
Die Aufforderung wurde von einem Rütteln an ihrer Schulter begleitet, das Lizzy aus dem Schlaf riss. Ihr Bruder kniete vor ihrem Bett. Geblendet vom Schein der Wandlampe über dem Kopfende, die er angeschaltet hatte, schloss sie ihre Augen. »Verschwinde!« Sie wollte sich auf die andere Seite drehen. Erneut spürte sie seine Hand.
»Dad ist weg.«
Die Beunruhigung in seiner Stimme ließ sie innehalten. »Weg? Was meinst du damit?« Sie blinzelte und richtete sich halb auf. »Wie spät ist es überhaupt?«
»Halb acht.«
»Spinnst du?«, fauchte Lizzy. »Ich hätte locker noch eine Stunde schlafen können. Mom hat doch gesagt, dass wir erst um neun Uhr frühstücken.«
»Aber ohne Dad.«
»Klar, er hat ja gesagt, dass er heute zeitig rausmuss.« Sie funkelte ihren Bruder an. »Und auch, dass wir in Ruhe ausschlafen können.«
»Ich weiß. Deswegen bin ich ja extra früh aufgestanden. Um ihn wenigstens noch kurz zu sehen. Aber er war schon weg.« Chris’ Unterlippe bebte. »Gestern Abend kam er auch erst kurz vor dem Schlafengehen. Obwohl er versprochen hatte, mit uns zu essen.« Er schniefte und fuhr leise fort: »Warum will er nicht mit uns zusammen sein? Hat er uns nicht mehr lieb?«
»Red keinen Unsinn! Dad hat eben viel Arbeit. Und jetzt lass mich weiterschlafen.« Lizzy schaltete die Leselampe aus.
»Du bist so gemein!« Chris sprang auf. »Genau wie Mom.« Er rannte aus dem Zimmer und schlug die Tür zu.
Lizzy schloss die Augen, öffnete sie jedoch im gleichen Atemzug wieder. An Schlaf war nicht mehr zu denken. Sie war genervt und zugleich schuldbewusst. Du hättest Chris nicht so abbügeln dürfen, meldete sich ihr Gewissen. Er scheint tatsächlich zu glauben, Dad hätte kein Interesse mehr an uns. Lizzy knipste das Licht wieder an. Die Frage ihres Bruders ging ihr näher, als ihr lieb war. Die diffuse Furcht vom Vortag, das ungewohnte Verhalten ihres Vaters könne schwerwiegendere Gründe als beruflichen Stress haben, beschlich sie erneut. Nur nicht darüber nachgrübeln, befahl sie sich. Das zieht dich nur runter. Sie schwang sich aus dem Bett, holte die mit dem Logo des Hotels versehene Schreibmappe von einem schmalen Tisch an der Wand, schlüpfte zurück unter die Daunendecke und setzte sich mit dem Rücken ans Kopfende gelehnt hin.
Die Vorhänge vor dem großen Fenster waren noch zugezogen, von draußen drang lediglich ein kaum wahrnehmbarer Lichtschein ins Zimmer. Die Sonne ging hier erst gegen halb zehn Uhr auf. Wenn ich sie bei dem trüben Schmuddelwetter überhaupt zu Gesicht bekomme, dachte Lizzy und beugte sich über den Briefblock.
Atlantic Hotel, Donnerstag, 8. Januar 1970
Liebe Shirley,
was würde ich darum geben, jetzt mit Dir reden zu können! Ich vermisse Dich so sehr! Die Vorstellung, dass ein ganzer Ozean zwischen uns liegt, ist schrecklich. Gerade jetzt, wo ich Deinen Trost und Rat besonders dringend brauche. Du glaubst nicht, wie besch… es mir gerade geht. Es läuft einfach alles schief.
Erstens wohnen wir in einem Hotel. Was ja noch einigermaßen okay wäre, wenn ich mir nicht das Zimmer mit Chris teilen müsste. Ist das nicht die Höhe? Mom will, dass ich »ein Auge auf ihn habe« und dafür sorge, dass mein lieber kleiner Bruder keinen Unsinn anstellt. Das kann sie sich abschminken, aber so was von! Ich bin doch nicht sein Babysitter!
Zweitens ist Stavanger ein ödes Nest, das obendrein zu den verregnetsten Orten Norwegens gehört. Ich komme mir vor, als sei ich in einem Pippi-Langstrumpf-Buch gelandet – total verschlafen und mit »pittoresken« Holzhäusern und Kopfsteinpflaster-Gässchen. Es gibt hier zwar ein paar modernere Gebäude (u. a. unser Hotel, das elf Stockwerke hat), aber für unsere Verhältnisse ist Stavanger ein absolutes Kaff. Dabei ist es mit seinen 80 000 Einwohnern die viertgrößte Stadt Norwegens! Stell dir vor, insgesamt leben nur ungefähr 3,8 Millionen Menschen in diesem Land. Also nur eine Million mehr als in Los Angeles! In dem schmalen Informations-Bändchen, das von der größten Tageszeitung »Aftenposten« in verschiedenen Sprachen für Touristen herausgegeben wird, steht über Stavanger nur, dass es führend auf dem Gebiet der Konservenindustrie und des Schiffsbaus sei und einen Dom aus dem 12. Jahrhundert habe. Geht’s noch trister?
Du hattest mir beim Abschied den gut gemeinten Rat gegeben, nicht vorschnell zu urteilen, und mich daran erinnert, dass ich dazu neige, an unbekannten Orten zu fremdeln, mich dann aber doch meistens schnell eingewöhne. Aber hier habe ich wenig Hoffnung, dass es so kommen wird. Wie trostlos Stavanger ist, habe ich sogar schwarz auf weiß aus objektiver Quelle. Auch wenn die Verfasserin sicher nicht die Absicht hatte, diesen Eindruck zu vermitteln. In »Your Guide to Norway« von Doddy Hay wird die Stadt auf zwei Seiten abgehandelt, bevor Ausflüge in die Umgebung beschrieben werden – und fast eine ganze davon verwendet die Autorin dazu, sich über ein Denkmal auszulassen, das einer Entenfamilie (!) gewidmet ist. Also, wenn das nicht Bände spricht.
Das »Atlantic Hotel« ist zwar ganz okay, aber halt unpersönlich und kein Zuhause. Das wird es aber wohl eine Weile sein müssen. Es steht nämlich in den Sternen, wann wir ein Haus oder zumindest eine Wohnung bekommen. Wir sind bei Weitem nicht die einzigen Amerikaner, die hier ein neues Dach über dem Kopf suchen. Seit Phillips Petroleum am Tag vor Heiligabend in der Nordsee auf eine ergiebige Erdölquelle gestoßen ist, herrscht hier Goldgräberstimmung. Jahrelang hat man vergeblich nach dem Öl gesucht. Andere Unternehmen wie Shell haben schon im Herbst das Handtuch geworfen und begonnen, ihre Leute abzuziehen. Nur Dads Firma wollte noch eine allerletzte Bohrung durchführen und wurde prompt fündig. Und jetzt ist Stavanger für die Branche the place to be … Für mich aber nicht! Ich finde es einfach nur grässlich hier.
Ach Shirley, ich habe solches Heimweh! Wenn ich richtig rechne, ist es bei Dir jetzt elf Uhr nachts, also noch Mittwoch. Komische Vorstellung: Du legst Dich gerade in »meinem Gestern« ins Bett, während ich in »Deinem Morgen« in einen neuen Tag starte, an dem ich mich am liebsten in den nächsten Flieger zurück nach L. A. setzen würde. Warum mussten sie das blöde Öl entdecken und ausgerechnet Dad herschicken? Weil er Norwegisch spricht und sich hier auskennt, soll er als Projektingenieur die Schnittstelle zwischen Phillips und hiesigen Subunternehmen bilden.
Lizzy hielt inne und ließ den Kugelschreiber sinken. Ihre Gedanken schweiften zu dem Mittagessen kurz nach den Weihnachtsfeiertagen, an dem ihr Vater seiner Familie von seiner Versetzung nach Norwegen erzählt hatte. Während ihrer Mutter der ungewöhnlich kurzfristig angesetzte Umzug zu schaffen machte und Chris sauer war, weil er den Super Bowl der Football League verpassen würde, war Lizzy im ersten Augenblick vor allem erstaunt über die Gründe, aus denen Phillips ihren Dad nach Stavanger schickte.
Sie wusste zwar von seinen skandinavischen Wurzeln, hatte jedoch angenommen, dass er das Land seiner Ahnen gar nicht kannte. Lizzy hatte ihre Großeltern väterlicherseits, die früh verstorben waren, nie kennengelernt und erst vor Kurzem erfahren, dass sie Norwegen nie verlassen hatten. Dass ihr Sohn ohne sie erst als Erwachsener nach Amerika gekommen war, war ihr ebenso neu gewesen. Aber wann genau und aus welchem Grund – darüber hatte ihr Vater (zumindest ihr gegenüber) nie ein Wort verloren. So wie er nie von seinem norwegischen Leben erzählte. Er gab zwar gelegentlich Anekdoten aus seiner Kindheit und Jugend zum Besten, im Nachhinein war Lizzy jedoch aufgefallen, dass er sie nie konkret verortet hatte. Dazu kam, dass ihr Vater nie das geringste Interesse bekundet hatte, in seine alte Heimat zurückzukehren, und sei es nur für einen Urlaub, um seiner Familie die Stätten seiner frühen Jahre zu zeigen. Ebenso wenig konnte Lizzy sich daran erinnern, dass er jemals norwegisch mit ihr oder Chris gesprochen hätte. Was also steckte hinter dem Sinneswandel? Warum wollte ihr Vater zurück nach Norwegen?
Lizzy beugte sich über den Briefblock und schrieb weiter.
Vielleicht liegt es ja an meiner schlechten Laune, dass ich gerade alles eher negativ sehe. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass mit Dad irgendetwas nicht stimmt. Wir haben ihn gestern nur sehr spät am Abend gesehen, obwohl er eigentlich mit uns zu Abend essen wollte. Er freut sich angeblich riesig, uns endlich wieder bei sich zu haben. Was ihn aber nicht davon abgehalten hat, heute noch vor dem Frühstück wieder zu verschwinden. Natürlich ist mir klar, dass er wahnsinnig viel zu tun hat und eine große Verantwortung trägt. Trotzdem beschleicht mich der Verdacht, dass die Arbeit ein Vorwand sein könnte, sich bei uns rarzumachen. WARUM??? DAS ist die Frage!
Von Mom weiß ich mittlerweile, dass er die Versetzung hätte ablehnen können. Er hätte auch keine Probleme, bei einer anderen Ölfirma einen Job zu bekommen. Schließlich gab es in der Vergangenheit schon ein paar Versuche von anderen Unternehmen, ihn abzuwerben. Aber anscheinend wollte er unbedingt hierher. Den Grund konnte mir Mom nicht nennen. Sie ist ihm (natürlich) wie immer fraglos gefolgt nach dem Motto »Mein Zuhause ist da, wo meine Familie ist«. Aber ich bin mir sicher, dass nicht nur ich glücklicher wäre, wenn Dad anders entschieden hätte. (Wieso ist das eigentlich so? Ich meine, warum wird von Frauen in der Regel immer noch erwartet, dass sie ihr Leben nach den Wünschen und Vorgaben ihres Mannes ausrichten???)
Ich kann nur hoffen, dass nichts
Die Tür wurde aufgerissen, Chris stürmte herein und ließ sich auf einen der beiden Sessel plumpsen. Lizzy, die vor Schreck mit dem Stift ausgerutscht war und einen dicken Strich quer über das Papier gezogen hatte, bedachte ihren Bruder mit einem wütenden Blick.
»Uff, und ich dachte schon, ich bin zu spät.« Er grinste. »Du bist ja noch nicht mal angezogen.«
Lizzy schaute zum zusammenklappbaren Reisewecker auf ihrem Nachttisch. Gleich neun Uhr – die verabredete Zeit, um die ihre Mutter sie zum Frühstück abholen wollte. Sie sprang aus dem Bett, schnappte sich das Kleiderbündel, das sie sich am Vorabend zurechtgelegt hatte, und verzog sich ins Badezimmer. Zum Glück scheint Chris die Abwesenheit von Dad nicht mehr so schwerzunehmen, dachte sie. Oder täuschte sie sich, und er vermittelte nur nach außen diesen Eindruck?
»Ist echt okay, der Laden«, hörte sie Chris rufen, während sie sich die Zähne putzte. »Hat zwar kein Schwimmbad, aber einen Fitnessraum. Außerdem einen Kicker, eine Tischtennisplatte und sogar …«
Der Rest seiner Ausführungen ging im Rauschen der Dusche unter, die Lizzy anstellte. Als sie kurz darauf wieder ins Schlafzimmer kam, fand sie ihre Mutter vor, die die Vorhänge aufgezogen hatte und neben Chris vor dem Panoramafenster stand, das nach Osten ging. Vom sechsten Stock, in dem sich das Zimmer befand, bot sich eine gute Aussicht über die Stadt und die dahinter aufragenden Berge. Direkt unter ihnen lag ein Teich inmitten eines Parks. Lizzy warf einen flüchtigen Blick hinaus und stellte fest, dass der Regen über Nacht in Schnee übergegangen war. Die kahlen Zweige der Bäume an der Uferpromenade und die Dächer der Häuser auf der anderen Seite des kleinen Sees waren von einer weißen Schicht bedeckt. Viele Fenster waren erleuchtet, und eine große Kirche linker Hand am nördlichen Ufer wurde von mehreren Scheinwerfern angestrahlt. Das musste die Domkirche sein, die der junge Chauffeur am Vortag erwähnt hatte.
»Und da hinten auf dem Hügel siehst du den Valbergtårnet«, erklärte Chris seiner Mutter gerade und deutete auf einen achteckigen Turm. »Früher hat da ein Feuerwächter gewohnt, der Alarm schlagen sollte, wenn irgendwo ein Brand ausbrach. Jetzt dient er als Aussichtsturm. Und als Werkstatt für einen Töpfermeister.«
»Du kennst dich ja schon richtig gut aus.« Cathleen Cole, die einen legeren Hosenanzug mit einem Rollkragenpullover aus dünner Wolle trug, zauste ihrem Sohn das Haar.
»Wieso weißt du das?«, fragte Lizzy, während sie sich einen Schal aus lilafarbener Seide um den Kopf band, um die Haare aus der Stirn zu halten. »Hast du etwa den Reiseführer auswendig gelernt?« Sie sah ihn argwöhnisch an. »Kleiner Streber«, setzte sie leise hinzu.
»Nö, da steht das nicht drin«, antwortete Chris, ohne auf die Beleidigung einzugehen. »Das hat mir Rieden gesagt.«
»Rieden?«, fragten Lizzy und ihre Mutter gleichzeitig.
»Was für ein seltsamer Name«, schob Letztere nach.
»Vielleicht spreche ich ihn falsch aus«, sagte Chris. »Sie arbeitet hier als Zimmermädchen. Auf ihrem Namensschild stand REIDUN.« Er zuckte die Schultern. »Jedenfalls ist sie echt nett. Hat mir sogar einen Schokoriegel geschenkt, weil ich solchen Kohldampf hatte.« Er zog ein zerknittertes, rot-gelb-grünes Einwickelpapier aus der Tasche, auf dem in dicken Großbuchstaben Kvikk Lunsj stand.
Nicht zum ersten Mal gestand sich Lizzy ein, dass sie die Gabe ihres Bruders, unbefangen auf fremde Menschen zuzugehen und deren Zuneigung zu gewinnen, bewunderte und zuweilen beneidete. Sie selbst tat sich damit sehr viel schwerer.
»Ich kann übrigens schon ein bisschen Norwegisch«, verkündete Chris. »Ist gar nicht so schwer. Kvikk lunsj bedeutet schnelle Mahlzeit, also quick lunch. Takk heißt danke und frokost Frühstück.«
»Speaking of, lasst uns in den Speisesaal gehen«, sagte Cathleen. »Nachher holt uns jemand ab, um uns ein bisschen herumzuführen und wichtige Anlaufpunkte in der Stadt zu zeigen.«
»Kann das nicht Dad machen?« Chris schob die Unterlippe vor. »Warum hat er überhaupt keine Zeit für uns? Hätte er sich nicht wenigstens heute ein paar Stunden freinehmen können?«
Lizzy wartete mit angehaltenem Atem auf die Antwort ihrer Mutter. Sie selbst hatte sich nicht getraut, diese Fragen zu stellen.
»Aber das weißt du doch.« In Cathleens Stimme schwang ein Hauch Unmut. »Dein Vater muss …«
»Ja, schon kapiert«, schnitt Chris ihr das Wort ab. »Er hat einen Haufen Arbeit. Aber sonst hat er sich doch auch immer freischaufeln können.«
»Chris hat recht«, sagte Lizzy, bevor ihre Mutter etwas erwidern konnte. »Dieses Mal ist es wirklich anders. Das muss dir doch auch auffallen.«
Cathleen wich ihrem Blick aus. Die Traurigkeit in ihren Augen hielt Lizzy davon ab, weiter in sie zu dringen.
»Na ja, egal«, fuhr sie rasch fort und sah Chris beschwörend an. »Heute Abend können wir unser Wiedersehen dann richtig feiern. Da will uns Dad doch in dieses Fischrestaurant ausführen.« Sie streifte den lila-grün-orangenen Ringelpullover über, den ihre Großmutter ihr zu Weihnachten gestrickt hatte, und ging zur Tür. »Lasst uns frühstücken.«
Auf dem Weg zum Speisesaal kreisten ihre Gedanken erneut um die Frage, ob bei ihren Eltern alles in Ordnung war. Bis zur Abreise ihres Vaters hatte sie nichts bemerkt, was auf einen Streit oder gar eine Zerrüttung ihrer Beziehung hingedeutet hätte. Im Gegenteil, an Weihnachten hatte Roger Cole seine Frau mit eigens für sie angefertigten Ohrringen mit braunen Rauchquarzen überrascht – eine Hommage an ihre dunklen Augen, die er so liebte. Und ein paar Tage später hatte er sich mit einer innigen Umarmung samt schier endlosem Kuss von ihr verabschiedet, bevor er ins Taxi zum Flughafen gestiegen war. Diese Beobachtungen ließen für Lizzy nur einen Schluss zu: Der Auslöser für seine Veränderung lag in der Zeit, die er allein in Stavanger verbracht hatte. Aber was konnte das sein? Lizzy war überzeugt, dass es nicht allein seine Arbeit war, die ihn über Gebühr in Anspruch nahm. Ich werde es herausfinden, versprach sie sich selbst. Falls sich nicht alles in Wohlgefallen auflöst, und er heute Abend wieder ganz der Alte ist.
4
Stavanger, Mai 1941
Als Solveig ihren Kollegen zurück ins Büro folgte, fiel ihr die Aufforderung des Dienststellenleiters wieder ein, der sie später in seinem Büro erwartete. Warum wollte er mit ihr sprechen? Zum Chef zitiert zu werden, verhieß in der Regel nichts Gutes. Immerhin hatte er offenbar nicht vor, sie im Beisein der anderen herunterzuputzen. Solveig verzog den Mund. Ein schwacher Trost. Ein Stapel Berichte, der auf ihrem Schreibtisch darauf wartete, von ihr abgetippt zu werden, beendete jedoch vorerst ihre Grübelei darüber, was sie sich in letzter Zeit womöglich hatte zuschulden kommen lassen.