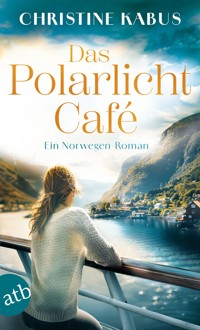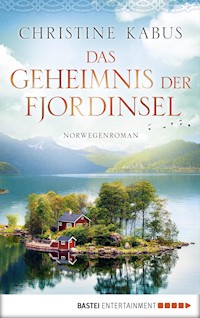6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Durch ein Jahrhundert getrennt, durch eine gemeinsame Geschichte vereint ...
Finnmark, 1915. Mit neun Jahren endet das friedliche Nomadenleben des Sámi-Mädchens Áilu: Auf der Wanderung zu den Sommerweiden wird sie von norwegischen Beamten verschleppt und in ein Internat gesteckt, wo sie zu einem zivilisierten Mädchen geformt werden soll. Tatsächlich verleugnet Áilu lange ihre Herkunft. Doch der Ruf ihrer Heimat lässt sich nicht unterdrücken ...
Oslo, Gegenwart. Nora ist Mitte dreißig, als sie den Namen ihres Vaters erfährt: Ánok war ein samischer Student, der damals plötzlich aus dem Leben ihrer Mutter verschwand. Nora spürt, dass sie ihr Glück erst finden wird, wenn sie in die Heimat ihres Vaters reist. Doch die Samen und ihre Kultur erscheinen ihr lange fremd. Bis sie auf den charismatischen Hundezüchter Mielat trifft. Gemeinsam mit ihm stößt sie auf die Geschichte von Áilu. Schon bald ahnt Nora, dass Áilus ungeheuerliches Schicksal eng mit ihrer eigenen Familiengeschichte verknüpft ist ...
Unberührte Landschaft, eine geheimnisvolle, lang unterdrückte Kultur und der Zauber des Nordlichts - der neue Roman von Christine Kabus erzählt vor der hinreißenden Kulisse Norwegens von der Sehnsucht nach Heimat und der Kraft der Liebe.
Weitere Norwegenromane von Christine Kabus: Das Lied des Nordwinds. Das Geheimnis der Fjordinsel. Das Geheimnis der Mittsommernacht. Im Land der weiten Fjorde. Insel der blauen Gletscher.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 729
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Norwegen-Romane der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Stammbaum
Karten
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Anmerkung zu den samischen Wörtern und Ausdrücken:
Danke! Takk! Giitu!
Weitere Norwegen-Romane der Autorin
Das Geheimnis der Mittsommernacht
Das Lied des Nordwinds
Im Land der weiten Fjorde
Insel der blauen Gletscher
Das Geheimnis der Fjordinsel
Über dieses Buch
Durch ein Jahrhundert getrennt, durch eine gemeinsame Geschichte vereint …
Finnmark, 1915. Mit neun Jahren endet das friedliche Nomadenleben des Sámi-Mädchens Áilu: Auf der Wanderung zu den Sommerweiden wird sie von norwegischen Beamten verschleppt und in ein Internat gesteckt, wo sie zu einem zivilisierten Mädchen geformt werden soll. Tatsächlich verleugnet Áilu lange ihre Herkunft. Doch der Ruf ihrer Heimat lässt sich nicht unterdrücken …
Oslo, Gegenwart. Nora ist Mitte dreißig, als sie den Namen ihres Vaters erfährt: Ánok war ein samischer Student, der damals plötzlich aus dem Leben ihrer Mutter verschwand. Nora spürt, dass sie ihr Glück erst finden wird, wenn sie in die Heimat ihres Vaters reist. Doch die Samen und ihre Kultur erscheinen ihr lange fremd. Bis sie auf den charismatischen Hundezüchter Mielat trifft. Gemeinsam mit ihm stößt sie auf die Geschichte von Áilu. Schon bald ahnt Nora, dass Áilus ungeheuerliches Schicksal eng mit ihrer eigenen Familiengeschichte verknüpft ist …
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Christine Kabus, 1964 in Würzburg geboren, arbeitete nach ihrem Studium der Germanistik und Geschichte als Dramaturgin und Lektorin bei verschiedenen Film- und Theaterproduktionen, bevor sie sich 2003 als Drehbuchautorin selbstständig machte. Schon als Kind faszinierte sie der hohe Norden. Vor allem die ursprüngliche, mythische Landschaft Norwegens beflügelte ihre Phantasie. Sie begann, die Sprache zu lernen und sich intensiv mit der Geschichte Norwegens zu beschäftigen – auch mit den dunklen Seiten wie in »Töchter des Nordlichts«. Insgesamt liegen bei Bastei Lübbe sechs Norwegen-Romane von Christine Kabus vor.
CHRISTINE KABUS
TÖCHTERDESNORDLICHTS
Norwegen-Roman
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2014/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Ulrike Brandt-Schwarze, Bonn
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven © Надя Ветрова/AdobeStock; Lukas Bischoff/GettyImages; StreetFlash/GettyImages; Rastan/GettyImages
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-0618-6
be-ebooks.de
lesejury.de
Für meinen Vater
Ii idja nu guhkki ahte beaivi ii boađe.
Prolog
Eine Bewegung in ihrem Rücken, die sie mehr ahnte als sah, ließ sie innehalten. Langsam drehte sie den Kopf und hielt den Atem an. Fünf Schritte von ihr entfernt stand ein Rentier zwischen den Stämmen der niedrigen Fjellbirken der Hochebene. Sein Fell war weiß. Es musste ein wildes Ren sein, denn seine Ohren waren unversehrt und trugen keine Einschnitte, mit denen die Herdenbesitzer ihre Tiere markierten, um sie von denen anderer Familien unterscheiden zu können. Noch nie war sie einem wilden Ren so nahe gekommen. Rentiere waren scheu und gingen den Menschen aus dem Weg. Doch dieses wirkte nicht ängstlich. Es stand ruhig da und schaute ihr direkt in die Augen. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Das Ren senkte den Kopf, als wolle es ihr zunicken, und trabte davon.
Die Worte ihrer Großmutter kamen ihr in den Sinn: »Jievja, der weiße Einzelgänger, zeigt sich nur Menschen mit reinem Herzen. Wenn das weiße Ren dich ansieht, lausche aufmerksam, denn es überbringt dir eine Botschaft.«
Sie fühlte Tränen in ihren Augen brennen. Tränen der Erleichterung. Sie war nicht länger verstoßen. Sie war willkommen. Sie ließ sich auf einen Felsblock sinken und schloss die Augen. Wie von selbst formte sich ein tiefer Ton in ihrer Brust, dem eine lange Reihe weiterer folgte. Die Töne strömten aus ihr heraus, kraftvoll und leicht. Längst vergessen geglaubte Bilder stiegen in ihr hoch. Von jenem Morgen, an dem sie als kleines Mädchen neben ihrer Großmutter gekniet und Rentierfelle mit einem Schaber von Fleischresten befreit hatte.
»Erzähl mir eine Geschichte, áhkku«, hatte sie wie so oft gebeten und zum ersten Mal die Legende von jievja gehört und von der Entstehung ihrer Heimat Lappland.
»Eines Tages beschloss der höchste Gott Jubmel, eine neue, gute Welt zu schaffen«, hatte ihre Großmutter begonnen und sich sogleich unterbrochen. »Weißt du noch, wie er auch genannt wird?«
»Radienattje«, hatte sie eifrig geantwortet. »Das bedeutet der herrschende Vater.«
Die Großmutter hatte ihr zugelächelt und ihre Erzählung fortgesetzt:
»Jubmel wollte also eine neue Welt schaffen, über die sein Sohn Bejve, der Sonnengott, herrschen sollte. Dafür schlachtete er seine schöne, weiße Renkuh. Ihre Knochen bildeten das Fundament, das Fleisch verwandelte er in Land, die Adern in riesige Flüsse, und aus dem Fell schuf er die Berge, Wiesen und Wälder. Aus dem Kopf der Renkuh modellierte Jubmel das Himmelsgewölbe, an dem er ihre strahlenden Augen als Abend- und Morgenstern befestigte. Das Herz des Rens aber versteckte er tief in der Erde. Seitdem schlägt es dort und schenkt uns Leben. Und wenn du aufmerksam lauschst, kannst du im Schweigen der hellen Sommernächte den Herzschlag der kleinen Rentierkuh hören.«
1
Oslo/Januar 2011
Das erste Mal sah Nora den Mann, als sie an einem Sonntagnachmittag Schlittschuh lief. Er lehnte bewegungslos am Sockel des Henrik-Wergeland-Monumentes an der Kopfseite des Springbrunnens, dessen rechteckiges Becken auch in diesem Winter zu einer Eislaufbahn umfunktioniert worden war, und schaute unverwandt zu ihr. Nora hätte im Nachhinein nicht sagen können, warum sie auf ihn aufmerksam geworden war. Sein dunkler Parka verschmolz mit dem Steingrau des Denkmals. Sie schätzte, dass er ungefähr einen Kopf größer war als sie selbst. Verglichen mit den meisten anderen Erwachsenen des gut besuchten Parks, der sich parallel zur Karl Johans Gate vom Nationaltheater bis zum Parlament erstreckte, war er von durchschnittlicher Größe. Seine Gesichtszüge konnte Nora auf die Entfernung kaum ausmachen. Dennoch hatte sie das vage Gefühl, ihn zu kennen. Nein, kennen war das falsche Wort. Es war mehr ein Anflug von Vertrautheit. Warum starrte er sie an? Oder bildete sie sich das nur ein?
Nora glitt über die Eisfläche, um ihn aus der Nähe zu sehen. Als sie den Rand des Brunnens erreicht hatte, war der Platz neben der Statue des Schriftstellers leer. Sie musterte die vorbeiflanierenden Spaziergänger. Den Mann konnte sie nirgends entdecken. Er war verschwunden.
Nora zuckte die Achseln und kehrte zu Leene und Petrine, ihren beiden Kolleginnen, zurück, mit denen sie unterwegs war. Die drei waren als Erzieherinnen bei der Tagesstätte »Lille Bamsen« angestellt, die einem Beratungs- und Betreuungszentrum für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund beziehungsweise aus sogenannten prekären Verhältnissen angegliedert war. Die Kita lag nordöstlich des Hauptbahnhofs am Rand des ehemaligen Arbeiterviertels Grønland, in dem sich viele Einwandererfamilien angesiedelt hatten.
Mit Leene, die wie sie selbst Mitte dreißig war, fühlte sich Nora nach neunjähriger Zusammenarbeit auch freundschaftlich verbunden. Sie schätzte ihre einfühlsame Art, ihren Humor und ihr sicheres Gespür im Umgang mit ›schwierigen‹ Kindern. Mit der achtundzwanzigjährigen Petrine, die vor drei Jahren zu ihnen gestoßen war und sich als zuverlässige, kompetente Kollegin entpuppt hatte, wurde Nora nicht recht warm. Zu unterschiedlich waren ihre Lebenseinstellungen und Sichtweisen. Um des guten Arbeitsklimas willen ließ sie sich dennoch hin und wieder auf die Dreimädelstreffen ein, die Petrine regelmäßig vorschlug. Nora vermutete, dass sie auf die Vertrautheit zwischen Leene und ihr eifersüchtig war. Aber Sympathie oder gar Freundschaft konnte man nun einmal nicht erzwingen.
»Ich könnte jetzt eine heiße Schokolade vertragen«, sagte Nora und deutete auf ein kleines Zelt, vor dem mehrere Stehtische aufgestellt waren. Obwohl die Temperatur nur wenige Grad unter null lag, Nora eine dicke Lammfelljacke trug und ständig in Bewegung gewesen war, fühlte sie sich ausgekühlt.
»Ich bin dabei«, antwortete Leene, die eine gesteppte rote Daunenjacke anhatte und eine ihrer zahlreichen Garnituren, wie sie die von ihr selbst gestrickten, farbenfrohen Mütze–Schal-Handschuhe-Ensembles nannte.
Petrine, in sportlichem, figurbetontem Winteroutfit, nickte. »Ja, ich habe auch nichts gegen eine kleine Aufwärmpause«, sagte sie und rieb sich mit der behandschuhten Hand ihre von der Kälte gerötete Nase.
Sie verließen die Eisbahn und standen kurz darauf mit dampfenden Bechern vor sich an einem der Tischchen. Neben Leene und Petrine, beide hochgewachsen und athletisch, kam sich Nora immer besonders klein und zierlich vor. Es war schon vorgekommen, dass man sie von Weitem für eines der Kinder gehalten hatte, die sie betreute. Nicht nur wegen ihrer Größe, sondern auch weil viele Eltern ihrer kleinen Schützlinge aus Asien, Afrika und vom Balkan stammten und Nora mit ihren dunklen Haaren und den hochsitzenden Wangenknochen im Vergleich zu ihren blonden, blauäugigen Kolleginnen etwas exotisch wirkte.
»Lasse und ich wollen uns in den Osterferien eine Hütte in den Bergen mieten. Wir suchen noch nette Leute, die sich mit uns zusammentun«, drang Petrines Stimme in Noras Gedanken. »Hättet ihr nicht Lust?«, fragte sie und sah Nora und Leene an.
Nora hob die Schultern. »In den Osterferien? Hab noch gar nicht drüber nachgedacht, was ich da mache«, antwortete sie. »Klingt aber verlockend«, schob sie etwas lahm nach, als sie Petrines enttäuschtes Gesicht sah.
Petrine wandte sich an Leene. »Was ist mit dir und Jens?«
Zu Noras Überraschung wurde Leene rot.
»Äh, bei uns steht jetzt erst mal was anderes an«, sagte sie. Ihr Gesicht strahlte. Sie hatte eine Hand auf ihren Unterleib gelegt und streichelte ihn sacht.
Petrines Augen weiteten sich. »Du meinst … bist du etwa schwanger?«, rief sie.
Nora sah, wie sich einige der Umstehenden neugierig zu ihnen umdrehten. Leene senkte verlegen den Kopf und nickte.
»Herzlichen Glückwunsch«, sagte Nora und hob ihren Kakaobecher, um mit Leene anzustoßen. »Seit wann weißt du es?«
»Schon länger. Ich bin jetzt im vierten Monat«, antwortete Leene. »Dieses Mal wollte ich es erst erzählen, wenn es ganz sicher ist«, fügte sie leise hinzu.
Nora nickte und drückte Leenes Arm. Ihre Freundin hatte bereits zweimal in den ersten Schwangerschaftswochen Fehlgeburten gehabt. Nora wusste, dass sie stärker darunter gelitten hatte, als sie es sich hatte anmerken lassen. Umso mehr freute es sie für ihre Freundin, dass sich deren Kinderwunsch nun erfüllen würde. Leene legte kurz ihre Hand auf Noras und sah ihr in die Augen.
»Wo wir gerade beim Verkünden sind«, sagte Petrine und sah die beiden anderen Aufmerksamkeit heischend an. Sie hielt es nie lange aus, wenn jemand anderes im Mittelpunkt stand.
»Lasse und ich werden im Sommer heiraten.« Sie schaute in die mittlerweile geleerten Becher, sammelte sie ein und eilte mit den Worten: »Ich besorg uns noch eine Runde zum Anstoßen«, zu dem Verkaufszelt.
»Ob Lasse schon von seinem Glück weiß?«, flüsterte Leene. »Das kam doch jetzt sehr plötzlich. Und wo ist der Ring? Den hätte sie uns doch als Erstes gezeigt.«
Nora kicherte. »Jetzt, wo du’s sagst. Es würde mich nicht wundern, wenn Petrine diese Neuigkeit eben erst beschlossen hat.«
Wobei sie keine Sekunde daran zweifelte, dass es tatsächlich zu dieser Hochzeit kommen würde. Petrine war zwar die Jüngste von ihnen, zugleich aber auch die resoluteste. Sie schien es für selbstverständlich zu halten, dass ihre Wünsche und Erwartungen erfüllt wurden. Manchmal beneidete Nora sie um dieses Selbstvertrauen. Wie es sich wohl anfühlte, keine Selbstzweifel zu haben?
Petrine kehrte mit frischem Kakao zurück. Nachdem sie ihr gratuliert und die zukünftige Braut hatten hochleben lassen, wandte sich Leene an Nora.
»Wie geht es eigentlich Per? Du hast schon länger nichts von ihm erzählt.«
»Ach, das hat nicht so gepasst zwischen uns«, sagte Nora.
»Oh, das tut mir leid.«
»Muss es nicht«, versicherte Nora, als sie Leenes besorgte Miene sah. »Wirklich, es war nichts Ernstes.«
Petrine runzelte die Stirn. »Ist es das je bei dir? Bist du es nicht leid, Single zu sein?« Die Frage kam schroff, fast vorwurfsvoll.
Leene sog scharf die Luft ein. Petrine schien zu bemerken, dass sie sich im Ton vergriffen hatte, denn sie schob gespielt salbungsvoll nach: »Nora Nybol, wird es nicht langsam Zeit, sich ernsthaft zu binden und eine Familie zu gründen?«
Nora grinste. »Du meinst, mit fünfunddreißig, da macht sich ein Mädchen Gedanken?«
»Marilyn Monroe war fünfundzwanzig, als sie das sagte«, entgegnete Petrine trocken.
Am nächsten Morgen wachte Nora früh auf und beschloss, die Arbeitswoche in ihrem Lieblingsbistro in der Thorvald Meyers Gate einzuläuten, das auf halbem Wege zu ihrem Arbeitsplatz lag. Die Besitzerin verstand sich nicht nur auf die Zubereitung köstlicher Kaffeekreationen, sondern buk auch leidenschaftlich gern. Beim Gedanken an einen ofenwarmen Rosinenboller lief Nora das Wasser im Munde zusammen.
Pünktlich um halb acht betrat Nora das zweistöckige Hauptgebäude der Kita, deren umzäuntes Grundstück am Rande eines kleinen Parks lag. In der oberen Etage befanden sich das Verwaltungsbüro, die Zimmer der Sozialberater und Familientherapeuten und ein großer Besprechungsraum. Unten gab es eine Küche und einen Aufenthaltsraum mit abschließbaren Schränken und Postfächern für die Mitarbeiter. Daneben war ein Arbeitszimmer mit Computern eingerichtet, auf denen unter anderem die wöchentlichen Berichte geschrieben wurden – eine der wenigen Aufgaben, auf die Nora gern verzichtet hätte.
Da das sonnige Wetter vom Wochenende umgeschlagen war, zog Nora ihre Jacke aus und verstaute sie in ihrem Schrank. Eigentlich hatte sie mit ihren Kindern nach draußen gehen wollen, doch der eisige Graupelregen, der aus dem verhangenen Himmel niederging, machte ihr einen Strich durch die Rechnung.
Auf dem Weg zur Tür warf Nora einen Blick in ihr Postfach. Überrascht zog sie einen an sie adressierten Umschlag heraus. Es kam selten vor, dass dort Briefe von außerhalb auf sie warteten. Gewöhnlich waren es interne Mitteilungen, Infobroschüren, Arbeitspläne und Ähnliches.
Nora verzog unwillig das Gesicht, als sie die runde Handschrift ihrer Mutter Bente auf dem Umschlag erkannte. Sie konnte sich schon denken, was in dem Brief stand: die Bitte um ein Treffen, bei dem sie Nora »alles« erzählen und erklären wollte. Seit Wochen lag Bente ihr damit in den Ohren, hatte ihr unzählige Male zu Hause auf den Anrufbeantworter und auf die Mailbox ihres Mobiltelefons gesprochen, ihr etliche E-Mails und Postkarten geschickt. Und jetzt also einen Brief an ihre Arbeitsstelle. Was würde als Nächstes kommen? Ein unangekündigter Besuch?
Nora spürte, wie die Wut auf ihre Mutter wieder in ihr hochkochte. Jetzt auf einmal wollte Bente reden. Nachdem sie fünfunddreißig Jahre lang geschwiegen hatte. Wie hatte sie ihr das nur antun können? Einerseits war sie nicht müde geworden zu behaupten, ihre Tochter wäre die wichtigste Person in ihrem Leben, und andererseits hatte sie sie konsequent angelogen.
Nora stopfte den Umschlag ungeöffnet in die Tasche ihrer taillierten, blaugrünen Wolljacke – fest entschlossen, auch diesen Annäherungsversuch zu ignorieren. Sie eilte aus dem Gebäude und überquerte den Platz, an dessen anderer Seite mehrere niedrige bunt gestrichene Holzhäuser standen. Nora steuerte das orangefarbene an, in dem ihre »Löwengruppe« untergebracht war.
Später am Vormittag stand sie mit den Kindern vor einer großen Weltkarte, die an einer Wand im Spielzimmer hing. Die Kontinente und Länder waren mit den für sie typischen Pflanzen und Tieren gekennzeichnet.
Gerade hatten sie gemeinsam Pakistan gesucht, die Heimat der Eltern des fünfjährigen Amal und seiner zwei Jahre älteren Schwester Bhadra, die demnächst eingeschult werden sollte. Diese hatte schließlich auf eine Ziege gedeutet, deren lange, spiralig gewundene Hörner v-förmig auseinanderstanden, und stolz erklärt: »Das ist eine Schraubenziege. Mein Papa hat gesagt, dass sie das Wahrzeichen von Pakistan ist.«
Bevor Nora dem Mädchen antworten konnte, fragte Amal: »Und woher kommen deine Eltern?« Er schaute zu Nora hoch.
Sein Freund Mahdi, dessen Großeltern einst aus Somalia eingewandert waren, knuffte ihn in die Seite und rief: »So eine blöde Frage. Aus Norwegen natürlich!«
»Gar nicht wahr«, rief Amal und zog die Augenbrauen zusammen. Er musterte Nora aufmerksam.
»Du hast so Augen wie die Seteney«, sagte er und deutete auf ein Mädchen mit dunkelbraunen, leicht schräg stehenden Augen und hohen Wangenknochen, die sie von ihrer Mutter geerbt hatte, die aus dem Kaukasus stammte. »Du bist klein«, fuhr er fort. »Deine Haare sind dunkel. Du siehst ganz anders aus als Leene und Petrine.«
Nora strich Amal über seine glänzenden, schwarzen Haare.
»Das stimmt schon«, sagte sie. »Trotzdem hat Mahdi Recht. Meine Eltern sind beide Norweger. Meine Mutter ist ganz hell. Ich komme wohl mehr nach meinem Vater. Er stammt aus der Finnmark. Wisst ihr, wo die liegt?«, wandte sie sich an alle Kinder.
Die kleine Seteney trat an die Karte, stellte sich auf die Zehenspitzen und deutete auf ein Rentier, das hoch oben im Norden Norwegens stand.
Nora nickte ihr zu. »Und wisst ihr auch, wer dort wohnt?«, fragte sie.
»Die Eskimos«, rief Mahdi.
»Nein, die leben da, wo immer Schnee liegt«, widersprach Bahdra.
»Aber da liegt doch Schnee!«, beharrte Mahdi und tippte auf die Karte.
»Die Eskimos, besser gesagt die Inuit, wie sie sich selber nennen, wohnen im nördlichsten Zipfel von Nordamerika«, sagte Nora und zeigte auf Alaska und Nordkanada, wo sich Eisbären, Robben und Walrösser tummelten. »Bei uns leben die Sami.«
»Was sind Sami?«, fragte Bahdra.
»Ich weiß es, ich weiß es!«, rief Seteney und hopste aufgeregt vor Nora herum. »Das sind doch die, die joggen.«
»Hä?«, machte Mahdi. »Rennen die den ganzen Tag rum?«
»Nein, die singen so komisch.«
»Ah, du meinst joiken«, sagte Nora.
»Was ist das denn?«, wollte Mahdi wissen.
»Ist doch egal«, maulte Bahdra. »Ich hab zuerst gefragt! Ich will endlich wissen, was Sami sind.«
Nora strich Mahdi über den Kopf. »Ich erklär’s dir ein anderes Mal«, versprach sie, froh, dass Bahdra sie unterbrochen hatte. Sie hätte nicht genau erklären können, was es mit dem Joiken auf sich hatte.
»Die Sami sind den Inuit in manchen Dingen ziemlich ähnlich«, fuhr sie fort. »Und weil sie ursprünglich weit aus dem Osten gekommen sind«, Nora deutete auf die Regionen hinter dem Ural, »haben manche von ihnen solche Augen wie Seteney und dunkle Haare.«
»Die Familie von deinem Vater ist also auch eingewandert«, stellte Amal fest.
Nora nickte. »Ja, und wenn man es genau nimmt, sind alle Norweger Einwanderer.«
Die Kinder sahen sich überrascht an und lächelten.
»Wieso sind die Sami den Inuit ähnlich?«, fragte Mahdi.
»Die haben früher auch als Nomaden gelebt. Das heißt, sie wohnten nicht in festen Häusern, sondern sind den Rentieren gefolgt, die bei ihnen Karibus heißen, auf ihren Wanderungen und …«
Eine Frauenstimme unterbrach Nora: »Kommt ihr nicht zum Essen?«
Nora drehte sich um und sah Leene in der Tür stehen.
»Oh, schon so spät? Ich hab gar nicht auf die Zeit geachtet«, sagte sie und wandte sich an die Kinder.
»Geht schon mal mit Leene. Ich räume noch rasch auf.«
Sie lächelte Leene zu, die die vier Kinder zu sich winkte. Während Nora die Malsachen in die dafür bestimmte Kiste legte und die Bilder einsammelte, die die Kinder gemalt hatten, dachte sie über Amals Frage nach der Herkunft ihrer Eltern nach. Bis letzten Sommer hätte sie sie nicht beantworten können, zumindest, was ihren Vater betraf. Und auch über die Familie ihrer Mutter hatte sie bis dahin so gut wie nichts gewusst. Nur dass Bente in Tromsø aufgewachsen war.
Nora starrte auf das Bild von Mahdi, das sie gerade in der Hand hielt. Die Kinder hatten ihre Familien gemalt. Mahdi hatte sich beschwert, dass das Blatt viel zu klein sei, um alle seine Verwandten darauf unterzubringen. Schon für seine fünf Geschwister, die Eltern und die Großeltern, die mit ihnen zusammenwohnten, hatte der Platz kaum gereicht. Geschweige denn für all die Onkel und Tanten und deren Familien.
Nora fiel das Familienbild ein, das sie vor ungefähr dreißig Jahren in der Schule gemalt hatte. Darauf waren nur ihre Mutter und sie selbst zu sehen. Zu Hause hatte sie dann noch einen Mann dazugemalt, prächtig gekleidet wie ein orientalischer Herrscher. Denn so stellte sie sich ihren unbekannten Vater vor. In ihrer Fantasie stammte er aus einem Königshaus und war zum Studium nach Norwegen geschickt worden. Natürlich nicht allein, sondern mit Aufpassern. Und diese hatten ihn umgehend in seine Heimat zurückbefördert, als sie von seiner Liebe zu Bente erfuhren. Lange hatte Nora davon geträumt, dass er eines Tages vor ihrem Osloer Häuschen stehen und Bente in die Arme schließen würde. Und vor allem überglücklich wäre, endlich seine Tochter kennenzulernen.
Sie hatte erst ihre verschollen geglaubte Großmutter finden müssen, um die Wahrheit zu erfahren, die ihren kindlichen Fantasien zumindest in einem Punkt sehr nahekam: Ihr Vater war tatsächlich Bentes große Liebe gewesen.
Nora schüttelte sich. Sie fasste sich mit beiden Händen in die vollen, schulterlangen Haare, zog das Haargummi heraus und band sich den Pferdeschwanz neu, aus dem sich überall Strähnen gelöst hatten. Jetzt war keine Zeit zum Grübeln, die Kinder warteten auf ihr Essen.
Am späten Abend stellte Nora ein Tablett mit Teekanne und Becher auf den Boden neben einen der beiden niedrigen, mit bunten Seidenkissen bedeckten Korbsessel vor das große Fenster in ihrem Ein-Zimmer-Appartement. Gegenüber an der Wand stand eine alte Holzkommode mit einer Stereoanlage darauf. Das Bett und der Kleiderschrank waren hinter einem Bücherregal verborgen, das als Raumteiler diente und auch ein Fernsehgerät beherbergte, das Nora je nach Bedarf zum Bett oder zum Wohnraum hindrehen konnte. Ein paar helle Rentierfelle, die auf dem Boden lagen, bildeten einen reizvollen Kontrast zu den dunkelgebeizten Holzdielen.
Sie nahm ihr Smartphone von der Kommode und ließ sich in den Sessel neben dem Tablett sinken. Bevor sie sich Tee einschenkte, öffnete sie das Internet und gab in der Suchmaschine den Begriff »joiken« ein. Es war ihr wichtig, die Fragen ihrer Löwenkinder zu beantworten und deren Wissensdurst zu stillen. Sie klickte sich durch mehrere Lexika und Fachartikel und erfuhr, dass die Wurzeln dieser lautmalerischen Musik bis in die Steinzeit zurückreichten. Der wesentliche Unterschied zu Liedern anderer Kulturen bestand offenbar darin, dass ein Joik dem Verständnis der Sami nach einfach existierte und nicht »gemacht« wurde. Man joikte also keine Geschichten oder über etwas, sondern man joikte Personen, Tiere, Landschaften oder auch Gefühle und stellte so eine unmittelbare Verbindung her. Das erklärte auch, weshalb Joiks endlos waren, eher kreisförmig als geradlinig, und dass sie sich – je nach Stimmung des Sängers – ändern konnten.
Nora schaltete das Smartphone ab, knipste die Stehlampe aus und goss den Früchtetee in den Becher. Der Schein der Stumpenkerze, die auf einem Teller stand, den ihr eines ihrer Löwenkinder zu Weihnachten getöpfert hatte, wirkte wie eine winzige leuchtende Insel in dem dunklen Raum.
Draußen wölbte sich der nächtliche Winterhimmel, erhellt von den vielen Lichtern der Stadt. Nora nippte an dem Tee, lehnte sich zurück und sah aus dem Fenster, das nach Westen ging. Ihre Wohnung lag in der vierten Etage. Da die gegenüberliegenden Häuser nur drei Stockwerke hoch waren, hatte sie einen weiten Blick über die Stadt. Ungehindert in die Ferne schauen zu können half ihr beim Nachdenken. Sie liebte diese ruhigen Momente vor dem Schlafengehen, in denen sie den Tag Revue passieren lassen konnte, Pläne machte oder einfach nur vor sich hinträumte.
Zweimal war sie im Laufe dieses Tages an ihre Mutter erinnert worden. Von dieser selbst mit ihrem Brief. Und durch die Frage des kleinen Amal nach ihren Eltern. Nora spürte, dass sie sich der Konfrontation mit Bente, der sie seit Monaten ausgewichen war, stellen musste. War es kindisch gewesen, auf deren jahrelanges Schweigen und die Lügen mit einer Funkstille zu reagieren? Und ihrerseits das Gespräch zu verweigern? Sie kniff die Augen zusammen. Das Nora-Kind in ihr – wie sie ihre Gefühlsseite für sich nannte – war zutiefst verunsichert und verletzt. Zugleich sehnte es sich danach, Frieden mit der Mutter zu schließen. Die störrische Seite fand, dass ihr Rückzug Bente recht geschehen war. Jahrzehntelang hatte diese behauptet, nicht zu wissen, wer der Vater ihrer Tochter war. Sie hatte Nora glauben lassen, sie wäre das Resultat einer stürmischen Liebesnacht mit einem namenlosen ausländischen Studenten, den Bente auf dessen Abschiedsfeier in Tromsø vor seinem Rückflug in seine Heimat zum ersten und letzten Mal gesehen hatte. All die Jahre hatte Nora vermutet, die ungewollte Schwangerschaft – also letztendlich sie selbst – sei der Grund gewesen, warum Bente sich mit ihren Eltern überworfen und ihnen und Tromsø für immer den Rücken gekehrt hatte.
Nora spürte, wie sie sich verkrampfte und den Teebecher so fest umklammerte, dass ihre Knöchel weiß wurden. Sie stellte ihn auf das Tablett, zog die Knie an und umschlang ihre Beine mit den Armen. Hätte ihre Mutter ihr irgendwann von sich aus die Wahrheit gesagt? Oder hätte sie es tatsächlich fertiggebracht, sie Zeit ihres Lebens im Dunkeln über ihre Herkunft zu lassen? Diese Frage nagte an Nora, seit sie im letzten Sommer mehr oder weniger zufällig über Bentes Geheimnis gestolpert war: ihre Liebesbeziehung zu Ánok, einem Studenten, der aus einer samischen Familie aus Lappland stammte und deshalb von ihrem Vater nicht akzeptiert worden war. Zu erfahren, dass dieser Student ihr Vater war, hatte Nora einen Schock versetzt. Außer sich war sie davongelaufen, ohne sich den Rest der Geschichte anzuhören. Den sie bis heute nicht kannte.
Es hielt sie auch jetzt nicht auf ihrem Sessel. Wie damals sprang sie auf – übermannt von dieser Mischung aus Fassungslosigkeit und Wut, mit der sie ihre Mutter angeschrien hatte. Sie presste ihre Stirn an die kühle Fensterscheibe. Wie konnte man seinem angeblich geliebten Kind so etwas Wichtiges vorenthalten? Einen wesentlichen Bestandteil der eigenen Identität?
Nora hatte sich nur Leene anvertraut, die gespürt hatte, wie aufgewühlt sie war. Die Freundin hatte ihr versichert, sie sei jederzeit für sie da, wenn sie reden wolle. Doch Nora hatte sich lange nicht in der Lage gefühlt, sich den Fragen zu stellen, die das neue Wissen in ihr aufwarf: Wer war sie? Und wer war der Mann, der sie zumindest genetisch zur Hälfte geprägt hatte? Leene hatte ihr nicht weiter zugesetzt, machte aber keinen Hehl daraus, dass sie das Verdrängen auf die Dauer für schädlich hielt. Insgeheim gab Nora ihr Recht. Sie wusste, dass sie der wachsenden Neugier auf ihren Vater und seine Familie irgendwann nachgeben würde. Und sie erkannte, dass dieser Zeitpunkt nun gekommen war.
Sie sah auf die Uhr. Kurz vor zehn. Noch nicht zu spät für einen Anruf. Sie stand auf, holte das Telefon und drückte die Kurzwahltaste, unter der sie die Nummer ihrer Mutter gespeichert hatte. Vor Anspannung hielt sie die Luft an. Als der Anrufbeantworter ansprang, atmete sie erleichtert aus. Nach der langen Funkstille wollte sie ungern ihr erstes Gespräch mit Bente am Telefon führen. Nach dem Piepton hinterließ sie eine kurze Nachricht, in der sie ihren Besuch für Freitagnachmittag ankündete, falls es ihrer Mutter passte.
2
Finnmark/Frühlingswinter 1915
Die neunjährige Áilu lag auf einem Rentierfell vor dem Eisloch, das ihr Vater für sie gebohrt hatte. Sie ließ die Angelschnur, an deren Ende sie einen Stein als Gewicht befestigt hatte, mit einer kleinen Elritze als Köder auf den Grund des Sees sinken. Sie beugte sich über das Loch. Im schwarzen Wasser spiegelte sich ihr Gesicht, das von einer Fellmütze eingerahmt war. Flüchtig sah sie sich in die hellbraunen Augen mit dem dunklen Rand, bevor sie sich eine Decke über den Kopf zog. Nun konnte sie in die Tiefe schauen.
Aus dem Weiß, das seit Monaten die Landschaft in den unterschiedlichsten Schattierungen beherrschte, tauchte Áilu in eine Welt der Farben. Das Licht der Sonne, die ihr den Rücken wärmte, ließ das Wasser unter dem Eis blaugrün erstrahlen. Aus den Tiefen des Seegrundes wuchsen zarte, verschlungene Gebilde empor, die in verschiedenen Gelb- und Grüntönen schimmerten. Áilu hielt den Atem an, als ein Hecht mit trägem Flossenschlag gemächlich unter ihr vorbeizog. Es schien ihr, als müsse sie bloß den Arm ausstrecken, um ihn zu berühren. Sie konnte sein Maul, das sie an einen Entenschnabel erinnerte, deutlich erkennen, ebenso die hellen Flecken, mit denen sein Körper gesprenkelt war. Noch nie war sie einem so großen Fisch so nahe gekommen. Die Lachse, die im Sommer aus dem Fluss emporschnellten, verschwanden wie silbrige Blitze wieder in den Fluten, kaum dass man sie erblickt hatte.
Das Zucken der Feder, die als Schwimmer in die Angelschnur geknotet war, riss Áilu aus ihrer Versunkenheit. Sie streifte die Decke ab, kniete sich hin, wickelte die Rentiersehne auf die Rolle an der Angel und zog wenige Augenblicke später einen Fisch aus dem Loch. Sie legte ihn in den Schnee und versetzte ihm mit dem Knauf ihres Messers einen Schlag auf den Kopf. Anschließend zog sie ihre Handschuhe aus, befreite den aus Knochen geschnitzten Haken aus dem Maul des rotgetupften Saiblings. Dann holte sie eine weitere Elritze aus dem Birkenrindenkörbchen, spießte das Fischchen auf und zog wieder die Decke über sich.
»Ich hab einen, ich hab einen!«
Das Jauchzen ihres zwei Jahre jüngeren Bruders Vuoitu, der einige Meter entfernt von ihr zusammen mit seinem gleichaltrigen Vetter Jov auf dem Eis lag, zerriss die Stille, die über dem See lag. Áilu lugte unter ihrer Decke hervor. Vuoitu war aufgesprungen und schwenkte lachend seine Mütze. Er war zum ersten Mal beim Eisfischen dabei. Áilu winkte ihm zu. Sie konnte sich noch gut an die Freude über ihren ersten Fisch erinnern, den sie geangelt hatte, als sie sieben Jahre alt gewesen war.
»Halt ihn fest, du Dummkopf!«, rief Jov und warf sich in den Schnee, um den Fisch aufzuhalten.
Doch seine Warnung war zu spät gekommen. Áilu sah, wie sich das runde, rotwangige Gesicht ihres Bruders vor Enttäuschung verzog, als seine Beute in das Loch entwischte, aus dem er sie gerade gezogen hatte. Während sich die beiden Jungen gegenseitig die Schuld an dem Missgeschick gaben, biss der nächste Saibling an Áilus Angel. Wieder vergaß sie alles um sich herum und konzentrierte sich ganz auf ihr Fangloch.
»Du bist eine tüchtige Fischerin.«
Unbemerkt war ihr Vater Heaika hinter sie getreten und begutachtete ihren Fang. Mittlerweile lagen sechs Fische neben ihr. Áilu rappelte sich hoch, zog ihren pesk, das warme Oberteil aus Rentierfell, glatt und lächelte Heaika an. Sein Lob machte sie stolz.
»Für heute ist es genug, es wird bald dunkel«, sagte er und bückte sich, um ihre Fische in seinen Korb zu legen.
Áilu sah sich um. Die Sonne berührte bereits die Kämme der westlichen Berge. Vuoitu und Vetter Jov packten ihre Sachen zusammen. Ihre Gestalten warfen lange Schatten auf dem Eis. Áilu beeilte sich, ihr Rentierfell zusammenzurollen, das Messer, die Angel und das Birkenrindenkörbchen an ihrem buntbestickten Gürtel zu befestigen und die Skier anzuschnallen.
Kurz darauf glitt sie hinter ihrem Vater, Vuoitu und Jov über die dicke Eisschicht auf das Ufer des Sees und den Waldrand zu. Sobald die Sonne verschwunden war, frischte der Wind auf und trieb Áilu die Tränen in die Augen. Sie hatte das Gefühl, als dringe die Kälte ungehindert durch ihre Hosen aus gewalkter Wolle und die Fellstulpen, die ihre Beine bis zu den Knien bedeckten. Im Sonnenschein hatte sie für ein paar Stunden vergessen, dass die Macht des Winters noch lange nicht gebrochen war. In den Nächten herrschten nach wie vor eisige Minusgrade.
Bald würden die Rentiere nicht mehr genug Futter finden. Der Schnee, unter dem die vom Frost konservierten Flechten und Blätter lagen, wurde tagsüber angeschmolzen und verwandelte sich durch die Nachtfröste in eine Eisschicht, die die Tiere nicht mehr mit ihren Vorderhufen beiseitescharren konnten.
Als sie den Lagerplatz erreichten, erschienen die ersten Sterne am Himmel. Zwischen den Stämmen der Kiefern und Fichten waren die drei Koten von Áilus Familie kaum auszumachen. Die kuppelförmigen Hütten verschmolzen mit der Landschaft. Im Sommer verschwanden sie unter den Erdsoden, mit denen sie bedeckt und von Moosen und Gräsern bewachsen waren. Jetzt sahen sie wie riesige Schneehaufen aus. Nur der Rauch, der aus den gemauerten Kaminen quoll, verriet, dass hier Menschen lebten.
Aus einer der Hütten schossen zwei schwarze Schatten auf die Ankömmlinge zu. Es waren Hirtenhunde. Der Größere umtanzte bellend den Vater, der Kleinere stürzte sich auf Áilu. Der fast ausgewachsene Welpe wedelte heftig mit seiner buschigen Rute, als er an ihr hochsprang. Lachend umarmte sie ihn und drückte ihr Gesicht in sein Fell, das bis auf die Brust und die Schwanzspitze, die weiß leuchteten, dunkelbraun war.
»Guoibmi« – Kamerad, flüsterte sie ihm seinen Namen ins Ohr und sang leise den Joik, den sie für ihn gefunden hatte, als ihr der Vater im letzten Heumonat, in dem sie Geburtstag hatte, das Wollknäuel in den Arm gedrückt hatte. »Mach einen guten Rentierhund aus ihm, beaivváža mánnán, mein Sonnenkind«, hatte er gesagt. »Ich verlass mich auf dich.«
Seitdem war kein Tag vergangen, an dem sie nicht mit Guoibmi geübt hatte. Mittlerweile folgte er, ohne zu zögern, den Befehlen »Los!«, »Komm!« und »Halt!«. Áilu brannte darauf, ihn mit den Rentieren arbeiten zu lassen.
»Vuoitu, trag bitte die Fische hinein«, bat Heaika seinen Sohn und reichte ihm den Korb mit dem Fang. »Ich sehe noch kurz nach den Rentieren.«
Áilu richtete sich auf. »Darf ich mitkommen?«
Heaika schüttelte den Kopf und lächelte. »Nein, du gehörst ins Warme. Du siehst schon aus wie ein Eiszapfen. Außerdem ist deine Mutter sicher froh, wenn du ihr ein wenig zur Hand gehst.« Er nickte ihr zu, rief seinen Hund und verschwand zwischen den Bäumen.
Áilus Enttäuschung verflog, als sie beim Lösen der Skiriemen merkte, wie steif ihre Hände waren. Sie fühlten sich taub an. Sie beeilte sich, die Skier gegen ein Holzgerüst neben der Kote zu lehnen, in der sie mit ihren Eltern und Geschwistern wohnte, und schlüpfte, gefolgt von Guoibmi, durch die Tür ins Innere. Wärme und der Duft frisch gebackenen Brotes wehten ihr entgegen. Das Feuer im gemauerten Ofen, der dem Eingang gegenüber am anderen Ende des ovalen Raumes stand, tauchte diesen in ein schummriges Halbdunkel.
Die Grundfläche der Kote hatte einen Durchmesser von ungefähr sieben Metern. Kräftige, bogenförmig gewachsene Birkenstämme, die als Außenpfosten in den Boden eingelassen waren, bildeten das tragende Gerüst und waren in halber Höhe mit Querstangen verbunden. Daran lehnte rund ein Dutzend sechs Meter lange, schlanke Kiefernstämme, die mit Birkenrinde belegt waren, um den Regen abzuhalten. Dicke Grassoden dienten als Wärmedämmung. Der Boden aus festgestampfter Erde war mit Birkenreisern belegt.
Áilu nahm die Mütze ab, zog die Fellstulpen aus, pellte sich aus dem Fellkittel, unter dem sie ein Lederhemd mit dem Fell nach innen trug, und verstaute ihre Sachen auf einem Gestell, das über einem Stapel Feuerholz links neben dem Eingang angebracht war. Der meiste Hausrat war an der Decke aufgehängt, kleinere und wertvolle Gegenstände wurden in einigen Truhen aufbewahrt.
»Bringst du mir bitte ein paar Scheite?«
Áilu drehte sich zum Ofen, vor dem ihre fünfunddreißigjährige Mutter Gutnel kniete und ihr zulächelte. Von ihr hatte Áilu die feingliedrige Statur, das schmale Gesicht und die kleinen Hände geerbt. Ihre Brüder Vuoitu und der fünfjährige Iskko kamen mehr nach dem Vater mit seinem kräftigen Knochenbau und den leicht geschlitzten Augen, die beim Lachen fast in den Hautfalten verschwanden. Áilu befahl Guoibmi, sich auf seinen Platz rechts der Tür zu setzen, und kam Gutnels Bitte nach.
Nachdem sie das Holz neben den Ofen gelegt und zwei Scheite ins Feuer geschoben hatte, kniete sie sich neben ihre Mutter, um ihr beim Ausnehmen und Schuppen der Fische zu helfen. Einen Teil davon spießten sie hinter den Kiemen auf eine dünne Stange, um sie zum Räuchern in den Kamin zu hängen. Den Rest würde es gebraten zum Abendessen geben.
Vuoitu hatte sich zu Iskko, dem jüngsten der drei Geschwister, auf eines der Rentierfelle gesetzt, die als Sitz- und Liegeunterlagen auf dem Boden entlang der Hüttenwände ausgebreitet waren. Er erzählte seinem jüngeren Bruder von seinen Erlebnissen beim Angeln.
Nach einer Weile rief Iskko: »Ich will auch Fische fangen. Warum muss ich immer hierbleiben? Das ist so gemein!«
»Du bist noch zu klein. Aber in zwei Jahren darfst du auch mit. Dann bringe ich es dir bei. Ich bin nämlich der geborene Fischer«, antwortete Vuoitu. »Ich hab heute die meisten gefangen«, fügte er leiser hinzu und schielte zu Áilu.
Sie kniff die Augen zusammen und drohte ihm mit dem Finger.
»Na ja, Áilu hat sich auch ganz geschickt angestellt«, sagte Vuoitu.
»Ja, denn meine Fische sind tatsächlich in Vaters Korb gelandet«, bemerkte Áilu.
Sie sah, dass sich Vuoitus Hals mit roten Flecken überzog – wie immer, wenn er sich ertappt fühlte oder schämte. Sie zwinkerte ihm zu und verzichtete darauf, sein Missgeschick mit dem entwischten Fisch zu erwähnen.
Ein Luftzug ließ sie zur Tür schauen. Der Vater war hereingekommen. Seine Augenbrauen und Wimpern waren mit Raureif bedeckt. Er zog die Handschuhe aus, hauchte in seine Hände und stampfte mit den Beinen.
Gutnel, deren Leib sich in den letzten Wochen zusehends gerundet hatte, bewegte sich schwerfällig und machte Anstalten aufzustehen. Áilu berührte sie am Arm.
»Bleib, ich mach das.«
Sie sprang auf, holte eine der runden Holztassen, die an Haken an der Wand hingen, füllte sie mit dem Kräutertee, der in einer Blechkanne auf dem Ofen heiß gehalten wurde, und brachte sie zum Vater.
Er trank einen Schluck und sagte: »Danke, mein Kind. Das tut gut.« Er tätschelte ihre Wange. »Du bist deiner Mutter eine große Hilfe in ihren schwachen Tagen«, fuhr er mit einem Blick auf seine schwangere Frau fort.
Áilu spürte, wie sie zum zweiten Mal an diesem Tag vor Freude über sein Lob rot wurde. Seit sie wusste, dass sie bald ein neues Geschwisterchen bekommen würde, war sie vollends in die Rolle der »Großen« geschlüpft. Mit jeder Aufgabe, die die Eltern ihr anvertrauten, wuchs ihr Selbstbewusstsein. Es fühlte sich gut an, gebraucht zu werden. Während sie die Stange mit den aufgespießten Fischen in den Rauchfang hängte, malte sie sich aus, wie es sein würde, wenn sie selbst einmal verheiratet wäre und Kinder hätte. Mindestens zwei Mädchen und zwei Jungen wollte sie haben. Wie sie wohl aussehen würden? Hauptsache, sie waren stark und wurden nicht krank, dachte Áilu. Sie schüttelte sich leicht, als ihr eine entfernte Verwandte ihrer Mutter einfiel, die drei Kinder verloren hatte, als diese noch ganz klein waren. Unwillkürlich wanderte ihr Blick zu Gutnel. Hoffentlich kam das neue Geschwisterchen gesund zur Welt.
Iskko lief zum Vater, der sich in die Nähe des Ofens gesetzt hatte, und kuschelte sich auf seinen Schoß. »Erzählst du mir eine Geschichte?«
Heaika drückte ihn an sich. »Vielleicht nach dem Essen. Jetzt knurrt mein Magen so laut, dass du kaum etwas verstehen würdest.«
»Ich höre nichts«, stellte Iskko fest und runzelte die Stirn.
»Komm etwas näher«, forderte Heaika ihn auf.
Iskko beugte sich über den Bauch des Vaters und lauschte angestrengt. Heaika ließ ein tiefes Brummen ertönen. Iskko fuhr zurück und riss die Augen auf. »Hast du einen Bären verschluckt?«
Áilu und Vuoitu warfen sich einen Blick zu und kicherten. Auf diesen Scherz des Vaters waren sie früher auch hereingefallen. Heaika blinzelte ihnen zu und fuhr Iskko durch die Haare.
»Das Essen ist fertig.« Gutnel hatte die Fische gebraten und verteilte sie nun auf Scheiben von Rindenbrot.
Im Winter, wenn die Vorräte an gekauftem Roggenmehl knapp wurden, mischte sie dieses mit getrocknetem und gemahlenem Bast, der aus dem Inneren von Kiefernrinden geschabt wurde. Er verlieh dem Brot eine herbe Note. Hungrig machte sich Áilu über ihre Portion her. Das saftige Fleisch des Saiblings schmeckte köstlich. Die Mutter hatte es mit Salz und getrockneten Kräutern gewürzt. Eine willkommene Abwechslung von den Gerichten aus geräuchertem oder gedörrtem Rentierfleisch, die es im Winter fast täglich gab.
Nach dem Essen lehnte sich Heaika zurück, zog eine kurze Pfeife aus einem Beutel, streute eine Prise Tabak hinein und ließ sich von Vuoitu einen brennenden Span bringen, um ihn anzuzünden. Áilu liebte den Geruch der frisch angerauchten Pfeife. Nach ein paar Zügen würde sie ausgehen, aber der Vater würde sie den ganzen Abend lang im Mund lassen.
Gutnel winkte Iskko zu sich. »Heute mache ich deinen kolt fertig.«
Iskko klatschte in die Hände. Seit Wochen lag er der Mutter in den Ohren, dass er endlich auch ein festliches Gewand haben wollte. Er rannte zu ihr und streckte die Arme nach oben, damit ihm Gutnel den Kittel aus blauem Wollstoff überstreifen konnte.
»Die Ärmel mache ich noch kürzer, aber sonst passt er gut«, stellte sie fest und zog ihm den Kolt wieder aus. »Welche Farben soll ich dir denn drannähen?« Sie zog ein paar gewebte Bänder aus ihrem Beutel mit dem Nähzeug und hielt sie Iskko hin.
»Die gleichen, wie Vater sie hat«, rief der Junge und deutete auf ein rotes Band mit gelben dreieckigen Mustern.
Gutnel nickte und schnitt passende Stücke für die Ärmelenden, den V-Ausschnitt und die Schultern ab. Heaika hatte währenddessen sein kleines Messer vom Gürtel genommen und zeigte Vuoitu, wie man eine Tasse schnitzt. Das Holz dafür – fein gemaserte Birkenknollen – hatte er im letzten Frühling gesammelt, lange in Salzwasser gekocht und anschließend getrocknet. Diese knotigen Wucherungen, in denen die Pflanzenfasern in alle Richtungen verliefen, lieferten besonders hartes Holz.
»Autsch!«, rief Vuoitu und steckte sich einen Finger in den Mund. Er war mit seinem Messer ausgerutscht und hatte sich geschnitten. »Warum schnitzen wir nicht das frische Holz?«, maulte er. »Das ist doch viel weicher.«
»Ja, aber dann hättest du nicht lange Freude an deiner Tasse«, sagte Heaika. »Sie würde schnell Risse kriegen.«
Vuoitu zuckte die Schultern und schaute unwillig auf das Holzstück.
Áilu hätte ihm gern das Messer aus der Hand genommen und die Tasse aus dem Birkenstück befreit. Sie liebte Holz, das ihr so warm und lebendig vorkam. Und das so gut roch. Doch Holzarbeiten waren Männersache. Frauen beschäftigten sich nach alter Sitte mit weichen Materialien, gerbten und färbten Leder, webten Bänder, nähten Kleidung und Taschen und flochten Schnüre oder Körbe aus Rinde.
Sie selbst bestickte gerade eine kleine Ledertasche mit einem Zinnfaden. Das Muster hatte sie mit Kohle vorgezeichnet. Auf dem großen Frühjahrsmarkt in Kautokeino wollte sie die Tasche verkaufen und sich vom Erlös Nadeln und eine Schere aus Stahl leisten. Und Zuckerstangen für sich und ihre Brüder.
»Die Renkühe werden unruhig«, sagte Heaika nach einer Weile. »Es wird Zeit, die Herde zu sammeln und die Schlitten zu packen.«
Gutnel nickte. »Der erste Frühlingsvollmond kommt früh dieses Jahr. Wenn wir zu Ostern in Kautokeino sein wollen, sollten wir bald aufbrechen.«
Áilu horchte auf. Ihr Gefühl hatte sie nicht getrogen. Der Beginn der Frühlingswanderung stand unmittelbar bevor. Ein Kribbeln durchlief ihren Körper. Sie sehnte sich danach, den Wald zu verlassen und endlich wieder über die Hochebene zu ziehen. Zuerst auf die Kälberwiesen, die sie zur Zeit der Schneeschmelze erreichen würden. Und später, im Frühlingssommer, mit den neugeborenen Kälbern weiter zu den Fjorden an der Küste, wo die Tiere reichlich frisches Gras finden würden. Und wo es nicht so viele Stechmücken gab wie im Binnenland.
Iskko kam zu ihr, legte seinen Kopf auf ihre Beine und murmelte schläfrig: »Singst du mir ein Lied?«
Áilu nickte und zog ihn an sich. Während sie vom Zug der Rentiere im Frühjahr sang, fielen Iskko die Augen zu.
»Es ist Frühling. Die Graugans zieht nach Norden.
Die Sonne wärmt und schmilzt den Schnee.
Die Nacht ist hell. Bald ziehen wir los.
Mutter backt viele Brote. Vater holt die Herde.
Wir warten auf die Rene.
Die Rentierglocken klingeln:
Dingeli, dingeli, dingeli.
Die Herde kommt!
Die Zugtiere werden mit dem Lasso geholt.
Die Schlitten werden beladen.
Die Zugtiere werden eingespannt.
Vater gibt das Zeichen, die Schlitten fahren los.
Die Rentierglocken klingeln:
Dingeli, dingeli, dingeli.«
3
Oslo/Januar 2011
Am Dienstagmorgen war es noch dunkel, als die Tür des Mietshauses, in dem sich Noras Wohnung befand, hinter ihr ins Schloss fiel. Zügig durchquerte sie den Innenhof, dessen Hecken und Bäume mit pudrigem Weiß bestäubt waren. Der Schein der Lampen am Rand der Wege zeichnete weiche Lichtkreise in den frischen Schnee, der über Nacht gefallen war. Als Nora den Torbogen erreichte, durch den man zur Straße gelangte, zuckte sie zusammen. Sie spürte die Gegenwart eines anderen Menschen. Sehen konnte sie in dem verschatteten Durchgang nichts. Nora blieb stehen und lauschte angestrengt. Es war nicht die Angst, überfallen zu werden, die sie vom Weitergehen abhielt. Seit sie vor zwei Jahren einen betrunkenen Hünen, der sie in einen Hauseingang zerren wollte, mit zwei gezielten Tritten in die Nierengegend, die sie in einem Selbstverteidigungskurs gelernt hatte, zu Fall gebracht hatte, fühlte sie sich solchen Situationen zumindest nicht hilflos ausgeliefert.
Nein, es war etwas anderes, das ihren Atem beschleunigte und sie erschauern ließ. Ein ähnliches Gefühl hatte sie das letzte Mal als Neunjährige gehabt. Damals hatte sie während eines Jugendlagers als Mutprobe nachts in die Kellergewölbe einer verlassenen Fabrik steigen müssen, in denen es angeblich spukte. Angestachelt von den Gespenstergeschichten, die zuvor erzählt worden waren, hatte ihre überhitzte Fantasie hinter jeder Ecke blutrünstige Geister vermutet und sie buchstäblich vor Angst zittern lassen.
Der Scheinwerfer eines vorüberfahrenden Autos erhellte die Toreinfahrt. Für einen kurzen Moment sah Nora die Gestalt eines Mannes, der unbeweglich an der Mauer lehnte. Sie war sicher, dass es derselbe war, der ihr bereits beim Schlittschuhlaufen aufgefallen war. Noras Erstarrung wich Empörung. War er ihr etwa am Sonntag gefolgt, um zu sehen, wo sie wohnte? Was fiel dem Kerl ein, ihr aufzulauern? Sie machte einen Schritt in seine Richtung, um ihn zur Rede zu stellen. Das Licht des nächsten Wagens, der die Straße entlangfuhr, leuchtete die Ecke aus. Sie war leer. Nora rannte durch den Bogen und sah sich um. Der Bürgersteig lag verlassen vor ihr – bis auf eine Frau, die ihren Hund ausführte. Nora eilte zu ihr.
»Entschuldigung, hast du gesehen, wo der Mann hingelaufen ist, der gerade aus der Einfahrt dort kam?«, fragte sie und deutete auf den Torbogen.
Die Frau zog die Augenbrauen hoch. »Was für ein Mann? Du bist die Erste, der ich heute Morgen begegne.« Kopfschüttelnd rief sie nach ihrem Hund, überquerte die Fahrbahn und hielt auf einen Hauseingang zu.
Noras Impuls, die Frau zurückzuhalten und nachzuhaken, erstarb, als ihr Blick auf den Gehweg fiel. Im Neuschnee war nur eine Fußspur zu erkennen, die von der Einfahrt wegführte. Ihre eigene. Nora schluckte. Das war doch nicht möglich! Hatte sie sich das eingebildet? Ihr wurde kalt. Litt sie plötzlich unter Wahnvorstellungen? Ach was, rief sie sich selbst zur Ordnung. Du warst in Gedanken und hast gestern einfach zu lange gelesen. Sie grinste schief.
Tatsächlich hatte sie in der Nacht kaum geschlafen. Der am Freitag bevorstehende Besuch bei ihrer Mutter versetzte sie in Unruhe, und so hatte sie sich in die Lektüre des neuesten Thrillers ihres Lieblingsautors gestürzt. Sie war erst in den frühen Morgenstunden darüber eingeschlafen und nach wilden Träumen wie zerschlagen aufgewacht. Kein Wunder, wenn ihr benommenes Bewusstsein die Traumbilder mit der Realität vermengte.
Den ganzen Tag über fühlte Nora sich angespannt und bedrückt. Es war, als erledige ein von ihr abgespaltener Teil die Arbeit mit den Kindern, die ihre ganze Aufmerksamkeit beanspruchten und sie gewöhnlich rasch aus solchen Stimmungen rissen. Immer wieder schweiften ihre Gedanken zu dem Fremden, den sie im Torbogen gesehen hatte. Oder sich eingebildet hatte, ihn zu sehen. Je länger sie darüber nachdachte, desto weniger glaubte sie allerdings, dass er ein Produkt ihrer verschlafenen Fantasie gewesen war. Dazu hatte sie seine Gegenwart zu deutlich gespürt. Warum ließ er ihr keine Ruhe? Sie hatte ihn nur flüchtig gesehen, hätte kaum beschreiben können, wie er aussah. Es war seine Ausstrahlung, die sie in seinen Bann geschlagen hatte. Der Mann hatte weder bedrohlich noch aufdringlich gewirkt. Eher ernst. Und unendlich traurig. Es kam ihr so vor, als habe sich diese Melancholie wie ein Tuch auch über sie gelegt.
Als sie mit ihrer Löwengruppe in den an die Kita grenzenden Park ging, um Schneemänner zu bauen und einem Bildhauer zuzusehen, der dort Skulpturen aus Eis schuf, ertappte sich Nora dabei, wie sie immer wieder nach dem Mann Ausschau hielt. Auch auf dem Heimweg am späten Nachmittag musterte sie die ihr entgegenkommenden Menschen aufmerksam und drehte sich ab und zu um, ob er ihr folgte. Fast war sie enttäuscht, ihn nirgends zu entdecken.
Der Fremde ließ sich auch in den nächsten Tagen nicht mehr blicken. Nora dachte immer seltener an ihn. Die betrübte Anwandlung, die er in ihr ausgelöst hatte, ging in Nervosität über, je näher das Wochenende und damit das Treffen mit ihrer Mutter rückten. Diese hatte Noras Ankündigung, sie am Freitag nach der Arbeit zu besuchen, mit einer derart begeisterten SMS beantwortet, dass Nora am liebsten einen Rückzieher gemacht hätte. Bente schien zu glauben, sie sei nun versöhnlich gestimmt. Erwartete sie etwa, dass Nora mit einem fröhlichen »Schwamm drüber!« zur Tagesordnung übergehen würde?
Als Leene sie am späten Freitagnachmittag nach der Arbeit fragte: »Kommst du mit ins Kino? Petrine und ich wollen uns die französische Komödie ansehen, die gerade im ›Saga‹ läuft«, war Nora kurz versucht, einfach zu nicken und den Besuch bei Bente sausen zu lassen. Stell dich nicht so an, wies sie sich im Stillen zurecht und schüttelte den Kopf.
»Nein, ich bin mit meiner Mutter verabredet«, sagte sie.
Leenes Augen weiteten sich. »Willst du dich endlich mit ihr aussprechen?«
Nora hob die Schultern. »Ich will vor allem mehr über meinen Vater wissen.«
»Es ist auf jeden Fall gut, wenn ihr wieder miteinander redet«, sagte Leene. »Du wirst sehen, danach geht’s dir besser.«
Sie nahm Nora kurz in den Arm, bevor sich diese in nördlicher Richtung auf den Weg zum Haus ihrer Mutter nach Sagene machte, einem ruhigen Wohnviertel, das nach den vielen Sägen benannt war, die einst am Flüsschen Akerselva betrieben worden waren. Die Sonne war bereits untergegangen, doch die Straßen des angesagten Szeneviertels Grünerløkka, das sie zügig durchquerte, waren hell vom Schein der Straßenlaternen und dem Licht, das aus den Schaufenstern der zahlreichen Designerläden, Boutiquen und Kunstgalerien leuchtete, die zwischen Restaurants, Cafés und Bars lagen.
Nora hatte keine Augen für die Auslagen der Geschäfte und die Passanten, die nach der Arbeit nach Hause strebten oder Einkäufe erledigten. Sie wickelte sich ihren Schal enger um den Hals und hielt den Kopf gesenkt, um sich gegen den Wind zu schützen, der um die hohen Häuserblocks pfiff. Das letzte Mal war sie diesen Weg im Sommer gegangen. Seither hatte sie Bente und ihr Haus gemieden.
»Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich über deinen Anruf gefreut habe!«
Bente stand in der Tür, strahlte Nora an und breitete die Arme aus, um sie zu umarmen. Nora wich zurück und runzelte die Stirn. Bente hielt inne und ließ die Schultern hängen. Sie war einen Kopf größer als ihre Tochter und stämmig gebaut. Wieder einmal war Nora erstaunt, wie jung ihre Mutter aussah. Ihr flächiges Gesicht war fast faltenlos, und die kurzgeschnittenen hellblonden Haare ließen sie jünger erscheinen als ihre sechsundfünfzig Jahre.
Bente räusperte sich. »Jetzt komm erst mal rein«, sagte sie und ging ihrer Tochter voraus. Nora hängte ihre Lammfelljacke im Flur an die Garderobe, wickelte sich aus dem langen Schal und folgte ihr. Dabei sog sie tief den Geruch ein, der in der Luft lag und der sie unmittelbar in ihre Kindheit zurückversetzte: eine Mischung aus dem Röstaroma gemahlenen Kaffees, dem Duft frisch gebackener Waffeln, einem Hauch des Parfüms, das Bente schon immer benutzte, und der herben Note von getrocknetem Lavendel, den ihre Mutter in Säckchen zwischen die Wäsche legte und zu kleinen Sträußen gebunden überall aufhängte, um Motten abzuschrecken.
Auch in der Küche hatte sich kaum etwas verändert. Gegenüber der Tür vor dem Fenster stand ein runder Tisch mit drei Stühlen. An der linken Wand war über der Arbeitsfläche neben dem Herd ein Wandbrett montiert, das Gläsern mit Nudeln, Reis, Mehl und Zucker Platz bot und an dessen Boden bunte Keramikbecher an Haken hingen. Gegenüber standen die Spüle und der Kühlschrank, direkt neben der Tür ein geräumiges Buffet.
Um ihre Nervosität zu überspielen, eilte Bente hin und her, deckte den Tisch mit Tellern und Bechern, holte einen Stapel Waffeln aus dem Ofen, wo sie sie warm gehalten hatte, öffnete ein Glas mit eingemachten Mirabellen, stellte die Kaffeemaschine an, rückte den Blumentopf mit den Alpenveilchen zurecht, der in der Mitte des Tisches stand, stieß dabei die Zuckerdose um und hielt mit einem Seufzen inne. Sie sah zu Nora, die mit vor der Brust verschränkten Armen in der Tür stand.
»Setz dich doch bitte«, sagte Bente. Nora schüttelte den Kopf, machte aber ein paar Schritte in die Küche und lehnte sich gegen die Arbeitsfläche neben dem Herd. Bente setzte sich auf einen Stuhl am Tisch.
»Ich weiß, dass es ein Fehler war, so lange zu schweigen«, begann Bente. »Aber ich dachte immer, es wäre leichter für dich, damit zu leben, einen unbekannten Vater zu haben, der in meinem Leben keine Rolle gespielt hat und …«
Nora schüttelte den Kopf. »Spätestens als ich volljährig wurde, hättest du es mir sagen müssen«, unterbrach sie Bente. »Du hattest kein Recht, es mir vorzuenthalten.«
Bente zuckte resigniert mit den Schultern. »Es tut mir wirklich leid. Ich wollte dir nicht wehtun.«
»Ach ja? Und was ist mit dem Gesülze von wegen: Ich habe es nie bereut, dich bekommen zu haben. Du warst das Schönste, was mir in meinem Leben geschenkt wurde.«
Bente zuckte zusammen. Die hellblauen Augen hinter den Gläsern ihrer randlosen Brille wurden feucht. Sie streckte eine Hand nach Nora aus. »Aber das stimmt doch!«
Nora löste sich von der Küchenzeile und stemmte die Arme in die Hüften. »Hör endlich auf zu lügen! Wie kannst du behaupten, mich zu lieben, wenn ich dich doch täglich an meinen Vater erinnere, der dich so mies behandelt hat?«
Nora spürte, wie sie zitterte. Das war die Frage, die sie am meisten quälte. Bente hatte Nora immer versichert, sie habe die Entscheidung, sie allein aufzuziehen, nie bereut und hege gegen ihren Erzeuger keinen Groll – schließlich habe er ihr nichts bedeutet. Seit Nora die Wahrheit kannte, zweifelte sie daran, dass Bente sich tatsächlich auf ihr Baby gefreut hatte. Die Angst, erneut angelogen zu werden, war der Hauptgrund gewesen, den Kontakt zur Mutter abzubrechen.
Bente straffte sich. »Ich kann mir vorstellen, wie verletzt du bist.«
»Nein, kannst du nicht!«, rief Nora aufgebracht. »Woher willst du denn wissen, wie es sich anfühlt, von der eigenen Mutter belogen zu werden? Nicht zu wissen, wer man ist?«
Bente sprang auf. »Jetzt reicht’s! Hast du auch nur ein einziges Mal darüber nachgedacht, warum ich dich angelogen habe? Ich wollte dich schützen!«
Sie brachte Nora, die etwas entgegnen wollte, mit einer Handbewegung zum Schweigen. »Ich wollte dir ja die Wahrheit sagen. Aber irgendwie habe ich den richtigen Zeitpunkt verpasst. Und je älter du wurdest, umso größer wurde meine Angst, auch dich zu verlieren. Du warst das Einzige, was mir von meiner Familie geblieben war.«
»Du hattest wenigstens mal eine Familie«, sagte Nora bitter.
Bente funkelte Nora an. »Okay, ich habe einen großen Fehler gemacht. Aber du suhlst dich jetzt seit Monaten in Selbstmitleid. Weißt du eigentlich, was ich durchgemacht habe? Wie es sich angefühlt hat, von einem Tag auf den anderen völlig allein dazustehen? Auf übelste Weise verraten zu werden? Und mein ganzes bisheriges Leben auf einen Schlag zu verlieren?«
Nora setzte zu einer Erwiderung an. Sie hat Recht, meldete sich eine leise Stimme in ihr. Du hast es wirklich noch nie wissen wollen. Sie sah Bente in die Augen. Sie wirkte so einsam und verletzlich. Nora unterdrückte den Impuls, sie in den Arm zu nehmen. So weit war sie noch nicht.
»Erzähl’s mir«, sagte sie mit rauer Stimme.
Bente, die wohl mit einer weiteren Abfuhr gerechnet hatte, kniff die Augen zusammen und starrte ihre Tochter überrascht an. Nach kurzem Schweigen, das Nora endlos erschien, setzte sich Bente wieder. Diesmal kam Nora ihrer stummen Aufforderung nach und nahm ihr gegenüber Platz.
»Wie du weißt, hätte mein Vater es niemals zugelassen, dass ich einen Sami heirate«, begann Bente.
Nora nickte. »Deshalb wolltest du mit Ánok durchbrennen und ihn heimlich heiraten. Aber dein Vater hat davon Wind bekommen und es verhindert.«
»Es war der schrecklichste Augenblick in meinem Leben. Als ich da am Busbahnhof stand und plötzlich mein Vater auftauchte. Ich weiß bis heute nicht, wie er es herausgefunden hat«, sagte Bente.
»Wer wusste denn von deinen Plänen?«, fragte Nora.
»Nur meine Mutter. Aber die hat mich nicht verraten.«
»Ich weiß. Was ist mit deinem jüngeren Bruder?«
Bente schüttelte den Kopf. »Nein, der wusste nichts.«
Sie nahm ihre Brille ab und rieb sich die Augen. Sie sah erschöpft aus.
Nora deutete auf die Kaffeemaschine. »Magst du auch?«
Sie stand auf, holte die Kanne und schenkte ihrer Mutter und sich Kaffee ein. Nachdenklich sah sie Bente an. »Du hast doch nie an Ánoks Liebe gezweifelt, oder?«
Bente schüttelte den Kopf. »Nein, ich war mir noch nie einer Sache so sicher.«
»Aber trotzdem konnte dein Vater ihn bestechen, damit er dich verlässt«, sagte Nora und stockte. Die Ungeheuerlichkeit dieses Vorgangs wurde ihr jetzt, wo sie es laut aussprach, erst so richtig bewusst. »Wie passt das zusammen?«
Bente hielt den Kopf schräg. »Na ja, seinen Leuten daheim ging es ziemlich schlecht, und das bedrückte ihn sehr. Zwanzigtausend Kronen waren damals ungeheuer viel Geld. Ich nehme an, dass er sich seiner Familie gegenüber mehr verpflichtet gefühlt hat als mir.« Sie beugte sich zu Nora und fuhr fort: »Für die Sami ist die Familie das Wichtigste. Außerdem wusste er nicht, dass ich schwanger war. Ich habe es ja selbst erst einige Wochen später gemerkt.«
»Aber einfach das Geld nehmen und verschwinden? Das ist doch unglaublich!«, rief Nora.
Bente stand auf. »Ich hätte es doch auch nie für möglich gehalten. Aber leider habe ich es schwarz auf weiß, dass es so war.«
Sie ging zum Buffet, öffnete eine Schublade und reichte Nora ein zerknittertes Blatt Papier. Die Schrift darauf war an einigen Stellen fast unleserlich und zerlaufen. Vermutlich waren Bentes Tränen darauf gefallen. Nora las.
Quittung über den Erhalt von zwanzigtausend Kronen. Der Empfänger Ánok Kråik bestätigt, diese Summe in Empfang genommen zu haben, und verpflichtet sich im Gegenzug, den Kontakt zu Bente Nybol einzustellen und Tromsø zu verlassen.
»Das ist eindeutig Ánoks Schrift«, sagte Bente.
Nora schluckte und blinzelte eine Träne weg. Sie sah ihre Mutter als junges Mädchen am vereinbarten Treffpunkt stehen und auf ihren Geliebten warten, nervös und zugleich voller Vorfreude auf das gemeinsame Leben. Und dann kam stattdessen der Vater, der ihr diesen furchtbaren Wisch unter die Nase hielt.
»Ich wäre auch nie wieder nach Hause gegangen«, sagte sie mehr zu sich als zu Bente.
Bente berührte sie leicht am Arm. »Danke.«
Nora trank einen Schluck Kaffee und räusperte sich. »Zuerst hab ich ja geglaubt, einfach so weiterleben zu können wie bisher. So zu tun, als würde es keine Rolle spielen, wer mein Vater ist. Aber es funktioniert nicht. Auch wenn er vielleicht ein Arschloch war. Es ist halt was anderes zu wissen, dass du mit ihm eine richtige Beziehung hattest. Dass ihr euch geliebt habt. Ich will, dass du mir von ihm erzählst.«
Bente nickte. »Ich bin froh, dass du mich darum bittest.«
Nora hob die Hand. »Aber nicht heute. Und nicht hier.«
Bente zog die Augenbrauen hoch. »Sondern?«
»Ich würde gern mit dir nach Tromsø fliegen. Ich möchte wissen, wo du aufgewachsen bist, dein Elternhaus sehen und die Orte, die für Ánok und dich wichtig waren und …« Nora hielt inne, als sie Bentes abweisenden Gesichtsausdruck sah.
»Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.«
Nora runzelte die Stirn. »Warum? Dein Vater ist doch schon vor einigen Jahren gestorben. Und mit deiner Mutter hast du dich längst versöhnt. Außerdem wohnt sie eh woanders.«
»Ja, schon«, sagte Bente und senkte den Kopf.
»Ist es wegen deinem Bruder?«
Bente nickte.
Nora stutzte und zog die Augenbrauen zusammen. »Soll das heißen, dass du noch gar keinen Kontakt zu ihm aufgenommen hast?«
Bente knetete ihre Hände und sah verlegen zur Seite.
»Aber warum? Du hast doch selbst gesagt, dass er dich nicht verraten hat«, sagte Nora.
Bente sah auf und sagte leise: »Das schon. Aber ich habe ja keine Ahnung, wie er zu der ganzen Sache steht.«
»Meinst du nicht, es ist höchste Zeit, das herauszufinden? Den Kopf in den Sand zu stecken ist keine Lösung. Das hast du mir zumindest immer wieder vorgehalten, als ich nicht auf deine Anrufe reagiert habe. Wovor genau hast du Angst?«
Bente atmete schwer aus. »Kåre hat jahrelang mit unserem Vater zusammengelebt. Was ist, wenn er genauso denkt wie er? Wenn er mich gar nicht sehen will?«
4
Finnmark/Frühlingswinter 1915