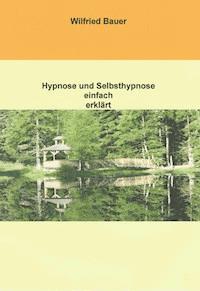4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Leben der Blütenbaiers Josef, Maria und Sohn Berni bewegt sich zwischen Komödie und Drama. Die Familie rutscht von einer peinlichen Situation in die nächste. Sie bestehen aufreibende Abenteuer und pflegen seltsame Beziehungen. Es wäre alles gut gegangen, hätte Maria nicht Josefs Schreibtisch aufgeräumt. Wichtige Unterlagen schmeißt sie in den Müll und löst damit ein Desaster aus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Wilfried Bauer
Die Blütenbaiers
Eine ziemlich schräge Familie
Roman
Zu diesem Buch:
Es geht nichts über einen gut aufgeräumten Arbeitsplatz, denkt Feng-Shui-Anhängerin Maria Blütenbaier und schmeißt die Unterlagen ihres Mannes Josef in den Müll. Entsetzt über seine Frau, sucht er im Müllraum die Arbeitspapiere, steigt in den Container und findet die Dokumente auf dem Boden liegend.
„Gott sei Dank!“, ruft er, steht auf und sieht in das Gesicht von Frau Schmitz, die plötzlich schreit wie am Spieß.
„Hilfe! Hilfe!“
Josef ist nicht weniger erschreckt, fängt sich und versucht die Frau zu beruhigen.
„Emma! Ich bin es, der Josef von nebenan. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben!“
In Panik rennt die Nachbarin aus dem Raum, läuft schreiend durch die Siedlung. Das Gerücht, Emma Schmitz sei überfallen worden, breitet sich schneller aus, als Emma laufen kann. Der schrullige und allseits beliebte Josef Blütenbaier hat aber nicht nur Freunde im Ort. Das Unheil nimmt seinen Lauf.
Der Autor:
Wilfried Bauer, 1955 in Köln geboren, lebt in Brühl im Rheinland, zwischen Köln und Bonn gelegen. Neben Anekdoten aus dem rheinischen Milieu schreibt er Kurzgeschichten.
‚Die Blütenbaiers‘ ist nach ’Manon’ sein zweiter Roman. Nicht die großen Superhelden spielen die Hauptrolle in seinen Geschichten, sondern Lück, wie ich und Du.
Impressum
Texte: © 2021 Copyright by Wilfried Bauer
Verantwortlich für den Inhalt: Wilfried Bauer
E-Book:neobooks
ISBN 978-3-7549-8296-9
Printed in Germany Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Liebe Leserinnen und Leser!
Vor Ihnen liegt eine brisante Erzählung mit Informationen, die der Öffentlichkeit zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt sind. Damit es so bleibt, hoffe ich auf Ihre Verschwiegenheit. Nachdem die Leserin oder der Leser die letzte Seite gelesen und das Buch zugeklappt hat, zerstört es sich innerhalb von fünfzehn Sekunden automatisch.
So, wie in der alten Agenten-Serie „Kobra übernehmen Sie“. Dort verglühte ein Kassettenrekorder, nachdem die Informationen über einen neuen Auftrag abgespielt und dem Chef der Truppe mitgeteilt wurden. Begeisterte Kartenspieler machten später daraus die Kinofilme „Mischen Impossible“.
Um meine Glaubwürdigkeit zu testen, könnte der Leser auf die Idee kommen, das Buch aufzuklappen und zu schließen. Explodiert es? Brennt es? Schmelzen die Buchstaben?
Mitnichten, denn Sie haben das Buch ja noch nicht gelesen.
Die Wörter und Sätze spüren die heißen Ohren und fiebrigen Augen der Leserschaft, merken, dass sie verfolgt werden und ob das letzte Wort, der letzte Satz mit dem abschließenden Punkt in des Lesers Kopf eingegangen ist.
Wenn der Leser dann das Buch erschöpft zuklappt, folgt die Erleuchtung. Es blitzt, das Zimmer strahlt heller als je zuvor. Der Leser stoppt den Prozess, indem er innerhalb fünfzehn Sekunden zehnmal „Gesegnet seist du Maria Blütenbaier“ betet, wobei er Ehemann Josef und Sohn Berni in seinem Gebet mit einschließt. Das Buch spürt: Die Leserschaft meint es gut mit mir und repariert sich selbst. Anschließend stellt der Erleuchtete das Buch vorsichtig ins Regal zurück, damit er es eines Tages rausholt zur Zweitlektüre.
Beim nochmaligen Lesen klopft der Puls gemäßigter, die Leserschaft ist inzwischen Familienmitglied.
Die Bücherwürmer zählen zum engeren Verwandtenkreis der Blütenbaiers.
Liebe Leserinnen und Leser, ich möchte Euch nicht verwirren, aber, dass ich von unglaublichen Vorkommnissen erzähle, habt Ihr bemerkt. Oder?
Davon liegen mehr als zweihundert Seiten vor Euch. Es gibt hartes Brot zu knacken. Doch: Wozu hat man denn die dritten Zähne? Bitte nicht in Panik verfallen, es wird keine Ecke abbrechen, die Geschichte enthält einen weichen Kern, ich schwör’s Euch, und wenn ich dafür zu Fuß nach Kölle gehen muss, was bei diesem Wetter eine Strafe als solche darstellt. Immerhin sind es fünfzehn Kilometer. Ich will damit sagen, wie ernst ich es meine. Deshalb diese wichtige Vorabinformationen.
Wilfried Bauer
PS: Als hätte ich es geahnt.
Nachdem das erste Buch gedruckt war, meldete sich der Hochadel der Literaturkritik, Herr Prinz Ferdinand vom Federkernbett.
Der Sohn des Kaisers aller Kritiker, des Mannes, der jeden Menschen köpfte, der es wagte, einen Satz oder leichtsinnigerweise mehrere Sätze schriftlich niederzulegen und der anschließend legendäre Grabreden auf die Toten hielt.
Der Sohn dieses Monsters lag auf seinem Federkernbett und las ein Buch von einem unbekannten Autor. In dieser Hinsicht war Prinz Ferdinand aufgeschlossener als sein Vater. Ein Mischmasch aneinandergereihter Wörter mit dem verzweifelten Versuch einer Sinngebung strömte auf den jungen Literaturkritiker ein.
Eine trostlose Szene. Doch, was passierte denn da?
Prinz Ferdinand lachte. Ja, dieser ernste Mann lachte.
Zunächst in sich hinein und dann vehement aus sich heraus in die atemlose Stille des Raumes hinein.
Dabei erhöhte sich die Lufttemperatur und die Federkerne quietschten vor Vergnügen.
Leben erwachte hinter den dicken Mauern der Kritiker-Burg. Über den Türmen wehten weiße Fahnen, ein Zeichen der Kapitulation. Ein Zeichen, das den Menschen draußen im Lande sagte: Prinz Ferdinand ist aus seinem Federkernbett geplumpst.
Später erzählte er seinem Fußvolk, was ihm beim Lesen passiert war: „Ich lag gemütlich und regungslos auf dem Sofa, meinen Kopf und Nacken mit einem weichen Daunenkissen abstützt, da hat mich das Buch durchgerüttelt.
Jeder Satz, jede Seite war ein Vulkanausbruch. Die Wörter spuckten mich wie herausgeschleuderte Lava an. Eine Hitzewelle strömte durch meinen Körper, schockte mich, hielt mich davon ab, um Hilfe zu schreien. Hatte ich während des Lesens zu wenig getrunken? Nein, auf gar keinen Fall, die Literflasche Rotwein war nahezu leer.
Jedenfalls kann ich Ihnen sagen: Nach der Lektüre des Buches werden Sie ein anderer sein als zuvor.
Ich meine, … huch, was ist denn los? Wäre ich bloß nicht aufgestanden.
Das Sofa zieht mich in seine Umlaufbahn!
Halt! Ich habe noch ein paar Seiten zu lesen. Nimmt die Couch Fahrt auf oder bin ich es? Nein, so geht das nicht, ich benötige Stabilität. Bis später!
Euer Prinz Ferdinand vom Federkernbett, live von der Polsterbank der Blütenbaiers, nein Quatsch, mein Bett, meine ich. Huch! Hilfe! Ich heb’ ab!“
Man fand Prinz Ferdinand später kilometerweit entfernt von seiner Burg, in einer Kneipe am Tresen stehend, trunken vor lauter Freude, singend und schunkelnd mit wildfremden Menschen. Ob ihn das Buch dazu animierte?
Prinz Ferdinands Kritik hat mich dermaßen gefreut, ich lag am Rande eines Freudenzusammenbruchs.
Ich will es deutlich hervorheben: Prinz Ferdinand ist einer, der sagt, was er denkt. Er hat sich von seinem Übervater befreit und ist bereit, neue Wege zu gehen. Trotz aller Ärgernisse (Rotwein ausgeschlossen) bewahrt er die Fassung. Ich liebe ihn, den Mann mit blauem Blut, den Adel mit beschränkter Haftung. Danke, Prinz Ferdinand vom Federkernbett.
So, jetzt geht’s aber los, besuchen wir die Blütenbaiers.
Ich glaub’ die diskutieren gerade.
1
Die Blütenbaiers
Maria und Josef suchten einen Namen für ihren noch ungeborenen Sohn. Bei den Vornamen der Eltern drängte sich ein religiöser Vorname auf.
Jesus kam ins Gespräch.
Maria füllte ihr Longdrink-Glas mit Sprudelwasser, nahm einen tiefen Schluck, atmete durch und stellte das Glas auf den Untersetzer. Maria hechelte ein wenig, so, wie sie es als werdende Mutter in den Babykursen geübt hatte, sich aber dort wesentlich lauter vollzog.
Bei ihrem Mann lief der Vorgang geräuschvoller ab. Die Kohlensäure, die von seiner Bauchgegend nach oben drückte, verflüchtigte sich mit unangenehm lautem rülpsen in die Atmosphäre der Küche, worauf Maria mit dem Ordnungsruf „Benimm dich!“ reagierte.
Sie hörte ein schuldbewusstes „Entschuldigung.“ Die werdende Mutter sah zu dem werdenden Vater.
„Josef, Maria und Jesus. Die Leute denken, wir wollen sie auf dem Arm nehmen.“
„Nicht unbedingt“, sagte Josef. „Stell’ dir vor, unser Sohn geht zu einem Rollstuhlfahrer und spricht zu ihm: Steh’ auf, du kannst wieder gehen. Der Rollstuhlfahrer steht auf und geht. Was wäre das denn?“
„Das wäre ein Fall für die Bild-Zeitung. Weißt du noch? Als ein deutscher Kardinal zum Stellvertreter Christi auf Erden gewählt wurde, schrieben sie: Wir sind Papst. Die neue, sensationelle Schlagzeile würde lauten: Jesus als falscher Arzt unterwegs.“
„Genau Maria, Konkurrenz belebt das Geschäft, das muss in diesem Fall sogar Jesus erfahren, also der echte. Da unser Sohn heilfähig ist, wie der Meister aus dem Neuen Testament, ergibt sich eine Copyright-Verletzung, die hoffentlich nicht all zu teuer wird.“
Maria hatte andere Sorgen. „Was geschähe mit dem Rollstuhl? Bliebe der in der Gegend stehen? Das teure Ding. Überhaupt, die ganze Aktion wäre ziemlich gottlos. Ich glaube, Jesus Blütenbaier würde wegen Betruges verhaftet.“
„Das will ich nicht bestreiten Maria, denn unser Sohn hätte die Mächtigen in unserem Lande herausgefordert. Die Mächtigen wie zum Beispiel die Kassenärztliche Vereinigung. Wenn die provoziert werden, dann fahren die schwere Geschütze auf.“
Maria nahm einen weiteren Schluck Mineralwasser und sprach sodann: „Jesus war ein Revolutionär. Wie die Geschichte zeigt, sind alle Revolutionäre früher oder später ermordet worden. Das können wir nicht wollen. Wir dürfen unseren Sohn nicht von vornherein in eine Schublade stecken. Der Junge soll sich frei entfalten können.“
„Richtig Maria, richtig! Gut, dass du das sagst. Ein kleines Kind in eine Schublade stecken, das wäre für das Baby äußerst unbequem. Dass du das nicht tust, das beruhigt mich. Es zeigt mir: Du wirst eine gute Mutter sein. Wenn ich als Versicherungsvertreter draußen im Lande tolle Verträge abschließe, ruft mein Herz: Gesegnet seist du, Maria! Ich tue das in dem glücklichen Gefühl zu wissen: Meinem Sohn geht es prima. Er hängt an deinem Busen, wie ich an meinem Cappuccino. Zum Feierabend steige ich in meinen Firmenwagen, einen Fiat 500 und rolle gemütlich nach Hause.“
Josef saugte mit seinen Lippen an der Tasse wie ein Gummistöpsel an einem verstopften Abflussrohr.
„Lecker, dieser Milchkaffee“, sagte er. „Ich glaub’, Jesus können wir nicht bringen. Die Leute verwechseln uns mit der Heiligen Familie und erwarten von unserem Sohn Wunderheilungen.“
„Keine Panik. Jesus ist erst im Alter von etwa dreißig Jahren zu dem geworden, den wir heute kennen. Das sagte meine Namensvetterin aus der Bonnstraße.“
„Na dann“, sagte Josef. „Maria 2.0 weiß es bestimmt. In dreißig Jahren wird er zu unserer Freude verkünden: Mama! Papa! Ihr werdet Oma. Aber bringe ihn erst mal auf die Welt, Maria. In eine Welt der Habenichtse und Höfe.“
„Du Pessimist, die Welt ist reich, reich an Farben und voller Melodien mit Zwischentönen. Unser Sohn wird sie erkennen, aufnehmen und neue Lieder komponieren.“
„Mit den Zwischentönen habe ich so meine Bedenken, nicht, dass er darauf pfeift.“
„Das tut er, mit ‚The Wind Of Change‘ von den Scorpions.“
„Maria, das wäre es. Unser Sohn pfeift ein neues Zeitalter ein, zum Wohle unseres Planeten und der ganzen Menschheit. Er verkündet die neue Sparsamkeit. Es wird nicht mehr neu gekauft, sondern alles repariert. Her mit den Fäden, es wird genäht, Knöpfe an die Hemden, Risse in den Hosen, wir stellen Designer-Kleidung selber her. Back to the roots. Der Tante-Emma-Laden feiert ein Comeback. Salat und Möhren aus Nachbars Garten. Welch himmlischer Geschmack. Die revolutionären Ideen, die schon lange existieren und in den Schränken still und verschlossen ihr Dasein fristen, werden von unserem Sohn befreit.“
„Gut, mein träumender Traummann. Trotzdem müssen wir diesem Revoluzzer einen Namen geben. Bloß nicht Che oder Lenin. Ich glaube, der Name Johannes passt zu unserer Familie.“
„Genau“, sagte Josef. „Johannes gehört zum biblischen Edelsegment und würde den High-End-Bereich der Familie Blütenbaier ergänzen. Quasi als Zusatzschmankerl.“
„Du erzählst einen Kokolores. Johannes ist ein schöner, traditioneller Name, den wir zu Jo amerikanisieren. In den ersten Lebensjahren ist es unser Little Jo.“
„Sehr gut Maria, sehr gut. Das klingt nach Wilder Westen, nach Bonanza, nach Schießereien und kündet vom Sieg der Gerechtigkeit. Dank unserem Johannes hat das Böse keine Chance.“
Sie einigten sich auf Johannes, ein zeitloser, biblischer Name. Merkwürdig, mit Religion hatten sich Maria und Josef lange nicht mehr beschäftigt und soeben bekam der letzte Ungläubige aus der Familie Zugang zum Christentum und sei es lediglich symbolisch gemeint.
Josef wollte noch einen weltlichen Vornamen, Maria nicht. „Bedenke folgendes: Sein erster Vorname bleibt Johannes, und damit die Leute nicht denken, wir wären religiöse Eiferer, schlage ich einen zweiten Namen vor: Bernhard. Johannes Bernhard.“
„Ich bitte dich, das meinst du nicht wirklich, oder?“
„Maria, das meine ich. Johannes Bernhard, genannt Jo, Jo-Berni oder einfach Berni. Welche Vielfalt diese Kombi bietet.“
„Bernhard! Wie altmodisch. Den Namen gibt es nicht mehr, hier handelt es sich um vollendete Vergangenheit, der Name war Ende des neunzehnten Jahrhunderts populär. Bernd geht noch, da kommen Erinnerungen an die goldenen zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts auf, eine positive Botschaft.“
Nein, Josef versteifte sich auf Bernhard. Johannes Bernhard Blütenbaier, genannt Berni. Maria schimpfte, der Name stand in der Beliebtheitsskala auf Platz zweitausend, also einer der unbeliebtesten Namen in der heutigen Zeit.
„Zugegeben, der Name Bernhard ist nicht so spektakulär wie Maverick oder Smörebröd. Die sind kein Maßstab“, sagte der angehende Vater. „Immerhin hießen viele Herrscher, Adlige und Geistliche mit Vornamen Bernhard. Bernhard Grzimek war ein deutscher Zoologe, Direktor des Frankfurter Zoos. Von wegen vollendete Vergangenheit: Bernhard Brink ist ein deutscher Schlagersänger. Der Star hat ein Lied gesungen mit dem Titel: Lass’ uns reden. Das heißt: Den Kompromiss suchen durch Verständigung. Das passt voll zu unserem Sohn. Er trägt zwar revolutionäre Tendenzen in sich, ist aber grundsätzlich ein Friedensstifter. Falls Bernhard tatsächlich diesen Namen hasst, dann steht es ihm frei, einen Künstlernamen zu wählen, wie Jesus Halleluja, Luis der Tränker oder Heidi Witzka Herr Kapitän oder was ihm gerade einfallen sollte. Schließlich wollen wir nicht, dass unser Sohn uns verabscheut, weil wir ihm einen feinen Namen gegeben haben.“
„Was heißt: Wir? Du bist der Unbelehrbare.“
Nach langen Streitereien durfte er das Kind trotzdem Bernhard nennen. Maria meinte, sie würde ihr Kind mit Johannes oder Jo ansprechen und Josef würde ihn Bernhard oder Berni nennen. Ob bei diesem Durcheinander ein guter Schüler aus Jo beziehungsweise Berni würde? Jo der Verwegene, Berni der Brave.
Der verwegene Jo kämpft maskiert wie ein Held mit dem Degen, ein Rächer der Armen und Unterdrückten. Der Brave Berni bringt Mama und Papa den Kaffee ans Bett, ist ein gehorsamer Junge, Berni seine Lieblichkeit. Name hin oder her, das allerwichtigste sei, der Junge kommt gesund zur Welt und die Mutter übersteht die Geburt problemlos. Mutter und Kind sind munter. Alles andere sei Nebensache, darüber waren sie sich einig und mit dem neuen Erdenbürger würde das Leben ein Thriller.
Maria gebar Jo-Berni, nach eigenen Angaben, in einem Stall in der Nähe von Köln. Nach Aussagen von Freunden handelte es sich nicht um einen Stall, sondern um das Städtische Krankenhaus. Rückschlüsse zu ziehen, Ähnlichkeiten mit einem religiösen Ereignis herzustellen welches vor zweitausend Jahren stattfand, wären verfrüht.
Die Heiligen Drei Könige ließen sich nicht blicken. Weihrauch und Myrrhe wären auch keine passenden Geschenke gewesen, es sei denn, der neue Erdenmensch wüsste damit etwas anzufangen, würde bei diesen Gerüchen strahlen, pausbäckig wie ein Koch. Gegen Gold hätten die Familienmitglieder allerdings nichts einzuwenden gehabt.
Aus dem Unterbewusstsein der Eltern kam immer wieder die Frage hoch: Ob aus dem Jungen ein Wunderknabe würde?
Zweifel waren angebracht, da ein Himmelsereignis zur Geburt ausblieb, wenn man von dem Flackern der Leuchtröhren an der Decke im Kreißsaal absah. Wackelkontakte gab es ständig, in Stromkreisen wie in zwischenmenschlichen Beziehungen.
Der Vater übte auch nicht den Beruf eines Zimmermanns aus, sondern verkaufte als Vertreter der Hof & Habenichts-Versicherung, HoHa genannt, mit gekämmten Haaren, messerscharfen Bügelfalten, steifen Kragen und sauberen Fingernägeln Policen fürs Leben. Fallende Rendite inbegriffen. Dafür konnte er nichts, die Regeln über fallende oder steigende Kurse stellten andere auf.
Gründer und Josefs Vorgesetzte entstammten ramponierten Adelsgeschlechtern. Der Werbeslogan lautete: Haste nix, biste nix – HoHa.
Wie konnte man sich solch einen Firmennamen geben? Welcher Mensch möchte gerne nichts haben und nichts sein? Der Adel meinte, das sei der perfekte Marketing-Gag von dem Er, Josef Blütenbaier, nichts verstünde.
Ein reiner Gag also, den Josef zu verteidigen hatte. Für ihn waren seine Vorgesetzten die Habenichtse: Ihre Höfe hatten sie geerbt, getan hatten sie dafür nichts, die Anwesen verfielen. Zukunft sah anders aus als zwei Männer mit Cognacgläsern in der Hand und dicken Zigarren im Mund. Dem Adel fehlte Mitgefühl für die Menschen, die schwer und hart arbeiteten, damit sie finanziell über die Runden kamen.
Täglich gegen den Frust kämpfend und immer lächelnd brachte Josef Policen an Mann und Frau. Das Konzept der HoHa war nicht verkehrt. Die HoHa bot Menschen mit geringem Einkommen Geldanlagen an. Diese führten zwar nicht zu exzessivem Reichtum, doch immerhin zu einem gewissen Besitz. Ihre wenigen Euros konnten durch riskante Termingeschäfte an der Börse vervielfacht werden. Gegenüber anderen Banken klärte HoHa ihre Kunden gnadenlos auf. Das angelegte Geld könnten sie auch verlieren und diese Möglichkeit wäre größer als umgekehrt. Wahrscheinlicher als ein Hauptgewinn im Lotto, wäre die Geldvermehrung bei der HoHa. Zwischen diesen Extremen balancierte Josef. Er redete den Kunden eher aus als ein, das Geld riskant anzulegen. Das sei vermerkt.
Erstaunlich viele Habenichtse wagten alles. Den einen oder anderen Supergewinn gab es. Paradoxerweise erstellte Josef einige Jahre später für diese Klientel Entschuldungspläne.
Maria nahm Mutterschaftsurlaub, blieb die ersten Jahre zu Hause und pflegte ihren Little Jo. Als er in den Kindergarten kam, arbeitete sie halbtags in ihrem Beruf als Bibliothekarin in der Stadtbibliothek.
Die Jahre vergingen. Little Jo besuchte die Grundschule. Der Schulweg führte über viel befahrene Straßen und war nicht ungefährlich. Maria begleitete ihren Sohn.
Das Leben in der Arbeitersiedlung wurde ungemütlich. Abends versammelten sich die Jugendlichen aus der Gegend auf der Straße, tranken Alkohol, lärmten bis in die Nacht hinein und hinterließen einen Haufen Dreck. Unruhiger Schlaf und ständiger Ärger ging an die Nerven.
Was war an dieser Gegend schön? Die Wiese am Rhein, die Wohnung, ja. Der Rest nicht.
In dieser Welt sollte Little-Jo aufwachsen? Nein, die Blütenbaiers wollten hier nicht mehr wohnen.
Die Großstadt Köln hatte sich in den zehn Jahren, in denen sie hier lebten, zu einem Moloch von mehr als einer Million Einwohnern entwickelt, wurde mit den Jahren hektisch, aggressiv und kriminell. Die einst saubere Stadt verdreckte immer mehr.
Maria bemühte sich, ein Eigenheim zu finden. Sie suchte ein Reihenhäuschen vor den Toren der Stadt. Selbst hier waren die Preise zu hoch und sie verlagerte ihre Suche tiefer ins Umland. Nach etlichen Recherchen, kurz davor aufzugeben, fand Maria eine Doppelhaushälfte, deren Vorbesitzer aufgrund von Scheidung die Immobilie verkaufte. Klein, fein und finanzierbar. Jawohl: Fi-nan-zier-bar! Das konnte man gar nicht laut genug sagen, das musste man sich auf der Zunge zergehen lassen: Fi-nan-zier-bar! Bei den dreisten Wucherpreisen heutzutage kam es ihnen wie ein Glückslos vor.
Wucherpreise für Wohnungen, Grundstücke und bei Eigenheimen, von der Politik bewilligt. Das müsste so sein, damit die Immobilienfonds investieren. Das Bauland sei zu teuer, deshalb die hohen Preise. Wer bestimmte den Preis des Baulandes? Der Markt. Vor laufender Kamera belogen sie die Menschen. Die Mehrheit der Betrogenen hatte Verständnis. Die Preise müssten so hoch sein, ein kleiner Gewinn müsse übrig bleiben. So wählten die Menschen Parteien, die eher Versicherungspaläste unterstützten als Wohnungen. Für Josef blieb es auf ewig ein Rätsel, warum die Bürger Parteien wählten, die offensichtlich nicht den Willen der Bürger nach bezahlbarem Wohnraum umsetzten.
Da für Little Jo die Zeit zum Schulwechsel gekommen war, passte es gut, aus dieser Stadt herauszukommen. Little Jo hatte leidlich die Grundschule überstanden, dennoch sollte er, wenn nicht das Abitur, so immerhin die Mittlere Reife erlangen.
Der Umzug nach Brühl, einer mittelgroßen Stadt linksrheinisch zwischen Köln und Bonn gelegen, klappte dank Freunden ausgezeichnet.
In der Steingasse im Ortsteil Badorf lag ihr neues Zuhause. Die Siedlung bestand aus Reihen- und Doppelhäuser mit farblich verschiedenen Fassaden. Unterschiedliche Dachformen lockerten die Architektur auf. Enge Wege zwischen den Bauten gaben diesem Areal einen gemütlich dörflichen Charakter.
Bäume, Sträucher und Gärten, von den Besitzern liebevoll gepflegt, sorgten für ein buntes Bild.
Die Ureinwohner trennten den Namen ihres Stadtteils liebevoll in Bad Orf. Es sei der kleinste Kurort Deutschlands, meinten einige. Es handelte sich nicht um einen klassischen Kurort mit großen Kliniken, sondern der Vorname Bad resultierte aus der Dichte der Badewannen pro Einwohner. Die Statistik erreichte mit achtzig Prozent einen europaweiten Spitzenplatz. Vortrefflich, da der Trend zur Dusche seit Jahrzehnten anhielt.
Würden die Badewannen in Reihe angeordnet, könnte der darin liegende ein Stückchen Mittelmeer erträumen, mit Strand wie an der Riviera oder Adria. Keiner müsste extra früh aufstehen, um seinen Platz vor oder hinter der Wanne mit einem Badetuch zu reservieren. Im Sommer bot sich ein lustiger Anblick: Badewannen mit planschenden Kindern, Freizeitkapitäne mit Strohhut im Wasser sitzend und Zeitung lesend, alle erfreuten sich der Abkühlung. Badesüchtige Nachbarn prosteten sich über niedrige Hecken zu. Die lustigen Leute wünschten einander eine Handbreit Wasser unter dem Hintern, was in den engen Schüsseln physikalisch unmöglich war.
In solch einer mediterranen Atmosphäre plätscherten die Sommertage daher.
Der neutrale Besucher könnte von einem verschlafenen Nest sprechen, stände da nicht dieser neu errichtete Supermarkt am Rande der Siedlung, der die Nahrungssuche der Einwohner vereinfachte, dafür erhöhten Lärm mit sich brachte. Der Autoverkehr in der Steingasse nahm beträchtlich zu.
Im Umkreis von einem Kilometer sorgten zwei Kirchen für das Seelenheil der Gläubigen. Zwei Kneipen die regelmäßig von Pfarrer und Pastor heimgesucht wurden, dienten der praxisorientierten Ökumene. Dies fand bei der Gemeinde großen Anklang. In den zwei Friseursalons, erfuhren die Kunden die neuesten Nachrichten aus dem Dorf. Wer hat mit wem eine Affäre? Wer schaut wen nur noch mit dem Hintern an? Für Wehwehchen gab es einige Arztpraxen, deren Equipment Generationen von Patienten gesehen hatte.
Die verschriebenen Rezepte für Salben und Pillen konnte man in der Gottesapotheke einlösen.
Drei Bäckereien gaben den Einwohnern ihr tägliches Brot.
Wäre man nicht so anspruchsvoll, man hätte sein ganzes Leben an diesem schönen Ort verbringen können, zumal die Landschaft drum herum bestückt war mit Wäldern, Seen und hügeligen Wiesen, auf denen Pferde grasten.
Sonntags spazierten die Blütenbaiers durch die Landschaft und Josef sagte, angesichts von Wald und Pferdekoppeln: „Das sieht hier aus wie im Urlaub.“
Er sagte es ständig und wenn Maria die ersten Worte hörte: „Das sieht hier aus …“, vollendete seine Frau den Satz:
„Wie im Urlaub.“
In ihrem Haus fühlten sich die Blütenbaiers pudelwohl. Die rechte Doppelhaushälfte bewohnte Emma Schmitz. Mit zweiundfünfzig Jahren war die Witwe nur ein Jahr älter als Josef. Vor acht Jahren starb ihr Mann an einem Herzinfarkt. Gemeinsam führte das Paar die Konditorei ‚Emmas Café“ in der Innenstadt. Nach dem Tod ihres Mannes verkaufte Emma die Feinbäckerei, unterstützte die neuen Inhaber und arbeitete für sie. Emmas Kuchenkunst war gefragt. Mit dem Erlös aus dem Verkauf des Geschäftes tilgte Emma einen großen Teil der Hypothek.
Die Familie Blütenbaier mochte die nette Dame, sie besuchten sich gegenseitig.
Links neben dem Doppelhaus befand sich der Müll- und Fahrradraum für vier Parteien.
Das zweite Doppelhaus lag links neben dem Schuppen.
In der rechten Hälfte lebte die Familie Frenzel. Ein junges Paar Ende zwanzig, mit zwei kleinen Kindern. Das Mädchen Carol war erst ein Jahr alt, ihr Brüderchen Malte zählte drei Jahre. Vater Mario bekamen die Blütenbaiers selten zu Gesicht, er arbeitete in Wechselschicht in einem Chemieunternehmen. Mutter Mareike war für die Kinder und den Haushalt da. Maria traf Mareike hin und wieder im Fahrradraum und die zwei hielten immer ein kleines Schwätzchen.
Neben den Frenzels wohnte ein Yuppie-Ehepaar, die Bergmanns. Das waren karrierebewusste Leute die großen Wert auf äußere Erscheinung legten. Die Nachbarn werden in Marias Alter gewesen sein, um die vierzig. Mit ihren Designer-Sonnenbrillen auf der Nase, im Schlepptau einen Designer-Hund, eine Art Huskie, sah man die Young Urban Professionals bei ihren Show-Spaziergängen durch die Siedlung. Das Fell des Hundes leuchtete so unnatürlich weiß, grau und schwarz, dass man dachte, es sei gefärbt. Gebellt hatte der Hund nie, vielleicht wurde das aus dem armen Kerl herausgezüchtet. Aber er saß stolz und aufrecht da, wie ein Macho, der betont den Brustkorb herausstreckte und den Bauch einzog, nur ohne große Anstrengung. Der Huskie war sich seiner Schönheit bewusst und er war überzeugt, jeden Schönheitswettbewerb zu gewinnen, was Herrchen oder Frauchen nie schaffen würden.
Josef wusste nicht, ob diese Überheblichkeit vom Hund auf die Besitzer übertragen wurde, oder ob es umgekehrt war. Viel konnte Josef mit diesen Nachbarn nicht anfangen, obwohl auch die Bergmanns beruflich finanztechnisch unterwegs waren, im Auftrag der Deutschen Bank. Das passte in eine Reihe: Arroganz, Gleichgültigkeit, Deutsche Bank.
Na gut, leben und leben lassen, aber Josef freute sich, wenn er die Rückleuchten ihres geleasten Mercedes-Cabriolet sah, bedeutete dies doch, das tolle Paar ist für einige Tage verreist. Den Designer-Hund gaben die Nachbarn anderweitig unter. Der Huskie wurde nur zu Darstellungszwecken benötigt. Josef befand die Bergmanns einer HoHa-Versicherung für nicht würdig. Das will was heißen.
Nachdem die Blütenbaiers in der Siedlung bekannt waren, redeten einige Leute hinter ihrem Rücken. Herr Blütenbaier hatte, nach deren Beurteilung, eine Macke oder wie Stammgäste der Wirtschaft auf der Ecke behaupteten, einen an der Waffel: Der sei eine schräge Type, den sie aber mochten. Dieses Urteil verdiente er sich nicht durch draufgängerische Heldentaten, sondern durch befremdliche Verhaltensweisen, welche bei der Ehefrau und dem Sohn nicht immer gut ankamen. Dabei war Herr Blütenbaier, nicht nur beruflich bedingt ein höflicher Mann. Dieser Mann strahlte Optimismus und Freude aus. Ihm konnten die Menschen vertrauen, mit ihm schlossen sie gerne Verträge. Der war nett, ehrlich, der verarscht keinen. Aber irgendwie, so meinten die Thekensteher und Kneipenhocker, ganz sauber war der nicht.
Dass Berni Josefs Sohn war, glaubten die meisten nicht. Für sie war es ein vorlauter Bengel, der einen Instinkt für Gefahr besaß, in brenzligen Situationen abhaute oder sich entschuldigte. Das rettete ihn vor so mancher Strafe. Sein Fehler: Er plapperte ohne Ende. Da es aus ihm herausschoss wie ein Geysir, gab es öfter Kollateralschäden, zu denen überwiegend sein Vater gehörte. Mutter Maria befand: Das sei reinste Lebensfreude, dieses Mitteilungsbedürfnis, ein Ausbund an Energie, ein Genie.
Maria schwebte in esoterischen Sphären. Sie arbeitete vormittags in der städtischen Bibliothek. Eine Aufgabe, die ihr gefiel. Die Esoterik-Ecke hatte es ihr angetan. Mit Psychologie für den Hausgebrauch kannte sich Maria durch Schmökern in den betreffenden Büchern bestens aus.
Eine Vorliebe für Feng-Shui kristallisierte sich heraus.
Marias Hobby bescherte Josef eine Menge Arbeit. Die Tapeten, noch nicht lange verklebt, durfte er runter reißen, die Wände schleifen und in zarten Blau-, Gelb- und Grüntönen streichen. Maria gab das Design vor. Die Umstellung der Möbel gestaltete sich schwieriger. Mehrfach änderte er den Platz der Schränke und Kommoden. Das Bett im Schlafzimmer verschob Josef auf die gegenüberliegende Seite mit Ausrichtung nach Osten, dem Kopfende der aufgehenden Sonne entgegen. Nicht schlecht, mit der Sonne aufzustehen, dachte er. Den Schreibtisch mit Computer und den Fernseher transportierte er an die andere Wand in eine Ecke. Stecker waren vorhanden, die Geräte konnte er anschließen, das Kabel der Satellitenantenne verlegte er neu. Diese Arbeiten erledigte Josef, der handwerklich nicht begabt war, dennoch bravourös. Ein Paravent teilte das Schlafzimmer in Schlaf- und Arbeitsbereich.
„Du sollst die Arbeit nicht sehen und dich entspannt dem Schlaf widmen.“
„Find’ ich gut, theoretisch jedenfalls.“
„Du wirst dich demnächst dran halten. Eine Verknüpfung von Feng, was Wind bedeutet und Shui, was Wasser bedeutet. Gegensätze die durch konkrete Vorgaben angepasst werden, dienen der Harmonie und Ausgeglichenheit.“
Nicht verkehrt. Josef bemäkelte nur diesen Hokuspokus von Zahlen addieren, Quersummen bilden, einen abziehen oder zwei dabei zählen. Das Endergebnis fiel dann in eine Kategorie der fernöstlichen Philosophie. Er fand das albern, war er doch handfeste Statistiken gewohnt.
„Ich studiere Feng-Shui weiter“, sagte Maria. „Dann gestalten wir unseren Garten neu. Das wird ein Highlight.“ Ein seliges Lächeln strich über Marias Gesicht und Josef dachte: Was wird noch auf mich zukommen?
„Lass dir beim Studieren Zeit“, sagte er mit böser Vorahnung.
Begegnung im Dunkeln
„Hauptsache Sonderangebot!“, hörte Herr Schulze die eindringliche Stimme seiner Frau, als er das Haus verließ. An einem schmuddeligen Winterabend gegen sechs Uhr ging er über die Steingasse zum Supermarkt. Gewappnet mit einem Beutel in der linken Hand, den Kragen seines Mantels hochgeschlossen, tappte er über den Fußweg. Der wichtige Einkaufszettel, den ihm seine Frau gegeben hatte, steckte in seiner Jackentasche. Früher konnte er sich vier oder fünf Teile merken. Das funktionierte wunderbar, bis er eines Tages anstelle des Spülmittels eine Palette Bier mitbrachte. Es war zwar ein Sonderangebot, aber es gab ein Gezeter zuhause und es nützte ihm nichts, darauf hinzuweisen, dass Bier ebenfalls ein Spülmittel sei. Es spülte Kehlen anstatt Teller. Nach diesem Vorfall verfasste seine Frau Einkaufszettel. Darauf hatte sie akribisch alle Artikel mit Gewichtsangaben und Preisen auf den Cent genau aufgeschrieben, zusätzlich gab sie die Farbe der Verpackungen an. Fehlte nur die Artikelnummer. Da Herr Schulze eh seine Lesebrille vergessen hatte, wäre diese Mühe vergeblich gewesen. Bloß nicht den Zettel verlieren, dachte er, das gäbe Ärger ohne Ende.
Schulze, erhob kurz seinen Blick vom Pflaster, schaute nach vorne und sah drei merkwürdige Gestalten, die ihm entgegenkamen. Er erkannte im Näherkommen eine Frau, einen Mann und einen Jungen, wahrscheinlich der Sohn. Schulze beobachtete die Gruppe nachdenklich, denn alle trugen die gleichen Anoraks: Auffällig und knallig rot mit schwarz eingefassten Reißverschlüssen. Die aufgesetzten Taschen ebenso schwarz. Die gelb weißen Signalstreifen quer über Brust und Rücken blendeten die Augen. Funktionsjacken, kein Autofahrer würde die Personen übersehen, vorbildlich. Das musste in der dunklen Jahreszeit sein. Bloß: Es gab mit Sicherheit schönere Jacken. Diese gehörten in die Kategorie ‚Krönung des schlechten Geschmacks‘.
Soweit sich Herr Schulze dieses Urteils erlauben durfte. Fairerweise sollte man das bemerken, denn auf dem neuesten Stand der Mode war der konservative Mann bei weitem nicht. Aber sogar ihm missfiel diese Kleidung.
Diese Menschen kaufen auch nur Sonderangebote, dachte er. Zwei Jacken kaufen, die dritte ist kostenlose Zugabe. Vermutlich hatte die Frau ihrem Mann genauso einen Einkaufszettel geschrieben mit Größen, Materialien und Preisen. Es fehlte die Farbangabe, der alles entscheidende Faktor. Der Mann hatte ohne Zweifel Ärger gekriegt. Bei Konservendosen spielte die Farbe keine Rolle, die leeren Dosen flogen in den Müll für Plastik und Metall. Aber Kleidung? Es könnten Wegwerf-Jacken sein. Na gut, so ist das in der heutigen Konsumgesellschaft, beendete er seine Vermutungen.
Die Familie sah aus wie eine kleine Armee, vom Rest der Truppe verlassen. Die Jacken dienten dazu, die Kameraden in die Flucht zu schlagen. Das Regiment wäre im Nu vom Feind entdeckt worden. Der uniformierte Eindruck ließ kaum erahnen, mit welcher Disziplin dieser Trupp das Leben organisierte, als gäbe es keinen Freiraum für den Einzelnen. Kein Spaß, kein Spiel, keine Spannung. So dachte Herr Schulze damals.
Er konnte nicht ahnen wie viel Spannung und Abenteuer ihm diese Familie noch bringen würde.
Zackig marschierte ihm diese kleine Kampfeinheit entgegen. Ob es ein Routineschritt, ein vom Oberbefehlshaber vorgegebener Rhythmus oder durch die Kälte bedingter Gang war, der Gleichschritt wurde gehalten.
Komme, wer da wolle.
In diesem Fall Herr Schulze. Der dachte an einen Hechtsprung in den Schützengraben. Die Vorstellung einer Rippenprellung hielt ihn davon ab. Wie hätte es ausgesehen? Die Riege gäbe ihm eine erbärmliche Haltungsnote.
Die Mutter der Kompanie schaute ihn an, sagte nichts, lächelte liebenswürdig. Abwesenheit lag in ihrem Blick.
Wer weiß, woran die Frau gerade dachte.
Der Feldwebel grüßte mit umfallender Freundlichkeit und diese, Schulze spürte es, kam von innen, es war kein plakatives Dauergrinsen, dass sich durch das Gesicht des Mannes zog, sondern ein herzliches, nett gemeintes.
Beim Sprecher des Restpostens gab es keinen guten oder schönen, sondern einen wunderschönen Feierabend, an dem der Kaffee genussvoll munden solle.
Was konnte Herr Schulze darauf antworten? Konnte er das noch toppen? Welch überwältigende Freundlichkeit. Er sah den Schützengraben, in den er hineinspringen könnte, fühlte die darauf folgende schmerzhafte Rippenprellung und er antwortete geistesgegenwärtig: „Dito!“ Der Angesprochene nickte und Schulze sagte energisch: „Aber verschärft!“ Mehr fiel ihm dazu nicht ein. Bei der Herzlichkeit dieses Mannes empfand er seine Antwort als mickrig. Der Mann hatte mehr verdient und erst recht, weil er Ärger wegen des Jackenkaufs hatte. Schulze überlegte, welche Grußworte er noch verwenden könnte: Einen noch herrlicheren Feierabend, an dem das Getränk Ihrer Wahl, welches von Ihrer Prinzessin lächelnd überreicht, sanft die Kehle runter rinnt und Ihnen ein himmlisches Erlebnis beschert, welches Sie hier und jetzt auf Erden genießen dürfen? Innerlich noch mit der Formulierung beschäftigt, befand sich der Restposten schon weit weg von ihm. Herr Schulze schaute dem Dreigespann hinterher. Hurtig, hurtig, dachte er, eine schnelle Truppe. Mit dieser Schnelligkeit und diesem Zusammenhalt könnten die drei eine Schlacht gewinnen. Ohne diese dämlichen Jacken würden sie das schaffen.
Als sendeten seine Gedanken böse Schwingungen aus, drehte sich der Sohn um. Seine bissige Fratze sagte: Fall nicht in mein Revier ein, oder du bist du des Todes. Schulze nahm die Kriegserklärung an und urteilte: Bürschchen, du bekämest in dem Moment, in dem du aus der Haustür trittst, von mir sofort ein paar Ohrfeigen, dann wärest du auf deinem Weg mit Sicherheit netter zu den Leuten. Rein gefühlsmäßig betrachtet. Keine Angst, der Mann würde nicht so handeln. Keine Gewalt. Davon gab es in der Welt zu viel. Love and Peace and Happiness oder auf Deutsch: Friede, Freude, Eierkuchen. Das sollte die Parole sein.
Als Herr Schulze vom Einkauf nach Hause kam und seine Frau alle Artikel auf dem Zettel mit der Rechnung kontrolliert hatte, sagte er zu seiner Frau: „Auf dem Hinweg sah ich die Familie, die vor ein paar Monaten in unsere Siedlung gezogen ist. Sie waren geschmacklos gekleidet, aber der Mann war dermaßen freundlich, da verschlug es mir die Sprache. Die Frau redete nichts, machte ein freundliches Gesicht. Der Sohn fiel ab. Bei ihm besteht Nachholbedarf, er ist noch jung und hoffentlich lernfähig.“
Es war seine erste Begegnung mit der Familie, deren Namen er noch nicht kannte. Es dauerte nicht lange, dann wusste er, wie deren Name geschrieben wurde. Ob Herr Schulze bei dieser verwirrenden Begegnung noch die richtigen Sonderangebote einkaufte, ist nicht überliefert.
Man sah ihn am anderen Tag mit gewohnt fader Miene durch die Gegend spazieren, ohne zerkratzten Backen. Das ließ darauf schließen, dass der Ehemann alles richtig gemacht hatte. In solchen Situationen nannte seine Frau ihren Eduard zärtlich Hamster. Das hatte eine Nachbarin gehört, als die Schulze unvorsichtigerweise bei offenem Fenster ihrem Mann zurief: „Hamster, das hast Du gut gemacht!“ Was hatte er denn gut gemacht, rätselte die Nachbarin. Sie konnte es nicht hören, da Frau Schulze das Fenster schloss. So ein Ärger.
Dieses Erlebnis erzählte die Nachbarin im Damensalon.
Die Frisöse drehte der Frau Lockenwickler in die nassen Haare ein. „Eventuell hat Herr Schulze das richtige Waschmittel gekauft. Bitte den Kopf leicht nach rechts neigen. Stopp! So ist gut. Der Mann könnte den Boden spiegelblank geputzt oder seiner Frau ein leckeres Würstchen gebraten haben.“
Die Kundin, in deren Haare etliche Lockenwickler steckten, bestätigte mit leichtem Kopfnicken die Vermutung der Frisöse.
„In der Richtung ist das bestimmt abgelaufen“, sagte die Frisöse, die den letzten Wickler eindrehte.
„Ich kenne die Frau, sie kommt ab und an vorbei oder besser gesagt: Sie lässt sich herunter, meinen Laden zu besuchen. Haare färben. Schneiden lässt die Dame woanders. Vielleicht bei ihrem Hamster.“
Die Frauen lachten.
„Ich bin gemein, ich weiß“, entschuldigte sich die Frisöse. „Ich möchte nichts Negatives über Frau Schulze sagen, nur, ihr Ton ist zackig wie ein General. Kurz und knapp und befehlsmäßig. Angenehm ist diese Generalin nicht. So, jetzt kommen sie unter die Trockenhaube. Darf ich Ihnen eine Zeitschrift zum Lesen geben? Bild der Frau? Gut.“
Die Frisöse suchte unter einem Stapel von Illustrierten die Zeitschrift ‚Bild der Frau‘. Wie immer lächelte ein Königspaar auf der Titelseite in die Gesichter der Leser und strahlte Zuversicht aus, so als wollten Königin und König sagen: Alles wird gut, sogar ihre Frisur.