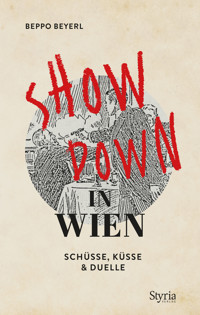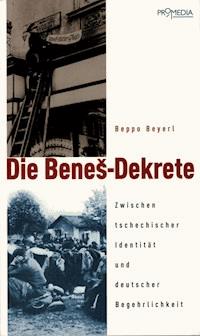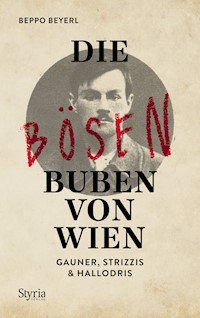
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Styria Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Sie hatten Charme und einen guten Schmäh. Ihrer Persönlichkeit konnte man sich nur schwer entziehen. Und dabei waren sie üble Täter, Kriminelle und Halsabschneider, denen man am besten aus dem Weg ging. Dennoch wurde so manchem warm ums Herz, wenn er mit ihnen plauderte – und gar nicht merkte, dass er dem Verbrechen ins Auge schaute. Dieses Buch ist den bösen Buben von Wien gewidmet, den Gaunern, Strizzis und Hallodris der letzten zweihundert Jahre. Ob sie nun bekannte Helden der Unterwelt in »Robin-Hood-Manier« waren wie der legendäre Meidlinger Einbrecherkönig Schani Breitwieser. Oder gefinkelte Lotteriebetrüger wie der verhasste Baron von Sothen. Ob sie Geschichte schrieben wie der Geldfälscher Peter von Bohr, der Mitbegründer der »Ersten«, oder ob sie beinahe unbekannt blieben wie der Räder rollende Wagnermeister Gregor Bildstein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GESUCHT:
VORWORT
WOLFGANG VON KEMPELEN
PETER RITTER VON BOHR
GREGOR BILDSTEIN
SEVERIN VON JAROSZYNSKI
JOHANN CARL FREIHERR VON SOTHEN
CAMILLO CASTIGLIONI
ERNST WINKLER
IMRE BÉKESSY
HERMANN STEINSCHNEIDERaliasERIK JAN HANUSSEN
GUSTAV BAUER
JOHANN „SCHANI“ BREITWIESER
SYLVESTER MATUSKA
EMIL MAREK
UDO PROKSCH
HEINZ BACHHEIMERaliasROTER HEINZI
RAINER MARIA WARCHALOWSKY
JOHANN KASTENBERGERaliasPUMPGUN-RONNY
AUSGEWÄHLTE LITERATUR
BILDNACHWEIS
DER AUTOR
VORWORT
Spricht man in Wien von den „bösen Buben“, so schwingt nicht selten eine versteckte Anerkennung, ja, eine heimliche Hochachtung mit. Denn die „bösen Buben“ haben das getan, vor dem uns das gute Gewissen, der gute Charakter und die Haltung als braver Staatsbürger stets bewahrt haben.
Stimmt natürlich nicht ganz. Die in diesem Buch vorkommenden „bösen Buben“ sind üble Täter und schaffen nicht den Vergleich mit einem Robin Hood, dem tapferen Rächer der Rechtlosen. Sie sind keine Sozialrevolutionäre, die den Umverteilungsprozess mit ihren Methoden halt ein bisserl beschleunigen wollen.
Im Gegenteil: Die Zahl der üblen Täter ist mit Männern gesättigt, die meist aus den unteren sozialen Schichten stammen und die mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln sich in der „guten Gesellschaft“ etablieren wollen, um dort erbarmungslos und nachhaltig ihre speziellen Vorlieben zelebrieren zu können.
Andere wiederum sind sowieso in den Spitzen der Gesellschaft beheimatet. Nach dem Motto „Gier ist alles“ sind sie der Meinung, dass es keine Grenzen und keine Einschränkungen für ihre enthemmte Gier gäbe. Letztlich scheitern beide, die vermeintlichen Sozialrevolutionäre und die vermeintlichen Giertäter.
Natürlich haben sich im Laufe der Jahre ihre Methoden stark verändert. Ich beginne chronologisch mit Wolfgang von Kempelen, einem genialen Techniker und Konstrukteur, der es um 1770 auch ohne „Zaubertricks“ zu Ruhm und Ansehen gebracht hätte. Doch nein, er musste seine Schachmaschine konstruieren, um in Wien, in Paris und in London die staunende Gesellschaft zu bluffen und zu verblüffen. Und am Schluss des Buches taucht ein gewisser Herr Udo Proksch auf, der ja schon längst als wilder Hund in der Öffentlichkeit bekannt war, ehe er sein allerletztes und retroperspektiv ziemlich unnötiges kriminelles Abenteuer startete: die Fahrt der Lucona.
Bei manchen der hier auftauchenden „bösen Buben“ gab es verlagsintern längere Debatten, ob diese Bezeichnung überhaupt für sie zutreffend ist, da sie neben ihren üblen Taten mit segensreichen Erfindungen oder mit wirksamen Gründungen ihre Gegenwart prägten. Im Zweifelsfall entschieden wir uns, sie trotzdem in dieses Buch aufzunehmen.
Auf die „bösen Mädchen“ habe ich bereitwillig verzichtet, da sie in hoher Zahl in Wien nicht aufzuspüren waren. Ihre „Stärken“ – in älteren Zeiten etwa Verwünschungen und falsche Weissagungen, in jüngerer Zeit das Hantieren mit Gift – hätten zudem genug Stoff für ein eigens Buch geliefert.
Noch eines: Es geht zwar um Moral. Aber ich wollte nie moralisch urteilen. Moralische Urteile unterlaufen einen ständigen Wechsel, können beliebig und austauschbar sein und sagen eher etwas aus über die Perspektive des jeweiligen Betrachters. Ich wollte schlicht und einfach Geschichten erzählen, skurrile, eigenartige, beinahe unglaubliche Geschichten über Männer, die skurrile, eigenartige und unglaubliche kriminelle Taten verübt haben. Und ich überlasse die Zuordnungen der Werturteile den geneigten Leserinnen und Lesern.
Da sich diese „bösen Buben“ in der Regel in Wien aufhielten, haben sie bestimmte Eigenschaften und Tugenden übernommen und in ihren Charakter integriert: Sie agieren mit Schmäh, mit Charme, sie neigen zur Kumpelei. Würden wir sie beim Heurigen treffen, so würden die meisten von uns ohne zu zögern in ihrer Nähe Platz nehmen.
Was ihre Gefährlichkeit eigentlich nur verstärkte, da vom einfachen Sitznachbarn im Beisl bis zum hochrangigen Politiker viele auf sie hereinfielen.
Womit ich wieder zum Anfang meines Vorwortes zurückkomme: Die „bösen Buben“ von Wien – ist bei dieser Ausdrucksweise eine Anerkennung versteckt, eine Hochachtung eingeschlossen?
Lesen Sie bitte dieses Buch.
Beppo Beyerl, Sommer 2022
GESUCHT:
WOLFGANG VON KEMPELEN
GEBOREN: 1734
BERUF: Erfinder und Staatsbeamter
GESUCHT WEGEN: Betrug
GENIE UND SCHWINDLER
Geboren ward er in Pressburg. Wolfgang von Kempelen, auf Slowakisch Ján Vlk Kempelen, auf Ungarisch Kempelen Farkas, kam am 23. Jänner 1734 im damaligen Poszony, zu Deutsch in Pressburg, also im heutigen Bratislava zur Welt. Und zwar in der Ventúrska 11 im Palais Leopold de Pauli, das später als Wittmann’sches Haus bekannt wurde. Die Lage war prominent: Gegenüber, in der Ventúrska 10, stand das Palais Pálffy, später war dort die österreichische Botschaft untergebracht, und das Nachbarpalais in der Ventúrska 12 sollte einer Familie mit dem Namen Vetsera gehören. Doch eine Mary Vetsera wird in dieser Geschichte nicht vorkommen.
Noch heute steht Kempelen in der slowakischen Hauptstadt hoch in der Gunst, doch darüber später. Zum Studium wurde er von seinem Vater, einem Zollbeamten, dem für seine Verdienste von Kaiser Karl VI. der Adelstitel verliehen worden war, ins nahe Wien geschickt. Infolge seiner profunden Sprachkenntnisse wurde er Mitglied jener Kommission, die den Codex Theresianus, den Entwurf zu einem bürgerlichen Gesetzbuch, das ab jetzt für alle Länder der Monarchie gelten sollte, binnen kurzer Zeit aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzte. Von nun an war dem jungen Mann die uneingeschränkte Dankbarkeit der Kaiserin Maria Theresia sicher: Sie ernannte ihn zum Hofkammerrat, gab ihm die Erlaubnis zur Heirat mit der Hofdame Franziska Piani, der Kammerfrau der Erzherzogin Maria Ludovica, und bewirkte 1765 seine Ernennung zum Leiter des Salz- und Siedlungswesens im Banat. Ein Jahr später betraute sie ihn mit der Aufgabe, für die Sicherheit der Salzminen in ganz Ungarn zu sorgen, und 1767 folgte schließlich die Ernennung zum Beauftragten für die Wiederbesiedlung des Banats. Kempelen erwies sich bei dieser Aufgabe als besonders geschickt, ließ Sümpfe trockenlegen und Straßen bauen und holte Tausende Siedlerfamilien ins Land. Seine große Leidenschaft waren jedoch Mechanik und Maschinen: An immer neuen Konstruktionen tüftelnd, stellte er alle paar Monate der staunenden Öffentlichkeit neue Erfindungen vor: Pumpensysteme für Bergwerke oder Wasserspiele für die Schlossgärten der Adeligen.
Als der französische Mathematiker und Taschenspieler Jean Pelletier anno 1769 der Kaiserin seine „Zaubertricks“ vorführte, bestand sie auf die Begleitung ihres Schützlings bei der Vorführung des Franzosen. Nach dem Auftritt Pelletiers um Rat gefragt, meinte Kempelen, das Gezeigte seien alles miese Tricks gewesen, er selbst könne hingegen eine Maschine bauen, die um vieles zugkräftiger, spektakulärer und komplexer ihre nicht näher bestimmte Arbeit verrichten könne.
Vielleicht hätte er mit seiner Prahlerei nicht so weit gehen sollen. Jedenfalls hatte er die fixe Neugierde der Herrscherin geweckt und diese ließ nun nicht locker: Sie entband den Herrn Kempelen für die Dauer eines halben Jahres von allen Verpflichtungen. Bis auf eine: Er solle, ja, er müsse jene Maschine konstruieren. Sollte ihm dies gelingen, so die Fama, würde sie das mit hundert Goldstücken belohnen.
Also konstruierte unser Herr Wolfgang von Kempelen in relativ kurzer Zeit seine Maschine. Die – und nun folgt ihre eigentliche Bestimmung – offenbar tatsächlich Schach spielen konnte.
Für das Datum des nächsten Treffens mit der Kaiserin fehlen genaue Informationen: Manche Chronisten bestehen noch auf eine Vorführung anno 1769, andere verlegen sie in den Frühling 1770. Bei der Schilderung der Dramaturgie, der die Vorstellung des Schachautomaten folgte, gibt es jedoch kaum Abweichungen: Herr von Kempelen reiste also mit seinem Schachautomaten von Pressburg nach Wien, die Präsentation fand in der Großen Galerie von Schloss Schönbrunn vor der Kaiserin und geladenem Publikum statt. Nachdem sein Auftritt angekündigt worden war, ließ Kempelen von Dienern einen hölzernen Kasten in den Raum schieben, 120 Zentimeter lang und 90 Zentimeter hoch. Auf dem Kasten lag ein Schachbrett. Hinter dem Kasten eine holzgeschnitzte Gestalt, mit Turban, Kaftan und weiten Hosen als Türke erkennbar. Die Bezeichnung „Schachtürke“ wird bald die Runde machen. Die rechte Hand der beeindruckenden Gestalt lag ausgestreckt auf dem noch leeren Schachbrett.
Das von Maria Theresia geladene hochadelige Publikum knurrte und murrte: Was will dieser Herr von Kempelen mit diesem Türken? Der wird doch nicht zum Schachspielen anfangen? Oder will uns der Herr von Kempelen betürken?
Herr von Kempelen öffnete die linke Vordertür des Kastens: Ein komplizierter Mechanismus aus Zahnrädchen und Gestänge, einem Uhrwerk gleich, wurde sichtbar. Er öffnete die hintere Tür und entzündete eine Kerze, um dem Publikum einen Blick durch den geheimnisvollen Automaten zu ermöglichen. Und so setzte er die Demonstration fort, alle Türen und Läden des Kastens wurden dem staunenden Publikum zur gefälligen Besichtigung geöffnet. Schließlich drehte Herr von Kempelen den Automaten um: Der Türke zeigte nun dem Publikum den Rücken. Nun öffnete der Konstrukteur zwei Türchen im Oberschenkel und im Rücken des Türken: Wieder wurden Räderwerk und Messinggestänge sichtbar. Dann drehte Kempelen seinen Apparat wieder in die Ausgangsstellung. Ein Satz roter und weißer Schachfiguren aus Elfenbein wurde inzwischen auf das Schachbrett gestellt. Schließlich postierte unser Meister zwei Kandelaber mit leuchtenden Kerzen auf den Spieltisch. Nun denn, das Spiel könne beginnen. Freiwillige mögen sich melden. Ein Genie! Ein tatsächlicher Zauberer mit immensen Kenntnissen der Mechanik! Vielleicht war es doch möglich, einen funktionierenden Schachautomaten zu konstruieren? Überraschenderweise meldete sich gleich einmal Johann Philipp Graf von Cobenzl, der Besitzer des Schlosses auf dem Reisenberg, als Herausforderer des Türken. Der Türke werde mit den weißen Figuren spielen, erklärte Kempelen. Dann trat er zur linken Seite und zog mit bedächtigen Bewegungen mit einem Schlüssel ein Uhrwerk auf.
Ein Genie! Ein tatsächlicher Zauberer mit immensen Kenntnissen der Mechanik! Vielleicht war es doch möglich, einen funktionierenden Schachautomaten zu konstruieren?
Surrendes, ja, ratterndes Geräusch. Die Holzfigur drehte auf einmal langsam den Kopf in Richtung Spielbrett. Sodann streckte sie die linke Hand aus und machte ihren ersten Zug.
Im Detail sah das so aus: Die mit einem Handschuh versehene Hand bewegte sich horizontal über das Brett bis zu einer bestimmten Figur. Dann schlossen sich die Finger um diese und setzten sie auf einem anderen Feld ab. Nach dem Ende des Zuges rückte die Hand wieder auf das Kissen neben dem Spielbrett zurück. Jetzt erst verstummte das die gesamte Dauer des Zuges anhaltende ratternde Geräusch des Uhrwerks.
Unser Staatsrat Cobenzl verlor die Partie binnen einer halben Stunde, den schnellen und aggressiven Spielzügen des Schachautomaten hatte der Herr Graf, der später Staatskanzler werden sollte, keine erfolgreiche Verteidigung entgegenzusetzen. Wobei heutzutage niemand mehr über die Qualitäten der Schachkünste des Staatsrates Bescheid weiß. Das Spiel war aus. Nein, das war noch nicht am Ende der Vorführung, jetzt kam die Draufgabe: Zur Unterhaltung des Publikums musste der Türke noch einige Aufgaben lösen, so den klassischen Rösselsprung. Dabei geht es um eine extrem schwierige Zugfolge, bei der das Pferd jedes Feld des Spielbretts einmal besetzen muss, aber keines zweimal besetzen darf. Und am Schluss wieder zum Ausgangspunkt zurückhüpft. Jawohl, auch das klappte anstandslos. Riesenapplaus, wir haben ein neues Wunderkind, ein wahres technisches Genie.
Die Kaiserin war von der Erfindung so beeindruckt, dass sie dem Techniker ein jährliches Gehalt als Pension garantierte und ihn zusätzlich mit einer Reihe von Aufträgen betraute. So durfte er 1772 eine Anlage für die Wasserversorgung der Schönbrunner Springbrunnen entwerfen, auch für den Neptunbrunnen. Und für die an Pocken erkrankte Kaiserin gelang es ihm 1774 mit leichter Hand, ein in der Höhe verstellbares mechanisches Bett zu konstruieren, in dem sie liegend oder sitzend ihren Regierungsgeschäften nachgehen konnte. Kempelen wurde auch zu einem Pionier der Dampfmaschinentechnik in Wien: Eine von ihm konstruierte Dampfmaschine wurde in der Näher des Stubentors aufgestellt und fand später beim Bau des Wiener Neustädter Kanals Verwendung. Nur den Schachautomaten, den wollte der Meister nicht mehr vorzeigen. Es wurde gemunkelt, er sei kaputt oder beschädigt und würde in der Pressburger Wohnung des Meisters verschimmeln.
Also: Schwindler oder genialer Konstrukteur? Scharlatan oder scharfsinniger Wissenschaftler? Nun, es gibt keine Beweise, jedoch eine klare Indizienkette, die nachweist, dass im Türken eine menschliche Figur versteckt war. Vielleicht ein Kind oder eine kleingewachsene Person. Sachdienliche Hinweise verdanken wir einem gewissen Silas Mitchell, dessen Vater John Mitchell den Automaten 1838 erwarb. Im Jahre 1857 wies Silas Mitchell in langwierigen Untersuchungen nach, dass man im Inneren des Gehäuses bei passendem Arrangement eine kleine Person verstecken oder einsperren konnte. Die Maschinerie des Uhrwerks füllte nämlich nur ein Drittel des Gehäuses aus. Zudem wies Silas Mitchell auf die Möglichkeit hin, das Innere des Raumes durch eine kleine Kerze zu erhellen, deren Rauch durch eine Öffnung des Turbans des Türken abziehen konnte. Die versteckte Person, der eigentliche Schachspieler, hockte vor einem zweiten kleineren Schachspiel, auf dem sie tatsächlich ihre Züge verrichtete. Ihr Arm bewegte dabei einen Metallzeiger, der mit dem Arm des Türken über ein System von Hebeln verbunden war und diesen so über das Spielfeld führen konnte. Ein ausgeklügeltes System von Magneten, das ich hier im Einzelnen nicht beschreiben kann, half dem Versteckten, die Züge des im Freien wirkenden Konkurrenten zu beobachten. Also doch: Ein Schwindler! Ein Possenspieler! Und im selben Atemzug ein genialer Konstrukteur! Welchem Aspekt der Persönlichkeit Kempelens sollen wir mehr Achtung zollen?
Nach wie vor ein Rätsel ist allerdings die Identität des Menschen im Inneren. Wer verbarg sich tatsächlich im Inneren des Türken? Zwei Kriterien waren jedenfalls maßgeblich: die Körpergröße und die Fähigkeiten als Schachspieler. Diese Person durfte keinesfalls ein Riese sein und musste das königliche Spiel dermaßen virtuos beherrschen, dass sie nahezu unschlagbar war. Sie musste also mit den Varianten und Finten ihrer jeweiligen Gegner vertraut sein. Zudem musste dieses kleine Schachgenie von Meister Kempelen in seinem Palais in Pressburg so gut versteckt werden, dass weder seine Frau noch seine Kinder noch seine Lakaien das Geheimnis entdeckten. Nur mit seinem Diener Anthon, Kempelens Vertrauten, hielt der ominöse Unbekannte Kontakt. Also Quarantäne, strenge Quarantäne für unseren Schachmeister! Was war mit Phänomenen wie Lagerkoller oder Klaustrophobie?
Wirklich überzeugende Erklärungen gibt es nicht, bis heute fehlt uns das genaue Wissen, wer in diesem Automaten, eingesperrt bei schlechter Luft und mangelhaften Lichtverhältnissen, geniale Partien auf dem Schachbrett über dem Kopf spielte.
Oder war die Familie Kempelen mit der Existenz dieses geheimnisvollen „Helfers“ vertraut? Machte sie bei diesem Schwindel mit? War vielleicht gar jemand aus der Familie dieser versteckte ominöse Spieler?
Eine literarische Erklärung für dieses Rätsel lieferte der Berliner Autor Robert Löhr. Er erfand dafür in seinem historischen Roman Der Schachautomat die Figur des Italieners Tibor Scardanelli aus Provesano. Dieser, tatsächlich ein Zwerg, verdient sich in Löhrs Roman sein Geld durch Schachspielen. Als er in Venedig einen Venezianer umgebracht hat, rettet Meister Kempelen den Zwerg aus dem Gefängnis vor dem sicheren Tod. Doch der Preis ist hoch: ein verstecktes Leben im Schachautomaten, eine nicht öffentliche Zwergenexistenz. Eine literarische Spekulation, die zwar reizvoll ist, mit der Wirklichkeit allerdings nichts zu tun hat.
Andere Autoren vermuten, dass Kempelen seine eigene Tochter für diese Aufgabe zunächst im Schachspiel unterwies und später auch als versteckte Figur einsetzte. Wieder andere behaupten, er habe bekannte Schachspieler seiner Zeit für diese Tätigkeit bezahlt. Wirklich überzeugende Erklärungen gibt es nicht, bis heute fehlt uns das genaue Wissen, wer in diesem Automaten, eingesperrt bei schlechter Luft und mangelhaften Lichtverhältnissen, geniale Partien auf dem Schachbrett über dem Kopf spielte.
Zurück zu unserer Geschichte. Nach der erwähnten Präsentation vor Maria Theresia im Jahre 1769 oder 1770 wollte Herr von Kempelen dem Schwindel entsagen und sich auf seriöse Erfindungen konzentrieren: etwa auf die Konstruktion einer Druckmaschine mit beweglichem Letternsatz für die blinde Pianistin und Komponistin Maria Theresia Paradis oder die Herstellung eines Stimmenimitators, einer „Sprechmaschine“ zur Erzeugung menschlicher Sprachlaute. Tatsächlich gelang Kempelen, nunmehr zum hungarischen Hofkammerrath avanciert, die erste funktionstüchtige Konstruktion zur Sprachsynthese.
Was den „Schachtürken“ betraf, so rechnete jedoch der Erfinder nicht mit den Launen von Maria Theresias Nachfolger. Im Jahre 1781, also elf oder zwölf Jahre nach dem letzten Auftritt, tat der inzwischen alleinherrschende Joseph II. kund: Der „Schachtürke“ müsse wieder nach Wien. Denn der russische Großfürst Paul, immerhin der älteste Sohn der Zarin Katharina, und seine Gattin, Großfürstin Maria Feodorowna, würden sich anlässlich ihres Wien-Besuches an den Künsten des Automaten aufs Löblichste delektieren. Das russische Thronfolgerpaar, das sich unter dem Pseudonym „Comte und Comtesse du Nord“ auf große Europareise begeben hatte, kam am 21. November 1781 in Wien an und blieb hier bis zum 4. Jänner 1782, die Wiener Zeitung brachte zu Ehren der Gäste auf ihrer Titelseite einen schönen Spruch:
Die Freude Wiens ist unbegränzt,
Seit uns das Glück zu Theil geworden,
Daß selbst der grosse Stern aus Norden In voller Majestät in unsern Mauern glänzt.
Das Kalkül Josephs II. ging auf: Die Präsentationen der „sehenswürdigen mechanischen Erfindung“ vor den hohen Gästen aus dem Zarenreich am 7. und 17. Dezember 1781 in der Hofburg waren dermaßen erfolgreich, dass es vonseiten des Kaisers hieß: Kempelen müsse mit seinem Türken nun auf Europa-Tour gehen. Joseph II. entband den Erfinder auf die Dauer von zwei Jahren von allen dienstlichen Verpflichtungen und lockte noch mit Extra-Prämien. Der zunächst zögernde Kempelen neigte schließlich doch zur Ansicht, dass es strategisch günstig sei, die Wünsche des Kaisers erneut zu befolgen, und fuhr im Frühjahr 1783 nach Paris. Auf der Reise begleiteten ihn sein Diener Anthon, seine Frau Anna Maria und seine Kinder. Über die Teilnahme einer zusätzlichen Person an der Reise ist nichts bekannt.
Verbürgt ist die Ankunft der gloriosen Schachdelegation Kempelen am 17. April in Frankreichs Hauptstadt. Am 21. April erfolgte die erste Vorstellung – möglicherweise im Schloss Versailles, dem „Wohnsitz“ von Königin Marie Antoinette, immerhin einer Schwester Kaiser Josephs II. Im Mai 1783 wurde der Schachtürke in Paris auch öffentlich vorgestellt, wobei der Diener Anthon immer mehr die Aufgabe des Administrators oder Vorführers übernahm und Kempelen sich in aller Bescheidenheit in die Niederungen des Vorführungssaales zurückzog. Gab es doch von französischen Wissenschaftlern geäußerte Vermutungen, Kempelen könne mit einem in seiner Tasche versteckten Magneten die Hand des Türken steuern. Dann hätte logischerweise unser Erfinder selbst ein profunder Könner des Spieles auf den 64 Feldern sein müssen. Ihm wurden zwar viele Fertigkeiten nachgesagt, die Kunst des Schachspiels war aber nicht dabei.
Bekannt wurden in Paris zwei Partien: So spielte der Türke gegen Benjamin Franklin, den damaligen diplomatischen Vertreter der Vereinigten Staaten in Paris, der 1776 die Unabhängigkeitserklärung der USA mitentworfen und mitunterzeichnet hatte. Franklin galt als ausgezeichneter Schachspieler, doch Kempelens Automat gewann. Und der Türke spielte gegen das damalige Schachgenie der französischen Hauptstadt, gegen François-André Danican Philidor. Und prompt verlor er, obwohl am Vorabend der Partie Herr von Kempelen den großen Schachstrategen aufgesucht und angeblich um den Preis eines Sieges seines Türken verhandelt hatte. Doch Philidor, der herausragende Schachspieler seiner Zeit, ließ sich nicht bestechen.
Im Herbst 1783 reiste die Schachfamilie Kempelen nach London und versetzte die englische Hauptstadt in Entzücken und Raserei und auch ein bisschen in Ratlosigkeit, da niemand die Funktionsweise des Automaten erklären konnte. Erst im Herbst 1784 erfolgte die Rückkehr nach Wien.
Nun hatte der Meister – und damit meine ich Herrn von Kempelen und nicht den versteckten Helfer – tatsächlich genug von seinem Schachtürken. Er beschäftigte sich mit verschiedenen Konstruktionen, arbeitete an seiner Sprechmaschine weiter, wurde 1786 zum Hofrat bei der siebenbürgischen-ungarischen Hofkanzlei ernannt und trat 1798 in den wohl oder übel verdienten Ruhestand. Er starb in allen Ehren am 26. März 1804 in der Alservorstadt, kurz nach seinem 70. Geburtstag.
Doch die Geschichte des Schachtürken ist damit nicht beendet. Kurz nach Kempelens Tod verkaufte dessen Sohn den Türken an den in Regensburg geborenen Ingenieur und Musiker Johann Nepomuk Mälzel bzw. Mälzl (1772–1838). Herr Mälzel, im Übrigen der Erfinder des Metronoms und erfolgreicher Konstrukteur von Musikautomaten, hatte strikte Prioritäten: Er wollte mit dem Türken Geld verdienen. Und als versteckte Helfer im Kasten setzte er verschiedene Könner des Faches ein, die er natürlich dementsprechend bezahlen musste. Ihm zu Diensten waren wohl u. a. der deutsch-österreichische Schachkönner Johann Baptist Allgaier oder der britische Schachmeister William Lewis. Als bei einer Vorführung jemand aus dem Publikum laut und deutlich „Feuer!“ rief, soll jemand aus dem Automaten herausgesprungen und in Windeseile fortgelaufen sein. Von verschiedenen Gästen aus dem Publikum wurde der Mann aus dem Kasten als der Elsässer Schachmeister Wilhelm (William) Schlumberger (1800–1838) identifiziert. Conclusio: Gibt es keine gesicherten Fakten, so entfacht sich ein Feuerwerk der Vermutungen.
Das Rätsel des „Schachtürken“ wurde zur großen Herausforderung: Kupferstich von Joseph Racknitz aus seinem Buch Über den Schachspieler des Herrn von Kempelen und dessen Nachbildung, erschienen 1789 (unten), und Enthüllungen im 19. Jahrhundert (oben).
Höchstwahrscheinlich spielte der Türke im Jahre 1809 im Schloss Schönbrunn eine Partie gegen Napoleon. Der Kaiser der Franzosen, die damals Wien besetzt hielten, sah dabei offenbar nicht gut aus, wobei es allerdings über den Spielverlauf verschiedene Berichte gibt.
Angeblich wischte Napoleon angesichts seiner bald aussichtslosen Stellung mit einer wütenden Handbewegung die Figuren vom Brett und beendete so das ominöse Duell mit dem Automaten.
Johann Nepomuk Mälzel, der ein tüchtiger Geschäftsmann war, ging mit dem Schachtürken schließlich auch nach Amerika, wo er auf großes Interesse stieß. Zahlreiche Schachfans versuchten ihr Glück im Spiel gegen den Türken. Edgar Allan Poe war etwa so fasziniert von diesem „Ungeheuer“ aus der Alten Welt, dass er einen klugen Essay über die Funktionsweise des Automaten veröffentlichte. Ob er auch selbst gegen ihn spielte, ist jedoch nicht bekannt.
Nach Mälzels Tod – der ehemalige kaiserliche Hofmechanikus starb 1838 an Bord eines Schiffes im Hafen von La Guaira, Venezuela – erwarb der Leibarzt von Edgar Allan Poe, ein gewisser Dr. John Kearsley Mitchell, den Apparat. Und dessen Sohn Silas Weir Mitchell enthüllte endgültig das Geheimnis des Schachapparates – darüber habe ich schon oben berichtet.
Aber noch nicht über das Ende des Türken: Sohn Silas verkaufte den Schachautomaten an Peale’s Museum in Philadelphia. Das Interesse an dieser merkwürdigen Erfindung war in der Zwischenzeit schon ziemlich abgeflacht. Und bei einem Brand des Museums am 5. Juli 1854 wurde auch Kempelens Erfindung zerstört. Von der Maschine, die einst das Publikum in aller Welt zum Staunen gebracht hatte, blieben nur mehr Schutt und Asche.
Angeblich wischte Napoleon angesichts seiner bald aussichtslosen Stellung mit einer wütenden Handbewegung die Figuren vom Brett und beendete so das ominöse Duell mit dem Automaten.
Etwas trauriger Nachsatz: In Bratislava wird Meister Jan Kempelen nach wie vor verehrt und geachtet. Am Hlavné námestie 5, unmittelbar neben dem Rathaus, befindet sich das im Jugendstil eingerichtete Café Roland. Und in diesem Café Roland konnten die Gäste bis vor Kurzem eine gelungene Rekonstruktion des Schachautomaten bewundern.
Warum bis vor Kurzem? Nun, das Café Roland brannte Ende 2018 ab. Und mit dem bis heute geschlossenen Kaffeehaus wurde auch die Rekonstruktion des legendären Schachautomaten ein Opfer der Flammen.
GESUCHT:
PETER RITTER VON BOHR
GEBOREN: 1773
BERUF: Unternehmer
GESUCHT WEGEN: Banknotenfälschung
DER MALER UND SEINE BLÜTEN
Ein Peter von Bohr – und das in Wien? Hier heißt man Sedlnitzky wie der Polizeichef der Metternichära oder Marek wie der Kommissar der Fernsehserie Oberinspektor Marek. Und wenn es unbedingt sein muss, so heißt man Breitwieser oder Steinschneider. Aber Bohr?
Natürlich war Peter Bohr, der in der Donaumetropole als einer der erfolgreichsten Geschäftsleute galt, kein Wiener. Er wurde am 30. Juni 1773 im heutigen Luxemburg geboren, genauer in Stadtbredimus im Kanton Remich im Süden des Herzogtums. Seine erste künstlerische Ausbildung erhielt er im Zisterzienserkloster Orval in den Ardennen, wo von dem „Malermönch“ Bruder Abraham eine Malerakademie geleitet wurde. Von der stillen Abtei der Zisterzienser übersiedelte er ins revolutionäre Paris und verbesserte hier seine Kenntnisse in den Bereichen Zeichnen und Malen. Der angehende junge Künstler, der später für seine penible Akribie und für die Liebe zum Detail bekannt wurde, trat dann einem Künstlerkorps bei, das die Revolutionstruppen begleitete, unbekannt ist jedoch, inwieweit er die politischen Ziele der Revolutionsarmee tatsächlich teilte. Schließlich wechselte er zur Artillerie der regulären französischen Armee, quittierte aber nach drei Kriegsjahren den Dienst und wechselte die Seite: Über Vermittlung von Feldzeugmeister Jean-Pierre de Beaulieu, der aus dem Brabant kam und in der österreichischen Armee diente, ließ sich Bohr in Linz nieder – als Miniaturmaler. Seine Porträts der Damen und Herren der Linzer Gesellschaft waren sehr gefragt und am 28. Oktober 1798 heiratete er Clara Poestion, die Tochter eines Zeichenlehrers. Doch Peter Bohr unterhielt noch immer gute Kontakte zur französischen Armee, die 1805 und 1809 Linz besetzte. Nun wusste er diese Kontakte bestens zu nützen – durch den Handel mit Armeegütern und durch Diskont- und Wechselgeschäfte mit den verschiedensten Heeren erlangte er schnell ein ansehnliches Vermögen.
Dass er noch eine zweite und weitaus ergiebigere Einnahmequelle besaß, das konnte ja wirklich niemand wissen.
Im Jahr 1814 begann der Wiener Kongress, der ambitionierte und vielerlei Geschäfte witternde Menschen wie das Licht die Motten anzog. Peter Bohr, der den frühen Tod seiner Frau verkraften musste, übersiedelte nach Wien und „regelte“ bei der Wiener Hofkanzlei die Anerkennung seiner ritterlichen Herkunft, auf gut Deutsch: Er kaufte sich in den Adelsstand ein. Fortan nannte sich der umtriebige Geschäftsmann stolz Chevalier de Bor oder Peter Ritter von Bohr. 1821 heiratete er standesgemäß Gräfin Mathilde von Christallnigg von und zu Gillitzstein, deren Namen auch perfekt in eines der Theaterstücke von Fritz Herzmanovsky-Orlando passen würde. Von nun an war er in den Kreisen des österreichischen Adels wohlgelitten.
Noch immer verdiente er sein Geld mit dem Malen von Porträts seiner neuen Freunde aus der Aristokratie.
Dass er noch eine zweite und weitaus ergiebigere Einnahmequelle besaß, das konnte ja wirklich niemand wissen.
Wobei Peter von Bohr keinem Luxusleben mit Mätressen, Galaempfängen und Teilnahmen an Kartenspielen frönte. Im Gegenteil: Nach den Wirren der napoleonischen Kriege und der Zeit der Restauration begann eine Phase des steten wirtschaftlichen Aufschwungs und unser akribischer Porträtmaler erkannte die Zeichen der Zeit. Als aufgeschlossener Geschäftsmann war er bei der Gründung fast jeder größeren „Gesellschaft“ beteiligt, oder mit anderen Worten: Keine Gesellschaft wurde gegründet, ohne dass Peter von Bohr seine finanzierende Hand im Spiel gehabt hätte. Dafür wurde er mit Posten in der Direktion oder im Kontrollorgan, dem Aufsichtsrat, belohnt.
Eine kurze Aufzählung: Peter von Bohr war Mitbegründer der Ersten Österreichischen Spar-Casse (1819), der heutigen „Erste Bank“, im alphabetischen Aktionärsverzeichnis stand er an erster Stelle. Er war Mitbegründer der Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft (1829) und Mitbegründer des Polytechnischen Institutes, der heutigen TU Wien. Und er erfand eine Guillochiermaschine: Guillochen – asymmetrisch geschwungene Ornamente – wurden damals als Sicherheitsmerkmale beim Druck von Banknoten und Ausweisen eingesetzt, da sie auf den um 1820 verwendeten Druckplatten nicht reproduziert werden konnten. Und last but not least übernahm er – wohl auf Bitte von Kaiser Franz I. – die Verwaltung der weit verzweigten Güter der Familie Orsini-Rosenberg in Kärnten samt deren Stadtpalais in Klagenfurt.
Der Reichtum musste auch gezeigt werden. So kaufte Peter von Bohr im Jahre 1819 Schloss und Herrschaft Kottingbrunn; das heute noch existierende Wasserschloss Kottingbrunn liegt etwa 15 Kilometer südlich von Baden. Dann erwarb er ein Haus im Weinort Mauer, der damals noch eine eigene Gemeinde war, eine Besitzung in der Leopoldstadt sowie ein Häuschen in Meidling. Dieses befand sich an der heutigen Kreuzung Tivoligasse und Zenogasse, lag also standesgemäß gleich neben dem Schönbrunner Schlosspark und wurde bei der Errichtung des heute noch stehenden Gründerzeitbaus kurz nach 1900 abgerissen.
Peter von Bohr war nicht nur wohlgelitten, sondern galt seinen adeligen Freunden als hochverehrte Persönlichkeit. Und er war, soweit man mit diesem Mann vertraut sein konnte, vertraut mit Staatskanzler Metternich. Auch Kaiser Franz I. war ihm gewogen, soweit der Kaiser einem offenbar erfolgreichen Geschäftsmann gewogen sein konnte. Peter von Bohr beeindruckte jedenfalls seine Freunde und Geschäftspartner immer wieder mit neuen, überraschenden Ideen – so schlug er etwa die Errichtung einer „Holzzerkleinerungsanstalt“ vor, in der Maschinen das Zerhacken des Brennholzes übernehmen sollten.
Doch schnell kann für Aufsteiger auch der Absturz kommen. Auch damals – im Vormärz – waren gesellschaftliche Positionen nicht auf Dauer fixiert. Innerhalb kurzer Zeit konnte man, ob mit legalen Mitteln oder nicht, von einer armen Kirchenmaus zu einem strahlenden Krösus aufsteigen und ebenso schnell konnte ein steinreicher Adeliger alle Besitzungen verlieren und in der Armutsfalle landen. 1826 schrieb der Volksdichter Ferdinand Raimund für sein Zaubermärchen Der Bauer als Millionär das „Aschenlied“, und das beginnt gleich mit folgenden Versen:
So mancher steigt herum,
Der Hochmut bringt ihn um,
Trägt einen schönen Rock,
Ist dumm als wie ein Stock.
Von Stolz ganz aufgebläht,
O Freunderl, das ist öd!
Wie lang steht’s denn noch an,
Bist auch ein Aschenmann!
Ein Aschen! Ein Aschen!
Nun, unser Peter von Bohr wollte kein Aschensammler werden, da hatte er schon auf geheime Weise vorgesorgt. Dann ging jedoch 1839 der Wirtschaftsbetrieb der Familie Orsini-Rosenberg, deren Güter Bohr verwaltete, in Konkurs. Franz Seraphicus Reichsfürst von Orsini-Rosenberg hatte sein gesamtes Vermögen am Spieltisch verloren, noch dazu war er mit 348.000 Gulden bei Peter von Bohr verschuldet. Um die Situation halbwegs zu klären, musste unser verhinderter Porträtmaler fast alle seine Besitzungen verkaufen; ihm blieben nur mehr das Wasserschloss in Kottingbrunn und das Häuschen am Grünen Berg in Meidling, gleich neben dem Schloss Schönbrunn.
Aber welch Wunder: Herr von Bohr und seine adelige Frau Gemahlin verkehrten in der besten Gesellschaft Wiens, als hätte der Schaden nicht sie getroffen. Gut, man wurde älter und gebrechlicher, auch die Sehkraft des Meisters ließ stark nach, er näherte sich seinem Siebziger. Aber noch immer führte das Ehepaar ein Leben auf großem Fuß und verfügte offenbar über beträchtliche Geldmittel.