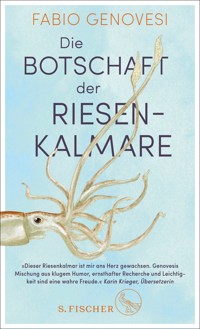
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Riesenkalamar ist eines der letzten Geheimnisse der Meere, über Jahrhunderte wurde seine Existenz als Seemannsgarn abgetan. Fabio Genovesi ist ein Geschichtenerzähler, und wovon er erzählt, ist wahr. Dies ist sein Liebesbrief an unsere Welt und an sein Lieblingstier. Von französischen Kapitänen, betrunkenen Seefahrern und einer Fossilienforscherin, die vergessen wird. Von Genovesis toskanischer Nonna und einer Insel, die auftaucht und wieder im Meer versinkt. Und vor allem vom Riesenkalmar, diesem mystischen, wundersamen und schwerelosen Tier, und davon, was wir von ihm lernen können. »Die Botschaft der Riesenkalmare« ist eine persönliche Kulturgeschichte und eine Hymne an die Menschen, die an das scheinbar Unmögliche glauben. Ein Buch, das uns verändert zurücklässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Fabio Genovesi
Die Botschaft der Riesenkalmare
Biografie
Über Fabio Genovesi und Karin Krieger
Fabio Genovesi, geboren 1974 in Forte dei Marmi am Ligurischen Meer, veröffentlicht seit 2011 Romane und Essays und hat dafür mehrere Preise gewonnen. Seit 2019 berichtet er vom Giro d'Italia und der Tour de France für das italienische Fernsehen und schreibt für den Corriere della Sera. »Die Botschaft der Riesenkalmare« ist sein Liebesbrief an sein Lieblingstier und an unsere Welt voller Wunder.
Karin Krieger übersetzt vorwiegend aus dem Italienischen und Französischen, darunter Bücher von Claudio Magris, Elena Ferrante, Anna Banti, Armando Massarenti, Margaret Mazzantini, Ugo Riccarelli, Andrea Camilleri, Alessandro Baricco und Gianfranco Calligarich. Sie war mehrfach Stipendiatin des Deutschen Übersetzerfonds und erhielt 2011 den Hieronymusring. Karin Krieger hat drei Kinder und lebt in Berlin.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Il calamaro gigante« bei Feltrinelli.
Feltrinelli © 2021
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2022 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Coverabbildung: Rüdiger Trebels
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491534-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Motto]
1 Willkommen im Zirkus
2 Erinnerungen kann man nicht umarmen
3 Sag niemals schon
4 Jesus wandelt auf dem Wasser von Pontedera
5 Kinder der Geschichten
6 Miserable Freunde, großartige Totengräber
7 Ein Autobus auf dem Meeresgrund
8 Eine ganze Flut von Kalmaren
9 Die Tentakel des Weihnachtsmanns
10 Kinder entstehen in der Eisdiele
11 Alles ringsumher tanzt
Nachbemerkung
Wie kann man denn schlafen
beim Mond dieses Abends?
Kommt, Freunde,
singen und tanzen wir
die ganze Nacht.
Ryōkan Taigu
1Willkommen im Zirkus
Über das Meer wissen wir nichts.
Rein gar nichts, und doch ist das Meer fast alles.
Am Anfang war nur das Meer, dann hat es ein bisschen trockenen, staubigen Raum ans Festland abgetreten, und schon waren wir selbstherrlich dabei, New York oder Peking zum Zentrum der Welt zu erklären wie früher Babylon, Athen, Rom oder Paris … Dabei ist das Zentrum der Welt das Meer. Es bedeckt drei Viertel des Planeten, den wir Erde nennen, der aber, wenn wir ehrlich sind, eigentlich Wasser heißen müsste.
Alles kommt aus dem Meer, auch wir, die komplizierte Weiterentwicklung irgendwelcher blinder Würmer, die damit beschäftigt waren, über den Grund der Ozeane zu kriechen. Dann haben wir uns Augen und Beine ausgedacht und sind rausgekommen, um zu sehen, was los ist, aber noch heute können wir nur deshalb auf dem Trockenen leben, weil wir jede Menge Wasser in uns haben. Mehr als die Hälfte unseres Gewichts. Wir sind zwar aus Fleisch und Blut, haben Knochen und Nerven und auch ein paar Kleider am Leib, die mit der Mode wechseln, doch hauptsächlich sind wir Meer.
Doch über das Meer wissen wir nichts.
Dabei glauben wir, es bestens zu kennen. Wir machen Ferien am Strand, wo wir schwitzen, photographieren und es betrachten, aber eigentlich sehen wir es überhaupt nicht. Die Weite vor uns ist nur seine Hülle, seine salzige, glitzernde Haut.
Das ist wie damals, als ich noch klein war und unbedingt in den Zirkus wollte. Der lässt die Kinder heute völlig kalt, aber damals war Zirkus das Größte. So ist das eben, die Zeiten ändern sich und wir uns mit ihnen. Mein Vater war als Kind verrückt nach Torrone, er durfte ihn nur zu Weihnachten essen, aber er träumte jede Nacht von ihm und kaute im Schlaf mit leerem Mund. Wenn du dagegen heute einem Kind ein Stück Torrone schenkst, kostet es davon und zeigt dich dann an.
Genauso war es mit dem Zirkus, den ich schrecklich gern besucht hätte, wie meine Freunde es taten, aber mein Vater ging nie mit mir hin. Er sagte, er sei trostlos, dort würde es stinken, die Tiere könnten einem leidtun, und die Clowns machten einem Angst, er denke nicht im Traum daran, da hinzugehen.
Aber eines Morgens verschenkte ein kleiner Herr in einer Jacke mit Sternen und mit einem Affen auf der Schulter vor der Schule Eintrittskarten, und wie könnte man einem mit einem Affen auf der Schulter widerstehen? Also bettelte ich hartnäckiger als sonst, bis mein Vater mich schließlich ins Auto verfrachtete und los. Wir stiegen vor dem Zirkus aus, mein Vater nahm mich an die Hand, und wir drehten eine Runde um das Zelt, das groß, prall und rot war, mit ein paar andersfarbigen Flicken hier und da.
Dann kehrten wir zum Auto zurück und wieder ab nach Hause.
»So, das war der Zirkus«, sagte mein Vater mit der nächsten Zigarette im Mund. »Bist du jetzt zufrieden?«
Und ich wusste es nicht. Ich war ein bisschen enttäuscht, aber auch froh, denn wenn dieser legendäre Zirkus vielleicht auch keine große Sache war, so hatte ich ihn doch endlich gesehen. Ich wusste ja nicht, dass das eigentliche Schauspiel drinnen stattfand, unter der Zeltplane. Die Manege, Akrobaten, Zauberkünstler, Löwen, Elefanten. Ich war klein, ich war naiv, ich war ziemlich dumm.
Aber wir sind auch nicht besser, wenn wir von einem Tag am Strand zurückkommen und uns einbilden, wir hätten das Meer gesehen. Stattdessen haben wir stundenlang vor seiner glitzernden Plane gesessen, und da hinten, da in der Tiefe und überall war sein unglaubliches Schauspiel verborgen, gewaltig, spektakulär, unerforscht.
Mehr als die Hälfte des Meeres ist über dreitausend Meter tief, wir kennen die Oberfläche der Venus viel besser als den Meeresgrund.
Dort unten schwimmt und tanzt ein so vielfältiges, andersartiges, unvorstellbares Leben, dass es gemütlicher ist, nicht daran zu glauben, in keinem Zeitalter der Welt und in keinem Menschenalter.
Wie an einem anderen Morgen in jenem Zirkusjahr, als unsere Lehrerin uns aufgetragen hatte, unser Lieblingstier zu zeichnen und dann der Klasse von ihm zu erzählen, und die anderen, als ich drankam, so laut lachten, dass sogar die Landkarten der Toskana und Asiens an den Wänden wackelten, während ich allen mein Bild vom Riesenkalmar zeigte.
Die Lehrerin versuchte, für Ruhe zu sorgen, aber da war nichts zu machen, und am Ende sagte sie, ein bisschen sei ich ja auch selbst schuld, weil ich mir von den vielen Tieren der Welt ausgerechnet eins ausgesucht hätte, das es nicht gibt. Ich wollte klarstellen, dass es das doch gab, na und ob, bloß dass im Klassenzimmer ein zu großer Radau herrschte und es sogar Bleistifte, Radiergummis, Füllhalter und Filzschreiber hagelte.
Kurz, sie waren wirklich fein raus. Alle, die sich im Leben keine Fragen stellen, die den kürzesten Weg nehmen, ohne auf das unermessliche Ringsumher zu achten, und wenn sie ihr Lieblingstier malen sollen, sich für einen Hund, für eine Katze oder höchstens mal für einen Hamster entscheiden, sind fein raus. Und wenn du einen Riesenkalmar malst, lachen sie und machen sich über dich lustig.
Denn auch sie wissen nicht, dass wir über das Meer nichts wissen. Dass unter der Plane Tiger sind, Affen, Schwertschlucker, Feuerspucker, bärtige Frauen, Messerwerfer. Und Riesenkalmare.
Wir wollen das nicht glauben, wir können es nicht, weil das ein so andersartiges Leben ist, dass es uns mit nur einem Schwanzhieb von jeder festen Überzeugung weghaut, von den Gleisen solider, immerwährender Gewissheiten, auf deren Erfindung wir viel Zeit verwendet haben, und es uns einer Realität aussetzt, die zu groß und zu üppig für uns ist.
Aber vielleicht ist das in Ordnung so, im Meer gibt es keine Gleise, man kann sich treiben lassen und hoffen, dass das Schicksal das Reiseziel bestimmt.
Auch Amerika wurde von einem entdeckt, der es nicht gesucht hatte. Kolumbus wollte zu einem Ort, der nichts mit Amerika zu tun hatte, aber er machte sich auf den Weg, und wenn du dich auf den Weg machst, kann alles passieren. Schon an Land, und erst recht auf dem Meer.
Wo ein gigantischer Traum auf uns wartet, eingehüllt in acht ellenlange Tentakel und zwei noch längere und uns mit zwei Augen, groß wie die Radkappen eines Lastwagens, anschaut.
Und während wir auf dem Weg sind, werden ein paar Freunde an Bord kommen, die an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten gelebt haben, aber Seelenverwandte sind und so seltsam wie wir. Auch sie haben an den Riesenkalmar geglaubt, und prompt hagelte es Federhalter und Tintenfässer, Bleistifte und Pergamente und alles, was man zu ihrer Zeit sonst noch so benutzte. Doch mit diesem vom Himmel gefallenen Zeug zeichneten sie den Lauf ihrer spannenden, einzigartigen Leben, die einfach unglaublich waren.
Wie der Riesenkalmar. Wie unsere Reise. Wie wir.
Also los, auf geht’s, willkommen an Bord, willkommen im Zirkus. Entschuldigt, dass ich keinen Affen auf der Schulter sitzen habe, aber Affen halten unter Wasser nicht lange durch. Und wir ja auch nicht, wenn man es recht bedenkt. Aber wir wollen jetzt nicht so viel nachdenken. Jeder Gedanke ist ein Nagel, der dich da festhält, wo du gerade bist, zwischen Gähnen und Bedauern.
Besser, wir wagen es, haben Vertrauen und springen hinein ins Vergnügen.
Fang uns nur gleich ein, du Riesenkalmar, Arme genug hast du ja.
2Erinnerungen kann man nicht umarmen
Gehen wir mal anderthalb Jahrhunderte zurück.
Ein ganz schöner Sprung, und dann noch mal zwei Jahrhunderte. Das ist schon in Ordnung, hier gibt es keinen Zeitplan. Wir kochen ja keine Spaghetti, wir folgen einem Traum, und Träume laufen sprunghaft ab und wie sie wollen, sie tanzen nach ihrer ganz eigenen, unvorhersehbaren Musik.
Im Schnitt verbringen wir sechs Jahre unseres Lebens damit, zu träumen. Als ich das gelesen habe, kam mir das zunächst sehr viel vor – sechs Jahre träumen – und dann sehr wenig. Aber eigentlich habe ich keine Ahnung, weil die Zeit gerade bei Träumen nicht funktioniert. Also springen wir anderthalb Jahrhunderte zurück, das ist nicht schwer, wenn wir den Ballast von Uhren, Terminkalendern und vollen Wochenplanern abwerfen. Weg damit, und auf geht’s.
Bis auf eine Jacke vielleicht, die brauchen wir noch, denn wir fahren zu den Kanaren, und da ist es immer windig.
Und doch liegt die Alecton hier jetzt reglos mitten auf dem Ozean. Denn stärker als der Wind ist ein Schrei vom Ausguckposten, der etwas gesichtet hat.
Ein feindliches Schiff, ein halb gesunkenes Wrack? Was sieht er da von der Spitze des Großmastes aus? Das fragt ihn auch Kapitän Bouyer, aber eine Weile ist nur der Wind zu hören, der noch mehr von seiner Kraft einsetzt wie ein Freund, der dir aus der Patsche helfen will. Dann die Antwort vom Ausguck, die einzig mögliche:
»Es ist … es ist riesig.«
Der Kapitän greift zum Fernrohr, zwängt seinen Blick hinein, lässt ihn über den ruhigen Ozean schweifen, hin und her, hin und her, und sieht nichts. Aber er verharrt noch regloser als sein Schiff, als ihm klar wird, dass das, was er am Horizont sucht, selbst der ganze Horizont ist. Unermesslich groß und dunkel taucht es auf und verschwindet, taucht auf und verschwindet.
Dabei hatte Bouyer einen einfachen Plan, er wollte reibungslos und ohne Verspätung in Französisch-Guyana ankommen, bei seinen Vorgesetzten glänzen und eine weitere Stufe der militärischen Karriereleiter hochklettern. Aber da vorn ist dieses Ding, schlimmer noch, es ist nicht vorn, es ist überall, und es ruft ihn. Also kratzt er das letzte bisschen Luft zusammen, das ihm nicht weggeblieben ist, und gibt seinen Befehl: Beidrehen und auf dieses Ding zuhalten.
Und so geht die Alecton, während sie vom geplanten Kurs abweicht, in die Geschichte ein.
Heute, am 17. oder am 30. November 1861. Die einen sagen dies, die anderen das. Aber eigentlich ist es der 30., das habe ich mir gemerkt, weil am 30. November meine Großmutter Giuseppina Geburtstag hatte.
Was jetzt gar nichts damit zu tun hat, aber doch auch sehr viel. Alles hat mit allem zu tun, das habe ich besonders von meiner Großmutter gelernt, in dem Sommer, den ich mit ihr in den Bergen verbrachte.
Ich war zehn Jahre alt, es war der letzte Schultag, ich war rausgeflitzt und wollte schnurstracks ans Meer, das nur einen Steinwurf entfernt war und mich seit einem Monat mit seiner Stimme aus den Wellen rief. Es strich mit ihnen über den Strand und zog sie zurück, vor und wieder zurück, als streichelte es die Haut der Erde und wollte mir sagen: Ich komme und hole dich, ich hole dich ab. Stattdessen holten mich an dem Tag meine Eltern ab, packten mich ins Auto, und los ging es in die Berge zu meiner Großmutter, sie luden mich bei ihr ab, und weg waren sie.
Vielleicht hatten sie mich satt. Vielleicht wollten sie noch mal von vorn anfangen, und ich war im Weg. Vielleicht hatte ich einen Fehler gemacht, als sie mich gefragt hatten, wie icƒh es denn fände, wenn ich ein Geschwisterchen bekäme, und ich geantwortet hatte, kein Problem, ich bräuchte nur vorher eine eigene Wohnung.
Also habe ich, als sie wegfuhren, geschrien, es wäre okay, wenn dieses Geschwisterchen käme. Ich könnte mich wahrscheinlich daran gewöhnen, es sei nicht nötig, mich in den Bergen auszusetzen. Da erklärte mir meine Mutter, es gebe kein Geschwisterchen, allerdings auch kein Geld, sie müsse den Sommer über in einer Pension putzen gehen und niemand könne auf mich aufpassen. Außer Großmutter Giuseppina, die vor ein paar Monaten hier hoch in die Garfagnana gezogen sei, aus mysteriösen Gründen.
Also Berge, Wälder, Tiere und ein kleiner Lebensmittelladen mit einer Tanzfläche nach hinten raus, soll heißen einem Stück Wiese und einer Jukebox mit nur einem Song, »Ti amo« von Umberto Tozzi.
So verbrachte ich dann meine Nachmittage, ich tanzte allein und sang das Lied auswendig mit, doch es waren Liebesworte, die ich nicht verstand, und zum Abendbrot ging ich mit dem Kopf voller Gedanken nach Hause. Aber an diesem Abend vergaß ich sie alle, denn draußen war es noch hell, während in der Küche die Fensterläden schon geschlossen waren und Dunkelheit herrschte. Nach einer kleinen Weile sah ich, dass meine Großmutter am Herd saß und in eine Ecke starrte.
Und wenn etwas noch merkwürdiger ist als deine Großmutter, die im Dunkeln sitzt, so ist das, wenn sie im Dunkeln zu flüstern anfängt:
»Pommes frites? Eine Pfanne Pommes frites, wie ich sie immer mache?«
Ein bisschen in der Hoffnung, dass sie nicht verrückt geworden war, und ein bisschen, weil Pommes frites mein Lieblingsessen waren, beschloss ich, dass sie mich meinte. »Ja, danke, Großmutter!«
Aber sie schreckte hoch und fuhr mit weit aufgerissenen Augen herum. Ihre Augen waren die schönsten der Welt. Denn tatsächlich war es gelogen, als ich später im Leben einer anderen Person sagte, sie hätte die schönsten Augen der Welt. Meine Großmutter hatte die schönsten Augen, und die waren jetzt im Dunkeln weit aufgerissen.
»Fabio, du bist das! Mammamia, hast du mich erschreckt!«
Sie ging zum Fenster, öffnete die Läden, und die Sonne stürzte mir ins Gesicht wie ein Eimer voll Licht.
»Entschuldige, Großmutter, das wollte ich nicht … geht es dir gut?«
»Ja, ja, bestens.«
»Was machst du denn hier?«
»Nichts, ich habe mich vor dem Abendessen nur ein bisschen ausgeruht.«
»Soso, alles klar. Aber wie wär’s mit einem Deal, Großmutter? Ich esse heute Abend wie ein Scheunendrescher, und du sagst mir dafür jetzt die Wahrheit.«
Ich war nämlich ziemlich dünn, ich hatte nie Hunger, und sie und meine Mutter machten sich deswegen immer Sorgen. Um mich aufzupäppeln, taten sie Zucker statt Salz an meine Spaghetti und erzählten mir, das koche man so, und mir schmeckte das sogar. Doch jetzt wollte ich nicht noch eine Lüge, ich wollte die Wahrheit.
»Was denn für eine Wahrheit, Fabietto?«
»Großmutter, ich schwöre, heute Abend schlage ich mir den Bauch voll, bis ich platze. Aber wenn du mir nicht die Wahrheit sagst, werde ich gar nichts essen. Morgen auch nicht, und übermorgen, und …«
»Schon gut, ich sag’s dir ja. Aber du schaufelst heute ordentlich was weg, du hast es versprochen! Also ich … ach, nichts weiter, ich habe bloß ein bisschen mit deinem Großvater geredet, das ist alles. Aber lassen wir das, Zeit fürs Abendessen, wie wär’s mit Pommes frites?«
»Ja, gern, Großmutter, aber …«
»Was – aber? Willst du keine Pommes frites?«
»Doch, will ich. Aber Großvater ist doch tot.«
Darauf sagte sie nichts mehr. Denn das wusste sie nur zu gut, sie wusste es seit vielen Jahren und dachte in jeder Sekunde an jedem Tag ihres Lebens daran, dass Großvater tot war. Aber schwere Dinge haben, selbst wenn sie dir wohlbekannt sind, eine andere Wirkung, wenn sie ausgesprochen werden. Sie breiten sich in der Luft aus, dringen über Ohren und Augen in dich ein, scheren sich nicht um das Gehirn, das sich immer einbildet, allwissend zu sein, sickern bis ins Herz, und das war’s.
Und so verzog meine Großmutter, als ich zu ihr sagte, dass Großvater tot sei, schmerzvoll das Gesicht und brauchte eine Weile, bis sie ihr Lächeln wiederfand. Es war das schönste der Welt. Denn tatsächlich war es gelogen, als ich später im Leben einer anderen Person sagte, sie habe das schönste Lächeln der Welt. Ihres war das schönste.
»Fabietto, ich weiß selbst, dass dein Großvater tot ist, aber ich sehe ihn. Das passiert nur hier. Er und ich haben früher in diesem Haus gewohnt, weißt du. Wir waren jung, frisch verheiratet, dann wurde deine Mutter geboren, und wir zogen runter ans Meer. Aber was waren wir glücklich hier oben, du meine Güte. Daran musste ich letztes Jahr denken, als wir noch mal hergekommen sind, um es wiederzusehen. Ich ging durch die Zimmer, alles war in Schuss gebracht worden, die Wände geweißt, aber ich lief herum und hatte nur einen Gedanken im Kopf, und als ich in die Küche kam, hörte ich diesen Gedanken tatsächlich mit eigenen Ohren: ›Schön, ja, aber früher war es schöner.‹ Ungelogen, das habe ich wortwörtlich gehört. Und da platzte ich heraus: ›Ach, früher, da war doch alles schöner.‹ Darauf die Stimme: ›Nein, Beppina, du bleibst immer schön.‹ Nur dein Großvater nannte mich Beppina, und diese Stimme war seine.«
»Aber … aber wie … und du?«
»Und ich, nichts, ich bin in Ohnmacht gefallen. Deine Mutter hat mich gefunden, ich lag plötzlich auf dem harten Boden. Ich habe ihr gesagt, dass mir schwindlig geworden sei, aber am Sonntag darauf sind wir noch mal hergekommen, und da ist es wieder passiert, darum bin ich hergezogen. Und weißt du was, mein lieber Fabio? Vielleicht bin ich plemplem, vielleicht bin ich übergeschnappt, aber ich bin glücklich dabei. Ich weiß, dass deine Eltern sagen, ich würde hier allein leben, weil ich traurig bin, aber genau das Gegenteil ist der Fall.«
»Eigentlich sagen sie, dass du ein bisschen komisch geworden bist.«
»Ach so? Na egal, vielleicht haben sie sogar recht. Jedenfalls lebe ich ruhig in den Tag hinein, und in der Abenddämmerung setze ich mich her und sehe bei zunehmender Dunkelheit da in der Ecke neben dem Herd etwas, das sich bewegt. Weißt du, das war sein Lieblingsplatz, abends saß dein Großvater immer dort und sah zu, wie ich kochte, und dabei hörte er den Amseln draußen vor dem Fenster zu, die zum Feierabend sangen. Ich sehe ihn dort sitzen, und es geht mir gut.«
»Siehst du ihn denn jetzt auch?«
»Jetzt nicht, es muss dunkel sein.«
»Und siehst nur du ihn?«
»Ja. Na logisch, es ist ja keiner weiter da«, sagte meine Großmutter. Dann sah sie mich an. Das heißt, sie hatte mich schon vorher angesehen, doch nun war ihr Blick durchdringend: »Aber jetzt … jetzt bist du ja auch da.«
Das hat sie gesagt und mich nichts gefragt, und ich habe nichts geantwortet. Das war nicht nötig. Sie ging zum Fenster, warf mir noch einen Blick zu, und ich spürte eine Mischung aus Angst, Neugier, Unruhe und noch anderes wild durcheinander. Ich nickte mechanisch, meine Großmutter schloss die Fensterläden, die Küche versank wieder im Dunkeln.
Und ich wurde ein Baum.
Denn Bäume atmen keine Luft ein, sondern Licht, und ich jetzt auch. Das heißt, in dieser mysteriösen Dunkelheit atmete ich überhaupt nicht mehr.
»Käpt’n, was sehen Sie?«, fragen sie ihn, doch Bouyer antwortet nicht. Er hält nur das Fernrohr fest auf das Ding gerichtet. Das ihm genauso viel Angst macht wie den sechsundsechzig Männern der Besatzung. Ja, sie sind Männer, und Männer müssen stets begreifen, müssen Besitz ergreifen. Also fahren sie mit weit aufgerissenen Augen auf das Mysterium zu. Und sie sind Soldaten, deshalb beschießen sie es, während sie sich ihm nähern, pausenlos mit Kanonenkugeln.
Bei jedem Schuss verschwindet das Ding, taucht wieder auf und füllt den Blick aus, weich und rötlich, ohne ein Oben oder ein Unten, ohne einen Anhaltspunkt zum Heranscheren. Ungreifbar wie ein Traum, unbegreiflich wie ein Traum. Es taucht kurz unter und erscheint wieder vor dir, ein bisschen weiter hier, ein bisschen weiter dort.
Aber näher und näher.
Inzwischen zu nahe für die Kanonen, also befiehlt Bouyer, zu den Gewehren zu greifen.
Wenn schon Kanonenkugeln nichts ausrichten, hat es nicht viel Sinn, es mit Gewehrschüssen zu versuchen. Aber der Sinn ist eine Kategorie, die die Alecton hinter sich gelassen hat, als sie beschloss, von ihrem Kurs abzuweichen. Sie war in voller Fahrt auf ihrem Weg nach Guyana, zur Teufelsinsel, wo Frankreich die zu Zwangsarbeit Verurteilten in die teuflischsten Gefängnisse der Welt schickte. Schuld und Sühne, Aktion und Reaktion, präzise, solide Räderwerke, die die Gesellschaft voranbringen, alles Andersartige und Unangepasste ist ein Körnchen, das dort hineingerät, zerrieben wird und wie Staub verfliegt, ohne länger zu existieren.
Und auch dieses Ding dürfte nicht existieren. Es gibt unzählige Geschichten von mehrköpfigen Ungeheuern, von Krabben so groß wie Inseln, Seeschlangen, die Schiffe mit einem einzigen Happen in der Mitte durchbeißen. Für die Wissenschaftler sind das Hirngespinste von Seeleuten, die zu lange aufs Wasser und zu tief in ihr Whiskyglas gestarrt haben. Und die Männer der Alecton sind tatsächlich Seeleute und keine Wissenschaftler, aber dieses Ding da ist kein Hirngespinst.
Es ist da vorn und verschluckt die ganze Munition, jeden ihrer Atemzüge, ihre wilden Herzschläge und die präzisen Räderwerke der Realität.
Und vielleicht verschluckt es gleich auch die Korvette, es ist so nah, dass es sie berührt, sie bedrängt, von allen Seiten. Die Männer laufen zum Heck, zum Bug, und überall sehen sie, wie es den Schiffsrumpf betastet und umklammert. Also schießen sie, schießen aufs Geratewohl, schießen ins Blaue hinein.
Und ins Blaue hinein hoffen sie auch.
»Was siehst du?«, hat mich meine Großmutter da in der dunklen Küche gefragt, und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich sah nämlich nichts, und das war mir sehr recht. Denn es gab nichts zu sehen, nur meine Großmutter, die verrückt war. Und das war nicht schlimm, sie war alt, und alte Menschen dürfen einen kleinen Webfehler haben. Bedenklich wäre es nur gewesen, wenn auch ich etwas gesehen hätte.
»Bist du sicher, dass du nichts siehst?«
Ich nickte.
»Überhaupt nichts?«
»Na ja, ich sehe, dass … keine Ahnung, dass sich was bewegt.«
»Na also, und was bewegt sich?«
»Die Dunkelheit. Es sieht aus, als … als würde sie flimmern. Aber so was sehe ich auch nachts, wenn ich nicht schlafen kann. Ich schaue zur Zimmerdecke, und dann macht die Dunkelheit so was. Wie ein wimmelnder Ameisenhaufen.«
»Warte, Fabietto, sieh noch mal kurz hin.«
Klar, ich hätte auch eine Stunde lang hinsehen können, oder bis zum nächsten Morgen, Hauptsache, ich sah nichts. Sonst wäre ich wirklich am Ende gewesen. Für meine Großmutter war das kein Problem, aber ich war nicht alt, ich hatte das Leben noch vor mir und lief Gefahr, es durchweg im Irrenhaus zu verbringen, in Maggiano in den Bergen kurz vor Lucca, in diesem Gemäuer, das aussah wie ein Schloss aus einem Horrorfilm, und jeder Verrückte war in einem Kellerloch eingesperrt mit nichts drin als einem Haufen trockenem Seetang zum Schlafen.
Das hatte mir der Freund meiner Cousine erzählt. Ich hatte ihn gefragt, warum man sie denn unter der Erde hielt, und er hatte geantwortet »darum«. Ich hatte gefragt, warum denn Seetang und nicht, zum Beispiel, Stroh oder Gras. Und warum man sie überhaupt einsperrte, warum sie dort gelandet waren.
»Darum.«
Und das Gleiche würden mir die Pfleger antworten, wenn sie mich in eine Zwangsjacke steckten und dorthin brachten und ich mich wehren und fragen würde, warum das denn. »Darum.«
Nein, schlimmer noch, sie könnten mir antworten: »Weil du den Geist deines Großvaters in der Küche siehst.«
Und genau das passierte nun. Das Dunkel flimmerte immer mehr, es begann sich in Einzelteile aufzuspalten, in Teile von einem Etwas, von einem Etwas mit einem Gesicht.
»Und jetzt, Fabio? Siehst du ihn jetzt?«
Ich schüttelte den Kopf, aber immer schwächer.





























