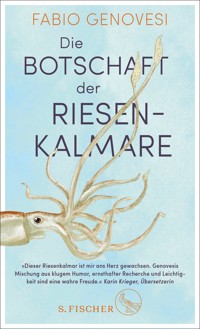9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Eine Kindheit am Meer, eine skurrile italienische Großfamilie und eine Liebeserklärung an das Leben
Fabio ist der Mittelpunkt seiner verrückten Großfamilie in der Toskana. Als Liebling seiner zehn »Großväter« – den schrulligen, unverheirateten Brüdern seines Opas – wird er zu den seltsamsten Unternehmungen mitgenommen. Die sind zwar selten kindgerecht, aber dafür immer unvergesslich. Doch als sein Vater nach einem Unfall im Koma liegt, muss Fabio sich dem richtigen Leben stellen. Er beginnt, seinem Vater selbst verfasste Geschichten vorzulesen. Denn was kann jemanden besser ins Leben zurückholen, als all die Abenteuer mit seinen zehn Großvätern ...
Das Buch ist 2019 unter dem Titel »Wo man im Meer nicht mehr stehen kann« im Verlag C. Bertelsmann erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 585
Ähnliche
Über das Buch:
Der 6jährige Fabio hat es nicht leicht: Seine »10 Großväter«, die vielen unverheirateten Brüder seines Opas, reißen sich nur darum, ihn zu den kuriosesten Unternehmungen mitzunehmen. Erst in der Schule merkt Fabio, dass man als Kind auch mit Gleichaltrigen spielen kann – doch da ist seine Rolle als Außenseiter schon vorprogrammiert. Die Kindheit ist die Kindheit am (und über weite Teile auch im) Meer ist für den Jungen ein ebenso großes Abenteuer wie die Entdeckung des Lesens und Schreibens. Und als sein Vater nach einem tragischen Unfall regungslos im Krankenhaus liegt, sind es die selbst verfassten Texte des inzwischen 12jährigen, die eine heilende Wirkung entfalten. »Wo man im Meer nicht mehr stehen kann« ist eine virtuos erzählte Familiengeschichte voller liebenswert-schrulliger Figuren und sommerlicher Italien-Atmosphäre. Mit seinen autobiografischen Zügen ist der Roman gleichzeitig eine Liebeserklärung an die (wortwörtlich lebensrettende) Kraft des Schreibens und der Fantasie.
Über den Autor:
Fabio Genovesi, 1974 in der Toskana geboren, ist am berühmten Badeort Forte dei Marmi aufgewachsen. Er hat als Bademeister, Radsporttrainer, Kellner und Übersetzer gearbeitet, bevor er sich höchst erfolgreich dem Schreiben widmete. Seit vielen Jahren gehört er zu den wichtigsten und beliebtesten Autoren Italiens und wurde mit dem renommierten Literaturpreis Premio Viareggio ausgezeichnet.
FABIO GENOVESI
Meine zehn Großväter, das Meer und ich
Roman
Aus dem Italienischen von Mirjam Bitter
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel
Il mare dove non si tocca bei Mondadori, Mailand
Die deutsche Erstausgabe erschien 2019 unter dem Titel
Wo man im Meer nicht mehr stehen kann bei C. Bertelsmann, München.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen von Penguin Books Limited und werden hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © 2017 Mondadori Libri S. p. A., Milano
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019
by C. Bertelsmann, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlag: Favoritbüro, München
Umschlagmotiv: Doreen Kilfeather / Trevillion Images
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-26944-9 V001
www.penguin-verlag.de
Meinen seltsamen Lehrmeistern
Einige (wenige) Dinge in diesem Roman habe ich erfunden, aber das sind die glaubhaftesten.
Im Dorf gab es auch noch Ettore, Lea, Alessandra, Luca und andere großartige Menschen. Sie kommen in diesem Buch nicht vor, in meinem Leben zum Glück aber sehr wohl.
Erster Teil
Gott segne den kaputten Kahn, der uns zurückbringt.
JASON ISBELL
Der Fluch
Wie es angefangen hat, weiß niemand. Vielleicht hat einer unserer Vorfahren das Grab eines Pharaos entweiht, vielleicht hat er eine Hexe geärgert oder das heilige Tier eines rachsüchtigen Gottes umgelegt, sicher ist nur, dass auf unserer Familie seitdem ein schrecklicher Fluch lastet.
Das ist schlimm, ist aber so, es war das Erste, was ich in der Schule gelernt habe.
Ach nein, als Erstes lernte ich gleich beim Betreten der Klasse, dass es auf der Welt noch andere Kinder in meinem Alter gab und dass die nur drei oder vier Großeltern pro Kopf hatten. Ich dagegen um die zehn.
Denn mein Opa mütterlicherseits hatte einen Haufen alleinstehender Brüder, die nie geheiratet, ja, nicht mal einer Frau die Hand geschüttelt hatten, sodass aus dieser riesigen Familie nur ich hervorgegangen war, und daher war ich der Enkel von allen.
Sie stritten sich immer darum, wer etwas mit mir unternehmen durfte, und als Opa starb, wurde es noch schlimmer, deshalb hängte Oma Giuseppina einen Zettel an die Platane oben an der Straße, auf dem der Schichtplan der Woche stand: Montag Fischen mit Opa Aldo, Dienstag Jagen mit Opa Athos, Mittwoch Eisessen mit Opa Adelmo, Donnerstag nach Vögeln Ausschauhalten mit Opa Aramis und so weiter, bis alle zufrieden waren. Das Einzige, was der Kalender nie vorsah, war ein freier Tag, den ich mit Kindern in meinem Alter hätte verbringen können. Die sich sehr wohl untereinander trafen und einen Haufen verrückter Spiele kannten, von denen ich an jenem Morgen in der Schule zum ersten Mal hörte: Verstecken, Himmel und Hölle, Blindekuh, sie brauchten nur eines zu nennen, und schon rannten oder hüpften alle los, nach Spielregeln, die mir absurd, ihnen aber völlig normal erschienen, dafür guckten sie komisch, wenn ich sie fragte, wie viele Karpfen sie diesen Sommer gefangen oder ob sie eine Fasanenfeder zum Tauschen hätten.
Einen Fasan hatten sie noch nie gesehen, und beim Karpfen wussten sie nicht einmal, was das überhaupt ist, deshalb beobachtete ich sie am ersten Tag nur von Weitem, diese geheimnisvollen Wesen, die so viele Spiele, aber so wenige Opas hatten, als wäre ich auf dem Mars gelandet, in einer Klasse Außerirdischer.
Als ich am Ende meines ersten Schultags hinter Mama nach Hause radelte, fühlte ich mich wirklich wie ein Raumfahrer, der von einer Weltraummission zurückkehrt, von einem so weit entfernten und unmöglichen Ort, dass ich trotz der altbekannten Straßen Angst hatte, den Weg in meine Welt nicht mehr zu finden. Die aus einer kurzen Sackgasse bestand, in der sich jeder Opa ein Häuschen gebaut hatte und wo nur wir wohnten; am Anfang der Gasse hing sogar ein Holzschild, auf dem von Hand geschrieben stand:
WILLKOMMEN IM DORF MANCINIBETRETEN VERBOTEN
Und wie bei der Rückkehr eines Raumfahrers wartete auf der Gasse eine große Menschenmenge auf mich: nämlich meine Verwandten, die mich nicht einmal absteigen ließen, sondern gleich umringten und wissen wollten, wie es war, wie es mir ging, ob mir jemand etwas angetan hatte.
Ich sagte ihnen aber nicht, wie es mir ging, denn ich wusste es selbst nicht. Ich sah meine vielen Opas nur einen nach dem anderen an, und es kam mir vor, als sähe ich sie zum ersten Mal. Dann fragte ich, ob ich sie ab sofort Onkel nennen dürfe.
»Da hast du es!«, riefen sie Mama zu. »Siehst du? Wir hätten ihn nicht zur Schule schicken sollen!«
Und ich war ihrer Meinung, eigentlich wollte ich da nie wieder hin. Doch Mama sagte, dass dann die Carabinieri kämen und mich ins Gefängnis stecken würden. Ich ließ mir erklären, wie es im Gefängnis war, und im Grunde war das ziemlich ähnlich wie in der Schule, nur dass man bis nach Lucca fahren musste. Also ging ich doch weiter zur Schule, die kleinen Außerirdischen wurden meine Klassenkameraden, und meine vielen Opas wurden zu Onkel Aldo, Onkel Athos, Aramis, Adelmo, Arno und so weiter. Alle trugen Namen, die mit A anfingen, wie ihre Eltern, die Arturo und Archilda geheißen hatten, bis auf den Letztgeborenen, der mein echter Opa gewesen ist und der unbedingt Rolando heißen sollte. Sie hatten alles Mögliche erwogen, neun Monate lang deswegen gestritten und ihn schließlich Arolando genannt.
Ich schwör’s, Arolando. Und warum er unbedingt Rolando heißen sollte, weiß keiner. So ist das in meiner Familie, hinter jedem Unsinn gibt es eine unendliche Geschichte, Millionen Erzählungen, die bei jedem Millimeter unseres schiefen und krummen Wegs hervorschießen, mit tonnenweise genauestens ausgeführten Einzelheiten. Aber von den wirklich wichtigen Dingen war nie etwas bekannt. Niemand sprach davon, und weil niemand davon sprach, wusste man nichts mehr darüber, so wurden aus Geheimnissen Rätsel.
Wie eben der Grund für den Namen Rolando-Arolando, aber vor allem diese Geschichte mit dem Fluch, der auf uns lastet, von dem niemand weiß, wann das angefangen hat und warum. Ich wusste nicht einmal, dass es ihn überhaupt gab, bis zu jenem Nachmittag des Jahres1980, als ich sechs Jahre alt war und in die erste Klasse ging.
Ich stand in Signora Teresas Laden und packte ein Wassereis mit Zitronengeschmack aus, während Mama sich mit ihr über die Theke hinweg unterhielt.
Der Laden lag ganz in der Nähe des Mancini-Dorfs, und ich war dort groß geworden. Im wahrsten Sinne des Wortes, als Neugeborener legte Teresa mich nämlich jede Woche auf ihre Waage für Schinken und Mortadella und sagte Mama, wie viel ich zugenommen hatte.
Offensichtlich war ich an dem Tag aber noch nicht groß genug geworden, denn Mama und sie sprachen in Andeutungen miteinander, damit ich nichts verstand, damit jenes Geheimnis mir nicht zu nahe kam, das mich sonst schlagartig hätte altern lassen.
Kurze und seltsame Sätze, Wispern und Blicke, Worte, die hier und da abprallten, wie bei einem Tennismatch, wo ich das Netz war und jede Information über mich hinwegzufliegen hatte, ohne mich je zu berühren. Aber wie im Tennis kam immer mal eine Aussage etwas zu kurz heraus und landete auf mir, also schnappte ich kleine Stücke Sinn auf wie etwa: Vor der ganzen Klasse, Teresa, oder: Was für eine Schande, die Lehrerin wird mindestens Anzeige erstatten, was für eine Schande!
Ich lutschte mein Zitroneneis, schaute in die Luft und versuchte die Teile zusammenzusetzen, und ein bisschen ärgerte ich mich darüber, dass Mama und Teresa mich ihre Gespräche nicht verstehen lassen wollten. Aber gleichzeitig musste ich lachen, denn die Geschichte, die die beiden Tennisspielerinnen vor mir geheim zu halten versuchten, kannte ich viel besser als sie beide und besser als die ganze Welt.
Denn ich war es ja leider gewesen, der morgens im Unterricht gesessen hatte.
Die Lehrerin hatte gerade die Urgeschichte erklärt und war bei den Höhlenmenschen angelangt, die gekrümmt herumliefen und so behaart waren wie Affen, aber ich zeichnete dabei einen riesigen Dinosaurier in mein Heft. Es tat mir einfach zu leid, dass die Dinosaurier irgendwann alle ausgestorben waren, deshalb machte ich den hier superstark, mit Kiemen, damit er unter Wasser atmen konnte, und mit Flügeln, damit er vor Gefahren davonfliegen konnte, so würde er sich retten, wenn die Sintflut oder ein anderes Unglück kam, und wenn das schrecklichste Unglück von allen auf Erden erschien, nämlich die Menschen, konnte er sie sofort von der Welt wegmampfen.
Aber ausgerechnet, als ich die vielen, vielen langen Zähne in seinem aufgerissenen Maul zeichnete, was besonders schwierig war und wobei man sehr genau sein musste, ging plötzlich die Tür auf, schlug wie eine Bombe gegen die Wand, und durch den Ruck rutschte mir die Hand weg, und so malte ich einen Strich über das Blatt, der die Arbeit eines ganzen Vormittags zunichtemachte.
Normalerweise ist es aber ja so, dass dir bei einem Ruck zwar kurz das Herz stehen bleibt, doch dann beruhigst du dich, und alles ist wieder in Ordnung. Aber diesmal schaute ich nach dem Ruck hoch, und da wurde die Angst hundertmal schlimmer. Denn dort, mitten in der halb aus den Angeln gerissenen Tür stand Onkel Aldo mit Zigarette im Mund und diesen zusammengekniffenen Augen, die er immer bekam, wenn ihn etwas ärgerte, zum Beispiel wenn der Wein zu Essig oder eine Ampel rot wurde.
Und vielleicht kannte auch die Lehrerin diesen Blick, denn erst war sie aufgesprungen und hatte gefragt: Darf ich fragen, wer Sie sind?, doch dann hat mein Onkel auf die Bänke gezeigt, und sie hat sich mit gesenktem Kopf zu uns in die erste Reihe gesetzt.
»Also Kinder, hört gut zu«, sagt mein Onkel mit einer Stimme, die klingt, als schlage jemand einen Aschenbecher aus Marmor gegen eine Wand aus Schmirgelpapier. »Heute Morgen vergesst ihr mal den ganzen Scheiß, den sie euch hier sonst beibringen. Heute reden wir mal über etwas Ernsthaftes. Seid still und nervt nicht rum, dann lernt ihr das sofort und richtig, verstanden?«
Wir nicken alle, sogar die Lehrerin.
»Gut. Dann fangen wir an. Gebt mir den Maschendraht.«
Aber Maschendraht ist keiner da.
»Ruhe, na gut, von mir aus auch normalen Draht.«
Doch auch davon haben wir keinen im Klassenzimmer.
»Was? In dieser Schule gibt es aber auch gar nichts! Also gut, hört zu, dann erkläre ich halt nur mit Worten, wie man das macht, aber seid still und rührt euch nicht, sonst werde ich wütend und alles geht drunter und drüber.«
Er presst die Zigarette zwischen zwei Fingern zusammen, nimmt einen so starken Zug, dass das Ende erst funkelt und dann aufflammt, anschließend reißt er sie sich aus dem Mund und schnippt sie Richtung Fenster. Nur dass das Fenster geschlossen ist, weshalb die Zigarette von der Scheibe abprallt und auf den Boden unter Mirko Turinis Bank rollt. Mirko will sie wegschubsen, aber mein Onkel brüllt: »Stillhalten habe ich gesagt!«, also rührt er sich nicht, verharrt so starr, wie er nur kann, und versucht möglichst geräuschlos zu ersticken.
Unterdessen fängt mein Onkel an, über den geeigneten Ort für einen Hühnerstall zu räsonieren, der weit genug vom Haus entfernt sein muss, weil die Hühnerkacke stinkt, aber auch nicht zu weit entfernt sein darf, weil man sonst nicht mitkriegt, wenn Füchse oder Marder kommen.
Und alle hören ihm aufmerksam zu, auch wenn sie kein Wort verstehen. Alle außer mir, der ich es nur zu gut verstehe. Denn darüber, wie man einen Hühnerstall baut, haben wir erst gestern gesprochen, als mein Onkel mich mitnehmen wollte, um Kakis in Onkel Arnos Obstgarten zu klauen. Der Garten liegt am Ende unserer Gasse, und wenn Arno seinen Bruder Aldo sieht, schießt er auf ihn, mit einem Gewehr, das mit Salz geladen ist, doch wenn ich mitkomme, dann nicht. Wenn ich dabei bin, geht zwar ein Schuss los, aber Onkel Aldo ruft schnell: Der Junge ist bei mir, der Junge!, also schießt Arno nur in die Luft, ruft: Dieb, verfluchter Dieb!, und während er nach einem Stock sucht, hauen wir ab.
Aber gestern konnte ich nicht mitkommen, ich musste noch meine Hausaufgaben fertig machen.
»Deine was?«
»Meine Hausaufgaben.«
»Was sind denn das für neue Sitten?«
»Ich gehe doch jetzt in die Schule, Onkel, und die Lehrerin gibt uns Aufgaben für zu Hause.«
»Und wie viel bezahlt dir die Lehrerin für die Hausaufgaben?«
»Nichts, glaube ich. Ich mache sie gratis.«
»Siehst du, wenn du sie gratis machst, kannst du sie machen, wann es dir passt, also auch einfach gar nicht.«
»Aber dann wird die Lehrerin wütend.«
»Und mit welchem Recht? Wenn sie dich nicht dafür bezahlt, kann sie nichts von dir verlangen. Hör zu, sie kommt nämlich auch nicht gratis in die Schule, weißt du, sie wird dafür bezahlt.«
»Echt?«
»Klar, sonst würde sie ihren Arsch nie im Leben da hinbewegen. Eigentlich müsste sie die Hausaufgaben machen, hat aber keine Lust und wälzt sie auf dich ab. Lass dich nicht verarschen, vergiss den Quatsch und komm mit.«
»Aber ich kann nicht, Onkel, das lässt mir dann keine Ruhe. Mir fehlt nur noch diese Matheaufgabe hier, wenn ich die gemacht habe, können wir los.«
»So ein Scheiß! Na gut, gib her, lass mal sehen, wir machen das eben zusammen. Ich habe dir Schreiben beigebracht, da kann ich dir auch Rechnen beibringen.«
Das mit dem Schreiben stimmte. Als ich noch ganz klein war, verbrachte ich die Abende mit ihm, den anderen Onkeln und Opa Arolando, der damals noch lebte und mit uns viele Buchstaben aus einer großen gelben Papierrolle ausschnitt, große Buchstaben, die wir anschließend auf ein rotes Tuch klebten, sodass daraus Wörter wurden, und die dienten dann als Transparent bei den Umzügen der Kommunistischen Partei. So habe ich Schreiben gelernt, sie zeigten mir, wie ein A aussieht, und ich schnitt einen Haufen As aus, dann ein B, dann C und so weiter. Als ich in die Schule kam und die Lehrerin uns das Alphabet erklärte, konnte ich es wirklich schon richtig gut. Auch wenn ich anfangs verwirrt war, weil meiner Meinung nach zwei Buchstaben fehlten. Sie sagte Nein, es seien alle da, von A bis Z, und da verstand ich, dass Hammer und Sichel nicht zum Alphabet gehören, obwohl meine Onkel mich viele davon ausschneiden ließen. Von da an hatte ich dann keine Probleme mehr im Italienischunterricht.
In Mathe aber schon, und nicht zu knapp. Es ist nicht nur so, dass ich Mathe nicht verstehe, Mathematik macht mich sogar richtig traurig, ich brauche nur daran zu denken, dass sie existiert, schon habe ich einen bitteren Geschmack im Mund, wie wenn mir ein Foto von Opa Arolando in die Hände fällt, auf dem er lächelt, wo ich ihn doch so lieb hatte und es mir ungerecht erscheint, dass er, wie die Dinosaurier, ausgestorben ist und nicht mehr wiederkommt. Und was im Fall der Mathematik nie wiederkommt, ist die Lebenszeit, die man vergeudet, während man ihre absurden Probleme zu lösen versucht, wie eben das von gestern:
Der Bauer Pino besitzt 20 Hühner, die jeden Tag 10 frische Eier legen. Eines Morgens jedoch wacht Pino auf und bemerkt, dass 5 Hühner aus dem Hühnerstall abgehauen sind und weitere 5 Hühner der Fuchs gestohlen hat. Armer Pino, wie viele Eier kann er an diesem Tag zum Markt tragen?
Ich las es laut vor und hoffte einen Moment lang wirklich, dass mein Onkel mir die Lösung sagen würde. Ohne Erklärungen, ohne mich durch Nachdenken selbst darauf kommen zu lassen, einfach nur die Anzahl der Eier und tschüss, Hausaufgaben. Dann schaute ich hoch und sah seine ins Leere starrenden, aufgerissenen Augen, und da war klar, dass es nicht so laufen würde. Er schüttelte langsam den Kopf, verzog angewidert den Mund, riss mir das Heft aus der Hand und rollte es so fest zusammen, als wollte er es erwürgen.
»Was soll das denn? Wie schafft man es, dass einem gleich fünf Hühner in einer einzigen Nacht entwischen, wie schafft ein Fuchs das, dir gleich fünf auf einmal zu klauen! Dieser Pino ist ein Idiot, was bringen sie euch in der Schule denn da bei?«
»Das weiß ich nicht. Aber weißt du die Lösung?«
»Klar weiß ich die! Die Lösung ist Null ! Dieser Idiot Pino verkauft kein einziges Ei, bescheuert wie er ist, verfährt er sich bestimmt und kommt gar nicht erst beim Markt an!«
Darauf nahm er den Stift und malte eine Null auf die Seite, so groß wie mein Kopf. Er fuhr sie so oft und so stark nach, dass es aussah wie ein durchdrehendes Rad, dann wie ein Strudel, der voller Wut herumwirbelte, mein Onkel hörte erst auf, als er das Blatt und mehrere Blätter darunter durchlöchert hatte. Dann packte er mich am Arm und zog mich fort, raus an die frische Luft und zu den vielen Vögeln, die, schlau wie sie waren, gleich davonflogen, weit weg von ihm, und er ließ mich erst los, als wir am Ende der Straße angekommen waren, damit wir uns auf den Boden legen und unter Onkel Arnos Zaun durchschlüpfen konnten.
Onkel Aldo brütete aber immer noch darüber, denn während wir wie Schlangen durch den Mais krochen, zischelte er weiter vor sich hin: Zehn Hühner auf einen Schlag … was für ein Depp … arme Kinder, was bringen sie euch da nur bei, arme Kinder …
Dann ging der Tag zu Ende und die Nacht begann, und in meiner Familie bringt es nie etwas, eine Nacht darüber zu schlafen. Im Gegenteil, das macht alles nur schlimmer. Wenn dich bei uns im Dorf etwas wütend macht und du im ersten Moment etwas Schlimmes tun würdest, mach es also besser gleich, ohne darüber nachzudenken, denn wenn die Nacht kommt, kochst du noch mehr vor Wut, und am Morgen danach ist es noch hundertmal schlimmer. Und der Morgen danach war eben genau heute Morgen, als mein Onkel in die Schule gekommen ist und die Klasse in Beschlag genommen hat. Und jetzt erklärt er uns gerade, wie man einen anständigen Hühnerstall baut.
»Oben bringt ihr rundum ordentlich Stacheldraht an. Am besten zweimal rum. Oder auch dreimal, Stacheldraht kann man nie genug haben. Wenn dann nämlich ein Huhn aus Versehen abzuhauen versucht oder irgendein wildes Biest eindringen will, findet ihr sie am Morgen danach erhängt da oben baumeln, und so habt ihr auch gleich das Problem gelöst, was es zum Abendessen gibt. Verstanden, Kinder? Na, habt ihr das verstanden oder nicht?!«
Und alle nicken mehrfach, auch die Lehrerin, während ich bloß versuche, mich hinter dem Rücken der Mitschülerin vor mir zu verstecken. Was schon mit einem normalen Kopf schwierig wäre, doch mit meinem Lockenkopf, bei dem die Haare in alle Richtungen abstehen, erst recht. Aber ich muss es schaffen, denn wenn Onkel Aldo mich sieht und mich anspricht, kommt heraus, dass ich sein Großneffe bin, und ich glaube, das ist nicht schön. Im Allgemeinen nicht, aber heute Morgen ganz besonders.
»Gut, also mit dem Hühnerstall sind wir durch, machen wir mit dem Gemüsegarten weiter. Wie sät man ordentlich aus? Fangen wir mit den Tomaten an, ihr nehmt …«
»Was ist denn hier los?« Von der Tür kommt eine andere Stimme, die ihm das Wort abschneidet. Sie ist so kräftig wie seine, und kräftig ist auch Mauro, der Hausmeister, der mit offenem Kittel in die Klasse kommt, weil die Knöpfe über seinem Bauch nicht zugehen.
Mein Onkel dreht sich ruckartig um, und genauso ruckartig springt die Lehrerin von ihrer Bank auf: »Mauro, endlich! Ich bitte Sie, entfernen Sie diese Person, sie ist mit Gewalt eingedrungen und hat uns in Geiselhaft genommen.«
Mauro schaut sie an, schaut meinen Onkel ganz ernst an, hebt dann die Hände, läuft auf ihn zu und brüllt: »Mensch Aldo, altes Haus! Was machst du denn hier?!« Sie umarmen sich und klopfen sich kräftig auf die Schultern.
»Nichts, Mauro, ich bringe den Kindern hier ein paar nützliche Sachen bei.«
»Ah, sehr gut, das wurde auch Zeit!«
»Wie, das wurde auch Zeit!?«, sagt die Lehrerin. »Mauro, sind Sie jetzt auch noch verrückt geworden?«
»Nein«, antwortet mein Onkel mit weit aufgerissenen Augen, »verrückt seid ihr! Was bringt ihr den Kindern denn da bei? Bescheuerte Bauern, die nicht wissen, wie sie ihre Arbeit richtig machen, mit nutzlosen Problemen vergeudete Nachmittage. Statt Fortschritt gibt es hier nichts als Rückschritte, früher wusste man ganz viel, jetzt weiß man gar nichts mehr. Bald fängt das zwanzigste Jahrhundert an, und so entlassen wir die Kinder ins neue Jahrhundert.«
»Hören Sie, im zwanzigsten Jahrhundert sind wir schon seit einer Weile.«
»Ach so, na dann umso schlimmer! Deshalb habe ich heute Morgen zu mir gesagt, es reicht, bin hierhergekommen und bringe den Kindern etwas bei, was ihnen wirklich nützt.«
»Amen«, sagt Mauro. »Du sprichst mir aus dem Herzen! Klar, aber warum ausgerechnet heute?«
»Wieso, was ist denn heute?«
»Na, heute ist doch Schlachtfest bei Oreste, oder? Ich muss noch bis Mittag hierbleiben, aber danach nehme ich die Beine in die Hand.«
Mein Onkel starrt ihn einen Augenblick lang nur an, dann schlägt er sich eine Hand vor den Mund. Aber hinter der Hand kommen trotzdem massenweise Flüche hervor, Beleidigungen des HERRN und der Madonna und aller um sie herum auf den Kirchenbildern.
»Das hatte ich ganz vergessen, Mauro, verdammte Sch…, das hatte ich ja ganz vergessen. Schlachtfest bei Oreste, und ich bin hier und verplempere meine Zeit mit diesen Trotteln!«
Darauf stürzt er zur Tür und verschwindet, ohne sich zu verabschieden. Na ja, schön wär’s gewesen. Stattdessen hält er inne, dreht sich noch einmal zur Klasse um und zeigt mit dem Finger auf mich. »Ach, Mauro, siehst du den Hässlichen da mit den vielen Locken? Das ist mein Enkel, behalt ihn für mich im Auge.«
Erst nach diesen Worten haut Onkel Aldo ab, und alle drehen sich zu mir um, auch die Lehrerin. Ich starre auf das abgenutzte Holz der Schulbank und würde am liebsten wie ein Holzwurm hineinschlüpfen, mir einen kleinen Tunnel graben und für immer in Frieden dort drinnen leben. Denn Holzwürmer sieht man nie, ein Holzwurm hat nicht so viele Locken auf dem Kopf, sondern gar keine Haare, und vor allem hat er keine Verwandten. Ein Holzwurm verschwindet, wann er will, und hinterlässt keine Spuren, abgesehen von einem klitzekleinen Loch.
Hier dagegen verschwindet nur mein Onkel, mit Mauro, der ihm hinterherruft: Okay, ich behalte ihn im Auge, aber leg du mir ein paar Würste beiseite! Während die Lehrerin ans Pult zurückgeht und sagt, dass er nicht herumschreien soll, dann sagt sie das auch zu uns, denn alle in der Klasse wiederholen jetzt die Schimpfwörter, die sie von meinem Onkel gehört haben, vor allem die Flüche, die ihnen besser im Gedächtnis geblieben sind als die Anleitungen, wie man einen perfekten Hühnerstall baut, und die sie nie mehr vergessen werden.
Und auch wenn es wahrscheinlich nicht genau das ist, was Onkel Aldo im Sinn hatte, kann man doch sagen, dass er uns heute Morgen wirklich etwas beigebracht hat.
Mehr noch: Seine Lektion hatte so großen Erfolg, dass sie sogar das Mäuerchen um die Schule überwunden hat und sich im Ort verbreitete, schließlich hörte ich sie gerade häppchenweise in dem Tennismatch zwischen Mama und Signora Teresa. Und je hitziger ihr Gespräch wurde, desto weniger achteten sie darauf, über mich hinweg zu zielen, ihre Worte flogen nah an meinem Kopf vorbei, streiften mich sogar, und am Ende kam dann der erschütternde Moment, in dem ich diesen Satz verstand, der vollständig und klar und zugleich so schreckenerregend war. Als Mama sagte: Zum Glück haben sie nicht die Polizei gerufen, ich weiß echt nicht mehr weiter, hob Teresa die Hände zum Himmel und seufzte: Da kann man nichts machen, Rita, du weißt doch, der Fluch ist schuld.
Das hat sie gesagt, ich schwör’s, und ich hörte auf, an meinem Zitroneneis zu lecken, ich hörte auf zu atmen, dann fragte ich mit der letzten Luft, die mir geblieben war: »Welcher Fluch?«
Schlagartig unterbrachen die beiden Tennisspielerinnen ihr Match, schauten zu mir herunter, und Teresa hielt sich den Mund zu. Doch was sie gesagt hatte, war gesagt, ich hatte es gehört, und das Eis lief mir langsam in vielen klebrigen Streifen über die Finger wie die Tentakel eines Kraken, die die Hand umschlangen, das Handgelenk, den Arm und langsam weiter bis zum Herzen drangen. Und Kraken sind superschlaue Tiere, Onkel Aramis sagte immer, dass alle Fische im Meer, sogar der Seebarsch, der am schlausten ist, im Vergleich mit Kraken Idioten sind. Aber man brauchte gar nicht so klug wie die Kraken zu sein, sogar ich begriff, dass das mit dem Fluch schwerwiegend war und ich mehr darüber wissen musste.
»Mama, welcher Fluch?«
»Hä? Was redest du denn da, welcher Fluch?«
»Onkel Aldos Fluch, hat Teresa gesagt.«
»Ach was, da hast du dich verhört.«
»Ist Onkel Aldo verflucht?«
»Ach was, das ist Unsinn, der vor langer Zeit im Ort über unsere Familie verbreitet wurde. Das kann dir doch wurst sein.«
»Das ist mir überhaupt nicht wurst! Wenn es um unsere Familie geht, betrifft es viele Menschen, die ich lieb habe. Auch dich, Mama.«
»Ja, ich gehöre zwar zur Familie, aber mich betrifft es nicht, mach dir keine Sorgen.«
»Ah, zum Glück. Dann betrifft es mich also auch nicht«, sagte ich. Und das sind so Sachen, bei denen die anderen, wenn man das so dahinsagt, sofort antworten sollten: Aber nein, wo denkst du hin, dich betrifft es am wenigsten von allen, du hast wirklich gar nichts damit zu tun!
Stattdessen blieb Mama aber kurz still. Sie schaute mich an, dann Teresa, dann wieder mich: »Das ist Unsinn, Fabio, das ist nur ein Märchen.«
»Gut, wenn es ein Märchen ist, dann erzähle es mir.«
»Nein, das ist ein blödes und dummes Märchen.«
»Und Onkel Aldo, der hat etwas damit zu tun, stimmt’s?«, frage ich. Aber ich brauche gar keine Antwort, es reicht schon, den beiden Tennisspielerinnen ins Gesicht zu sehen, um zu begreifen, dass Onkel Aldo so viel damit zu tun hat, dass er fast nichts anderes mehr tun kann. »Aha, dann lass ich es mir von ihm erzählen, wenn wir wieder zu Hause sind!«
Und ich schwöre, dass ich dabei gar keine Hintergedanken hatte, ich hatte das nicht aus strategischen Gründen oder aus Berechnung gesagt, ich wollte einfach nur wirklich wissen, worum es geht, wenn die anderen es mir also nicht sagen wollten, würde ich eben meinen Onkel fragen. Der es mir sofort gesagt hätte, und zwar auf die entsetzlichste Art. Also holte Mama tief Luft, steckte das Brot und die Milch und die letzten Reste des Einkaufs in eine Tüte und gab sie mir, der ich sie mit eisverklebten Händen entgegennahm. Zu Teresa sagte sie, sie solle alles auf die Rechnung setzen, und zu mir: »Ach nichts, Fabio, das ist eine dumme Geschichte über die Männer unserer Familie. Es heißt, wenn sie nicht spätestens mit vierzig heiraten, werden sie verrückt. Das ist alles.«
Dann lief sie zu ihrem Fahrrad, stieg auf und sah sich um, ob ich nachkomme. Aber ich stand stocksteif, wie angewurzelt vor dem Laden.
Ich hatte diese Geschichte von den Männern, die verrückt werden, zwar nicht wirklich verstanden, aber verrückt zu werden war nicht schön, und unter den Männern meiner Familie waren viele Menschen, die ich lieb hatte. Verdammt, sogar ich selbst gehörte zu diesen Männern! Und wenn es eine absurde Art und Weise gab, diese furchtbare Enthüllung abzuschließen, war es genau dieses Das ist alles, das Mama mit dem Versuch eines Lächelns ans Ende gesetzt hatte.
»Ja, Mama, aber … aber vierzig Jahre sind ganz arg lang, oder? Ich meine, mit vierzig ist man richtig alt, und wenn man da verrückt wird, merkt das gar keiner, stimmt’s? Es ist ja schon schwer, überhaupt so alt zu werden. Auch bei dir, Mama, bei dir dauert es noch ganz lange, bis du vierzig wirst, oder?«
Sie sah mich eine ganze Weile nur an, dann meinte sie: »Lassen wir’s gut sein!«, und fuhr los.
Und ich hinterher, die Tüte an den Lenker gehängt, ganz klebrig und mit Zitronengeschmack. Ein Tritt in die Pedale, zwei, der Laden entfernte sich in meinem Rücken, und ich hoffte, dass auch diese Geschichte mit dem Fluch dort bliebe, weit weg von mir, immer weiter weg.
Aber Geschichten sind wie der unbesiegbare Dinosaurier, den ich morgens in der Schule malen wollte, bevor Onkel Aldo gekommen war und alles durcheinandergebracht hatte. Geschichten kommen von weit her, können aber unter Wasser atmen und haben riesige Flügel, um dich überall einzuholen.
Wie der verzweifelte Schrei, der mich von hinten anfiel, so laut, dass ich mich so oder so umgedreht hätte, auch wenn sie nicht meinen Namen geschrien hätte. Es war Signora Teresa, auf der Schwelle ihres Ladens, die Hände zum Himmel gereckt:
»Heirate, Fabio! Es reicht, wenn du heiratest, dann wird alles gut! Heirate, Fabio, um Gottes willen!«
Mein Papa ist Little Tony
Auf dem Gipfel des Berges, im Dunkel des Waldes, ein stilles Licht. Es ist ein gerade entfachtes Feuer, die ersten Flammen zittern wie ein erschrockenes Herz, dicht bei den Bäumen, bis zu den krummen Ästen da oben, knotige Adern, die unter der schwarzen Haut der Nacht anschwellen, dem weißen Auge des Mondes entgegen, der auf das Grauen blickt, das sich zusammen mit diesem markerschütternden Schrei ausbreitet.
Denn das Feuer kommt von einem Holzhaufen, auf dem eine Frau an einen Pfahl gebunden ist. Sie ist ganz schwarz gekleidet, tiefschwarz sind auch ihre Haare und Augen, mit denen sie zum Himmel aufblickt, während sie schreit und die Flammen schon ihre Beine verschlingen. Dann kehrt ihr Blick hierher zurück und bohrt sich ins Gesicht der zehn aufrecht stehenden, dunklen Männer vor ihr, die sie gerade verbrennen. Sie umklammern Sensen und Heugabeln, tragen ein Kreuz um den Hals und sind gekleidet wie die Leute beim Palio von Siena. Doch es sind meine Onkel.
Und als das Feuer aufsteigt und die Brust der Hexe verzehrt, hebt sie einen Arm, um ihn noch einen Moment vor dem Scheiterhaufen zu retten, und zeigt auf sie, einen nach dem anderen:
»Ich verfluche euch, ihr Gebrüder Mancini! Ich fahre zur Hölle, aber ich nehme euch mit in die Hölle des Wahnsinns!« Ihr Mund verzieht sich in einem unheilvollen Gelächter. »Dieser Fluch wird euch und eure Söhne befallen. Und die Söhne eurer Söhne. Und die Söhne der Söhne eurer Söhne. Und die Söhne der Söhne der Söhne eurer Söhne. Und die Söhne der Söhne der …«
»Ja, wir haben es kapiert!«, sagt der Mann, der dem Scheiterhaufen am nächsten steht und bei genauerem Hinsehen aussieht wie Onkel Aldo. Er wirft noch mehr Stroh ins Feuer, und eine Stichflamme verschlingt die Hexe, aber einen Augenblick lang bleibt noch das Echo ihres Schreis Seid verflucht! Seid verflucht!, er steigt in die Luft und verfängt sich in den trockenen Zweigen dort oben, die sich wie die Hände eines Skeletts in einer tödlichen Umarmung um die Nacht und die Onkel und alles andere schließen.
Sogar um mich, der ich im Traum gar nicht anwesend war, der Hexe aber trotzdem zu sagen versuchte, dass das nicht gerecht ist, dass ich zwar der Sohn der Söhne wer weiß wie vieler Söhne bin, von dieser Geschichte mit dem Scheiterhaufen aber nicht mal etwas wusste. Das einzige Mal, dass meine Onkel eine Kirche betreten haben, war aus Versehen, in einer Silvesternacht, als ihr Lastwagen ins Schleudern geraten und gegen die Kirche geprallt war, da konnte ich mir wirklich nicht vorstellen, dass irgendwelche Vorfahren von mir so religiös gewesen waren, Hexen zu verbrennen. Das war nicht meine Schuld, zu der Zeit war ich noch nicht auf der Welt und würde auch noch für eine geraume Weile nicht auf die Welt kommen, mit diesem Fluch hatte ich nichts zu tun. Im Gegenteil, erst heute Nachmittag hatte ich überhaupt davon erfahren, ganz zufällig in Teresas Laden, als ich das Wassereis lutschte, was eine moderne und supergute Erfindung ist, von der ich der Hexe gerne einen Bissen abgegeben hätte, um Frieden zu schließen, aber ich glaube, es ist nicht so einfach, ein Wassereis zu essen, wenn man gerade Feuer fängt.
Aber das war ja echt nicht meine Schuld. Ich rief es den Flammen zu, dem Wald, dem Vollmond da oben, der mich anstarrte, ohne zu antworten. Und er wurde immer weißer, immer breiter und flacher, bis er sich in meine Zimmerdecke verwandelte. Und statt der Zweige im Wald, die sich schüttelten, spürte ich, wie etwas mich schüttelte, zwei Hände, leibhaftig und stark, die mich aufweckten und aus diesem Albtraum rissen. Verschwitzt und außer Atem setzte ich mich auf, schaute meinem Retter ins Gesicht und umarmte Little Tony ganz fest. Wenn ich das so sage, klingt es, als wäre ich aus einem absurden Traum erwacht, nur um mich in den nächsten noch irrsinnigeren zu stürzen, ich weiß, aber ich schwöre, dass es wirklich so war: Mein Papa war der berühmte Sänger Little Tony, der italienische Elvis Presley.
Jedenfalls glaubte ich ganz fest daran. Denn Mama tat alles, um mir Kummer und Enttäuschungen zu ersparen. Sie sagte, das Leben würde sich noch gründlich genug darum kümmern, mir welche zu verschaffen, und solange sie sich dazwischenstellen konnte, wollte sie dafür sorgen, dass ich glücklich bliebe.
Und eines Tages kam im Fernsehen eine Sendung für alte Leute, wo sie noch mal die alten Sänger zeigten, die vor langer Zeit gesungen haben, als noch niemand alt war. Irgendwann betrat ein junger Mann mit riesiger Tolle und einer fantastischen Jacke voller Sterne die Bühne, und die jungen Frauen flippten aus und riefen seinen Namen, eben Little Tony. Und Little Tony sah haargenau so aus wie mein Papa.
Der wunderschön war, der Schönste im Ort und an der ganzen Küste, von der Magra bis runter zum Arno. Papa war für seine Schönheit berühmt. Und was ihn noch unwiderstehlicher machte, war, dass es ihm egal war. Er fuhr mit der Ape herum und ging Wasserhähne, Duschen und Heizkessel reparieren, ohne die jungen Frauen zu bemerken, die ihn vorbeikommen sahen und sich so sehr wünschten, dass er auch sie in Ordnung brächte. Sie drückten ihre Hände gegen die Brust und hauchten seinen Namen, Giorgio, oh, Giorgio, was der perfekte Name war, weil man, um ihn auszusprechen, einen Kussmund machen muss. Nur dass Giorgio keine küsste. Und mit keiner redete, nicht mal einer zulächelte, denn um jemandem zuzulächeln, muss man erst einmal bemerken, dass er existiert, für Papa dagegen existierte nur seine Arbeit. Doch eines Tages, als sich alle langsam damit abgefunden hatten, heiratete Papa aus dem Nichts heraus meine Mama, und von da an grüßten die Frauen des Orts sie nicht mehr. Die Schönen hassten sie, weil sie fanden, dass sie es nicht verdient hatte, und die Hässlichen, weil sie es zwar verstanden hätten, wenn Giorgio mit einer Schönen gegangen wäre, das war eben der Lauf der Welt, aber wenn die Welt einmal eine Ausnahme ihrer erbarmungslosen Regeln zugelassen hatte, dann hätten ja statt Rita auch sie diesen herrlichen Mann heiraten können, der aussah wie der berühmte Sänger Little Tony. So haargenau gleich, dass ich, kaum hatte ich ihn im Fernsehen gesehen, meine Augen aufriss und Mama und Oma ansah:
»Aber … aber das ist ja Papa!«
Und sie, kurz darauf: »Das ist Little Tony«.
Da riss ich die Augen noch weiter auf, sodass es richtig wehtat. »Wirklich? Papa ist Little Tony?«
Sie schauten mich an und müssen in meinem Blick ein zu strahlendes Glück gesehen haben, zu funkelnd, um es mit diesem Eimer eiskaltes Wasser auszulöschen, den die Leute Wahrheit nennen. Mama drehte sich zu Oma um, dann wieder zu mir, und antwortete: »Ja.«
Mir blieb eine Luftblase im Hals stecken. Mein Papa war ein Star, ein berühmter Sänger, was an sich schon etwas Unglaubliches ist, aber erst recht bei meinem Papa, der im normalen Leben praktisch stumm war.
Er machte Zeichen, deutete mit seinen Fingern auf etwas, nur ab und zu kam ein Wort aus seinem Mund, aber immer vereinzelt und verloren, und um ihm einen Sinn zu geben, brauchte man Fantasie: Er sagte spät, und vielleicht wollte er damit sagen, dass ich spät dran war für die Schule oder den Katechismus. Er sagte Hunger, und das sollte heißen, dass es Zeit fürs Mittag- oder Abendessen war. Er sagte Wasser, und es konnte sein, dass er Durst hatte oder dass er dir etwas zu trinken anbot oder dass es anfing zu regnen. So war Papa halt, aber nicht aus Bosheit. Im Gegenteil, während er dir mit Zeichen antwortete, sah er dich mit diesen Augen an, die so grün waren wie glänzende Flaschen mitten im Meer und dich mit Güte überschwemmten. Er verstand sich mit allen gut, außer mit den Wörtern. Er drückte sich durch Taten aus, ließ seine Hände sprechen. Mit Worten schlägt man keine Nägel in die Wand, sagte er. Vielmehr sagte Opa das, aber Papa zeigte dabei auf ihn und nickte mit dem Kopf.
Jetzt dagegen, auf dieser Bühne im Fernsehen, tanzte er wie wild und füllte das Mikrofon ununterbrochen mit einer fantastischen Stimme. »Wieso sagt er hier zu Hause denn nie was?«
»Na, kein Wunder«, sagte Mama. »Das hat einen einfachen Grund, einen ganz einfachen«, aber statt ihn mir zu sagen, sah sie Oma an. Und die: »Weil er seine Stimme schont, nicht? Behalt es für dich, Fabio, aber dein Papa organisiert gerade ein großes Comeback, ein letztes Abschiedskonzert, dafür schont er seine Stimme. Aber vergiss nicht, das ist ein Geheimnis, erzähl niemandem davon.«
Ich nickte erst, schüttelte dann den Kopf, presste meinen Mund zusammen und hielt die Hand davor. Um dieses sensationelle Geheimnis wie auch die ganze Aufregung und den Stolz auf meinen Papa darin verschlossen zu halten. Und von da an kümmerte ich mich darum, ihn als ein Meter zehn großer Bodyguard zu beschützen. Wenn wir in eine Bar, zum Fischladen oder in die Eisenwarenhandlung gingen und es eine Schlange gab, versuchte ich die Leute beiseitezuschieben und sagte: Platz da, lasst Little Tony durch. Aber er schüttelte den Kopf, denn er war zwar berühmt, aber auch bescheiden und wollte sich in die Schlange stellen wie alle anderen auch, und an der Kasse angekommen, bezahlte er wie ein normaler Mensch, obwohl er ein großer Star war. Mehr noch, der größte Star von allen, denn viele Sänger mochten auf der Bühne ihr Publikum zum Ausflippen bringen, das schon, aber welcher andere ging anschließend in die Häuser seiner Fans und reparierte ihre Waschbecken und Klos? Nur mein Papa, der ein vollkommener Künstler war. Ein großer Sänger und ein großartiger Mensch, der heute Nacht sogar Zeit gefunden hatte, hier ins Zimmer seines Sohns zu kommen, um ihn aus einem schrecklichen Albtraum voller Hexen und Flüche aufzuwecken.
»Danke, Papa, danke, danke, danke!«, ich umarmte ihn fest, »ich habe nichts damit zu tun, ich habe sie nicht verbrannt, mich gab es da ja noch gar nicht, im Mittelalter!«
Er nickte und sagte »schlaf«.
Aber ich konnte nicht mehr schlafen. Denn es war nicht nur ein schlimmer Traum gewesen, seit jenem Nachmittag wusste ich schließlich, dass es eine echte, schreckliche Verdammnis war, von der ich für immer verfolgt würde, ob ich nun schlief oder wach war. Deshalb war an Schlafen jetzt nicht zu denken.
Also nahm Papa meine Arme, zog mich aus dem Bett und sagte »komm mit«. Und da erst merkte ich, dass er nicht im Schlafanzug war, sondern in Jacke, Hosen und Arbeitsschuhen. Ich fragte, wohin wir gingen, er drehte den Kopf zur anderen Seite und antwortete »raus«.
»Wohin denn raus, wie spät ist es?«
Er hob zwei Finger.
»Zwei Uhr? Und wo gehen wir um zwei Uhr nachts hin?«
Er nahm meine Socken von der Heizung, machte den Schrank auf und gab mir Hosen und eine dicke Jacke. »Brrr«, sagte er und legte fröstelnd die Arme um sich, er half mir, die Sachen über den Schlafanzug anzuziehen, und dann los, in jene Kälte, von der er sprach.
So sieht’s also aus, eben war ich noch im Bett, gewärmt von den Decken und einem Scheiterhaufen, der mitten im Mittelalter brannte, und jetzt plötzlich hier, in der Kälte einer Oktobernacht irgendwo im zwanzigsten Jahrhundert im Dorf Mancini.
Auf den ersten Blick, von der Hauptstraße aus, wo die Autos und der Rest der Welt im Licht der Straßenlaternen vorbeifuhren, mochtest du es bloß für eine Einbahnstraße halten. Aber es reichte ein Schritt, der erste Schritt ins Dunkle, und dir wurde klar, dass du einen eigenen Ort betreten hattest, ein echtes Dorf, das auf den Landkarten zwar nicht eingezeichnet war, aber doch existierte, samt Schild, das dich willkommen hieß und dir gleichzeitig befahl, dich fernzuhalten.
Als Erstes kamst du zum Haus von Oma Giuseppina, gegenüber war dann das, in dem ich mit Mama und Papa wohnte. Und wenn du mutig warst und bis ganz nach unten gingst, kamen hinter unseren Häusern nacheinander die meiner Onkel, immer weiter entfernt von der öffentlichen Beleuchtung und vom Licht der Vernunft. Das von Onkel Aurelio, das allerdings leer stand, weil er inzwischen im Jenseits lebte, und das von Onkel Adamo, das auch leer stand, weil er nach Mantua gezogen war und nie vorbeikam und nie anrief, nur an Weihnachten schickte er eine Salami per Post, ohne Karte oder sonst was, weshalb diese Salami für uns der einzige Unterschied war zwischen In-Mantua-Sein und Tot-Sein. Noch weiter hinten, verloren in der Finsternis, waren dann die Häuser von Onkel Aldo, von Athos, Aramis, Adelmo und so weiter, bis zum Ende der Straße beim Garten von Onkel Arno, der immer dort blieb, mit seinem Hund namens Sturm in einem ganz kaputten Wohnwagen, dem er die Räder abgenommen hatte, um sicherzugehen, dass er nicht wegfuhr.
Und jetzt liefen wir in diese Richtung, bei Vollmond, der sich über dem Dorf ausbreitete, genau wie vorhin in meinem Traum. Er ließ mich wieder an den dunklen Wald und die Flammen, an die Augen und die Worte der Hexe denken. Da verlängerte ich meine Schritte, um mich an Papa zu hängen, von dem ich zwar nicht wusste, was er um zwei Uhr nachts draußen zu suchen hatte, aber bei ihm gab es für alles immer nur einen Grund: seine Arbeit. Vielleicht hatten sie ihn wegen eines Notfalls gerufen, wie die Ärzte, nur dass es statt eines Menschen, der sich schlecht fühlte, ein undichtes Rohr gab oder einen Heizkörper, der nicht heiß wurde, und schon eilte er zu Hilfe. Auch wenn es nachts um zwei war, auch wenn heute Nacht sein Geburtstag war. Denn er reparierte alles, sofort und immer, das war Papas Mission.
Und zugleich Mamas Verdammnis. Tatsächlich habe ich sie nur ein einziges Mal streiten hören, und zwar an einem Abend, als wir bei einer Frau aus dem Kirchenchor zum Abendessen eingeladen waren und Mama ihn, bevor wir das Haus verließen, auf der Schwelle anhielt und sagte: »Giorgio, bitte, was hast du da drunter?«
Papa schaute runter auf seine Jacke, die auf einer Seite etwas ausgebeult war, aber nur ganz leicht, und schüttelte den Kopf.
»Giorgio, tu mir den Gefallen, heute Abend nicht, wenigstens heute Abend nicht.«
Er sah sie an, sah mich an, hob dann seine grünen Augen zum Himmel, der direkt da hinter der Haustür anfing, machte seine Jacke auf und zog eine Plastiktüte mit Schraubenziehern, Schraubenschlüsseln, Dichtungsmasse, Kombizange und Kneifzangen hervor. Er legte sie auf den Küchentisch, Mama grummelte irgendetwas und machte dann Anstalten rauszugehen, doch er griff in die hintere Hosentasche seiner Jeans und zog auch noch zwei Batterien, Kabel und eine kleine, mit verschiedenen Schrauben gefüllte Schachtel heraus. Und Mama sah ihn ganz ernst an, hielt aber nur einen Moment stand, dann musste sie doch lachen, drehte sich zur Gasse um, und endlich brachen wir zu dem Abendessen auf.
Aber ob jetzt mit oder ohne Werkzeug, es lief sowieso immer darauf hinaus: dass bei Tisch alle aßen und plauderten, bis auf Papa, der nichts sagte, sondern nur zuhörte. Irgendwann hörte er dann nicht mal mehr zu, weil er den verzweifelten Ruf eines hustenden Abflusses hörte, einen weinenden Wasserhahn oder Rasensprenger im Garten, die nicht gut spritzten. Und diesem Ruf musste Papa einfach folgen.
Er fragte nach der Toilette, ging aus dem Zimmer und kam nicht mehr zurück. Anfangs fiel es nur Mama auf, mit einer Mischung aus Wut und Scham, dann sagte jemand: Hm, ob Giorgio wohl ins Klo gefallen ist? Und alle lachten, auch Mama, aber etwas weniger und nur zum Schein. Denn sie wusste, dass er zwar wahrscheinlich nicht ins Klo gefallen war, man ihn aber, wenn jemand nachschauen ginge, darunter ausgestreckt fände, zwischen auseinandergenommenen Rohrleitungen und mit lauter Fettflecken auf dem guten Hemd. Kurz, mit ihm zu Essenseinladungen zu gehen, war, als ginge sie allein hin, am Ende des Abends bat sie die Gastgeber beim Abschied um Verzeihung, und die antworteten: Aber wofür denn, Rita, er hat unser Haus wieder auf Vordermann gebracht, ganz herzlichen Dank! Und Papa lächelte und ging, Mama ging und nichts weiter.
So wie jetzt er und ich die kleine Gasse unseres Dorfs entlanggingen, still in tiefer Nacht, bis hinter Onkel Aldos Haus, wo leere Plastikstühle um ein brennendes Feuer standen.
Und es wird wohl der Vollmond gewesen sein oder die zitternden Flammen, dicht bei den Oleandern, den Bambusrohren und auch bei uns, jedenfalls kam es mir jetzt wirklich vor, als wäre ich wieder in meinem Albtraum. Nur dass da anstelle des Scheiterhaufens ein Gaskocher stand, und statt der Hexe brannte darauf eine große Stahlflasche voller Grappa.
Das heißt, die Flasche war voll mit Obstschalen oder Trester oder so was, und vom Kochen wurde daraus Dampf, der durch ein langes, gewundenes Röhrchen strömte, er drehte sich und drehte sich da drinnen, kühlte so ab und fiel am Ende des Röhrchens durch irgendein Wunder Tropfen für Tropfen in einen Eimer darunter, wie brennende Tränen aus Grappa, die im Dunkel der Nacht Plop Plop machten.
Papa setzte sich ans Feuer, holte eine Fernbedienung hervor, und für einen kurzen Moment dachte ich, dass Onkel Aldo vielleicht einen Fernseher in den Garten gestellt hatte. Aber natürlich wollte Papa die Fernbedienung nicht benutzen, er wollte sie in Ordnung bringen: Wie andere Menschen Zigaretten oder etwas zum Knabbern dabeihaben, hatte er immer etwas zum Reparieren in der Tasche. Er öffnete das Plastikgehäuse und zeigte mir die Fernbedienung, um mir beizubringen, wie man das macht, aber ich glaube, ich habe sein Talent nicht geerbt, denn ich verstand gar nichts, außerdem war mir so kalt, dass ich lieber näher ans Feuer rücken wollte. Nur dass die Stahlflasche rumorte und schnaubte und ich Angst hatte, dass sie gleich explodieren würde, also blieb ich sitzen, auf halber Strecke zwischen Tod durch Erfrieren und Tod durch Explosion.
Und etwas Bauchweh hatte ich auch, aber daran war das ganze Eis schuld, das ich zum Abendessen gegessen hatte. Es war Papas Geburtstag, und er wurde genau vierzig Jahre alt, kam also ins Fluch-Alter, nur dass er schon verheiratet war und außerdem nicht das vermaledeite Blut der Mancinis hatte, also war er gleich doppelt außer Gefahr. Tatsächlich hatte er ganz ruhig und ohne Verrücktheiten zu Abend gegessen, Spaghetti mit Muscheln und Sardellen aus der Pfanne und am Ende die Geburtstagstorte, die wie jedes Jahr keine Torte war, sondern eine riesige Packung Vanilleeis. Was absurd war, weil die Geburtstagskerzen immer umfielen und es Mama und ihm noch nicht einmal schmeckte. In der Tat hatte nur ich davon gegessen, eine halbe Packung war komplett in meinem Bauch verschwunden, während Papa mir zuschaute und lächelnd die Pfanne auskratzte.
Das fiel mir jetzt vor der Stahlflasche für den Grappa wieder ein, und ich hätte ihn so gerne gefragt, warum er jedes Jahr so viel Vanilleeis kaufte, obwohl es nur mir schmeckte. Aber mein Papa war Little Tony und schonte seine wunderschöne Stimme für ein großes Abschiedskonzert, deshalb fragte ich ihn nichts. Ich sagte bloß: »Papa, Vanille schmeckt gut, aber Haselnuss ist noch besser, und Sahneeis auch. Ich finde, nächstes Jahr könnte man auch mal verschiedene Sorten nehmen, wo doch sowieso nur ich davon esse.«
Aber ich hatte das nur so dahingesagt, ohne eine Antwort zu erwarten, einfach, um ein wenig Klang in den Dampf zu bringen, der mir beim Atmen aus dem Mund kam. Aber, ob es nun am Weißwein lag, den es zum Abendessen gegeben hatte, ob am Grappadunst, der die Luft schwängerte, ob es daran lag, dass er an diesem Tag vierzig wurde und ihm das Eindruck machte, jedenfalls legte Papa kurz darauf die Fernbedienung auf den Boden, schaute auf und sah mir für einen Moment in die Augen, der so lange andauerte, dass er alle Uhren und Kalender der Welt durcheinanderbrachte. Und dann, das schwöre ich mit vor dem Herzen gekreuzten Fingern, ging sein Mund auf und daraus entwischte ein Wort, dann noch eines, und dann noch eins und noch eins.
Sechs … Jahre … war … ich …
Wie die ersten Tropfen eines plötzlichen Unwetters, und wirklich schaute ich Papa an und klammerte mich unwillkürlich an meinem Stuhl fest, während seinen Lippen ein Orkan entfuhr, der mich, den Stuhl und den Garten ringsum mitriss und uns fortwehte, in eine andere Welt, eine andere Zeit.
»Sechs Jahre war ich alt. So wie du jetzt. Und auch an jenem Tag damals war mein Geburtstag. Ich half meinen Großeltern auf dem Feld, was mir Spaß machte. Aber abends um sechs machte es mir keinen Spaß mehr, denn von Weitem hörte ich die Klingel des Parisers, der mit einer ganz weißen Ape vorbeikam und Eis verkaufte. Er verkaufte es in der Innenstadt an die Kinder, die aus der Schule kamen und sich welches leisten konnten, bei uns kam er dagegen nur vorbei, weil die Straße auf seinem Heimweg lag. Es war eine schmale Schotterpiste, die sich zwischen den Olivenbäumen entlangschlängelte, und auch hier gab es viele Kinder, aber nicht viel Geld, und ein Eis konnte sich hier niemand leisten. Nur hin und wieder, wenn zu Hause mal ein Ei mehr abfiel und Mama es mir gab, gab ich es dem Pariser, der mir im Tausch eine kleine Waffel mit Vanilleeis machte. Aber das passierte eigentlich nie. Wenn ich also diese Klingel hörte, krampfte sich mein Magen vor Lust auf Eis zusammen, ich streckte mich auf dem Feld aus und hielt mir ganz fest die Ohren zu. Vor allem im Sommer, wenn es so heiß war, dass die Felder aufbrachen, die Erde sich öffnete und man darin von der Sonne geröstete tote Ameisen, Würmer und andere Tierchen sah. Aber das Ei für ein Eis hatte ich nie. Nicht einmal an jenem Tag, als der Sommer zwar vorbei, aber dafür mein Geburtstag war. Es gab auch kein Geld für Geschenke, stattdessen hatte Mama, also deine Oma, in einer Schublade ein rotes Geschenkband gefunden, es mir um die Stirn gebunden und gesagt: Herzlichen Glückwunsch, Giorgio. Und das gefiel mir sogar als Geschenk! Ich tat so, als sei ich Tex, als er in die Siedlung der Navajo geht, weißt du, wo er seine Cowboy-Kleider ablegt, sich wie ein Indianer anzieht und sich dieses Stirnband umbindet. Doch dann hörte ich die Klingel des Parisers, und das Spiel war vorbei, denn es war klar, dass ich nicht Tex war. Der echte Tex hätte mindestens auf die Reifen der Ape geschossen und sie zum Umkippen gebracht, sodass alle Kinder der Straße hätten herbeirennen und sich ein Eis nehmen können. Weil das gerecht war, weil es gut war und weil mein Geburtstag war, verdammt noch mal! Stattdessen stand ich da am Straßenrand und konnte mich bloß auf den Boden legen und an eklige Sachen denken, etwa, dass der Pariser, wenn er das Eis machte, sich nicht die Hände wusch, hineinspuckte oder sogar -pinkelte. Aber das half alles nichts, ich wollte trotzdem welches, ich war verrückt danach. Und auch mit zugehaltenen Ohren ließ der Motor der Ape meine Knochen erbeben, ich spürte, wie sie sich immer mehr näherte, bei mir ankam und anhielt. Ich machte die Augen auf, und da war der Pariser und sah mich an, mit aus dem Fenster hängendem Ellbogen.
›Junge, was ist los, geht’s dir nicht gut?‹
Ich schüttelte den Kopf, ohne ihn anzusehen.
›Sicher?‹
Ich nickte.
›Und was hast du da auf dem Kopf?‹
Im ersten Augenblick verstand ich ihn nicht, dann erinnerte ich mich an das rote Band. Ich sagte, dass es ein Geschenk sei, zu meinem Geburtstag.
›Ach, heute ist dein Geburtstag?‹
Ich nickte.
›Na, dann herzlichen Glückwunsch! Wie alt wirst du denn?‹
›Sechs‹, sagte ich. Und ich zeigte die Zahl auch mit den Fingern.
›Sehr gut. Das ist ein besonderer Tag. Und weißt du, wie man einen besonderen Tag feiert? Mit einem leckeren Eis. Hast du noch ein bisschen Platz im Bauch?‹
Ich nickte, so heftig, dass sich mein Kopf fast vom Hals löste und bis zur Ape rollte, um auf der Stelle das Eis zu verschlingen. Und ob ich Platz im Bauch hatte, und eine unendliche Lust auf Eis!
›Sehr gut, Junge. Und hast du auch ein Ei für mich?‹
Nein, das Ei nicht, das war das Einzige, was ich nicht hatte. Ich hörte auf, ununterbrochen zu nicken, und schüttelte nur einmal, kaum wahrnehmbar, den Kopf.
Und der Pariser: ›Ach je, wie schade! Tschüss, Junge, und alles Gute noch!‹
Mit einem Lächeln, das sein ganzes Gesicht ausfüllte, während er sich schon entfernte, zusammen mit dem Motorenlärm und dieser verfluchten Klingel. Die Ape verschwand am Ende des Wegs im Staub, der aufwirbelte und zu einer Wolke wurde, und ich weiß nicht, wie lange ich in dieser Wolke aufrecht und unbeweglich stehen blieb, mindestens ein, zwei Stunden. Und ich schwöre, dass ich die ganze Zeit geweint habe. Ich weinte so viel und so heftig, dass ich an diesem Tag vielleicht alle Tränen aufbrauchte, die ich als Vorrat für mein ganzes Leben hatte, jedenfalls habe ich seitdem nie mehr geweint. Und auch Vanilleeis habe ich seitdem nicht mehr gegessen, ich brauche es nur zu riechen, schon wird mir übel. Allerdings fing ich an diesem Tag an, viel zu arbeiten, so richtig viel, ohne je aufzuhören. Bis heute, wo ich vierzig werde. Vierzig Jahre, verdammt noch mal, dabei kommt es mir vor wie ein Augenblick, weißt du? Ich war genauso alt wie du, ich habe die Augen zugemacht, wegen des Staubs, den der Pariser aufgewirbelt hatte, und bumm, schon bin ich hier. Und Vanilleeis finde ich zwar widerlich, aber wenn ich Geburtstag habe, will ich welches auf dem Tisch stehen haben, eine ganze Packung. Denn weißt du, was ich daran so mag, Fabio? Ich mag es, so wie heute Abend am Tisch zu sitzen, gemütlich mit einem schönen Glas frischem Wein, und meinem Sohn dabei zuzusehen, wie er so viel Eis isst, wie er will. Das gefällt mir wirklich sehr. Ich bin bescheuert, ich weiß, aber ich bin auch glücklich, also ist das in Ordnung so.«
All das erzählte mir Papa von der anderen Seite des Feuers in jener unglaublichen Nacht. Er sah mich für einen weiteren seiner unendlichen Augenblicke an, dann schaute er runter auf seine Hände und wunderte sich, dass er sie leer und unbewegt vorfand, ohne mit irgendetwas zu hantieren.
Und unbewegt war auch ich geblieben, während ich ihm atemlos zuhörte, so als wäre Zuhören Trinken, als schluckte ich seine volle Stimme, die ich praktisch zum ersten Mal hörte, gierig hinunter. Ich wollte, dass er nicht aufhörte, dass es noch ewig so weiterging. Nur dass es so nicht läuft. Du schaust nicht zufällig genau in dem Moment zum Himmel auf, wenn der Halleysche Komet vorbeikommt, und sagst dann zu ihm: Sehr schön, gratuliere, jetzt dreh dich um und komm noch mal vorbei. Nein, es ist ein Wunder, das einem besonderen Augenblick innewohnt, und du hattest das Glück, diesen Augenblick mitzuerleben, der so kurz und so sensationell war, dass du dich fragst, ob du ihn nur geträumt hast, während Papa schon wieder in sein Schweigen und zu seiner Fernbedienung zurückgekehrt war.
Er brachte die Plastikteilchen da drinnen in Ordnung, von denen niemand auf der Welt wusste, was sie da sollten, außer ihm. Und bestimmt würde die Fernbedienung in wenigen Minuten wieder so funktionieren wie früher, ja besser noch als früher, wahrscheinlich würde sie zu einer Superfernbedienung, die selbst dann auf das Programm schaltete, das du eigentlich sehen wolltest, wenn du aus Versehen die falsche Taste gedrückt hattest.
Doch um dieses Wunderwerk zu vollenden, fehlte ihm ein Schraubenzieher. Er stand auf und tastete die tausend Taschen seiner Hosen und seiner Jacke ab, aber er hatte wirklich keinen dabei, also sagte er zu mir, dass er kurz zu uns nach Hause ginge, um einen zu holen. Das heißt, in Wirklichkeit sagte er nur »ich hole den Schraubenzieher«, zeigte auf unser Haus, und weg war er.
Und ich wäre ihm so gerne hinterher, denn es tat mir leid, ihn allein zu lassen, nach der schlimmen Geschichte, die ihm passiert ist, als er in meinem Alter war. Seit der zwar viele Jahre vergangen waren, aber zugleich nur ein Augenblick. Und es tat mir noch mehr leid, dass ich nur die halbe Packung Eis aufgegessen und die andere Hälfte für die nächsten Tage ins Kühlfach gestellt hatte. Aber mir war kalt, und am Feuer war es zu kuschelig warm, außerdem hatte er mir mit der Hand zu verstehen gegeben, dass ich dableiben solle und er gleich zurückkomme. Ich nickte, machte es mir gemütlich und fragte, ob er mir das übrig gebliebene Eis mitbringen könne. Denn plötzlich hatte ich Lust darauf, große Lust.
Papa sah mich an, lächelte und nickte, dann verschwand er aus dem Feuerschein und hinter den Oleandern. Und ich blieb allein, in der Wärme der Flammen unter der Stahlflasche, im Widerhall seiner wunderbaren Stimme. Und ich verstand die Millionen Menschen, die die Stadien füllten, um ihm zuzuhören, und schätzte mich glücklich, sein Sohn zu sein und dass er an seinem Geburtstag mir etwas geschenkt hatte: eine ganze Packung Eis und ein Sonderkonzert nur für uns.
Etwas so Schönes, dass mir Zweifel kamen, ob ich vielleicht immer noch träumte: erst der Albtraum mit der brennenden Hexe, jetzt ein wunderschöner Traum mit meinem Papa, der spricht und mir von der Zeit erzählt, als er in meinem Alter war.
Aber das war schon in Ordnung, wenn etwas Wunderschönes passiert, ist das immer gut, auch wenn es nur ein Traum ist. Es reicht, nie aufzuwachen.
Zehn Finger sind zu viele
Papa war einen Schraubenzieher holen gegangen, aber das war jetzt schon eine ganze Weile her, und er war immer noch nicht zurück. Vielleicht fand er nicht den passenden, oder er hatte von seiner Werkstatt aus die Stimme eines Wasserhahns oder Rohrs gehört, die ihn von wer weiß wo um Hilfe baten. Oder er war erst eine Minute weg, und es kam mir nur so lange vor, weil die Angst in mir aufstieg, war ich doch so allein hier in der Dunkelheit und schließlich derjenige, der seine Hilfe in dieser Nacht am allermeisten brauchte.
Die Flamme tanzte unter der großen Stahlflasche für den Grappa und erfüllte die Welt mit schaurig flackernden schwarzen Schatten. Besonders schreckenerregend waren die stacheligen Schatten der Oleander. Sie bewegten sich auf der Wand von Onkel Aldos Haus auf und ab wie viele spitze Zähne, die an den Dingen nagen, bis sie unter der Haut auf deren Geheimnisse stoßen.