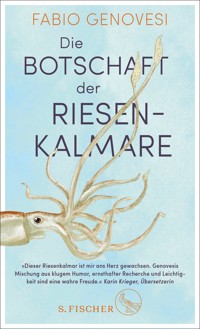15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
»Warum müssen wir etwas oder jemand werden? Sind wir das nicht schon? Warum müssen wir so schnell wie möglich einen Ort erreichen, von dem wir nicht einmal wissen, wo er liegt, und verpassen dabei die Aussicht, die wir bei jedem Schritt unseres holprigen Wegs genießen könnten?«
Als wäre die Tatsache, dass er Jura studiert, obwohl ihn das Fach gar nicht interessiert, nicht schon schlimm genug, wird Fabio auch noch in den Zivildienst berufen. Dabei wollte er nach Sevilla und ein Mädchen kennenlernen. Stattdessen soll er als Erzieher in die Apuanischen Alpen. Schon kurz nach seiner Ankunft merkt Fabio jedoch, dass es in dem (fast) menschenleeren Kloster schon lange keine Schule mehr gibt, sondern nur einen eigenwilligen 80-jährigen Priester im Jogginganzug …
Ein humorvoller und kluger Roman über eine ungewöhnliche Freundschaft, der Antworten auf die kleinen und großen Fragen des Lebens bereithält.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 482
Ähnliche
Autor
Fabio Genovesi, 1974 in der Toskana geboren, ist am berühmten Badeort Forte dei Marmi aufgewachsen. Er hat als Bademeister, Radsporttrainer, Kellner und Übersetzer gearbeitet, bevor er sich höchst erfolgreich dem Schreiben widmete. Seit vielen Jahren gehört er zu den wichtigsten und beliebtesten Autoren Italiens und wurde mit dem renommierten Literaturpreis Premio Viareggio ausgezeichnet.
FABIO GENOVESI
Vom Mut, das Glück zu suchen
Roman
Aus dem Italienischen von Mirjam Bitter
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel Cadrò sognando di volare bei Mondadori, Mailand.Questo libro è stato tradotto grazie ad un contributo alla traduzione assegnato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano.Dieses Buch wurde übersetzt dank einer Übersetzungsförderung des italienischen Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten und internationale Kooperation.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe 2020 by Fabio Genovesi
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Brigitte Lindecke
Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka
Umschlagmotiv: © arcangel images / Sybille Sterk; shutterstock / Barks; Arak Rattanawijittakorn
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-27562-4V001
www.penguin-verlag.de
Das Dach ist verbrannt –jetzt kann ich den Mond sehen.
MIZUTA MASAHIDE
1 Die Aufhebung der Grenzen
Der schönste Sommer meines Lebens war der 10. Dezember 1982. Das mag merkwürdig klingen, aber meine Eltern waren noch merkwürdiger. Merkwürdig und genial darin, den Widrigkeiten des Lebens ein Schnippchen zu schlagen und das Beste aus jeder Situation zu machen.
Wie im Juni jenes Jahres 1982, als ich acht Jahre alt war und es mir vor Aufregung in der Brust kribbelte, weil die Schule zu Ende ging und der Sommer anfing, und wenn es auf der Welt jemanden gibt, der das nicht für den schönsten Moment des Jahres hält, dann kenne ich ihn nicht und will ihn auch gar nicht kennenlernen.
Doch dann bin ich an ebenjenem ersten Ferientag von einem Baum gefallen und gute Nacht.
Ich klaute gerade den Amseln die Kirschen, die sie wiederum dem Besitzer des Feldes klauten, auf dem der Baum stand. Nur dass der Besitzer plötzlich zurückkam, die Amseln stiebend von den Zweigen aufflogen und ich ihnen hinterher. Dann fiel mir ein, dass ich keine Flügel habe, dafür aber hatte ich kurz darauf ein gebrochenes Bein.
Tschüss, Kirschen, tschüss, Sommer.
Der riesige, schwere Gips zog mich tief hinunter in den Morast der Langeweile, während meine Cousine Alessandra und die anderen Kinder ans Meer rannten und nicht einmal Zeit hatten, auf meinem harten weißen Bein zu unterschreiben. Die einzigen Unterschriften waren vom Postboten, dem Besitzer des Kirschbaums und von Papa und Mama. Die unter ihren Namen noch dazugeschrieben hatten: Sei nicht traurig, Fabio, du wirst den Sommer nicht verpassen, der Sommer wartet auf dich.
Und an den öden, heißen Nachmittagen habe ich diese Worte wieder und wieder gelesen und sie zwar nicht verstanden, aber sie klangen gut. Dann kam der 10. Dezember, und da wurde mir alles klar.
Nicht sofort, im ersten Moment bin ich von der Schule gekommen, habe die Tür aufgemacht, und mir schwallten tausend Grad Hitze entgegen. Vielleicht waren es auch nur dreißig, aber jedenfalls verdammt heiß, wenn du mit Wollpulli und Mantel von draußen kommst, wo es eiskalt ist.
»Was ist denn hier los?«, habe ich meine Eltern gefragt. »Was ist das für eine Hitze?«
»Tja, so ist es halt im Sommer«, haben sie mir in Badeanzug und Badehose geantwortet. Dann haben sie mich geschnappt und mich ausgezogen, und schon war auch ich in Badehose.
Die Heizungen auf volle Pulle und ein Elektroofen, der brühheiße Luft ausspuckte, im Wohnzimmer, wo auf dem Boden statt des Teppichs zwei Strandtücher lagen, und daneben stand die Kühlbox, die Papa immer mit zum Angeln nahm, voll mit Eis und einer halben Wassermelone, wer weiß, wo sie die im Dezember aufgetrieben hatten.
Die haben wir gegessen, und dann ab ins Bad, die Badewanne war schon voll, und wir sind zu dritt rein, haben gelacht und uns gegenseitig nass gespritzt. Nach einer Weile habe ich darauf aufmerksam gemacht, dass wir den Bauch voller Wassermelone haben und man eigentlich mindestens drei Stunden warten sollte, bevor man ins Wasser geht. Aber sie haben gelacht und mir erklärt, das sei vollkommener Quatsch, das bekämen die Kinder von ihren Eltern zu hören und glaubten dran, und wenn sie größer würden, erzählten sie es dann wieder ihren Kindern und den Kindern ihrer Kinder, und so habe diese Legende von den drei Stunden die Jahrtausende durchquert und bis zum heutigen Tag überlebt. Bis zum 10. Dezember 1982. An dem sie allerdings für immer starb.
Und noch so ein Quatsch war der Kalender: Denn ihm zufolge war schon fast Weihnachten, dabei waren wir gerade erst Baden gewesen, und jetzt lagen wir auf den Handtüchern im Wohnzimmer, um uns zu sonnen und im Kreuzworträtselheft zu blättern.
Dann hat es geklingelt. Ich bin aufgestanden und zum Fenster gerannt, und am Gartentor stand Onkel Ettore mit nacktem Oberkörper und einem Korb unter dem Arm. Er zitterte vor Kälte, denn da draußen war es keineswegs so sommerlich wie bei uns, also habe ich aufgemacht, und er ist schnell rein, hat gehustet, geflucht und dann angefangen zu rufen: »Kokosnuss! Leckere Kokosnuss!«
In seinem Korb hatte er Kokosnussstückchen, schon gewaschen und fertig, er hat uns welche gegeben, und zusammen mit ihm haben wir auch die gegessen, während er mir einen schmutzigen Witz erzählt hat, und obwohl ich ihn nicht wirklich verstanden habe, musste ich ziemlich viel lachen.
Aber nach der Kokosnuss und dem Witz ist mein Lächeln mit der sinkenden Sonne draußen vor den Fenstern langsam untergegangen, denn sie erinnerte mich daran, dass ich bis zum nächsten Tag noch eine Menge Hausaufgaben machen musste.
»Ach was«, hat Mama da gesagt, »im Sommer sind doch Ferien und keine Schule.«
»Ja, Mama, aber morgen ist Schule.«
Und sie: »Nein, Fabio, morgen ist keine Schule – wenn du nicht hingehst.«
Ich habe sie angeschaut, ich habe Papa angeschaut, und sie haben mich auf eine Art und Weise angeschaut, dass es unmöglich war, einander nicht in die Arme zu fallen. Also haben wir uns ganz feste gedrückt, so feste, dass alles ringsum angehalten hat. Auch die Welt. Auch die Zeit.
Und als die Schule dann auch für mich wieder losgegangen ist, ließ uns die Lehrerin doch tatsächlich einen Aufsatz zum Thema Erzähle von deinem schönsten Sommer schreiben, und ich habe geschrieben, dass meiner im Dezember gekommen ist, und sie hat zu mir gesagt, das wäre nicht möglich.
Aber das war nicht ihre Schuld. Sie war ja nicht dabei, als meine Eltern die Grenze verschoben haben. Denn das ist es, was das Mögliche vom Unmöglichen trennt: eine irgendwann zufällig gezogene Grenze wie die zwischen zwei Staaten, die wer weiß was zu sein scheint, aber wenn du dort ankommst, ist es bloß ein weißer Strich auf dem Boden mit ein paar Grenzschutzsoldaten hier und ein paar da, in verschiedenen Uniformen.
Und doch hat es Jahrhunderte voller Kriege und Berge von Toten gebraucht, um diese Grenzen auf der unermesslichen, freien Erde zu ziehen, dann schauen wir hoch und sehen, dass wir schon auf die eine oder die andere Seite verbannt sind, Gefangene von Schranken, die wir uns selbst gesetzt haben.
Wie als die Lehrerin uns in der ersten Klasse an Weihnachten für zu Hause aufgegeben hatte, den Weihnachtsmann zu malen, nur dass ich, als ich fast fertig war, den von meiner Cousine Alessandra angeschaut habe, die zwar noch im Kindergarten war, mir aber hatte Gesellschaft leisten wollen. Ihrer war wunderschön. Er sah aus, als wäre sie zum Nordpol gereist und hätte ihn fotografiert, und auf dem Foto war der Weihnachtsmann wirklich gut getroffen. Wenn ich ihn also schon nicht so realistisch wiedergeben konnte, dachte ich, viel hilft viel: Ich malte ihm einen riesigen Bart, der sich mit seinen langen, überall unter seiner Mütze hervorschauenden Haaren vermischte, während ich auf seinen roten Mantel ein Kilo Tempera kippte, um ihn farbenfroher zu machen. Doch ich bin farbenblind und habe statt Rot Braun genommen. Und die Augen wollte ich riesengroß machen, aber je mehr ich daran arbeitete, desto boshafter wurden sie wie auch das tausendzahnige Lächeln auf dem riesigen Mund. Kurz, am Ende war mein Weihnachtsmann kein Weihnachtsmann mehr:
»Das ist ein Wolfsmensch«, hat Alessandra etwas verängstigt gesagt.
Und noch verängstigter war ich selbst. Ich hatte ihn in meinem Zimmer aufgehängt, und nachts konnte ich vor Angst nicht schlafen. Angst vor einem schrecklichen Monster, das ich mir selbst gemalt hatte.
So sind Grenzen. Erfundene Begrenzungen, die uns einengen und den Horizont vor und hinter uns abschnüren.
Aber ebenso, wie man das Bild vom Weihnachtsmann abnehmen und in eine Schublade werfen kann, lassen sich zum Glück auch die Grenzen verschieben.
Alle, nicht nur die zwischen zwei Ländern, sondern auch die tyrannischeren, konkreteren, wie Mauern, die früher oder später einstürzen, wie Flüsse, die bei Hochwasser ihren Lauf ändern. Der Mississippi beispielsweise ist riesig, der Mississippi ist elfmal so groß wie Italien. Elf flüssige Italiens, die in dieselbe Richtung fließen und mit ihrem über die Jahrtausende in die Erde gegrabenen Verlauf die Grenzen ziemlich vieler der Vereinigten Staaten bestimmen.
Und doch kann der Mississippi bei heftigem Hochwasser manchmal seine Route ändern. Vielleicht verliert er an einer Stelle, wo er einen weiten Bogen gemacht hat, eines Tages die Geduld und beschließt, geradeaus zu fließen, und ein Stück Land, das vorher auf der einen Seite war, befindet sich plötzlich auf der anderen. Kurz, man geht mit dem Fluss zur Rechten ins Bett, und wenn man am nächsten Morgen aufsteht, ist er links. Was vielleicht nichts Weltbewegendes zu sein scheint, aber wenn es in den richtigen Jahren an der richtigen Grenze passierte und du schwarz warst, bist du als Sklave in Missouri eingeschlafen und in Illinois wieder aufgewacht, an deinem ersten Tag als freier Mensch.
Genau so, ich schwörs. Das passiert bei Flüssen, Mauern und auch bei Bergen. Und sogar bei den starrsten und gefürchtetsten Grenzen von allen: denen, die wir in uns drin ziehen. Zwischen schön und hässlich, früh und spät, richtig und falsch. Und ebendiese furchtbare Grenze zwischen möglich und unmöglich, zwischen dem, was wir gerne tun würden, und dem, was man tun darf. Und da halten wir an, lahmgelegt von einem Strich.
Aber hin und wieder kommt plötzlich ein Gefühlshochwasser, und eine außergewöhnliche, unwiderstehliche Flut hebt uns hoch und schleudert uns nach drüben, auf die andere Seite, wo unsere Träume weiden. Dabei spült sie Regeln, Gewohnheiten, Pläne und Vorhersagen weg, all die von kurzen und vorsichtigen, immer gleichen Schritten in den Fels gegrabenen Pfade.
Und genau davon handelt diese Geschichte, die an einem fernen Tag im Jahr 1982 beginnt, einem Dezembertag, an dem eben, auch wenn es unmöglich erscheint, plötzlich der Sommer da war.
Es ist die Geschichte eines weiteren Sommers, dem Sommer des Jahres 1998, als ein Gefühlshochwasser uns mitgerissen und in einem unbekannten Land ausgespuckt hat, das du nicht über vorgezeichnete Seerouten und mithilfe von Berechnungen erreichst, sondern nur, wenn du verrückt genug bist, zu improvisieren und deinen Träumen und Gefühlen zu folgen.
Den Berg hoch bis zu jener Grenze, die uns von dem trennt, was wir das Unmögliche nennen, doch wenn du oben ankommst und richtig hinschaust, siehst du, wie sich da vor dir ein steiler Abstieg hin zu so unermesslichen Horizonten auftut, dass dir die Luft wegbleibt.
Es ist die Geschichte eines Mannes. Besser gesagt, zweier Männer. Oder von wenigstens fünf Menschen.
Aber in Wirklichkeit ist es unser aller Geschichte. Vom Entern des Unmöglichen und vom Knacken seiner Tresore, sodass es ringsum seine unglaublichen, sensationellen Schätze herabregnen lässt.
Schätze, die uns nicht bloß von Armen in Reiche verwandeln, sondern etwas noch sehr viel Besseres tun: Sie finden uns als Sklaven vor und machen uns zu freien Menschen.
2 Postkarten aus der Welt
Wenn 1998 eine Postkarte kam, war das noch normal.
Nicht so wie heute, wenn du heute in einem Laden danach fragst, wirst du komisch angeguckt. Die Ernsten und Pragmatischen schütteln nur den Kopf und bedienen schon den nächsten Kunden, die Freundlichen – oder die, die gerade keine anderen Kunden haben – überlegen kurz, bücken sich dann zu irgendeiner Schublade, die seit Jahrhunderten niemand mehr geöffnet hat, und manchmal kommen sie mit einem Stapel stockfleckiger Postkarten wieder hoch, mit Bildern in Schwarz-Weiß oder in feurigen Farben von Plätzen voller Cinquecentos, Alfettas, Bianchinas und Innocentis. Denn damals gab es noch keine für den Verkehr gesperrten Altstädte, so wie es heute keine Postkarten mehr gibt, und wenn du doch welche haben willst, dann bekommst du solche.
Die wunderschön sind, ja, wenn du eine davon nimmst, Einen lieben Gruß draufschreibst und sie abschickst, ist, wer sie bekommt, im ersten Moment, wie wenn jemand spazieren geht und plötzlich eine Kutsche neben ihm fährt. Doch dann lässt er sich auf die Umarmung der Vergangenheit ein, die warm ist und nach deinen Sachen riecht.
Eine weit zurückliegende Vergangenheit, und doch war es erst gestern. Deshalb war es an jenem Maitag 1998 also nichts Ungewöhnliches, als mir meine Mutter zurief, dass eine Postkarte angekommen sei.
Ich bin in die Küche, um sie zu holen, sie kam aus Spanien, mit dem Foto eines Matadors und eines Stiers, der das rote Tuch angriff, und das Tuch war als echtes Stück Stoff auf die Karte geklebt.
Meine Freunde hatten sie mir aus Sevilla geschickt, meine besten Freunde und vielleicht auch meine einzigen. Sie waren als Erasmusstudenten dort an der Uni, und in drei Tagen würde auch ich zu ihnen stoßen, hatte ich doch gerade die letzte Juraprüfung hinter mich gebracht.
Meine Mama, mein Papa und meine Tante meinten, das sei eine gute Idee, so würde ich mich ein wenig erholen. Ich habe geantwortet, dass ich für Bibliotheksrecherchen hinführe, die bräuchte ich für meine Abschlussarbeit, an der ich schon schriebe. Von wegen Ausruhen und auch sonst kein Quatsch, genau wie meine Freunde, die nur zum Studieren da seien.
Ich habe Mama die Postkarte aus der Hand genommen, sie umgedreht, und hintendrauf stand ihre Nachricht an mich:
Hallo du Trottel!
Wann kommst du endlich?
Hier jeden Abend Party, jede Nacht Remmidemmi! Wir saufen wie die Löcher, gerade sind wir auch wieder blau! Und heiße Bräute ohne Ende, Muschis für alle! Sogar Rino hat eine abgekriegt!
Ich habe mich auf dem Tisch abgestützt, um all die Scham tragen zu können, die mich vor meinen Eltern überkam.
Auch wenn die sich bei bestimmten Dingen sehr viel weniger schämten: Als ich klein war, haben sich Papa und Mama manchmal vor mir umarmt, angefangen, sich zu küssen, und nicht mehr damit aufgehört. Wenn ich sie fragte, ob sie das nicht sein lassen könnten, sagte meine Mutter mit seltsam verzerrter Stimme, ich solle still sein, Küsse seien das Schönste auf der Welt: »Nicht reden, Fabio, küssen!«
»Wen soll ich denn küssen, wenn ich allein bin?«
»Keine Ahnung, küss deine Hand.«
»Wie, meine Hand? Wozu soll das gut sein?«
Da löste sich Papa einen Moment: »Das wirst du in ein paar Jahren schon noch sehen, wie viel Befriedigung dir diese Hand verschaffen wird!«
Er schaute meine Mama an, die da an ihm klebte, und Mama ihn, und beide brachen in schallendes Gelächter aus. Sie nannte ihn Dummkopf, er nannte sie Dummkopf, und zu mir sagten sie, ich sei eine Nervensäge.
Und vielleicht hatten sie recht, aber bei bestimmten Dingen hatte ich mich vor ihnen schon als kleiner Junge geschämt, auch wenn ich gar nichts gemacht hatte, wie dann erst an jenem Tag mit der Postkarte, auf der von Alkohol und Sex mit Unbekannten die Rede war.
Wer weiß, ob sie sie gelesen hatten, bevor sie mich gerufen haben. Ich versuchte es an ihren Blicken zu erkennen, aber ich konnte ihnen nicht in die Augen schauen und sie mir auch nicht. Der einzige Unterschied: Sie mussten lachen.
Also bin ich bloß schnell in mein Zimmer abgehauen und habe die Stereoanlage voll aufgedreht. Dann habe ich die Karte noch mal gelesen.
Es kam mir so vor, als hörte ich Sergios, Micheles und Gianlucas Stimmen, betrunkene Stimmen, tief aus einer überwältigenden Nacht, und da konnte ich nicht mehr in meinem Zimmer bleiben. Es war so eng wie eine Zelle. Aber wahrscheinlich gibt es in den Gefängnissen der Welt nur wenige Zellen, die so klein sind wie mein Zimmer, vielleicht gerade mal in Nordkorea oder irgendwo in Afrika. Daher kam es mir eher so vor, als wäre ich nicht in einem Gefängnis, sondern in einer Telefonzelle eingesperrt. Die es, wie Postkarten, heute ja auch nicht mehr gibt. Aber es war im Mai 1998, und damals gab es alles, und wieder und wieder las ich diese gigantischen Worte in meinem winzigen Zimmer, das halb ausgefüllt war von meinem schon gepackten Koffer auf dem Fußboden.
Denn in Kürze würde ich endlich aufbrechen.
In den Koffer hatte ich T-Shirts und Sommersachen gepackt, weil ich zwar noch nie in Sevilla gewesen war, es dort aber bestimmt heiß war. Nur einen Wollpulli, man weiß ja nie. Und sicher in den Pulli eingewickelt eine Zwölferpackung Kondome.
Die hatte ich in einer Apotheke in Querceta gekauft, nicht in der unweit von unserem Haus, denn da hingen ständig meine Mama und meine Tante herum, die Apothekerin ließ mich jedes Mal Grüße an sie ausrichten, das war also zu peinlich. Aber Kondome brauchte ich nun mal unbedingt. Hoffte ich jedenfalls, ich wünschte mir so, dass ich welche brauchen würde. Ich hatte gelesen, dass man zum Beispiel in Japan keine bekommt. Das heißt, schon, aber kleinere, und wenn du sie anprobierst, sind sie zu eng. Und vielleicht sind sie das in Spanien ja auch, oder vielleicht sind sie dort zu weit, wer weiß.
Ich wusste nur, dass ich auf dem Höhepunkt der Unerfahrenheit war. Ich war vierundzwanzig Jahre alt, aber beim Sex noch ein Debütant, ich konnte mir das Handicap fremder und befremdender Kondome nicht leisten. Na, jedenfalls hatte ich welche gekauft.
Und jetzt war ich mir noch sicherer, dass ich gut daran getan hatte, denn auf der Postkarte stand die unglaubliche Nachricht, dass sogar Rino mit einer abgezogen war. Rino! Das hieß, dass wirklich jeder eine abkriegte. Dass in Sevilla eine ungeheuerliche Welle göttlicher Gerechtigkeit die spitzen Gittertore der Jungfräulichkeit niedergerissen hatte und dass alle der Liebe in die Arme rennen konnten.
Eine wirklich perfekte Gelegenheit: Meine große Scham darüber, so unerfahren zu sein, schleppte ich schon seit der Mittelstufe mit mir herum, und seit damals war mein Leben ein ständiges Hinterherjagen, Sichinformieren, ein serielles Anhäufen von Theorie und ein ermattender Mangel an Praxis, der jedes Jahr schwerwiegender und himmelschreiender wurde. Es war also wunderbar, jetzt in Sevilla aufholen zu können, an einem so weit entfernten Ort, mit fremden Mädchen, die vielleicht enttäuscht sein würden, die du aber nicht hinterher auf den Straßen deines Ortes trafst und die nicht alles ihren Freundinnen erzählten, die es dann wiederum deinen Freunden erzählten.
Nein, Sevilla war einfach perfekt. Vielleicht hatte ich mich mit der Zwölferpackung Kondome sogar noch zu sehr zurückgehalten, vielleicht sollte ich noch mal nach Querceta fahren und noch mehr holen.
Ich erinnere mich, wie ich am nächsten Morgen genau darüber nachdachte. Ich war in meinem Zimmer, und vielleicht sollte ich einfach sofort losfahren, schließlich hatte ich nichts zu tun. Nachmittags dagegen war die erste Etappe des Giro d’Italia, und das Einzige, was mir an diesem spanischen Abenteuer missfiel, war, dass ich den Giro dort nicht so gut verfolgen konnte.
Ich schwöre, dass ich gerade aufstehen wollte, um zur Apotheke zu fahren, aber dann bin ich stattdessen ganz schnell in die Küche gehastet, weil Mama gerufen hat: »Da ist noch eine Postkarte!«
Noch eine? Wer weiß, was meine Freunde noch geschrieben hatten, was auf die von gestern nicht mehr draufgepasst hatte. Orgien, Drogen, Banküberfälle? Ich wusste es nicht, und ich wollte nicht, dass meine Eltern es erfuhren, deshalb bin ich in die Küche gerannt und habe ihnen die Postkarte aus der Hand gerissen.
Aber diese war anders. Keine Fotos, vorne und hinten alles grau. Mein Name stand drauf, aber diese kam vom Wehrbereich.
Ich wollte nicht zum Militär, ich hatte mich entschieden, den Wehrdienst zu verweigern, und tatsächlich wurde meinem Wunsch entsprochen: In einer Woche sollte ich aufbrechen.
Nicht nach Sevilla, sondern zum Zivildienst.
Für ein Jahr.
Oben im Apennin.
In einem Altersheim.
Für Priester.
Ich habe es meinen Eltern erzählt, da in der Küche. Und mein Vater, ich schwörs:
»Na ja, so verpasst du wenigstens nicht den Giro d’Italia.«
3 Wo fährst du hin, alter Junge?
Der Erste, der Samen aufbewahrt, sie in die Erde gepflanzt und mit Wasser begossen hat.
Der Erste, der zwei Flügel aus Eselshaut gebaut, sie sich auf den Rücken geschnallt und sich vom Turm des Ortes gestürzt hat.
Der Erste, der seinen Mund auf den Mund einer anderen Person gelegt hat, um sie spüren zu lassen, wie sehr er sie liebt.
Einer hat den Ackerbau erfunden, einer war der erste fliegende Mensch, einer hat den ersten Kuss der Geschichte gegeben. Und gemeinsam ist ihnen: dass alle sie angeschaut haben, als wären sie verrückt – kurz bevor sie die Welt verändert haben.
Das Gleiche passiert am 5. Juni 1994, vier Jahre bevor diese verfluchte Postkarte bei mir ankommen wird. Jetzt aber beginnt der Anstieg des Mortirolo, und ein unbekannter Jungspund geht aus dem Sattel und reißt aus.
Vor ihm die Ausreißergruppe, darunter auch sein Kapitän Claudio Chiappucci, genannt El Diablo. Der Jungspund dagegen hat noch keinen Spitznamen, man kennt nicht einmal seinen richtigen Namen. Um sich die Aufmerksamkeit der Fans zu verdienen, braucht es erst eine Heldentat auf den Straßen des großen Radsports.
Aber nicht jetzt. Denn sein Kapitän greift gerade an, und er sollte ihn machen lassen und schön brav hinten bleiben, und auf gar keinen Fall sollte er einfach so losschießen, auf die Gefahr hin, dass das Hauptfeld wieder zu den Ausreißern aufschließt.
Das lassen die Fernsehkommentatoren in einer Umschreibung durchblicken; in der Bar La Gazzella dagegen reden mein Papa und seine Freunde immer geradeheraus: »Wo zum Teufel fährt der denn hin?!«
Und aus irgendeinem Grund fragen sie das mich. Vielleicht weil der Namenlose und ich ungefähr gleich alt sind. Es ist eine Frage an unsere nichtsnutzige Generation, die nicht weiß, was sie tun soll, und ja auch tatsächlich nichts tut, und wenn sie es doch mal versucht, macht sie irgendeinen Scheiß.
Ich weiß nicht, was ich antworten soll. Ich bin genau zwanzig Jahre alt, im ersten Unijahr, bald habe ich meine ersten Prüfungen, daher wäre ich heute zum Gucken der Etappe fast gar nicht in die Bar gekommen: »Vielleicht bleibe ich zu Hause und gucke da, dann kann ich nebenbei ein bisschen lernen.«
Das habe ich zu Papa gesagt, und er hat genickt, dann hat er mich am Kragen gepackt – mit seiner Hand, die von der Krankheit immer mehr zittert. Aber noch ist er stark, er hat mich nämlich auf die Ape gesetzt, zwischen die Gerätschaften und ein Stück Rohr, und los gings zur Bar. Wer hat behauptet, es wäre schwierig, sich zu entscheiden? Manchmal ist es ganz einfach. Es reicht, sich nicht allzu steif zu machen, wenn das Schicksal einen am Kragen packt.
Und heute kommt es mir sogar so vor, als hätte ich eine gute Entscheidung getroffen, denn der Anstieg des Mortirolo hat gerade erst angefangen, und schon gibt es Attacken im Fernsehen und aufgeregt durcheinanderschreiende Leute entlang der Straße und hier in der Gazzella-Bar.
Und die schreien eben: »Wo zum Teufel fährt der denn hin?!«
»Der« ist der abgedrehte Jungspund, der die gestrige Etappe gewonnen hat. Eine irrwitzige Attacke im Finale, er hat auf dem letzten Anstieg einen Vorsprung herausgeholt und die Champions im Regen abgehängt, dann runter mit neunzig Stundenkilometern auf dem nassen Asphalt, in einer Haltung mit dem Arsch hinter dem Sattel, sodass er, wenn er ein Steinchen erwischt hätte, gar nicht erst ins Krankenhaus, sondern direkt zum Friedhof gebracht worden wäre. Aber es ist gut gegangen: Er ist nicht gestürzt, und niemand war so wahnsinnig, dass er versucht hätte, an ihm dranzubleiben. Er hat sein erstes Profirennen gewonnen und dann gleich eine Etappe beim Giro d’Italia! Ein Tag Ruhm, Interviews, Anrufe in Tränen von seiner Mama und seiner Verlobten, das sollte ihm reichen.
Doch es reicht ihm nicht. Denn seiner Mama hat er gesagt, er sei nicht dafür gemacht, mitten im Hauptfeld dahinzuzockeln, bei diesem Giro müsse er irgendetwas Großes vollbringen, sonst schmeiße er alles hin und mache mit ihr an ihrem Imbissstand Piadine.
Und eine Verlobte hat er gar nicht. Oder besser gesagt ist sie sowieso hier bei ihm, denn er ist mit seinem Fahrrad verlobt. Schon seit seiner Kindheit sind sie den ganzen Tag zusammen, und abends nimmt er das Rad mit ins Haus, stellt es in die Wanne und badet es, trocknet es gründlich ab, lehnt es an sein Bett und schläft neben ihm ein.
Was eine schöne Geschichte ist, fast rührend, aber dem Hauptfeld ist das gerade scheißegal. Heute ist die härteste und wichtigste Etappe des Giro, sie haben schon das Stilfser Joch erklommen, und jetzt ist der Mortirolo dran, dann kommt noch der Santa Cristina und die Ankunft in Aprica. Gigantische Berge, die den Sieg der Giganten des Rennens fordern.
Vielleicht des Nationalhelden Gianni Bugno, der einen Giro d’Italia gewonnen hat, bei dem er immer vorne war, von der ersten bis zur letzten Etappe. Oder des Russen Berzin, der das Rosa Trikot trägt und beim Zeitfahren alle anderen demütigt. Aber was am wahrscheinlichsten ist, des großen Miguel Indurain, Gigant unter den Giganten, der erst zweimal den Giro, aber schon dreimal die Tour de France gewonnen hat und hier ist, um das wieder auszugleichen.
Als der Mortirolo angefangen hat, waren diese Champions an der Spitze des ehrfürchtigen Hauptfelds und haben sich gegenseitig beäugt, um herauszufinden, wer sich besser fühlt, haben einander gemustert, mit versteinerten Mienen, um sich die Anstrengung nicht anmerken zu lassen. Lebende Denkmäler, Statuen auf Pedalen, den ersten Antritt abwägend.
Aber dann greift plötzlich aus dem dunklen Schatten dieses Radsport-Olymps der Jungspund da an.
Also, wirklich: Wo zum Teufel fährt der denn hin?!
Zum Sterben fährt er. Auf die Rampen des Mortirolo, der das italienische Wort für Tod schon im Namen trägt, la Morte. Ein erbarmungsloser, böser und heimtückischer Anstieg, der dir bei jedem Tritt ein Stück Leben raubt. Es sind mehr als zwölf Kilometer, aber er ist losgesprintet, als wäre die Ankunft hinter der nächsten Kehre. Denn er ist jung, er kann seine Kraft noch nicht einteilen, kennt noch nicht die Taktiken, die Regeln, die ein Jahrhundert an Rennen, Triumphen und Zusammenbrüchen ins Fleisch geritzt hat. Bald wird auch er sie lernen, wenn er sich gleich am Straßenrand die Seele aus dem Leib kotzt.
Bisher hält der Jungspund aber durch, er hat das Hauptfeld abgehängt und sichtet vor sich schon die Gruppe der Ausreißer mit seinem Kapitän. Der sich umdreht und ihn kommen sieht, und da wird mit einem Mal alles klar:
»Jetzt gehts los, jetzt reißen sie zusammen aus!«, ruft Franca, auf den Tresen der Bar gestützt. Sie ist die Barbesitzerin, aber als junges Mädchen ist sie für den Radsportverein Unione Ciclistica Pozzese gefahren, dreimal hat sie den Stazzema-Pokal gewonnen: Wenn sie den Mund aufmacht, dann nicht ohne Grund. »Jetzt flüchten der Diablo und er zu zweit, und im Finale donnert der Kapitän dann los und gewinnt!«
Ein genialer Schachzug, sicher gestern Abend im Hotel mit dem Teammanager ausgetüftelt. Auf den ersten Blick sah es nach bloßem Unfug aus, aber jetzt offenbart es sich in seiner ganzen Genialität.
Und tatsächlich schließt der Jungspund zu der Ausreißergruppe auf, sein Kapitän schaut ihn an und hängt sich an ihn dran, doch statt in regelmäßigem Tempo weiterzufahren, geht der Jungspund erneut aus dem Sattel, und ohne sich umzudrehen, sprintet er noch mal los und lässt alle hinter sich zurück.
Verwirrt und verloren wie Reisende am Bahnhof, die schon ewig auf den Zug warten und ihn kommen sehen, ihre Koffer schnappen und sich dem Gleis nähern – aber der Zug hält nicht an. Er bremst nicht einmal ab, wie eine Rakete rauscht er durch zu seinem geheimnisvollen Ziel, und wer schnell aufzuspringen versucht, der wird am Abend geborgen, mit Handschuhen und Eimer, um die Einzelteile im Unkraut aufzusammeln.
Und so rast der verrückt gewordene Zug weiter, hin zu der drückenden Hitze, die ihn bei der Ankunft erwartet, nachdem er das Stilfser Joch zwischen zwei weißen Wänden aus Schnee erklommen hat, während ihm der frostige Wind den Schnee auf dem Gesicht zerquetschte. Heute Morgen nach dem Aufstehen hat er den Masseur gefragt, wie das Wetter wird, und der: »Von allem etwas, Jungchen. Heute gibt es alle Wetter, denk nicht darüber nach.«
Und er versucht, nicht darüber nachzudenken, während er den Mortirolo hochfährt, aber es wäre einfacher, nicht zu atmen. Vor sich hat er jetzt nur noch Franco Vona, der seit dem Morgen und achtzig Kilometern auf der Flucht ist, ein einsamer Versuch. Er holt ihn ein und fährt so schnell an ihm vorbei, dass die Fernsehkameras den Moment verpassen. Man sieht nur ihn, wie er davonfliegt, und Vona, wie er auf seinen Lenker gestützt zusammensackt.
Aber das ist normal, das hier ist eigentlich kein Anstieg für Fahrräder. Und nicht mal für Motorfahrzeuge: Bergauf müssen die Rennfahrer im Zickzack zwischen Autos und Motorrädern der Veranstalter durchfahren, die dort stehen geblieben sind, mit ruinierter Kupplung und qualmendem Motor, ein Auto fängt sogar Feuer.
Das Feuer im Leib hat da oben allerdings vor allem und vor allen dieser Jungspund, der immer noch die Zähne zusammenbeißt und weiterfährt.
Im Stehen auf den Pedalen, so wie auch wir in der Bar La Gazzella jetzt alle stehen. Papa, Franca, Stelio und sogar Urano, der normalerweise nur vom Tisch aufsteht, um noch mehr Wein zu holen oder den auszupinkeln, den er schon getrunken hat, in einer Wolke aus Flüchen vor Anstrengung.
Auch jetzt hallen Flüche durch die Luft, aber vor Aufregung. Sie steigen nicht auf, um den Himmel zu beleidigen, sondern prallen an der Decke ab und kommen als erregte Schreie zu uns zurück.
Denn es ist zwar immer noch nicht klar, »wo zum Teufel der denn hinfährt«, mit seiner irrwitzigen, hitzköpfigen Attacke, aber jetzt wollen wir bloß noch, dass er ankommt. Fahr, Jungchen, fahr!
Sie nennen ihn »Jungchen«, weil es im Fernsehen heißt, er sei vierundzwanzig, aber vielleicht ist das ein Irrtum: Dem Augenschein nach wirkt er älter als alle anderen. Mager und gebeugt, das Gesicht zu einer Grimasse verkrampft, unter den wenigen Haaren, die nur auf und hinter den Schläfen wachsen. Er ist ein junger Mann, der gerade erst als Profiradsportler angefangen hat, aber gleichzeitig ist er ein Gespenst aus der Vergangenheit, das den Radsport mindestens fünfzig Jahre in der Zeit zurückwirft.
Er ist in einer Welt der Berechnungen gelandet, der Computer, die den Tritt vorgeben, vorsichtiger Strategien und Champions, die ihr Rennen auf Regelmäßigkeit und Taktik stützen, auf absolute Kontrolle. Nie übertreiben, nichts riskieren. Das ist die Gegenwart, das sind die Zutaten einer Formel, die den Radsport ins Koma und in einen sanften, stinklangweiligen Tod begleiten wird.
Doch da kommt aus dem Nichts ein Jungspund, der aussieht wie ein alter Mann, und alles steht kopf.
Es heißt, große Champions sind diejenigen, die eine Sportart schlagartig einen Satz nach vorne machen lassen. Der hier dagegen lässt sie gerade in der Zeit zurückspringen. Zu jenem alten, zornigen Ort, von dem der Radsport kommt. Als wäre er an einem sonnigen Morgen der Fünfzigerjahre aufgebrochen, Fahrradschläuche über Kreuz vor der Brust, eine Schotterstraße hoch. An einer Weggabelung ist er falsch abgebogen, und jetzt steht er plötzlich, verdutzt und verloren, hier, im Jahr 1994. Und weil er nicht weiß, was er in dieser neuen, absurden Welt tun soll, flüchtet er.
Er flüchtet, und wir, noch verdutzter als er, hüpfen und krakeelen, während hinten in der Gegenwart die Einzigen, die nicht zu viel Boden verlieren, ein ungleiches Paar sind: der winzige Kolumbianer Rodríguez, genannt »Cacaito«, und der Koloss Indurain, Champion unter den Champions.
Der Anstieg endet, und bei der Abfahrt holen die beiden ihn ein, also werden sie durch die Ebene und bis zum Schluss gemeinsam in die Pedale treten, wobei für jeden ein Gewinn herausspringt: Indurain wird Berzin abhängen, der sich hinter ihm dahinschleppt, und wird den Tagessieg Rodríguez und dem Jungspund überlassen, die beim Endspurt darum spielen werden.
So läufts, so muss es laufen. Um das noch klarer zu machen, setzt sich Indurain an die Spitze und zieht. Seine Schenkel sind Kolben, die einen unmenschlichen Rhythmus vorgeben und den beiden Winzlingen zeigen, dass es schon eine Ehre ist, neben ihm in die Pedale zu treten, während sie gleichmäßig und präzise bis ins Ziel fahren.
So ist es, das weiß Indurain, das wissen die Leute in den Teamwagen und die Kommentatoren im Fernsehen. Das wissen auch die Fans, die eine Weile ganz aufgeregt waren, sich jetzt aber wieder bequem hinsetzen, um die Gegenwart zu verfolgen, die vorsichtig wieder das Steuer übernimmt. Wie früher in der Schule, wenn der Lehrer rausging und zur Klasse sagte, wir sollten schön brav bleiben, aber sobald der Lehrer weg war, blieb niemand brav, es wurde geschrien, auf die Tische gehauen, und es wurden Sachen durch die Gegend geworfen. Es war fabelhaft, es war frevelhaft, aber es war nur ein Moment. Dann kam der Lehrer wieder, und es blieb nur ein wildes Lächeln auf dem Mund zurück, das nach und nach seine Krümmung verlor, bis es im allgemeinen Gähnen unterging.
Aber heute ist da dieser neue Schüler in der Klasse, und der weiß noch nicht, wie man sich benimmt. Er weiß nur, dass die Straße sich nach der Ebene wieder aufschwingen wird, auf den Colle di Santa Cristina, den letzten Anstieg des Tages, und wie ein Zündholz streicht er sich kräftig über den rauen Rücken der Steigung, entzündet sich erneut und düst mit einer weiteren irren Stichflamme los.
Im ersten Moment glaubt es keiner. Am wenigsten Indurain. Er ist der größte Champion von allen, im Hauptfeld verehren sie ihn wie einen Gott, es gibt Rennfahrer, die ihn siezen. Und jetzt sprintet dieser halb kahle Jungspund schon wieder vor seiner Nase los?
Nein, das darf nicht sein. Taktik, Regelmäßigkeit, Kräfteeinteilen schön und gut, aber ein Affront dieser Art ist nicht hinnehmbar. Also umklammert Indurain seinen Lenker, schüttelt den Kopf und macht das Einzige, was er sonst nie macht: einen Fehler.
Er beschleunigt und versucht mitzuhalten. Er verbraucht alle Energie, die ihm geblieben ist, um dem anderen zu zeigen, dass der ihn nicht abhängt, dass Big Mig ihn sich vor dem Gipfel wieder einverleibt.
Eine Weile hält er durch, sitzend, den Kopf gesenkt, und ab und zu schaut er hoch, um zu prüfen, wie viel ihm noch fehlt, bis er den Jungspund eingeholt hat. Nur dass der Jungspund immer weiter weg ist.
Indurain schaut sich um, und zum ersten Mal in seiner langen, ruhmreichen Karriere stellt er fest, dass er an dem geheimnisvollen Ort angelangt ist, von dem er bisher nur in den Legenden alter Radrennfahrer gehört hat: Indurain ist über seine Grenzen gegangen. Und er ist auf ausgedörrter Erde gelandet, wo die Energie aufgebraucht ist und die Luft fehlt, und unter jedem Stein, hinter jeder Kurve lauert der Zusammenbruch, wenn dein Körper sagt, es reicht, und du alles verlierst, was du auf vielen Kilometern Weisheit angesammelt hast.
Also verlangsamt der Champion, atmet durch, setzt den Anstieg zusammen mit Rodríguez in einem menschlicheren Tempo fort, das ihn wieder auf diese Seite der Grenze zurückbringt, in kartierte und bekannte Gebiete, geeignet für die Muster des Gewöhnlichen.
Da vorne hingegen, schon außer Sicht, rast der alte Jungspund in eine Welt, die nur für ihn existiert, erleuchtet vom Schein des Begeisterungstaumels.
Und Begeisterungstaumel herrscht auch hier in der Bar, wo alle durcheinanderschreien für dieses Jüngelchen, das kein Junge mehr ist, sondern einer von ihnen, einer aus ihrer Zeit, die ernsthafter, härter, stärker war, in der man keine Müdigkeit kannte. Heute entdecken Papa und seine Freunde, dass ihre Vergangenheit gar nicht vergangen ist: Da fliegt sie ja und lässt alles andere hinter sich.
Ich dagegen kann im wilden Geschrei noch Fetzen des Fernsehkommentars hören und stelle fest, dass ich einen älteren Bruder habe.
Er heißt Marco Pantani.
Er ist vier Jahre älter als ich.
Er ist in einem Touri-Ort am Meer geboren, wo er auch lebt – wie ich.
Er ist der Sohn einer Hausfrau und eines Klempners – wie ich.
Wie ich! Wie ich! Der ich schreie und springe, und Schreien und Springen tun auch die Alten in der Bar und das Menschenmeer aus Jung und Alt, das den Anstieg von Santa Cristina überschwemmt und sich erst im letzten Moment teilt, um ihn durchzulassen. Sie sind heute Morgen zu Fuß da hinaufgepilgert oder haben die Nacht dort verbracht, um die Rennfahrer zu sehen, um Indurain, Bugno, Berzin, Chiappucci und die anderen Großen des Radsports zu erkennen und sie anzufeuern.
Und nicht ihn. Den keiner kennt.
Aber auf irgendeine mysteriöse, magische Art erkennen sie ihn doch: die Fans auf dem Santa Cristina wie auch die Millionen Menschen in den Häusern, Läden, Krankenhäusern und Bars.
Wir haben ein bisschen gebraucht, ja, aber logisch: Schließlich verbringen wir unser Leben damit, vergeblich auf ein Wunder zu warten. Und wenn das Wunder nach so langem Warten eines Tages dann endlich passiert, ist es so unmöglich, so anders als alles Übrige, dass wir es für einen Fehler halten.
Aber nur kurz, dann verstehen wir.
Dass das hier kein Jungspund ist, der versucht hat, die Großen anzugreifen, nein, wer hier vor unseren aufgerissenen Augen davonfliegt, zwischen den zum Himmel gereckten Fäusten, den Wasserspritzern und dem animalischen Gebrüll, das ihn bis ins Ziel treiben soll, ist ein neuer, ein gewaltiger, ein außergewöhnlicher Champion.
Und so ist in der Zeitspanne eines Anstiegs und einer Abfahrt passiert, was oft in einer ganzen Karriere nicht gelingt: Aus dem halb kahlen Jungspund ist Pantani geworden.
Er fliegt zum Triumph und gewinnt mit derart großem Vorsprung, dass er, wenn es weitere ernsthafte Steigungen gäbe, Gefahr liefe, den Giro zu gewinnen.
Stattdessen wird er Zweiter. So aus dem Nichts, mit vierundzwanzig.
Also wird er den Giro nächstes Jahr bestimmt gewinnen. Man muss zwar zwölf Monate warten, aber was sind schon zwölf Monate für so ein Talent, das in einem Augenblick den Radsport ein halbes Jahrhundert in der Zeit zurückkatapultiert hat? Nichts ist das, wir blinzeln nur einmal, und schon beginnt der Giro d’Italia von 1995.
Aber Pantani ist nicht dabei.
Dann der von 1996, aber Pantani ist nicht dabei.
Dann der von 1997, aber Pantani ist wieder nicht dabei.
Wegen einer Reihe von Unglücksfällen, wo sie dir, wenn du dir das für einen Roman ausdächtest, sagen würden, das wäre zu viel, du hättest übertrieben, und es wäre nicht glaubhaft, nicht realistisch. Autos, die Stoppschilder missachten, Autotüren, die sich plötzlich öffnen, Jeeps, die direkt aus dem japanischen Dschungel geschossen kommen, Amputationen, die wie ein Damoklesschwert über dir schweben, verfluchte Katzen …
All das kann die Wirklichkeit passieren lassen, um diesen jungen Mann ans Bett zu fesseln und weiter auf seine Chance warten zu lassen. Aber jetzt sind vier Jahre vergangen, der Giro von 1998 fängt an, und diesmal hat die Wirklichkeit beschlossen, dass Pantani dabei ist, und bereitet sich darauf vor, seine Geschichte zu schreiben.
Und die Wirklichkeit ist die größte Schriftstellerin, die es gibt.
4 Erzieher
Erzieher. Das stand auf der Postkarte, dazu ein Ort und ein Tag.
Der Tag war heute, der Ort war dieser hier, und der Erzieher war ich.
Denn da gab es eine Schule, eine private Mittelschule in einem Priesterkonvent, eine Art Internat oben in den Bergen, wo die Kinder lebten und lernten. Und ich kam, um sie dabei zu unterstützen.
Darum hatte ich selbst gebeten, als ich beschlossen hatte, nicht zum Militär zu gehen, sondern aus Gewissensgründen den Kriegsdienst zu verweigern. Es gab ein Recht darauf, aber dieses Recht wurde vom Verteidigungsministerium verwaltet, die Kriegsdienstverweigerer wurden der Armee anvertraut. Als würde man ein Schwein einem Schweineschlachter anvertrauen. Deshalb war ich nun wie eine Salami hier aufgehängt, auf einem riesigen Betonplatz, um ein Jahr lang mitten im Nichts zu reifen.
Ich stand unter der sengenden Sonne mit der Postkarte in der einen, dem Koffer in der anderen Hand, ringsum viele Fenster, die in einem grauen Rechteck den Platz beäugten, alle geschlossen.
Nach dem Zufallsprinzip bin ich auf eine der Fassaden zugegangen, habe gehüstelt und gefragt: »Ist niemand da?« Dann habe ich mich umgedreht und es noch mal an der anderen Seite probiert, diesmal lauter: »Ist niemand da?« Aber zurück kam nur das Echo, um mich hören zu lassen, wie dumm meine Frage war.
Das war mir schon bei der Herfahrt passiert, als ich das letzte Dörfchen durchquert hatte, sieben an die Straße geklammerte Häuschen. Aber nicht sieben im Sinne von wenige, nein, wenn man durchzählte, waren es exakt sieben. Und danach wurde die Straße immer enger und schotteriger, und es schien unmöglich, dass da außer Wäldern, Wölfen und Bären noch irgendetwas kommen würde. Ich wollte jemanden fragen, aber da waren nur die sieben Häuser, still und verschlossen.
Also bin ich halt weitergefahren, aber nach einer Weile hörte die Straße ganz auf, an einem Gittertor, auch das verschlossen, mit einer Kette. Und daneben eine Klingel mit zwei Schildern, die die Zeit ausgebleicht hatte, eins drüber, eins drunter. Auf dem darüber stand »Konvent«, auf dem anderen »kaputt«.
Ich habe trotzdem geklingelt, aber der Klingelknopf ist ächzend im Torpfosten verschwunden und nicht mehr rausgekommen. So habe ich ein paar Minuten gewartet, aber nichts ist passiert. Zwischen Tor und Zaun war ein Spalt, wo ich durchpasste, also habe ich das Auto draußen stehen lassen, meinen Koffer genommen und bin durch die Lücke geschlüpft, dann hoch bis zu einer Kurve hinter den Bäumen, wo der Wald sich lichtete und diese gigantische rechteckige Konstruktion stand und einem den Blick in den Himmel raubte. Das Sträßchen endete an einem viereckigen Torbogen, und von da bin ich hier auf den leeren Platz gelangt, wo ich jetzt zu den geschlossenen Fenstern redete, den Koffer immer noch in der Hand.
Denselben, den ich für Sevilla gepackt hatte. Ich hatte nur eine Jacke dazugetan, weil meine Mama und meine Tante meinten, dass es in den Bergen vielleicht frischer würde.
Meine Freunde dagegen hatten mich angerufen und mir SMS geschickt, alle, um mich einen Trottel zu nennen, während sie auf Partys die Sau rausließen, ginge ich zu den Priestern in die Berge. Wo es abends vielleicht frisch sein mochte, aber bis dahin wurde ich hier auf dem Platz gegrillt, und meine Worte prallten immer weniger überzeugt von Fenstern und Mauern zurück. Und je länger sie auf mich zurückfielen, desto mehr klang meine Frage wie eine Feststellung: »Ist niemand da? Ist niemand da?« Nein, es ist wirklich niemand da.
Es hätte merkwürdig sein sollen, aber das einzig wirklich Merkwürdige war, dass ich hier war, hier mitten im Nichts.
Bis heute Morgen war ich bei mir zu Hause gewesen. Bis vor ein paar Tagen noch sollte ich nach Sevilla fahren. Gestern und vorgestern war ich in der Bar La Gazzella, mit Papa und den anderen dicht um den Tresen geschart, um die ersten Etappen des Giro d’Italia zu gucken.
Wo nach Jahren voller Unglücksfälle endlich auch Pantani wieder dabei war, mein großer Bruder.
Der an jenem Tag 1994 aus dem Nichts aufgetaucht war und das Rennen auf den Kopf gestellt hatte, der gedrängt und angegriffen hatte, als gäbe es kein Morgen. Und er hatte recht, denn es sollte wirklich kein Morgen geben und nicht mal ein Übermorgen. Das Karussell des Ruhms hatte sich vor ihm gedreht und gedreht, aber wegen des einen oder anderen Unglücks war es ihm noch nicht gelungen aufzusteigen.
Aber dieses Jahr schon. Und wer weiß, was er anstellen, was er sich ausdenken würde. Und wer weiß, ob ich ihn würde sehen können. Hier. Wie ich hier so reglos auf einem leeren Platz oben in den Bergen herumstand, war ich nicht bloß runter vom Karussell, es waren nicht mal irgendwelche Karussells in Sicht.
Dann, aus dem Nichts: »Sie da! Wer sind Sie, was wollen Sie, warum haben Sie nicht geklingelt?!«
Ich habe mich umgeschaut, es war niemand zu sehen. Also habe ich in die Luft geantwortet: »Ich habe geklingelt, ich schwörs, aber die Klingel funktioniert nicht!«
»Schade!«, hat die Stimme gesagt. Die von irgendwo dahinten kam, gegenüber dem Eingang, wo noch ein anderer Durchgang war. Da bin ich hin, ein paar Stufen führten etwas nach unten, auf einen offenen Platz mit einem Fußballfeld, einem Gemüsegarten und einem Hühnerstall. Und einem gelben Schulbus, der alt, aber gleichzeitig nagelneu aussah.
Und einem alten Mann mit weißen Haaren und Besen in einem mit Ölschlamm und Farbe bekleckerten Blaumann. »Schade, dass ich es einfach nicht hinkriege, diese Klingel zu reparieren, das ist meine große Schmach!«
Er hat sich die riesige Hand an seinem Blaumann abgewischt und dann meine gedrückt. Ich habe gespürt, wie die Knochen in meinen Fingern ihre Plätze getauscht haben.
»Sehr erfreut, ich bin Don Mauro. Hüter und Hausmeister des Konvents. Ich bewache und repariere alles. Bis auf diese Klingel da, die plagt mich schon seit Jahren. Habe ich Ihnen schon gesagt, dass das meine große Schmach ist?«
»Ja.«
»Ach so. Manchmal wiederhole ich mich. Dafür erzähle ich nie irgendwelche Lügen. Nie. Das kann ich gar nicht. Und Sie, sind Sie gekommen, um zu beichten? Dann müssen Sie warten, oder Sie erzählen mir alles, während ich den Spiegel am Bus in Ordnung bringe. Schön, oder? So was mache ich, wissen Sie, ich repariere alles.«
»Bis auf die Klingel.«
»Sehr gut! Die ist meine Schmach. Woher wussten Sie das?«
»Das war nur geraten. Aber ich muss nicht zur Beichte, ich bin für den Zivildienst hier.«
»Ah!«, hat Don Mauro gesagt. »Aber hier macht gerade keiner Zivildienst, wissen Sie?«
»Ja, das heißt, ab heute mache ich das, glaube ich.«
»Ah!«, hat er wieder gemacht. Und: »Oh! Wie wunderbar! Dann werden wir viel Zeit miteinander verbringen, freut mich, dich kennenzulernen!«
Und leider hat er wieder seine riesige Hand ausgestreckt. Mit Ergebenheit habe ich meine hineingelegt, und die Knochen haben sich noch ein bisschen vermischt.
»Also, sag mal, mein Sohn, brauchst du irgendetwas?«
»Ja. Das heißt, alles. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wo …«
»Ah, solche Sachen musst du mit dem Direktor besprechen.«
»Ja, bestens! Können Sie mir sagen, wo er ist?«
»Er ist nicht da. Besser gesagt, er ist zwar da, bleibt aber meistens für sich. Warte ein wenig, dann wirst du ihn schon noch kennenlernen. Erst mal informiere ich ihn, dass du da bist.«
»Danke, sehr freundlich. Also, wenn ich da niemanden störe, gehe ich auf den Platz zurück und warte dort auf ihn.«
»Nein, besser du richtest dich schon ein, es wird ein Weilchen dauern.«
»Das macht nichts, ich habe nichts zu tun, ich kann auf ihn warten, solange er will. Eine halbe Stunde, Stunde?«
»Sagen wir ein paar Tage.«
»Wie? Ein paar Tage?! Ich weiß nicht, was ich tun soll, ich … Also, die Schule ist ja bald zu Ende, gibt es vielleicht Sommerkurse? Kann ich nicht mit jemand anderem reden? Mit irgendeinem Lehrer vielleicht.«
»Mit wem?«
»Mit einem Lehrer, einer Lehrerin, einem stellvertretenden Direktor.«
»Hör zu, komm mal mit.« Er hat den Schraubenschlüssel und zwei Schrauben auf den Boden gelegt, ist Richtung Treppe gegangen und ich hinter ihm her. Verwirrt, aber etwas beschwingter, denn endlich gingen wir irgendwohin. Über den großen Platz und bis zu dem Torbogen, durch den ich gekommen war. In der Betonmauer war ein quadratisches Fensterchen mit Schiebeglas, das mir vorher nicht aufgefallen war. Don Mauro hat es mir gezeigt.
»Solange kannst du schon mal auf deinen Platz gehen, in die Pförtnerloge.« Er hat mich angelächelt und wollte schon wieder dorthin zurück, von wo er gekommen war.
»In die Pförtnerloge?«
»Ja, die Tür ist dahinten, immer an der Mauer entlang. Geh rein und mach es dir bequem, das ist dein Platz. Entschuldige den Staub, aber dein letzter Kollege ist schon vor einer Weile hier weg, es werden drei oder vier Jahre sein, dass wir keinen Pförtner mehr haben.«
»Aber nein, Padre, ich bin kein Pförtner, ich bin Erzieher!«
»Erzieher? Von wem denn, von uns? Sind wir etwa schlecht erzogen? Ah, entschuldige! Ich habe vergessen zu fragen, ob du Durst hast, willst du ein Glas Wasser?«
»Nein, nein danke, ich habe keinen Durst, und Sie sind sehr gut erzogen.«
»Schon gut! Brauchst du vielleicht irgendetwas anderes?«
»Ja, Padre. Ich müsste mit dem Direktor sprechen, und zwar sofort.«
»Ja, ja, das hab ich dir doch schon gesagt, erst mal spreche ich mit ihm. Sonst noch was?«
»Nein danke. Das heißt, also … Hier steht nicht zufällig irgendwo ein Fernseher?«
»Ein Fernseher? Was willst du denn damit? Im Fernsehen läuft doch nur dummes Zeug, damit vergeudet man nur seine Zeit, die man zum Arbeiten nutzen könnte.«
»Ja, aber es kommt der Giro d’Italia.«
»Ah! Der ist schön! Aber ich habe keine Zeit. Ich muss arbeiten.«
»Ja, aber wenn einer Zeit hätte, gäbe es dann zufällig einen Fernseher, um den Giro zu gucken?«
»Natürlich, einen gibts.«
»Juhuu, und wo ist der?«
»Den hat der Direktor. Aber in der Pförtnerloge steht ein Radio. Das kannst du hören, deine Arbeit ist ja sowieso dadrin.«
»Ja. Aber ich wiederhole noch einmal: Ich bin nicht der Pförtner, ich sollte ein Erzieher sein.«
»Erzieher? Von wem denn, von uns?«
»Nein, nein, Padre, Sie sind sehr wohlerzogen. Ich soll die Kinder erziehen.«
»Die Kinder? Welche Kinder denn?!«
»Wie, welche Kinder? Die, die hier zur Schule gehen, oder nicht?«
»Ah! Natürlich, die Schule!«, und ein Lächeln erschien auf seinem Mund voller riesiger perfekter Zähne. Der starke Kiefer eines Mannes von früher, als man noch in ganze Äpfel biss, Nüsse mit den Zähnen knackte. Als ich ihn angeschaut habe, musste auch ich lächeln. Einen Augenblick, dann er: »Die Schule gibt es nicht mehr, mein Sohn. Bei der wird es auch drei oder vier Jahre her sein.«
Mir ist die Luft weggeblieben, aber Don Mauro hat für uns beide weitergeredet. Er hat mir erklärt, dass ein großes auf Luxushotels und Thermalbäder spezialisiertes Unternehmen auf diesen Konvent aufmerksam geworden sei – so viel kostbarer Beton mitten im Naturpark der Apuanischen Alpen – und ein hohes Angebot gemacht habe. So richtig hoch, denn die Diözese habe sofort die Schule geschlossen und wollte schon unterschreiben. Dann seien allerdings irgendwelche Schwierigkeiten aufgetreten, das Gebäude war nämlich die Schenkung einer reichen und sehr frommen Dame, die es der Kirche unter der Auflage überlassen hatte, dass es der christlichen Erziehung von Kindern dienen würde. Die Anwälte des Unternehmens behaupteten, Thermalkuren wären auf alle Fälle im Einklang mit den Lehren Jesu, da sie ja Leidenden Erleichterung verschafften, und die Angelegenheit lag nun den Richtern zur Prüfung vor.
Aber während die Justiz in ihrem Tempo voranschritt, also nicht voranschritt, hatte die Diözese die Schule und alles drumherum bereits geschlossen und sie in ein Hospiz für Priester umgewandelt, die zu alt waren, um in anderen Gemeinden behilflich zu sein, aber noch zu lebendig, um sie auf den Friedhof zu bringen. Wo sie in äußerst regelmäßigem Rhythmus einer nach dem anderen landeten, sodass mittlerweile hier oben nur noch Don Mauro und der Direktor übrig geblieben waren. An diesem gigantischen Ort, der für Priester und Kinder zusammen mindestens dreihundert Schlafplätze bereithielt, lebten sie nun zu zweit. Vielmehr ab heute zu dritt, mit mir, der ich als Erzieher ins Hospiz gekommen war.
»Wir brauchen hier gar keinen Erzieher«, wiederholte unterdessen Don Mauro. »Hier braucht es nur einen Pförtner, um die Leute in Empfang zu nehmen, die uns besuchen kommen.«
»Wie ist das nur möglich, dass es die Schule gar nicht mehr gibt, derentwegen bin ich doch hier!«
»Glaub mir, du bist hier, um die Leute in Empfang zu nehmen, die uns besuchen kommen.«
»Aber nein, ich bin nicht … Außerdem, was soll ich denn machen, wenn die Leute kommen, ich habe damit keine Erfahrung, keine …«
»Mach dir keine Sorgen, es kommt sowieso niemand.«
Das hat Don Mauro gesagt, und diesmal ist er wirklich gegangen. Er ist auf der anderen Seite des Platzes die Treppe runter verschwunden, und alles wurde wieder still und leer.
Also habe ich das Türchen gefunden, es aufgemacht und bin rein in die Pförtnerloge, eine kleine Kammer mit Mauern zu drei Seiten, die den modrigen Geruch hüteten, einem Stuhl, einem Holztischchen und vor dem Tischchen das Schiebefenster. Sie war fast so eng wie mein Zimmer zu Hause. Daran dachte ich jetzt, dann an meine Eltern, daran, was sie wohl gerade machten, meine Eltern und mein Zimmer, da unten, weit weg von mir.
Ich habe den Koffer auf den Tisch gestellt und ihn aufgemacht, um Wasser rauszuholen, denn Don Mauro gegenüber hatte ich es zwar verneint, aber ich hatte Durst. Als ich die Flasche zwischen den Klamotten suchte, habe ich etwas Glattes, Kantiges gespürt. Das Zwölferpäckchen Kondome, das ich für Sevilla gekauft hatte. Ich hatte vergessen, es wieder auszupacken. Oder vielleicht hatte ich es auch extra dringelassen, denn na ja, man weiß im Leben ja nie, wann sich die Gelegenheiten ergeben.
Ich habe es rausgeholt, angeschaut und wieder in den Koffer gelegt. Ich habe mich hingesetzt, einen Schluck Wasser getrunken und das Fläschchen auf den Tisch gestellt.
Und da, unter dem Fenster, stand tatsächlich das Radio. Ein altes Transistorradio mit verbogener Antenne. Die heutige Etappe hatte noch nicht angefangen, aber ich musste sie komplett verfolgen, denn es war eine ganz besondere Etappe: Die Ankunft war in meinem Ort, gegen Ende ging es sogar an unserer Bar vorbei.
Franca hatte ihr Fahrrad von damals, als sie noch Rennen fuhr, rausgestellt und sich in Radsportkluft geworfen, und alle gingen ihr zur Hand, wenn sie mit dem Rosa Trikot servierte. Nicht dort zu sein, tat so weh, dass es mir den Atem raubte, das bisschen Atem, das mir in dieser modrig riechenden Kammer noch geblieben war. Aber wenigstens wollte ich das Rennen im Radio hören.
Ich habe es eingeschaltet, und es funktionierte, aber als ich das Rädchen drehte, kam nur Rauschen, ein leidendes Seufzen und zwischendurch gelegentlich eine elektrische Entladung. Und in diesem Meer wirrer Geräusche erst gegen Ende ein Sender, den man gut hörte, sehr gut sogar: die Gebete von Radio Maria.
»Ein Vaterunser von Mirella aus Frascati für die kleine Simonetta und ihre Mama Piera, die Fieber haben. Vater unser im Himmel …«
Ich habe es ausgeschaltet. Ich habe es auf den Tisch neben die Flasche gestellt.
Dann habe ich dort auch die Ellbogen aufgestützt und starr geradeaus geguckt, auf das Panorama hinter dem Schiebeglas meiner Pförtnerloge.
Eine Betonmauer.
Ohne Eile habe ich angefangen zu weinen.
5 Der Trick mit den Früchten
Ein einziger, genialer Trick hält seit jeher und für alle Zeiten die Welt am Laufen: die Früchte. Die schön aussehen und so süß schmecken, aber ein Trick sind sie trotzdem. Denn wir stellen uns immer in den Mittelpunkt und denken, die Früchte wären für uns da, damit wir sie pflücken oder kaufen und uns in den Mund stecken können. Und das Einzige, was uns dabei nicht interessiert, was für uns nutzlos und lästig ist, sind die Kerne.
Dabei sind die Kerne der Sinn von allem. Ihretwegen gibt es die Früchte und nicht etwa unseretwegen.
Sie wachsen um sie herum, um sie zu beschützen und zu nähren, und sie sind so farbenfroh und saftig, damit die Vögel und die anderen Tiere sie sehen, fressen, mit den Kernen im Bauch weit wegfliegen und sie am Ende meilenweit entfernt von den unbeweglichen Wurzeln ihrer Eltern wieder abladen – also die Fruchtsamen säen – und so ihre Existenz über die Welt verbreiten.
Diesen Trick wenden die Pflanzen bei den Tieren an, und denselben nutzt das Leben bei uns: Es wedelt mit farbenfrohen Träumen und den süßesten Wünschen vor uns herum, mit funkelnden Zielen und aufsehenerregenden Hoffnungen, die in uns die Lust entfachen, hartnäckig nach etwas zu streben, uns in Bewegung zu setzen und etwas zu wagen. Doch das sind alles Tricks des Lebens, um uns loszuschicken, und zwar dahin, wo es uns haben will, denn während wir voller Leidenschaft nach etwas oder jemandem suchen, finden wir am Ende immer etwas anderes, was damit überhaupt nichts zu tun hat und was wir gar nicht wollten – aber das Leben wollte es so.
Du verliebst dich in ein Mädchen, du hast sie in einem Lokal gesehen und weißt nur, dass sie in einer Tierhandlung arbeitet, du kurvst durch die Provinz, um sie zu finden, und wenn du sie schließlich vor dir hast, parkst du, überquerst mit heftig klopfendem Herzen die Straße und gehst im Kopf noch mal durch, was du zu ihr sagen willst, und … bumm, ein Lastwagen fährt dich platt und tschüss.
Oder vielleicht bist du gerade auf dem Weg zu einem Kongress über Verkehrssicherheit, etwas so Sterbenslangweiliges, dass du dir lieber eine halbe Stunde die Augen mit Schmirgelpapier abreiben würdest, findest aber den Veranstaltungsort nicht und betrittst nach langem Herumirren eine Tierhandlung, um nach dem Weg zu fragen, und dort drinnen lernst du die Frau kennen, mit der du den Rest deiner Tage verbringen wirst.
So funktioniert das Leben, es bringt uns mit seinen Früchten in Gang, aber das Wichtige daran sind die Samen, die wir, ohne es zu wissen, in uns tragen. Und tatsächlich kommen die dicksten Dinger, die uns passieren – ob fantastisch oder furchtbar –, immer so, ohne dass wir sie uns ausgesucht hätten, von etwas anderem, das wenig oder gar nichts mit ihnen zu tun hat.
Also ist es normal, dass ich Anwalt werde, weil die Miesmuscheln, die unten an der Landungsbrücke in meinem Ort wachsen, die besten im gesamten Mittelmeer sind.
Und es ist normal, dass Pantani zum Champion wird, weil die Stadtverwaltung von Cesenatico nicht weit von dem Platz entfernt ist, an dem er wohnt.
Bei der Stadt arbeitet nämlich Roberto Amaducci, der allerdings gleich nach dem Mittagessen abhaut und ins Auto des Sportvereins Fausto Coppi steigt; und weil ebenjener Platz zwischen der Stadtverwaltung und seinem Zuhause liegt, ist dort sein Treffpunkt mit den Kindern, die mit ihm Radrennen fahren.