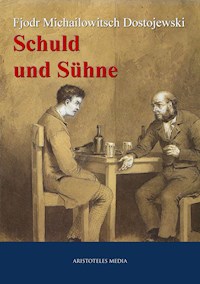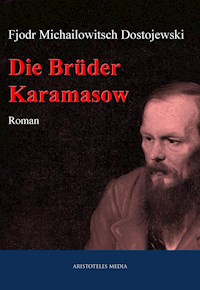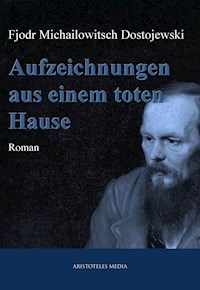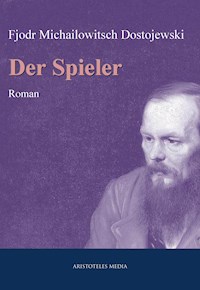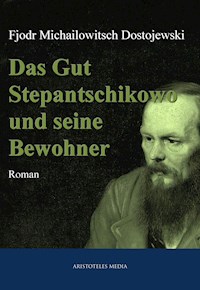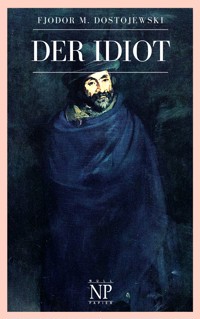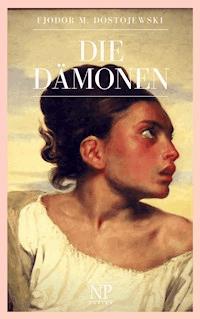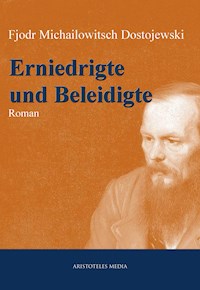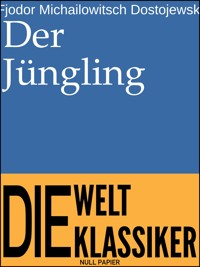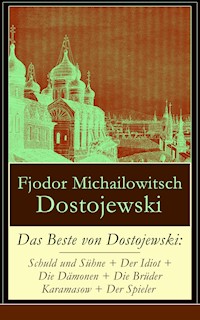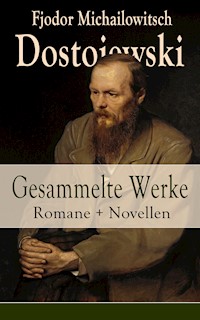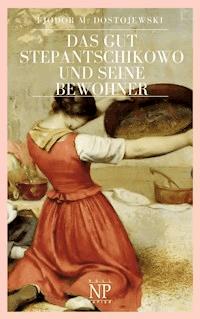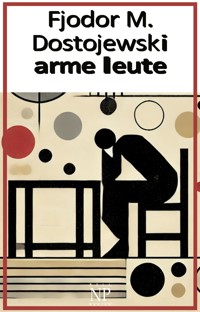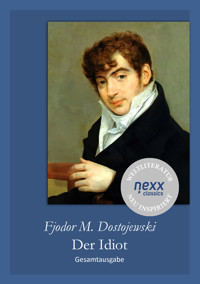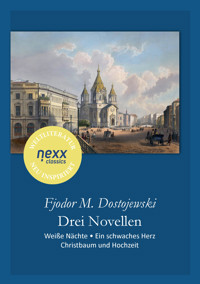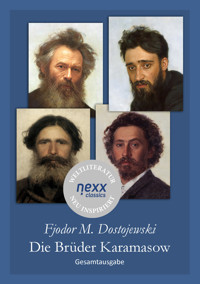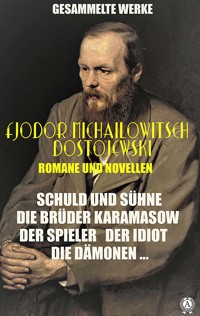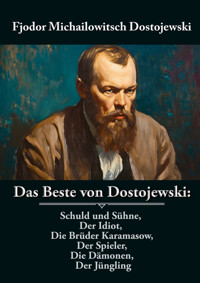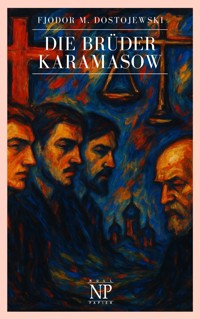
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Vollständige Ausgabe, mit interaktivem Personenverzeichnis und erklärenden Fußnoten Mit einführendem Aufsatz zu Autor und Werk Der letzte Roman von Fjodor M. Dostojewskis übertrifft alle vorausgegangenen in der Breite und Komplexität. Man kann dieses Buch - das auch sein letztes wurde - als die Essenz seines Schaffens sehen. Das Buch ist (anspruchsvoller) Kriminalroman, Entwicklungsgeschichte, Psychogramm und Sittengemälde in einem. Die drei Söhne von Fjodor Karamasow, einem alten Trinker und Tunichtgut, kehren als Erwachsene ins Elternhaus zurück und müssen sich mit ihrem nur schlecht versteckten Hass auf den Vater auseinandersetzen. Ein Bruder, Dimitri, buhlt um dieselbe Frau wie der Vater: die schöne Gruschenka. Der zweite Bruder, Iwan, ist ein antireligiöser Intellektueller. Der jüngste Bruder, Aljoscha, lebt im Kloster. Ein vierter - unehelicher Sohn - Smerdjakow, erschlägt schließlich den Vater und begeht daraufhin Selbstmord. An seiner Stelle wird Dmitri als Vatermörder angeklagt. Der Roman entfaltet eine Fülle tiefer Gedanken über die christliche Religion und die in ihr angesprochenen menschlichen Grundfragen nach Schuld und Sühne, Leid und Mitleid, Liebe und Versöhnung. Für Sigmund Freud war "Die Brüder Karamasow" "der großartigste Roman, der je geschrieben wurde". Thomas Mann und James Joyce spielten in ihren eigenen Texten mehrfach auf Motive des Werks an. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1829
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Fjodor Michailowitsch Dostojewski
Die Brüder Karamasow
Vollständige Ausgabe
Fjodor Michailowitsch Dostojewski
Die Brüder Karamasow
Vollständige Ausgabe
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2025Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: Hermann Röhl EV: Reclam jun., Leipzig, 1924 5. Auflage, ISBN 978-3-954181-19-3
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Autor und Werk
Vorwort des Verfassers
Erster Teil
Erstes Buch – Die Geschichte einer Familie
1. Fjodor Pawlowitsch Karamasow
2. Der erste Sohn wird aus dem Haus geschafft
3. Die zweite Ehe und die Kinder daraus
4. Der dritte Sohn Aljoscha
5. Die Starzen
Zweites Buch – Eine verfehlte Zusammenkunft
1. Ankunft im Kloster
2. Ein alter Possenreißer
3. Gläubige Weiber
4. Eine kleingläubige Dame
5. Amen, es soll also geschehen!
6. Wozu lebt ein solcher Mensch?
7. Ein Seminarist und Karrierist
8. Der Skandal
Drittes Buch – Wollüstlinge
1. In der Gesindestube
2. Lisaweta die Stinkende
3. Beichte eines heißen Herzens (in Versen)
4. Beichte eines heißen Herzens (in Prosa)
5. Beichte eines heißen Herzens (»Mit den Fersen nach oben«)
6. Smerdjakow
7. Eine Kontroverse
8. Beim Kognak
9. Die Wüstlinge
10. Beide Frauen zusammen
11. Noch ein verdorbener Ruf
Zweiter Teil
Viertes Buch – Überspanntheiten
1. Vater Ferapont
2. Beim Vater
3. Er gibt sich mit Schulknaben ab
4. Bei den Chochlakows
5. Überspanntheit im Salon
6. Überspanntheit in der ärmlichen Wohnung
Fünftes Buch – Pro und Kontra
1. Die Verlobung
2. Smerdjakow mit der Gitarre
3. Die Brüder lernen einander kennen
4. Rebellion
5. Der Großinquisitor
6. Ein vorläufig sehr unklares Kapitel
7. Mit einem klugen Menschen ist auch ein kurzes Gespräch von Nutzen
Sechstes Buch – Ein russischer Mönch
1. Der Starez Sossima und seine Besucher
2. Aus dem Leben des in Gott entschlafenen Priestermönchs und Starez Sossima, nach seinen eigenen Worten zusammengestellt von Alexej Fjodorowitsch Karamasow
3. Aus den Gesprächen und Belehrungen des Starez Sossima
Dritter Teil
Siebentes Buch – Aljoscha
1. Verwesungsgeruch
2. Der gewisse Augenblick
3. Die Zwiebel
4. Die Hochzeit zu Kana in Galiläa
Achtes Buch – Mitja
1. Kusma Samsonow
2. Ljagawy
3. Die Goldbergwerke
4. In der Dunkelheit
5. Ein plötzlicher Entschluss
6. Ich komme selbst!
7. Der Frühere und Unbestreitbare
8. Im Fieberwahn
Neuntes Buch – Die Voruntersuchung
1. Der Beginn der Karriere des Beamten Perchotin
2. Alarm
3. Die Wanderung einer Seele durch die Leiden.
4. Das zweite Leid
5. Das dritte Leid
6. Der Staatsanwalt fängt Mitja
7. Mitjas großes Geheimnis wird nicht ernst genommen
8. Die Zeugenaussagen und der Traum vom ›Kindelein‹
9. Mitja wird abtransportiert
Vierter Teil
Zehntes Buch – Die Jungen
1. Kolja Krassotkin
2. Kinder
3. Schüler
4. Shutschka
5. An Iljuschas Bett
6. Frühreife
7. Iljuscha
Elftes Buch – Der Bruder Iwan Fjodorowitsch
1. Bei Gruschenka
2. Das kranke Füßchen
3. Ein Teufelchen
4. Eine Hymne und ein Geheimnis
5. Nicht du, nicht du!
6. Erster Besuch bei Smerdjakow
7. Zweiter Besuch bei Smerdjakow
8. Dritter und letzter Besuch bei Smerdjakow
9. Der Teufel – Iwan Fjodorowitschs Alptraum
10. »Das hat er gesagt!«
Zwölftes Buch – Ein Justizirrtum
1. Der verhängnisvolle Tag
2. Gefährliche Zeugen
3. Die medizinischen Gutachten und ein Pfund Nüsse
4. Das Glück lächelt Mitja
5. Die plötzliche Katastrophe
6. Die Rede des Staatsanwalts: Personencharakteristik
7. Historischer Überblick
8. Der Traktat über Smerdjakow
9. Psychologie auf Hochtouren. Die dahinjagende Troika. Schluss der Rede des Staatsanwalts
10. Die Rede des Verteidigers. Der Stab mit zwei Enden
11. Kein Geld – also auch kein Raub
12. Und auch kein Mord
13. Und selbst wenn…
14. Die Bauern haben ihren Kopf für sich
Epilog
1. Pläne zu Mitjas Rettung
2. Für einen Augenblick wird die Lüge zur Wahrheit
3. Iljuschetschkas Begräbnis und die Rede am Stein
Anhang: Namensregister
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Autor und Werk
Fjodor Michailowitsch Dostojewski ✳ 11. November 1821 in Moskau; † 9. Februar 1881 in Sankt Petersburg) gilt als einer der bedeutendsten russischen Schriftsteller.
Fjodor Dostojewski war das zweite Kind von Michail Andrejewitsch Dostojewski und Maria Fjodorowna Netschajewa. Er hatte zwei Brüder und drei Schwestern. Die Familie entstammte verarmtem Adel; der Vater war Arzt. Nach dem Tod seiner Mutter, 1837, ließ sich Dostojewski mit seinem Bruder Michail in St. Petersburg nieder, wo er von 1838 bis 1843 Bauingenieurwesen studierte. 1839 soll sein Vater auf dem heimischen Landgut durch Leibeigene ermordet worden sein.
Dostojewski war zweimal verheiratet. Seine erste Ehe mit der Witwe Maria Dmitrijewna Isajewa endete 1864 nach sieben Jahren mit dem Tod Marias und war kinderlos. Seine zweite Frau war Anna Grigorjewna Snitkina. Aus der am 15. Februar 1867 geschlossenen Ehe, die bis zu Dostojewskis Tod andauerte, gingen vier Kinder hervor, von denen jedoch nur zwei das Erwachsenenalter erreichten.
Dostojewski begann 1844 mit den Arbeiten zu seinem 1846 veröffentlichten Erstlingswerk »Arme Leute«. Mit dessen Erscheinen wurde er schlagartig berühmt; die zeitgenössische Kritik feierte ihn als Genie. 1847 trat er dem revolutionären Zirkel bei. 1949 denunzierte man ihn, und er wurde zum Tode verurteilt. Eigentlich hätte er am 22. Dezember 3. Januar 1850 durch ein Erschießungskommando hingerichtet werden sollen. Erst auf dem Richtplatz begnadigte Zar Nikolaus I. ihn zu vier Jahren Verbannung und Zwangsarbeit in Sibirien, mit anschließender Militärdienstpflicht. In der Haft in Omsk wurde bei Dostojewski zum ersten Mal Epilepsie diagnostiziert.
1854 trat er seine Militärpflicht im Rahmen seiner Verbannung in Semei (Semipalatinsk) an; 1856 wurde er zum Offizier befördert. Nach seiner Heirat 1857 und schweren epileptischen Anfällen beantragte er seine Entlassung aus der Armee, die jedoch erst 1859 bewilligt wurde, sodass Dostojewski nach St. Petersburg zurückkehren konnte.
1859, noch zur Zeit seiner sibirischen Verbannung, entstand sein Roman »Onkelchens Traum«, unmittelbar vor den »Aufzeichnungen aus einem Totenhaus« (1860).
Gemeinsam mit seinem Bruder gründete er die Zeitschrift »Zeit« (Wremja), in der im darauf folgenden Jahr sein Roman »Erniedrigte und Beleidigte« erschien.
Bereits 1863 jedoch fiel die Zeitschrift der Zensur zum Opfer und wurde verboten. In der 1860er Jahren reist Dostojewski mehrmals durch Europa.
1863 spielte er zum ersten Mal Roulette. 1864 starben in kurzer Folge Dostojewskis erste Frau, sein Bruder und sein Freund Apollon Grigorjew; die Nachfolgezeitschrift der »Zeit«, die »Epoche«, musste er aus Geldmangel einstellen.
1865 verspielte er beim Roulette in der Spielbank in Wiesbaden seine Reisekasse. Im Mittelpunkt seines 1866 erschienenen Romans »Der Spieler« steht ein Roulettespieler. Im selben Jahr erschien der erste der großen Romane, durch die Dostojewskis Werk Teil der Weltliteratur wurde: »Schuld und Sühne« (oder auch in der Neuübersetzung: »Verbrechen und Strafe«).
Kurz nach seiner zweiten Eheschließung, 1867, nach dem Zusammenbruch der mit seinem Bruder gegründeten zweiten Zeitschrift ins Ausland, um sich dem Zugriff seiner Gläubiger zu entziehen. Er wohnte längere Zeit in Dresden.
Erst 1871 kehrte er wieder nach Russland zurück. Entgegen der weitverbreiteten Annahme, Dostojewski habe große Beträge am Roulettetisch verloren, war er ein Spieler mit geringen Einsetzen, der oft tagelang mit dem Geld eines gerade verpfändeten Kleides seiner Frau spielte.
1868 erschien sein zweites Großwerk, »Der Idiot«, die Geschichte des Fürsten Myschkin, der (wie Dostojewski selbst) unter Epilepsie leidet und aufgrund seiner Güte, Ehrlichkeit und Tugendhaftigkeit in der St. Petersburger Gesellschaft scheitert.
Zu seinem Ende hin verlief das Leben Dostojewskis in ruhigeren Bahnen. Er verfasste seine beiden letzten großen Werke, den Roman »Der Jüngling« – in der Neuübersetzung »Ein grüner Junge« – und schließlich den Roman »Die Brüder Karamasow«, den er in den 1860er Jahren, also in der Zeit der Entstehung von »Schuld und Sühne«, begonnen hatte und der die Entwicklung der russischen Gesellschaft bis in die 1880er Jahre behandeln sollte.
Fjodor Michailowitsch Dostojewski starb am 9. Februar 1881 in Sankt Petersburg an einem Lungenemphysem; an seinem Begräbnis nahmen 60.000 Menschen teil. Sein Grab befindet sich auf dem Tichwiner Friedhof des Alexander-Newski-Klosters.
Vorwort des Verfassers
Indem ich die Lebensbeschreibung meines Helden Alexej Fjodorowitsch Karamasow beginne, bin ich in einer gewissen Verlegenheit. Obgleich ich nämlich Alexej Fjodorowitsch als meinen Helden bezeichne, weiß ich doch selbst, dass er keineswegs ein großer Mann ist; daher sehe ich unweigerlich Fragen voraus wie etwa: Wodurch zeichnet sich Ihr Alexej Fjodorowitsch denn aus, dass Sie ihn zu Ihrem Helden erwählt haben? Was hat er schon geleistet? Wem ist er bekannt und wodurch? Warum soll ich, der Leser, meine Zeit mit dem Studium von Ereignissen aus seinem Leben vergeuden?
Die letzte Frage ist die heikelste; denn ich kann auf sie nur antworten: »Vielleicht entnehmen Sie das dem Roman.« Wenn nun jemand den Roman liest und es nicht entnimmt und meinen Alexej Fjodorowitsch nicht als bemerkenswert anerkennt? Ich sage das, weil ich es zu meinem Leidwesen voraussehe. Für mich ist er ein bemerkenswerter Mensch; aber ich zweifle stark, ob es mir gelingen wird, dies dem Leser zu beweisen. Das liegt daran, dass er zwar handelt, aber eben unsicher, ohne Klarheit. Allerdings wäre es seltsam, in einer Zeit wie unserer von jemandem Klarheit zu fordern. Eines steht aber wohl ziemlich fest: Er ist ein seltsamer Mensch, ja sogar ein Sonderling. Aber Seltsamkeit und Wunderlichkeit schaden eher, als dass sie ein Recht auf Beachtung geben, namentlich da alle bemüht sind, die Einzelerscheinungen zusammenzufassen und wenigstens darin irgendeinen gemeinsamen Sinn in der allgemeinen Sinnlosigkeit zu finden. Ein Sonderling aber ist in der Mehrzahl der Fälle etwas Vereinzeltes, Isoliertes. Ist es nicht so?
Wenn Sie nun aber mit dieser letzten These nicht einverstanden sind und antworten: Es ist nicht so! oder: Es ist nicht immer so! – dann würde ich hinsichtlich der Bedeutung meines Helden Alexej Fjodorowitsch doch wieder Mut fassen. Abgesehen davon, dass ein Sonderling »nicht immer« etwas Vereinzeltes und Isoliertes ist – es kommt sogar vor, dass gerade er den Kern des Ganzen in sich trägt, dass alle übrigen Menschen seiner Epoche aus irgendeinem Grund, durch irgendeinen andrängenden Wind zeitweilig von diesem Ganzen losgerissen sind…
Am liebsten hätte ich mich auf diese sehr uninteressanten und unklaren Darlegungen gar nicht eingelassen, sondern mein Werk ganz einfach ohne Vorwort begonnen: wem’s gefällt, der wird es sowieso lesen. Aber das Unglück besteht darin, dass ich zwar nur eine Lebensbeschreibung habe, dafür aber zwei Romane. Der Hauptroman ist der zweite; er enthält die Tätigkeit meines Helden in unserer Zeit, gerade in diesem jetzigen Augenblick. Der erste Roman jedoch hat sich schon vor dreizehn Jahren zugetragen; eigentlich ist er kaum ein Roman, eher ein Moment aus der frühen Jugend meines Helden. Diesen ersten Roman wegzulassen ist für mich unmöglich, vieles in dem zweiten wäre dann unverständlich. Aber auf diese Weise vergrößert sich für mich noch die ursprüngliche Schwierigkeit: Wenn schon ich, der Biograf selber, finde, ein einziger Roman ist für einen so bescheidenen und undeutlichen Helden vielleicht schon zu viel – wie soll ich da mit zwei Romanen auf den Plan treten, und womit soll ich eine solche Anmaßung entschuldigen?
Da mir die Beantwortung dieser Fragen schwerfällt, entschließe ich mich, sie überhaupt nicht zu beantworten. Selbstverständlich hat der scharfsinnige Leser längst bemerkt, dass ich von Anfang an dazu neigte, und nun ist er bloß ärgerlich auf mich, weil ich unnütze Worte und kostbare Zeit zwecklos vergeude. Darauf gebe ich eine klare Antwort: Ich habe unnütze Worte und kostbare Zeit erstens aus Höflichkeit und zweitens aus Schlauheit vergeudet. Immerhin könnte ich nachher sagen: Ich habe im voraus gewarnt! Übrigens freue ich mich sogar darüber, dass sich mein Roman von selbst in zwei Erzählungen gegliedert hat, »bei wesentlicher Einheitlichkeit des Ganzen«; wenn sich der Leser mit der ersten Erzählung bekannt gemacht hat, kann er selbst entscheiden, ob es lohnend für ihn ist, sich mit der zweiten zu befassen. Natürlich ist niemand zu etwas verpflichtet, jeder kann das Buch schon nach zwei Seiten der ersten Erzählung weglegen, um es nie wieder aufzuschlagen. Aber es gibt ja zartfühlende Leser, die durchaus bis zu Ende lesen wollen, um zu einem irrtumsfreien, unparteiischen Urteil zu gelangen; dazu gehören zum Beispiel alle russischen Kritiker. Gerade ihnen gegenüber fühle ich mich jetzt erleichtert: trotz aller Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit haben sie einen durchaus gesetzlichen Vorwand, die Erzählung bei der ersten Episode des Romans beiseite zu legen.
Nun das wäre mein ganzes Vorwort. Zugegeben, es ist überflüssig; aber da es einmal hingeschrieben ist, mag es stehenbleiben.
Doch nun zur Sache.
Erster Teil
Erstes Buch – Die Geschichte einer Familie
1. Fjodor Pawlowitsch Karamasow
Alexej Fjodorowitsch Karamasow1 war der dritte Sohn des in unserem Kreis ansässigen Gutsbesitzers Fjodor Pawlowitsch Karamasow, der seinerzeit äußerst bekannt war (und bis heute noch nicht vergessen ist) wegen seines dunklen, tragischen Endes, das vor genau dreizehn Jahren eintrat; ich werde, wenn es sich anbietet, darauf zurückkommen. Jetzt aber will ich von diesem »Gutsbesitzer«, wie er bei uns genannt wurde, obwohl er sein ganzes Leben fast nie auf seinem Gut lebte, nur so viel sagen, dass er ein sonderbarer, aber ziemlich häufig vorkommender Typ war: nicht nur ein gemeiner und ausschweifender, sondern auch unverständiger Mensch, allerdings einer von denen, die es vorzüglich verstehen, ihre Geldgeschäftchen zu betreiben – sonst aber, wie es scheint auch nichts. Fjodor Pawlowitsch zum Beispiel hatte beinahe mit nichts begonnen; er war ein ganz kleiner Gutsbesitzer gewesen, war zu fremden Tischen gelaufen, um da sein Mittagsbrot zu finden, hatte sich als Kostgänger durchschmarotzt, und dennoch fanden sich bei ihm nach seinem Tode an die hunderttausend Rubel bares Geld. Dabei war er sein Leben lang einer der unverständigsten Narren in unserem ganzen Kreis. Ich wiederhole, ich meine nicht Dummheit – die meisten dieser Narren sind recht klug und schlau –, sondern Unverstand, und zwar eine besondere, nationale Art von Unverstand.
Er war zweimal verheiratet und hatte drei Söhne: den ältesten, Dmitri Fjodorowitsch, von der ersten Frau; die beiden anderen, Iwan und Alexej, von der zweiten. Seine erste Frau stammte aus dem ziemlich reichen, vornehmen Adelsgeschlecht der Miussows, ebenfalls Gutsbesitzer in unserem Kreis. Wie es gekommen war, dass ein Mädchen mit Mitgift und noch dazu ein schönes Mädchen, eines jener frischen, klugen Mädchen, die in unserer jetzigen Generation so zahlreich sind, aber auch schon in der vorigen vorkamen, wie ein solches Mädchen einen solchen »Jammerlappen«, wie ihn die Leute damals riefen, heiraten konnte, das will ich nicht lange erörtern. Kannte ich doch selbst noch ein Mädchen aus der vorvorigen, der »romantischen« Generation, das sich nach mehreren Jahren einer rätselhaften Liebe zu einem Mann, den sie jeden Augenblick ganz bequem hätte heiraten können, selbst unüberwindliche Hindernisse ausdachte und sich in einer stürmischen Nacht von einem felsigen Steilufer in einen ziemlich tiefen, reißenden Fluss stürzte und darin umkam, einzig und allein, um Shakespeares Ophelia zu gleichen. Und wäre der lange ins Auge gefasste, ja liebgewonnene Felsen nicht malerisch gewesen, wäre an seiner Stelle prosaisches flaches Ufer gewesen, der Selbstmord hätte vielleicht überhaupt nicht stattgefunden. Das ist eine Tatsache, und man darf annehmen, dass in unserem russischen Leben der zwei oder drei letzten Generationen nicht wenige Taten dieser oder ähnlicher Art vorkamen. Dementsprechend war denn auch der Schritt Adelaida Iwanowna Miussowas ohne Zweifel auf fremde Einflüsse und auf ihre vom Affekt gefesselten Gedanken zurückzuführen. Vielleicht wollte sie weibliche Selbstständigkeit an den Tag legen, sich gegen die gesellschaftlichen Zustände, gegen den Despotismus ihrer Verwandtschaft und ihrer Familie auflehnen, und ihre willige Fantasie überzeugte sie, wenn auch vielleicht nur für den Augenblick, in Fjodor Pawlowitsch trotz seiner Schmarotzerstellung einen der kühnsten, spottlustigsten Männer jener auf alles orientierten Übergangsepoche zu sehen, während er in Wirklichkeit nichts als ein übler Possenreißer war. Das Pikante bestand auch darin, dass die Sache mittels einer Entführung vor sich ging, was für Adelaida Iwanowna einen besonderen Reiz hatte. Und Fjodor Pawlowitsch war damals schon wegen seiner sozialen Stellung zu allen derartigen Streichen bereit; er wünschte leidenschaftlich, Karriere zu machen, ganz gleich mit welchen Mitteln; und sich in eine gute Familie zu drängen und eine Mitgift einzustreichen, das hatte etwas sehr Verlockendes. Gegenseitige Liebe war, wie es scheint, nicht vorhanden, weder auf seiten der Braut noch auf seiner Seite, sogar trotz Adelaida Iwanownas Schönheit. So stand dieser Fall vielleicht einzig da im Leben Fjodor Pawlowitschs, dieses überaus sinnlichen Menschen, der jeden Augenblick bereit war, sich an jeden erstbesten Weiberrock zu hängen, wo immer ihn einer lockte. Trotzdem weckte nur diese eine Frau seine Leidenschaft nicht im geringsten.
Adelaida Iwanowna hatte gleich nach der Entführung erkannt, dass sie für ihren Mann nichts anderes als Verachtung empfinden konnte. So traten die Folgen dieser Heirat außerordentlich rasch zutage. Obwohl sich die Familie ziemlich bald mit dem Geschehenen aussöhnte und der Entflohenen ihre Mitgift auszahlte, begannen die Ehegatten ein ungeordnetes Leben mit ewigen Szenen. Man erzählte sich, die junge Frau habe unvergleichlich mehr Edelmut und Hochherzigkeit bekundet als Fjodor Pawlowitsch, der ihr, wie jetzt bekannt ist, ihr ganzes Geld, etwa fünfundzwanzigtausend Rubel, abnahm, sobald sie es bekommen hatte, sodass die Tausende für sie gleich ins Wasser gefallen waren. Lange Zeit bemühte er sich mit aller Kraft, ein kleines Gut und ein ziemlich gutes Stadthaus, die sie ebenfalls mitbekommen hatte, durch eine entsprechende Urkunde auf seinen Namen übertragen zu lassen. Wahrscheinlich hätte er es auch erreicht, und zwar allein dank der Verachtung und dem Ekel, die seine schamlosen Erpressungen und Betteleien bei seiner Gattin hervorriefen, dank ihrer seelischen Ermüdung und ihrem Wunsch, ihn loszuwerden; zum Glück jedoch schritt die Familie Adelaida Iwanownas ein und setzte der Räuberei eine Grenze. Es war zuverlässig bekannt, dass sich die Eheleute nicht selten schlugen, doch wollte man wissen, dass der aktive Teil nicht Fjodor Pawlowitsch war, sondern Adelaida Iwanowna, eine heißblütige, mutige, ungeduldige, brünette Frau mit bemerkenswerter Kraft. Schließlich verließ sie das Haus und floh mit einem bettelarmen Seminaristen, dem Lehrer Fjodor Pawlowitschs; den dreijährigen Mitja2 ließ sie zurück.
Fjodor Pawlowitsch richtete im Hause sofort einen ganzen Harem ein und ergab sich zügellos der Trunksucht; zwischendurch fuhr er im Gouvernement umher, beklagte sich weinend bei allen und jedem, Adelaida Iwanowna habe ihn verlassen, und erzählte dabei Einzelheiten aus seinem Eheleben, deren er sich als Ehemann eigentlich hätte schämen müssen. Besonders gefiel und schmeichelte es ihm, allen Leuten die lächerliche Rolle des gekränkten Ehemannes vorzuspielen und sogar die Einzelheiten der ihm angetanen Kränkung ausführlich zu schildern. »Man sollte meinen, Ihnen wäre eine Rangerhöhung zuteil geworden, Fjodor Pawlowitsch, so zufrieden sind Sie trotz Ihres Kummers«, sagten Spötter zu ihm. Viele fügten gar hinzu, er spiele gern wieder von neuem die Rolle des Possenreißers und tue, um noch mehr Gelächter zu erregen, absichtlich so, als merke er seine komische Lage gar nicht. Wer weiß, vielleicht war das bei ihm Naivität. Endlich gelang es ihm, die Spur seiner geflohenen Frau zu finden. Die Ärmste war mit ihrem Lehrer nach Petersburg gegangen, wo sie sich schrankenloser Emanzipation hingab. Fjodor Pawlowitsch entwickelte sofort eine geschäftige Tätigkeit und schickte sich an, nach Petersburg zu fahren; wozu, wusste er selbst nicht. Vielleicht wäre er auch wirklich gefahren; doch nachdem er den Entschluss gefasst hatte, sah er es zunächst als sein gutes Recht an, zur Ermutigung vor der Reise erneut maßlos zu trinken. Und eben um diese Zeit erhielt die Familie seiner Gattin die Nachricht, dass sie in Petersburg ganz plötzlich gestorben war, in irgendeiner Dachkammer, dem einen Gerücht zufolge an Typhus, nach einem anderen einfach vor Hunger. Fjodor Pawlowitsch war betrunken, als er vom Tod seiner Gattin erfuhr; er soll auf die Straße gelaufen sein und mit zum Himmel erhobenen Armen voll Freude ausgerufen haben: »Nun lässest du mich in Frieden fahren.« Nach anderen Berichten soll er geweint und geschluchzt haben wie ein Kind, sodass man trotz allen Widerwillens angeblich sogar Mitleid für ihn empfand. Durchaus möglich, dass beides zutraf: dass er sich über seine Befreiung freute und dabei auch seine Befreierin beweinte – alles zugleich. Meistens sind die Menschen, sogar die schlechten, viel naiver und offenherziger, als wir gemeinhin annehmen. Und wir selber auch.
Namensgebung für das Verständnis deutsche Leser: Karamasow ist der Familien- und Alexej der Vorname, wie bei uns. Fjodorowitsch ist der Vatersname (Sohn des Fjodor). Die Anrede erfolgt meist in der Form Alexej Fjodorowitsch. Bei Frauen erfolgt die Bildung des Vatersnamen analog; wenn sie heiraten, nehmen sie den Namen des Mannes an. Die zweite Frau Fjodor Pawlowitschs heißt also Sofja Iwanowna Karamasowna. <<<
Diminutiv von Dmitri <<<
2. Der erste Sohn wird aus dem Haus geschafft
Man kann sich natürlich vorstellen, was für ein Erzieher und Vater so ein Mensch sein musste. Er tat denn auch als Vater, was zu erwarten war, das heißt, er vernachlässigte das Kind vollkommen, nicht aus Hass, auch nicht aus dem Gefühl gekränkten Gattenstolzes, sondern einfach, weil er den Kleinen vergessen hatte. Während er alle Leute mit seinen Tränen und Klagen belästigte und sein Haus in eine Lasterhöhle verwandelte, nahm ein treuer Diener des Hauses mit Namen Grigori den dreijährigen Mitja in seine Obhut, und hätte er nicht für ihn gesorgt, es wäre vielleicht niemandem eingefallen, dem Kind auch nur einmal das Hemd zu wechseln. Außerdem hatte auch die Verwandtschaft mütterlicherseits das Kind in der ersten Zeit beinahe völlig vergessen. Sein Großvater, Herr Miussow selbst, Adelaida Iwanownas Vater, war damals nicht mehr am Leben; seine verwitwete Gattin, Mitjas Großmutter, war nach Moskau verzogen und sehr krank; Adelaida Iwanownas Schwestern hatten sich verheiratet; infolgedessen musste Mitja fast ein ganzes Jahr bei dem Diener Grigori zubringen und bei ihm im Gesindehaus wohnen. Selbst wenn sich der Papa seiner erinnert hätte (seine Existenz konnte ihm ja nicht unbekannt sein), er hätte ihn wieder ins Gesindehaus geschickt, da ihn das Kind bei seinen Ausschweifungen störte. Aber da kehrte ein Vetter der verstorbenen Adelaida Iwanowna, Pjotr Alexandrowitsch Miussow, zurück aus Paris, er lebte später viele Jahre ununterbrochen im Ausland, damals aber war er noch sehr jung. Von den übrigen Miussows unterschied er sich erheblich: Er war aufgeklärt, ein Freund der Großstadt und des Auslandes, dazu zeit seines Lebens ein Anhänger westeuropäischer Ideen und gegen Ende seines Lebens ein Liberaler unserer vierziger und fünfziger Jahre. Während seiner Laufbahn stand er mit vielen Liberalen in Russland und im Ausland in Verbindung; er kannte Proudhon1 und Bakunin2 persönlich und erzählte am Ende seiner Wanderungen besonders gern von den drei Tagen der Pariser Februarrevolution von 1848, wobei er andeutete, dass er sich beinahe selbst auf den Barrikaden an ihr beteiligt habe. Das war für ihn eine der angenehmsten Erinnerungen aus seiner Jugendzeit. Er besaß ein beträchtliches eigenes Vermögen, nach der früheren Zählweise an die tausend Seelen. Sein schönes Gut lag nahe bei unserem Städtchen und grenzte an den Landbesitz unseres berühmten Klosters, mit dem Pjotr Alexandrowitsch schon in sehr jungen Jahren, gleich nachdem er sein Gut geerbt hatte, einen endlosen Prozess begann, um das Recht irgendwelchen Fischfangs im Fluss oder irgendwelchen Holzeinschlags im Wald, genau weiß ich das nicht; einen Prozess mit den »Klerikalen« hielt er sogar für seine Pflicht als Staatsbürger und aufgeklärter Mensch. Nachdem er alles über Adelaida Iwanowna gehört hatte, an die er sich noch erinnerte, weil sie ihm früher einmal aufgefallen war, und nachdem er erfahren hatte, dass Mitja zurückgeblieben war, nahm er sich trotz der jugendlichen Entrüstung und Verachtung, gegenüber Fjodor Pawlowitsch dieser Sache an. Bei diesem Anlass lernte er Fjodor Pawlowitsch zum ersten Mal kennen. Er erklärte ihm ohne Umschweife, er wünsche die Erziehung des Kindes zu übernehmen. Lange Zeit später erzählte er wiederholt folgende charakteristische Episode: Als er begonnen habe, mit Fjodor Pawlowitsch über Mitja zu sprechen, habe jener eine Weile so getan, als verstehe er schlechterdings nicht, von welchem Kind die Rede sei; er habe sogar gestaunt, dass er irgendwo im Hause einen kleinen Sohn besitzen sollte. Pjotr Alexandrowitschs Bericht mag vielleicht übertrieben gewesen sein, etwas Wahrheit enthielt er doch. Aber Fjodor Pawlowitsch verstellte sich in der Tat sein ganzes Leben lang gern, begann plötzlich vor jemand irgendeine unerwartete Rolle zu spielen, und zwar, was besonders hervorgehoben werden muss, manchmal ganz unnötig, sogar zu seinem eigenen Schaden, wie zum Beispiel im vorliegenden Fall. Dieser Charakterzug ist übrigens vielen Menschen eigen, sogar sehr klugen, nicht nur solchen wie Fjodor Pawlowitsch. Pjotr Alexandrowitsch betrieb die Sache mit großem Eifer und wurde zusammen mit Fjodor Pawlowitsch zum Vormund des Kindes berufen, weil er von der Mutter etwas Vermögen geerbt hatte, nämlich das Haus und das Gut. Mitja siedelte denn auch wirklich zu diesem entfernten Onkel über. Eine eigene Familie besaß dieser nicht, und da er es eilig hatte, wieder für lange Zeit nach Paris zu reisen, übergab er das Kind einer entfernten Tante, einer Moskauer Dame, nachdem er die Zusendung von Geld geregelt hatte. So vergaß auch er das Kind, sobald er sich in Paris wieder eingelebt hatte, besonders als jene Februarrevolution ausbrach, die zeit seines Lebens seine Fantasie fesselte. Die Moskauer Dame jedoch starb, und Mitja wurde von einer ihrer verheirateten Töchter übernommen. Später scheint er nochmals, zum vierten Male, sein Nest gewechselt zu haben, doch will ich mich darüber nicht weiter auslassen, zumal von diesem Erstgeborenen Fjodor Pawlowitschs noch viel zu erzählen sein wird. Ich beschränke mich jetzt auf die notwendigsten Nachrichten über ihn, ohne die ich diesen Roman nicht beginnen kann.
Erstens, dieser Dmitri Fjodorowitsch war von den drei Söhnen Fjodor Pawlowitschs der einzige, der in der Überzeugung aufwuchs, er besitze einiges Vermögen und werde nach erreichter Volljährigkeit unabhängig dastehen. Seine Knaben- und Jünglingsjahre verliefen ungeordnet; ohne das Gymnasium beendet zu haben, kam er auf eine Militärschule, wurde dann in den Kaukasus verschlagen, zum Offizier befördert, duellierte sich, wurde degradiert, diente sich wieder empor, führte ein lockeres Leben und verbrauchte verhältnismäßig viel Geld. Und da er von Fjodor Pawlowitsch vor seiner Mündigkeit keins bekam, machte er bis dahin Schulden. Seinen Vater lernte er erst kennen, als er sofort nach Erreichen der Mündigkeit in unsere Stadt kam, um sich mit ihm über sein Vermögen zu einigen. Sein Erzeuger schien ihm damals nicht sonderlich gefallen zu haben; er blieb nicht lange und reiste so bald wie möglich wieder ab, nachdem er etwas Geld erhalten und eine Art Vertrag über die weiteren Einkünfte aus dem Gut mit ihm geschlossen hatte; über dessen Rentabilität und Wert erhielt er jedoch von Fjodor Pawlowitsch keine Auskunft – eine bemerkenswerte Tatsache. Fjodor Pawlowitsch merkte damals sofort – auch das sei festgehalten –, dass Mitja sich von seinem Vermögen eine übertriebene, unrichtige Vorstellung machte. Fjodor Pawlowitsch war damit sehr zufrieden; er hatte seine Pläne. Er sah, dass der junge Mann leichtsinnig, hitzig, leidenschaftlich, ungeduldig und verschwenderisch war. ›Ich brauche ihm‹, sagte er sich, ›nur von Zeit zu Zeit etwas zukommen zu lassen, dann wird er sich sofort beruhigen, wenn auch selbstverständlich nur für eine Weile.‹ Diese Tatsache begann Fjodor Pawlowitsch auszunutzen: Er speiste ihn von Zeit zu Zeit mit kleinen Gaben ab, und das Ende vom Lied war, nach vier Jahren, als Mitja, ungeduldig geworden, zum zweiten Mal im Städtchen erschien, um seine Angelegenheiten mit dem Vater nunmehr endgültig zu ordnen, erfuhr er plötzlich zu seinem größten Erstaunen, dass er bereits nichts mehr besaß, dass sogar eine ordentliche Abrechnung schwierig war, dass er durch die Geldzahlungen nach und nach den ganzen Wert seines Besitztums von Fjodor Pawlowitsch erhalten und womöglich gar schon Schulden gemacht hätte und dass er nach den und den Abmachungen, die dann und dann auf seinen eigenen Wunsch getroffen worden waren, zu keinen weiteren Forderungen berechtigt wäre, und so weiter. Der junge Mann war bestürzt; er vermutete Unrecht und Betrug, geriet außer sich und verlor beinahe den Verstand. Und eben dieser Umstand führte zu der Katastrophe, die der Gegenstand meines ersten, einleitenden Romanes ist oder, richtiger, sein äußerer Rahmen. Bevor ich aber zu diesem Roman komme, muss ich noch von den anderen beiden Söhnen Fjodor Pawlowitschs, Mitjas Brüdern, berichten und etwas zu ihrer Herkunft sagen.
Frz. Sozialist »Eigentum ist Diebstahl«, † 1865 <<<
Russ. Revolutionär, Theoretiker des Anarchismus, † 1876 <<<
3. Die zweite Ehe und die Kinder daraus
Bald nachdem Fjodor Pawlowitsch den vierjährigen Mitja losgeworden war, heiratete er zum zweiten Mal, und diese zweite Ehe dauerte ungefähr acht Jahre. Er holte sich seine zweite, ebenfalls sehr junge Frau, Sofja Iwanowna, aus einem anderen Gouvernement, wohin er mit einem Juden wegen eines kleinen Liefergeschäfts gefahren war. Obgleich Fjodor Pawlowitsch ein Trinker und Wüstling war, beschäftigte er sich nämlich ununterbrochen mit der vorteilhaften Anlage seines Kapitals und brachte seine Geschäftchen immer glücklich, wenn auch fast immer auf betrügerische Weise, zu Ende. Sofja Iwanowna, Tochter eines Diakons, war seit ihrer Kindheit Waise; aufgewachsen war sie im Hause ihrer Wohltäterin, Erzieherin und Peinigerin, einer angesehenen reichen, alten Dame, der Witwe des Generals Worochow. Näheres weiß ich nicht; ich habe nur gehört, dass man die sanfte, gutmütige, fügsame Pflegetochter einmal aus einer Schlinge befreite, die sie an einem Nagel in der Rumpelkammer befestigt hatte – so schwer ertrug sie den Eigensinn und die ewigen Vorwürfe der boshaften Alten, die durch den Müßiggang ein so unausstehlicher Querkopf geworden war. Fjodor Pawlowitsch bewarb sich um die Hand des Mädchens, die alte Frau zog Erkundigungen ein und wies ihm die Tür; und wieder schlug er, wie bei seiner ersten Ehe, eine Entführung vor. Wahrscheinlich hätte sie ihn um keinen Preis geheiratet, wäre ihr rechtzeitig Näheres über ihn bekannt gewesen. Aber er stammte aus einem anderen Gouvernement, und der Verstand des sechzehnjährigen Mädchens reichte nur zu der Überlegung: Lieber in den Fluss gehen als länger bei der Wohltäterin bleiben. So vertauschte sie die Wohltäterin mit einem Wohltäter. Fjodor Pawlowitsch erhielt diesmal keine Kopeke; die Generalin war wütend, gab nichts und verfluchte die beiden. Er hatte auch nicht damit gerechnet, etwas zu bekommen; ihn reizte nur die auffallende Schönheit des Mädchens, vor allem ihr unschuldiger Gesichtsausdruck, der auf ihn, den immer nur lüsternen Liebhaber körperlicher weiblicher Reize, starken Eindruck machte. »Diese unschuldigen Äuglein strichen mir damals wie ein Rasiermesser übers Herz«, sagte er später mit seinem gemeinen hässlichen Kichern. Doch auch das konnte für einen so verdorbenen Menschen nichts anderes als ein sinnlicher Reiz sein. Da er von seiner Heirat keinerlei materiellen Vorteil hatte, machte Fjodor Pawlowitsch mit seiner Frau keine Umstände; sie hatte ihm sozusagen »Schaden gebracht«, und er hatte sie gewissermaßen »aus der Schlinge genommen« – also trat er, ihre unglaubliche Demut und Fügsamkeit ausnutzend, die gewöhnlichsten ehelichen Anstandsregeln geradezu mit Füßen. In seinem Hause feierte er vor den Augen seiner Frau Orgien mit liederlichen Weibern. Als charakteristisch führe ich an, dass sich der Diener Grigori, ein finsterer, dummer, eigensinniger, rechthaberischer Mensch, der die frühere Hausfrau, Adelaida Iwanowna, gehasst hatte, diesmal auf die Seite der Frau stellte und sich ihretwillen mit Fjodor Pawlowitsch für einen Diener fast unerlaubt heftig stritt. Einmal verhinderte er sogar eine Orgie und jagte alle Dirnen gewaltsam aus dem Haus. Später bekam die unglückliche, seit frühester Kindheit verschüchterte junge Frau eine Art nervöse Frauenkrankheit, die am häufigsten beim einfachen Volk, bei Bäuerinnen, vorkommt, die sogenannte »Schreikrankheit«. Infolge dieser mit hysterischen Anfällen verbundenen Krankheit verlor sie zeitweilig sogar den Verstand. Sie gebar jedoch ihrem Mann zwei Söhne, Iwan und Alexej, Iwan im ersten Jahr ihrer Ehe, Alexej drei Jahre später. Als sie starb, war der kleine Alexej noch keine vier Jahre alt, und wenn das auch seltsam ist, ich weiß zuverlässig, dass er sich später sein ganzes Leben an die Mutter erinnerte, natürlich nur wie im Traum. Nach ihrem Tod erging es den beiden Knaben fast ebenso wie dem ersten, Mitja: Der Vater vergaß sie und kümmerte sich nicht im geringsten um sie; sie kamen zu demselben Grigori ins Gesindehaus. Da fand sie auch die alte querköpfige Generalin, die Wohltäterin und Erzieherin ihrer Mutter. Sie war noch am Leben und hatte all die acht Jahre die ihr angetane Kränkung nicht vergessen. Über Sofjas Schicksal hatte sie ständig unterderhand die genauesten Nachrichten erhalten, und als sie hörte, wie krank sie war und unter welchen schlimmen Umständen sie lebte, hatte sie mehrmals zu ihren Kostgängerinnen gesagt: »Das geschieht, ihr recht; das hat ihr Gott zur Strafe für ihre Undankbarkeit geschickt.«
Genau drei Monate nach Sofja Iwanownas Tod erschien die Generalin plötzlich in unserer Stadt und fuhr geradewegs zu Fjodor Pawlowitsch. Sie hielt sich zwar nur ungefähr eine halbe Stunde auf, richtete aber dennoch viel aus. Es war gegen Abend. Fjodor Pawlowitsch, den sie in den acht Jahren nicht gesehen hatte, empfing sie betrunken. Sie soll ihm sofort ohne alle Erklärungen zwei schallende Ohrfeigen versetzt und ihn dreimal an den Haaren fast bis zur Erde gezerrt haben. Dann ging sie, ohne ein Wort zu sagen, in das Gesindehaus zu den Knaben. Da sie auf den ersten Blick sah, dass sie ungewaschen waren und schmutzige Wäsche trugen, verabreichte sie unverzüglich auch noch dem Diener Grigori eine Ohrfeige und erklärte ihm, sie werde die Kinder zu sich nehmen. Darauf nahm sie die beiden, wie sie waren, wickelte sie in eine Decke, setzte sie in den Wagen und fuhr mit ihnen in die Stadt, wo sie wohnte. Grigori ertrug die Ohrfeige wie ein Sklave, wortlos; als er die alte Dame zum Wagen geleitete, verbeugte er sich tief und sagte eindringlich, Gott werde ihr lohnen, was sie an den Waisen tun wolle. »Ein Tölpel bist du trotzdem!« rief ihm die Generalin im Abfahren zu. Fjodor Pawlowitsch fand bei näherer Überlegung die Sache ganz in Ordnung und erhob später bei seinem formellen Einverständnis mit der Erziehung der Kinder durch die Generalin in keinem Punkt Einspruch. Von den Ohrfeigen jedoch erzählte er selbst in der ganzen Stadt.
Bald darauf starb auch die Generalin. In ihrem Testament hatte sie für jeden der Knaben tausend Rubel ausgesetzt; das Geld sollte unter allen Umständen für sie und nur für sie verausgabt werden, »zu ihrer Erziehung«, und zwar so, dass es bis zu ihrer Volljährigkeit reiche; für derartige Kinder reiche ein solches Geschenk vollauf; wenn jemand Lust habe, so möge er selbst seinen Beutel auftun und so weiter, und so weiter. Ich habe das Testament nicht gelesen, weiß aber, dass es wirklich solch eine sonderbare Bestimmung enthielt. Der Haupterbe der Alten, der Adelsmarschall jenes Gouvernements, Jefim Petrowitsch Poljonow, erwies sich allerdings als Ehrenmann. Nach einer langen Korrespondenz mit Fjodor Pawlowitsch musste er einsehen, dass von ihm kein Geld zur Erziehung seiner Kinder zu bekommen war; der Vater weigerte sich zwar nie direkt, zog aber die Sache in die Länge und erging sich höchstens in sentimentalen Redensarten. Also nahm er sich selbst der Kinder an und gewann vor allem Alexej, den jüngeren, lieb; dieser wurde sogar lange Zeit in seiner Familie erzogen. Dies bitte ich von vornherein zu beachten. Wenn die jungen Menschen jemandem für ihre Erziehung und Bildung zu Dank verpflichtet waren, so Jefim Petrowitsch, einem edeldenkenden, humanen Menschen, wie man ihn selten findet. Er ließ die von der Generalin hinterlassenen Summen von je tausend Rubeln unangetastet, sodass sie bei Volljährigkeit der Knaben mit den Zinsen auf je zweitausend angewachsen waren, erzog die Knaben auf seine eigenen Kosten und gab dabei natürlich weit über tausend Rubel für jeden aus. Auf eine ausführliche Schilderung ihrer Kinder- und Jugendzeit verzichte ich wiederum, ich führe nur das Wichtigste an. Iwan entwickelte sich zu einem finsteren, verschlossenen Knaben; er war nicht schüchtern, schien aber schon als Zehnjähriger zu spüren, dass sie in einer fremden Familie aufwuchsen und von fremder Barmherzigkeit lebten und dass sie einen Vater hatten, dessen man sich schämen musste und so weiter, und so weiter. Dieser Knabe zeigte schon in früher Kindheit (wenigstens erzählte man das) ungewöhnliche, glänzende Fähigkeiten. Ich weiß nichts Genaues, jedenfalls verließ er wohl, kaum dreizehnjährig, die Familie Jefim Petrowitschs und kam auf ein Moskauer Gymnasium, wo ein erfahrener, angesehener Pädagoge, ein Jugendfreund Jefim Petrowitschs, ihn in Pension nahm. Iwan selbst erzählte später, all das sei eine Folge von Jefim Petrowitschs »feuriger Begeisterung für gute Taten« gewesen; er habe sich durch die Idee begeistern lassen, ein genial veranlagter Knabe müsse auch einen genialen Erzieher haben. Übrigens waren Jefim Petrowitsch wie auch der geniale Erzieher bereits tot, als der junge Mann nach dem Gymnasium die Universität bezog. Da Jefim Petrowitsch mangelhafte Anordnungen getroffen hatte und die Auszahlung des Geldes der Generalin sich infolge der unvermeidlichen Formalitäten verzögerte, ging es dem jungen Mann in den beiden ersten Universitätsjahren recht schlecht; er musste selbst für seinen Unterhalt sorgen und gleichzeitig studieren. Es sei vermerkt, dass er nicht einmal versuchte, mit seinem Vater in Briefwechsel zu treten – vielleicht aus Stolz oder aus Verachtung, vielleicht auch in der kühlen, gesunden Erkenntnis, dass von seinem werten Papa doch keine ernsthafte Beihilfe zu erwarten war. Wie auch immer, jedenfalls verlor der junge Mann nicht den Kopf und verschaffte sich Arbeit. Zuerst gab er Privatstunden für zwanzig Kopeken, dann lieferte er bei den Zeitungsredaktionen zehnzeilige Artikel über Straßenvorfälle mit der Unterschrift »Ein Augenzeuge« ab. Die kleinen Notizen sollen immer so interessant und pikant abgefasst gewesen sein, dass sie schnell Anklang fanden. Schon hierdurch zeigte der junge Mann seine praktische und geistige Überlegenheit gegenüber den vielen, immer notleidenden und unglücklichen studierenden Jugendlichen beiderlei Geschlechts, die in den Hauptstädten von früh bis spät in die Redaktionen der Zeitungen und Journale laufen und nichts Besseres wissen, als ständig zu betteln, man möge ihnen Übersetzungen aus dem Französischen oder die Anfertigung von Reinschriften übertragen. Einmal mit den Redaktionen bekannt geworden, brach Iwan Fjodorowitsch die Verbindungen nicht wieder ab und ließ in seinen letzten Universitätsjahren talentvolle Rezensionen von allerlei fachwissenschaftlichen Büchern drucken, sodass er sogar in literarischen Kreisen bekannt wurde. Jedoch zog er erst in der allerletzten Zeit, und zwar ganz plötzlich, die Aufmerksamkeit eines größeren Leserkreises auf sich. Ein ziemlich eigenartiger Zufall brachte es mit sich, dass ihn auf einmal viele beachteten und in Erinnerung behielten. Als Iwan Fjodorowitsch eigentlich schon von der Universität abgehen und für seine zweitausend Rubel ins Ausland reisen wollte, veröffentlichte er in einer der größten Zeitungen plötzlich einen sonderbaren Aufsatz, der ihm sogar beim nichtfachmännischen Publikum Beachtung verschaffte. Es war ein Aufsatz über ein Thema, das ihm anscheinend ganz fernlag, da er Naturwissenschaften studiert hatte: die kirchliche Gerichtsbarkeit. Nachdem er einige andere Meinungen geprüft hatte, trug er seine persönliche Ansicht vor. Besonderes Interesse erregten der Ton seiner Arbeit und ihre überraschenden Schlussfolgerungen. Viele Kirchliche hielten den Verfasser für einen ihrer Anhänger, bis ihm auf einmal nicht nur die Verfechter ziviler Gerichtsbarkeit, sondern auch die Atheisten Beifall spendeten. Schließlich erklärten einige besonders scharfsinnige Köpfe, der ganze Aufsatz sei nur eine dreiste Farce und eine Verhöhnung. Ich erwähne das alles, weil der Aufsatz seinerzeit auch in das berühmte Kloster nahe unserer Stadt gelangte und bei dessen Insassen, die sich lebhaft für die Frage der kirchlichen Gerichtsbarkeit interessierten, die größte Verwunderung hervorrief. Als sie dann den Namen des Verfassers erfuhren, erregte es ihr besonderes Interesse, dass er aus unserer Stadt stammte und ein Sohn »eben dieses Fjodor Pawlowitsch« war. Gerade zu dieser Zeit erschien übrigens auch der Verfasser selbst in unserer Stadt.
Warum kam Iwan Fjodorowitsch damals zu uns? Ich habe mir diese Frage, gleichsam beunruhigt schon damals gestellt. Diese verhängnisvolle Ankunft, die vielerlei Folgen hatte, blieb mir noch lange nachher, ja fast immer unklar. Es war schon an und für sich seltsam, dass ein derart gelehrter, stolzer und anscheinend vorsichtiger junger Mann in solch einem Haus erschien, bei einem Vater, der ihn zeit seines Lebens ignoriert hatte, der unter keinen Umständen Geld herausrücken würde, auch wenn er vom eigenen Sohn darum gebeten worden wäre, und der dennoch sein Leben lang fürchtete, seine Söhne Iwan und Alexej könnten einmal kommen und Geld von ihm verlangen. Und siehe da, der junge Mann lässt sich im Haus dieses Vaters nieder, bleibt einen und noch einen Monat bei ihm, und beide leben so gut miteinander, wie man es sich besser nicht vorstellen kann. Das letztere erstaunt mich besonders, und so wie mir ging es vielen. Pjotr Alexandrowitsch Miussow, der entfernte Verwandte Fjodor Pawlowitschs, von dem ich schon gesprochen habe, tauchte damals zufällig wieder bei uns, auf seinem nahe bei der Stadt gelegenen Gut, auf, er war aus Paris, wo er ständig wohnte, zu Besuch gekommen. Ich erinnere mich, dass gerade er sich am allermeisten wunderte, nachdem er den jungen Mann kennengelernt hatte; er interessierte ihn sehr, und nicht ohne innerlichen Schmerz maß er sich manchmal mit ihm im Wissen. »Er ist stolz«, sagte er damals zu uns, »er wird sich stets sein Geld verdienen, hat auch jetzt schon genug zu einer Auslandreise – was will er denn hier? Dass er nicht zu seinem Vater gekommen ist, um Geld zu erbitten, ist klar: Der Vater gibt ihm auf keinen Fall welches. Trinken und Ausschweifungen mag er nicht, und doch kann der Alte nicht mehr ohne ihn leben, so haben sie sich aneinander gewöhnt!« Das war die Wahrheit. Der junge Mann hatte sogar sichtlich Einfluss auf den Alten; ja, dieser begann beinahe schon, auf ihn zu hören, obwohl er mitunter ungewöhnlich und geradezu boshaft eigensinnig war. Bisweilen benahm er sich sogar etwas anständiger…
Erst später stellte sich heraus, dass Iwan Fjodorowitsch teils auf Bitten, teils in Angelegenheiten seines älteren Bruders Dmitri Fjodorowitsch gekommen war. Ihn sah er damals gleichfalls zum ersten Mal, hatte mit ihm aber schon vor seiner Ankunft aus Moskau in einer wichtigen Sache, die mehr Dmitri Fjodorowitsch anging, in Briefwechsel gestanden. Was das für eine Sache war, wird der Leser später ausführlich erfahren. Trotzdem erschien mir, auch als ich diesen Umstand kannte, Iwan Fjodorowitsch noch immer rätselhaft, und sein Besuch blieb mir unerklärlich.
Ich füge noch hinzu, Iwan Fjodorowitsch schien damals zwischen dem Vater und seinem älteren Bruder Dmitri Fjodorowitsch vermitteln zu wollen, denn der letztere hatte sich mit dem Vater zerstritten und sogar einen formellen Prozess gegen ihn angestrengt.
Ich wiederhole, diese kleine Familie war damals zum ersten Mal im Leben vollzählig beisammen, einige von ihnen sahen sich überhaupt zum ersten Mal. Nur der jüngste Sohn, Alexej Fjodorowitsch, lebte bereits ein Jahr bei uns; er war also früher als alle Brüder zu uns gekommen. Über ihn in der einleitenden Erzählung zu sprechen, bevor ich ihn im Roman auf die Bühne bringe, fällt mir besonders schwer. Ich muss aber auch über ihn eine Vorbemerkung machen und vorbereitend einen sonderbaren Punkt erklären; ich bin nämlich genötigt, meinen künftigen Helden gleich in der ersten Szene in der Kutte eines Novizen vorzustellen. Ein Jahr etwa hatte er damals schon in unserm Kloster verbracht, und er bereitete sich, wie es schien, ernstlich darauf vor, sich für das ganze Leben darin einzuschließen.
4. Der dritte Sohn Aljoscha1
Er war damals erst zwanzig Jahre alt; sein Bruder Iwan war im vierundzwanzigsten, ihr ältester Bruder Dmitri im achtundzwanzigsten Lebensjahr. Zuallererst erkläre ich, dieser Aljoscha war ganz und gar kein Fanatiker und ebensowenig ein Mystiker, nach meiner Meinung wenigstens. Ich will von vornherein meine Ansicht rückhaltlos aussprechen. Er war einfach ein jugendlicher Menschenfreund, und wenn er ins Kloster ging, so nur, weil allein dieser Weg zu jener Zeit seine Bewunderung erregte und sich seiner aus der dunklen Schlechtigkeit der Welt zum Licht der Liebe strebenden Seele gewissermaßen als idealer Ausweg anbot. Ihm imponierte dieser Weg nur deswegen, weil er auf ihm einer – wie er meinte – ungewöhnlichen Persönlichkeit begegnet war, unserem berühmten Starez2 Sossima, an den er sich mit der ganzen unersättlichen Leidenschaft der ersten Liebe anschloss. Ich bestreite allerdings nicht, dass er auch damals schon ein sonderbarer Mensch war, eigentlich von der Wiege an. Ich habe bereits erwähnt, dass er sich sein Leben lang an seine Mutter erinnerte, an ihr Gesicht und an ihre Liebkosungen, »ganz als ob sie lebendig vor mir stünde« und das, obwohl sie gestorben war, als er noch nicht vier Jahr alt war. Solche Erinnerungen bleiben bekanntlich aus noch früherer Zeit, aus dem zweiten Lebensjahr sogar, haften, aber sie treten das ganze Leben hindurch nur wie helle Punkte aus dem Dunkel hervor, wie ein abgerissnes Eckchen von einem großen Gemälde, das ganz verblichen und verschwunden ist bis auf dieses Eckchen. Genauso war es bei ihm; er erinnerte sich an einen stillen Sommerabend, an ein geöffnetes Fenster, an die schrägen Strahlen der untergehenden Sonne (die schrägen Strahlen hatte er am deutlichsten im Gedächtnis), an das Heiligenbild, das brennende Lämpchen in der Ecke des Zimmers, davor seine Mutter, sie lag auf Knien und schrie, umschlang ihn mit beiden Armen und drückte ihn an sich, dass es ihm weh tat; dann betete sie für ihn zur Muttergottes, dabei streckte sie ihn mit beiden Händen dem Heiligenbild entgegen, als wollte sie ihn unter den Schutz der Muttergottes stellen, und dann kam plötzlich die Kinderfrau und riss ihn von der Mutter weg. Das war das Bild, das ihm vor Augen stand! Aljoscha wusste auch noch, wie das Gesicht der Mutter in jenem Augenblick ausgesehen hatte: verzückt, aber schön, soweit er sich erinnern könne. Aber nur selten vertraute er jemandem diese Erinnerung an. In seiner Kindheit und seinen Jugendjahren war er wenig mitteilsam, sogar wortkarg, aber nicht aus Schüchternheit und finsterer Menschenscheu, sondern aus einer Art Innerer, rein persönlicher Sorge, die andere Menschen nichts anging, aber für ihn selbst so wichtig war, dass er um ihretwillen die anderen gewissermaßen vergaß. Er liebte die Menschen; er schien ihnen sein ganzes Leben hindurch zu vertrauen, und dabei hielt ihn nie jemand für beschränkt oder naiv. Etwas war in ihm, was nachdrücklich bekundete (auch in seinem ganzen späteren Leben), dass er nicht über die Menschen richten und sie um keinen Preis verdammen wolle. Da er unter keinen Umständen jemand verdammte, schien es sogar, als halte er alles für berechtigt, obgleich er oft tieftraurig war. Mehr noch: in diesem Sinn ging er so weit, dass ihn niemand erstaunen oder erschrecken konnte, und das schon seit seiner frühesten Jugend. Als er mit zwanzig Jahren zu seinem Vater kam und geradezu in eine schmutzige Lasterhöhle geriet, entfernte er sich immer nur schweigend, wenn er in seiner Reinheit etwas nicht mehr mit ansehen konnte, aber ohne das geringste Zeichen von Verachtung oder Verdammung für irgendwen. Sein Vater, der als ehemaliger Kostgänger ein feines Ohr für Beleidigungen besaß, war ihm gegenüber zwar anfangs misstrauisch und mürrisch (»Der schweigt mir zu viel und denkt zu viel im stillen«), ließ das aber bald, schon nach etwa vierzehn Tagen, und begann Ihn schrecklich oft zu umarmen und abzuküssen. Trotz aller Säufertränen und der Betrunkenenrührseligkeit sah man doch, dass er ihn so tief und aufrichtig liebgewonnen hatte, wie es wohl niemand von seinem Schlag gelingen würde.
Alle Menschen liebten diesen Aljoscha; das war so schon von seinen Kinderjahren an. Als er im Hause seines Wohltäters und Erziehers Jefim Petrowitsch Poljonow lebte, nahm er dessen gesamte Familie derart für sich ein, dass man ihn wie ein eigenes Kind behandelte. Und er war so jung in dieses Haus gekommen, dass man bei ihm weder berechnende Schlauheit und Intrigantentum erwarten konnte noch die Kunst, sich einzuschmeicheln und andere zu gewinnen. Die Gabe, sich besondere Zuneigung zu erwerben, war ungekünstelt, unmittelbar, sie machte gleichsam einen Teil seiner Natur aus. Ebenso erging es ihm in der Schule, eigentlich gehörte er doch gerade zu jenen Kindern, die bei ihren Kameraden Misstrauen, manchmal Spottlust, wenn nicht gar Hass erwecken. Er war ein Grübler und sonderte sich oft von den anderen ab. Er zog sich von Kindheit an gern in einen Winkel zurück und las, und trotzdem schätzten ihn seine Kameraden derart, dass man ihn als Liebling aller bezeichnen konnte. Selten war er ausgelassen, selten auch nur lustig; aber alle sahen mit einem Blick, das zeugte durchaus nicht von Missmut, sondern von Ausgeglichenheit und Ruhe. Er wollte sich unter seinen Altersgenossen nicht hervortun und fürchtete sich vielleicht gerade deshalb vor keinem. Die Knaben merkten indes sofort, dass er sich mit seiner Furchtlosigkeit nicht brüstete: Er schien sich seiner Kühnheit und Unerschrockenheit gar nicht bewusst zu sein. Beleidigungen vergaß er rasch. Es kam vor, dass er einem, der ihn gekränkt hatte, nach einer Stunde so vertrauensvoll und ruhig antwortete oder selbst ein Gespräch mit ihm anfing, als wäre überhaupt nichts zwischen ihnen vorgefallen. Nie hatte es in solchen Fällen den Anschein, er hätte die Beleidigung zufällig vergessen oder absichtlich verziehen; er hielt sie einfach nicht für eine Beleidigung, und das besonders entwaffnete die Kameraden und unterwarf sie ihm. Ein Charakterzug aber erregte von der untersten Klasse des Gymnasiums bis zur obersten die Necklust seiner Kameraden, nicht aus Bosheit, sondern weil es sie amüsierte. Das war seine ungekünstelte, fanatische Schamhaftigkeit. Er konnte gewisse Worte und Gespräche über Frauen nicht vertragen, und diese »gewissen« Worte und Gespräche sind in den Schulen leider unausrottbar. Knaben, unverdorben und fast noch Kinder, reden zuweilen in den Klassen ganz laut von Dingen, von denen nicht einmal Soldaten sprechen; ja, die Soldaten wissen und verstehen oft vieles nicht, was auf diesem Gebiet schon den jungen Kindern unserer gebildeten höchsten Gesellschaftskreise bekannt ist. Moralische Verderbtheit braucht das nicht zu sein, auch nicht echter, im Innersten schamloser Zynismus; es ist ein äußerlicher Zynismus, der als interessant oder elegant, als forsch und nachahmenswert gilt. Als die Kameraden sahen, dass sich Aljoschka Karamasow die Ohren zuhielt, sobald sie von »solchen Dingen« zu reden begannen, stellten sie sich manchmal absichtlich dicht um ihn herum, rissen ihm die Hände von den Ohren und schrien die Unanständigkeiten. Aljoscha machte sich frei, ließ sich zu Boden fallen, verbarg sich, ohne ein Wort zu sagen, ohne zu schimpfen: Er ertrug die Beleidigung schweigend. Erst gegen Ende der Schulzeit ließen sie ihn in Ruhe und hänselten »das Mädchen« nicht mehr; sie blickten eher mitleidig auf ihn herab. Übrigens war er, was das Lernen anlangte, einer der Besten, doch niemals ausdrücklich Erster.
Nach Jefim Petrowitschs Tod blieb Aljoscha noch zwei Jahre auf dem Gymnasium der Gouvernementsstadt. Jefim Petrowitschs Witwe begab sich mit der ganzen, nur aus weiblichen Personen bestehenden Familie für längere Zeit nach Italien, und Aljoscha kam in das Haus zweier Damen, entfernter Verwandter Jefim Petrowitschs, die er bis dahin nie gesehen hatte – unter welchen Abmachungen, das wusste er selbst nicht. Ein charakteristischer, sogar sehr charakteristischer Zug an ihm war, dass er sich nie darum kümmerte, auf wessen Kosten er lebte. In diesem Punkt war er das direkte Gegenteil seines älteren Bruders Iwan Fjodorowitsch, der sich die ersten beiden Universitätsjahre kümmerlich durch eigene Arbeit ernährte und es von Kindheit an als bitter empfand, aus der Tasche eines Wohltäters leben zu müssen. Man durfte jedoch diesen seltsamen Zug an Alexejs Charakter nicht allzu streng beurteilen; jeder, der ihn näher kennenlernte, konnte bei einem Gespräch über dieses Thema feststellen, dass Alexej so etwas wie ein »frommer Narr« war. Wäre ihm plötzlich ein Kapital zugefallen, er hätte es sicherlich unbedenklich auf die erste Bitte weggegeben, sei es zu einem guten Zweck, sei es, weil ein geschickter Schwindler ihn darum ersuchte. Überhaupt schien er den Wert des Geldes nicht zu kennen – selbstverständlich meine ich das nicht im buchstäblichen Sinn. Wenn er Taschengeld bekam (worum er niemals bat), so wusste er entweder wochenlang nichts damit anzufangen, oder er ging so erschreckend achtlos damit um, dass es im Nu verschwunden war. Pjotr Alexandrowitsch Miussow, der ein feines Gefühl für Geld und bürgerliche Ehrenhaftigkeit besaß, sagte später einmal über Alexej: »Er ist vielleicht der einzige Mensch auf der Welt, der, plötzlich allein und ohne Geld auf einen Platz in einer fremden Millionenstadt verschlagen, bestimmt nicht umkommen würde. Man würde ihm sofort Nahrung und Unterkunft gewähren; täten es die Leute nicht von allein, würde er sich selbst bei jemand unterbringen, was ihn nicht die geringste Überwindung kosten und keine Erniedrigung für ihn bedeuten würde. Und, die ihn aufnähmen, wurden das nicht als Last, sondern im Gegenteil vielleicht als Vergnügen empfinden.«
Das Gymnasium beendete er nicht; es fehlte ihm noch ein ganzes Jahr, als er den Damen auf einmal erklärte, er wolle zu seinem Vater fahren: in einer Angelegenheit, die ihm eingefallen sei. Den Damen tat das leid, sie wollten ihn gar nicht weglassen. Die Fahrt kostete nur wenig, und die Damen erlaubten ihm nicht, seine Uhr, die ihm die Familie seines Wohltäters vor ihrer Abreise ins Ausland geschenkt hatte, zu versetzen. Sie statteten ihn reichlich mit Geld aus, versorgten ihn sogar mit neuen Kleidern und neuer Wäsche. Die Hälfte des Geldes gab er ihnen jedoch mit der Erklärung zurück, er wollte unbedingt dritter Klasse fahren. Nach der Ankunft in unserem Städtchen gab er seinem Vater auf die Frage, warum er eigentlich vor Abschluss des Gymnasiums gekommen sei, überhaupt keine Antwort; er war nur ungewöhnlich nachdenklich. Bald stellte sich heraus, dass er das Grab seiner Mutter suchte. Er gab damals sogar selber zu, nur deshalb gekommen zu sein. Aber das dürfte schwerlich der einzige Grund gewesen sein. Wahrscheinlich wusste er selbst nicht, was plötzlich in seiner Seele erwacht war und ihn unwiderstehlich auf einen neuen, unbekannten, aber schon unvermeidlichen Weg zog. Fjodor Pawlowitsch konnte ihm nicht zeigen, wo seine zweite Frau begraben lag; er war nicht wieder an ihrem Grab gewesen, seit man den Sarg zugeschüttet hatte, und während der vielen dazwischenliegenden Jahre hatte er völlig vergessen, wo sie beerdigt worden war.
Bei dieser Gelegenheit noch ein paar Worte über Fjodor Pawlowitsch. Er hatte vor Aljoschas Ankunft lange nicht in unserer Stadt gelebt. Drei oder vier Jahre nach dem Tode seiner zweiten Frau war er nach Südrussland gegangen, zuletzt nach Odessa, wo er mehrere Jahre verbrachte. Anfangs hatte er dort, wie er sich ausdrückte, »viele Juden und Jüdchen« kennengelernt, und zuletzt war er nicht nur »bei Juden, sondern auch bei den Hebräern ein und aus gegangen«. Es ist anzunehmen, dass er sich in dieser Periode seines Lebens die besondere Kunst zu eigen machte, Geld zusammenzuscharren, indem er es anderen Leuten abgaunerte. Erst drei Jahre vor Aljoschas Ankunft kehrte er für immer in unser Städtchen zurück. Seine früheren Bekannten fanden ihn sehr gealtert, obgleich er durchaus noch nicht alt war. Er benahm sich aber keineswegs anständiger, sondern noch schamloser als früher. So zeigte sich zum Beispiel bei dem früheren Possenreißer das Bedürfnis, sich andere als Possenreißer zu halten. Bei den Weibern verhielt er sich nicht wie früher nur schamlos, sondern geradezu widerwärtig. Binnen kurzem eröffnete er zahlreiche neue Schenken in unserem Kreis. Er musste an die hunderttausend Rubel besitzen, jedenfalls nicht viel weniger. Viele Einwohner der Stadt und des Kreises wurden alsbald seine Schuldner, selbstverständlich nur gegen vollkommen sichere Pfänder. In der allerletzten Zeit bekam er ein aufgedunsenes Aussehen, er büßte seine Selbstsicherheit und Gleichförmigkeit ein und wurde irgendwie leichtfertig. So fing er das eine an, um bei etwas anderem zu enden, änderte unversehens seine Absichten und betrank sich immer häufiger. Hätte der Diener Grigori, der zu dieser Zeit ebenfalls schon ziemlich gealtert war, ihn nicht manchmal fast wie ein Erzieher beaufsichtigt, wäre Fjodor Pawlowitsch wohl in arge Unannehmlichkeiten geraten. Aljoschas Ankunft hatte auf ihn sogar eine moralische Wirkung, so als wäre in diesem früh vergreisten Menschen etwas erwacht, was lange betäubt in seiner Seele gelegen hatte. »Weißt du«, sagte er oft zu Aljoscha und starrte ihn dabei an, »dass du mit ihr, mit der Schreierin, große Ähnlichkeit hast?« (So nannte er seine verstorbene Frau, Aljoschas Mutter.) Ihr Grab zeigte Aljoscha schließlich der Diener Grigori. Er führte ihn in einen abgelegenen Winkel des städtischen Friedhofs und zeigte ihm eine Platte aus Gußeisen, nicht kostbar, aber sauber gearbeitet, mit Namen und Stand, Alter und Todesjahr der Verstorbenen; darunter stand ein vierzeiliger Vers: altertümliche Kirchhofspoesie, wie sie auf Gräbern von Leuten des Mittelstandes üblich ist. Zu Aljoschas Verwunderung war diese Platte eine Stiftung Grigoris. Er hatte sie auf eigne Kosten auf dem Grab der armen »Schreierin« anbringen lassen, nachdem Fjodor Pawlowitsch, dem er mehrfach mit Vorhaltungen wegen des Grabes zugesetzt hatte, nach Odessa gereist war und mit anderen Erinnerungen an die Vergangenheit auch den Gedanken an die Gräber getilgt hatte. Aljoscha zeigte sich am Grabe seiner Mutter nicht besonders empfindsam; er hörte sich Grigoris würdigen und gesetzten Bericht über das Anbringen der Platte an, stand ein Weilchen mit gesenktem Kopf und ging dann, ohne ein Wort gesagt zu haben. Seitdem war er vielleicht ein Jahr lang nicht mehr auf dem Friedhof gewesen. Auf Fjodor Pawlowitsch aber übte auch dieser kleine Vorfall seine Wirkung aus, und zwar eine sehr eigentümliche. Er nahm auf einmal tausend Rubel und brachte sie in unser Kloster: für Seelenmessen für seine Gattin – aber nicht für Aljoschas Mutter, die »Schreierin«, sondern für die erste, Adelaida Iwanowna, die ihn geprügelt hatte. Am Abend jenes Tages betrank er sich und schimpfte vor Aljoscha auf die Mönche. Er selbst war alles andere als ein religiöser Mensch; wahrscheinlich hatte er noch nie im Leben auch nur eine Fünfkopekenkerze vor einem Heiligenbild aufgestellt. Solche Typen haben eben mitunter sonderbare Gefühlsausbrüche und unvermittelte Einfälle.
Ich habe bereits gesagt, dass er sehr aufgedunsen war. Sein Gesicht war ein unbestechlicher Zeuge für die Art und den Inhalt seines bisherigen Lebens. Außer den langen, fleischigen Säckchen unter den ewig frechen, misstrauischen und spöttischen kleinen Augen, außer den vielen und tiefen Runzeln auf seinem kleinen fetten Gesicht war da unter seinem spitzigen Kinn noch ein zweites, dick und lang wie ein Geldbeutel, was ihm ein widerliches, lüsternes Aussehen verlieh. Dazu kam noch der breite, sinnliche Mund mit den dicken Lippen, hinter denen die fast verfaulten Zähne als ganz kleine Stummel sichtbar wurden. Wenn er zu reden anfing, spritzte ihm der Speichel aus dem Mund. Übrigens machte er auch selbst gern Witze über sein Gesicht, obgleich er damit ganz zufrieden war, glaube ich. Besonders gern wies er auf seine Nase hin, die mittelgroß, sehr schmal und stark gekrümmt war. »Eine echte Römernase«, sagte er, »zusammen mit dem Doppelkinn das typische Abbild eines alten römischen Patriziers aus der Zeit des Verfalls.« Darauf war er offenbar stolz.
Kurz nachdem er das Grab seiner Mutter gefunden hatte, erklärte Aljoscha dem Vater, er wolle in das Kloster eintreten, und die Mönche seien bereit, ihn als Novizen aufzunehmen. Dies sei sein innigster Wunsch, und er bitte ihn als Vater um die förmliche Erlaubnis. Der Vater wusste bereits, dass der Starez Sossima, der zurückgezogen in der Einsiedelei des Klosters lebte, seinen »stillen Jungen« besonders beeindruckt hatte.