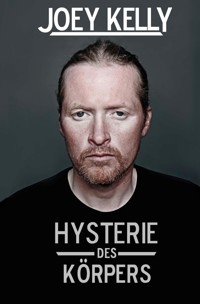Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: National Geographic Deutschland
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Ganz ohne Geld? Ein extremes Reiseabenteuer. Joey Kelly und seinen Sohn Luke unterwegs ohne Geld mit einem alten VW T1 von Berlin über das Baltikum, die Weiten Russlands, Kasachstans und der Mongolei bis nach Peking. Der T1 war das erste Fahrzeug der großen Kelly-Family und ist für Joey Kelly Das schönste Auto der Welt. Erleben Sie eine wunderbare Geschichte von Vater und Sohn über Mut und Ideenreichtum, über Mitmenschlichkeit und Gastfreundschaft und tauchen Sie ein in neue, unerzählte Geschichten aus der großen Zeit der Künstlerfamilie, entlang der Route nach Peking. Ob die beiden wirklich ankommen? Lesen Sie selbst!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
»Das ganze Leben ist ein Marathon«
Joey Kelly
Joey & Luke Kelly
BULLI CHALLENGE
VON BERLIN NACH PEKING
Aufgezeichnet vonRalf Hermersdorfer
Fotografiert vonThomas Stachelhaus
DAS FUNDSTÜCK
1BERLIN DANZIG
2DANZIG MOSKAU
3MOSKAU IRKUTSK
4IRKUTSK PEKING
DAS VERSPRECHEN
Es war arschkalt da draußen, Minusgrade. Wir spielten mitten in Paris auf der Straße, am Bahnhof. Wenn es regnete, sind wir rein, dort, wo die Leute zu den Zügen hetzen, direkt in den Tunnel, da wo es zu den Gleisen geht.
Und wenn wir Pause hatten, schaute ich mir immer die Züge an. Da stand der weltberühmte Orient-Express, auf den eingehangenen Schildern in den Türen stand: Paris - Bukarest.
Wenn ich durch die Fenster sah, konnte ich die erste Klasse bestaunen, das war alles aus Plüsch. Es standen Kellner im Frack herum, mit versteinertem Blick und weißen Handschuhen, es gab eine Bar mit Kristallleuchtern, in der Küche wurden Drei-Gänge-Menüs gezaubert. Die Leute, die sich das leisten konnten, hatten eine eigene Kabine, für mich so groß wie eine Präsidentensuite.
Die Wohlbetuchten waren nur zwei, drei Wochen unterwegs, fuhren mit abgekoppelten Waggons bis nach Moskau, dann weiter über tausende Kilometer durch ganz Russland bis in den fernen Osten. Das fand ich als Neunjähriger unglaublich faszinierend, wie ein Zug ununterbrochen fahren kann und dann mitten in der Nacht an irgendeinem Bahnhof in Wien, Warschau oder Irkutsk hält. Städte, die ich lediglich vom Namen her kannte und auch nie im Leben sehen würde.
Und genau zu dieser Zeit sah ich den Film »Doktor Schiwago«. Mit meinen Geschwistern durften wir einmal die Woche ins Kino gehen, und diesen Film habe ich regelrecht eingesaugt. Da gibt es mehrere Szenen, wo die Transsibirische Eisenbahn mitten durch das tiefste Sibirien fährt. Und dann sah ich am nächsten Tag diese übermächtige Stahlmaschine leibhaftig vor mir, dampfend mit einem unheimlichen Beben auf dem Gleisbett, bereit, in die unendliche Welt hinauszufahren, die Zeit überspringend, Länder vereinnahmend, ohne Pause mit einer gleichmütigen Geschwindigkeit die unglaubliche Entfernung abspulend. Ich war wie verzaubert, alle Szenen spielten sich ab wie von meinem eigenen Drehbuch inszeniert. Und ich selbst war der große Doktor Schiwago.
Ich habe mir in diesem Moment geschworen: Wenn ich groß bin, fahre ich auch dahin.
Irgendwie.
DAS FUNDSTÜCK
»Es ist noch keine zwei Jahre her, da finde ich ihn. Wie aus dem Nichts heraus taucht er plötzlich auf.«
In der Nähe von Köln gibt es eine total heruntergekommene Tankstelle aus dem letzten Jahrhundert, wo kreuz und quer Gebrauchtwagen, die von unzähligen Jahreszeiten gepeinigt sind und die keiner mehr haben will, zum Verkauf herumstehen.
Eigentlich macht es keinen Sinn, da herumzuschlendern, außer man hat Langeweile. Die habe ich tatsächlich eines Tages und halte einfach mal ganz spontan an. Ich bin noch keine fünf Minuten beim Begutachten der überteuerten Schrottkisten, da denke ich, mich tritt ein Pferd: Ganz hinten auf dem Hof, am Drahtzaun, eingequetscht zwischen einem Mazda und einem Ford Kuga, steht ein alter T1, und zwar nicht irgendeiner, sondern ein Samba, das Sondermodell mit fünfzehn Fenstern und einer Seitenschiebetür. Optisch macht der VW-Bulli einen völlig abgerockten Eindruck, der komplette Innenraum ist zugemüllt, sechs Reifen liegen drin und unzählige, ausgebaute Ersatzteile wie Lichtmaschinen, Anlasser und sogar Lampen von dem Nachfolgemodell. Die platten Reifen sind bilderbuchmäßig von Unkraut umrankt.
Einen T1 im Originalzustand zu bekommen ist heutzutage fast aussichtslos. Man kann zwar über diverse Internetportale einen fertig restaurierten Bulli kaufen, aber da werden astronomische Preise aufgerufen. Es gibt Wahnsinnige, die zahlen bis zu hunderttausend Euro dafür. Und nun finde ich durch einen irren Zufall einen Samba, das gleiche Teil, in dem ich als Kind auf der Pritsche hockend groß geworden bin, mit dem wir Kellys damals als unseren ersten Tourbus durch die Welt tuckerten. Seit Jahren schon bin ich auf der Suche danach, weil dieses Auto meine Erinnerungen an eine unbeschwerte Zeit weckt. Es gibt einem dieses sonnige Gefühl der grenzenlosen Freiheit, einfach jeder strahlt, der im Vorbeifahren so einen Bulli sieht, auch wenn er selbst nicht am Lenker sitzt.
Nach einem kurzen Schwatz mit dem Autohändler halte ich den Fahrzeugschein in der Hand: eine 1,3-Liter-Maschine mit 44 PS, gebaut im April 1967, also von der absolut letzten Baureihe. Es ist ein originales deutsches Auto, kein Import aus den USA oder Brasilien. Der T1 gehört dem Ex-Schwiegervater des Verkäufers, stand wohl über zwanzig Jahre lang in der Scheune und sollte irgendwann mal aufgebaut werden. Und genau das werde ich mit diesem Bulli machen.
Zwei Wochen und diverse Überredungskünste später habe ich den Autohändler soweit: Er gibt mir den Bulli für fünfzehntausend Euro, ich lege noch zwei teure Rennräder und kostenlose VIP-Tickets für ein »Kelly«-Konzert obendrauf und der Bulli steht endlich bei mir in der Scheune.
Alles ist da, es fehlt eigentlich nichts. Mit meinem Sohn Luke räumen wir den ganzen Kram aus dem Innenraum raus, sortieren die Ersatzteile und begutachten die gesamte Karosserie von oben und unten. Dann widme ich mich dem Motor: Er ist nicht fest, ich ziehe am Keilriemen und er läßt sich manuell drehen, Öl ist auch noch drin, auch wenn es eine tiefschwarze Farbe hat. Schon mal ein gutes Zeichen, dann hat er auf keinen Fall einen Kolbenfresser. Ich versuche jetzt einfach mal, das Ding zum Laufen zu kriegen.
Der Tank ist leer, wir schütten ein paar Liter Benzin rein, als nächstes schaue ich mir den Filter an, der muss raus, da kommt vor lauter Dreck kein Tropfen mehr durch. Ich klemme eine neue Batterie an, die Zündkerzen funktionieren noch, was der Verteiler durch ein kurzes Klicken bestätigt. Mein Herz schlägt immer schneller. Sollte die Kiste wirklich anspringen?
Ich schwinge mich auf den Fahrersitz, stecke den Schlüssel in die Zündung und atme tief durch. Ein fester Tritt auf das Gaspedal, damit der Vergaser vorab auch ordentlich Nahrung kriegt, dann drehe ich den Schlüssel zackig um. Erst spüre ich jenes feine Schütteln, wie sich kurz die Kolben trocken hoch und runter schrauben, dann explodiert das Benzin im Motorblock. Und auf einmal höre ich dieses knurrige Grollen, diesen vertrauten Rhythmus in zwei Takten. Nicht zu fassen, nach über zwanzig Jahren springt der Bulli einfach an!
Vor lauter Euphorie drehe ich spontan eine Runde über den Hof, mein Sohn hüpft im Vollsprint bei laufender Fahrt mit rein, knallt die Beifahrertür zu und strahlt mich über das ganze Gesicht an.
Als der Motor wieder schweigt, weiß ich: Mit diesem Bulli fahren wir nach Peking.
Der Bulli der Kelly Family
Für uns Kinder war das Leben ein einziges Abenteuer, mit 36 Pferdestärken durch halb Europa unterwegs, wie ein nie enden wollender Urlaub. Wir hatten keine Verantwortung, mussten uns um nichts kümmern, wir haben einfach nur gesungen. Und das jeden Tag in einer anderen Stadt, ohne zu wissen, wo wir vielleicht morgen sind.
Der Volkswagen-Bulli war unser erster Tourbus. 1975 kaufte mein Vater einen gebrauchten VW T1 in Spanien, der war eigentlich schon völlig hinüber.
Wir waren damals neun Geschwister: Daniel, Karolin, Paul, Kathy, Johnny, Patricia, Jimmy, Barbie und ich. Mein Vater saß am Steuer, meine Mutter war Beifahrerin, mit der kleinen Barbie auf dem Schoß. Ich saß zwischen meinen Eltern und hinter uns ein wirrer Haufen von sieben Kindern übereinander.
Am Anfang waren noch zwei Rückbänke drin, aber weil über die Jahre ständig mehr Kinderkonkurrenz dazu kam, hat mein Vater die Teile einfach rausgerissen und rote Stahlkästen zum Sitzen eingebaut, die konnten wir praktischer Weise auch gleich als Stauraum nutzen. So hockten wir Kids dann während der Fahrt wie an einem runden Tisch. Der Dachgepäckträger war mit unserem ganzen Hausrat beladen, in wasserdichten Kisten das Essen, Klamotten, Kostüme für die Aufritte, die Instrumente für alle Kinder, ganz hinten das Schlagzeug und dann noch oben drauf ein paar Fahrräder.
Wenn es dunkel wurde, hielten meine Eltern Ausschau nach einem passablen Rastplatz. Dann ging alles ganz schnell: Eine riesige Plane aus Plastik direkt auf der Straße neben dem Bus ausgebreitet, dann alle Jungs draufgelegt und noch eine große Plane über uns alle drüber geworfen. Und drinnen im Bus hat meine Mutter mit den Kleinkindern und Mädchen geschlafen.
Wie das meine Mutter alles hinbekommen hat, ist mir bis heute ein Rätsel. Das plärrende Gewusel von uns Kindern, zwei bis drei kleine Babys, die ständig die Hosen voll hatten, da war eigentlich immer Alarm. Wir hatten in dem T1 ein mobiles Elektrofeld, so ein Billigteil mit zwei Platten. Unsere Mutter packte nach dem Sonnenaufgang ihre einzigen drei Töpfe aus, die sie hatte, machte erstmal für alle Müsli und kochte dann für den ganzen Tag vor: Linsen, Bohnen oder Irish Stew. Das waren die drei Gerichte, mit denen wir groß geworden sind. Klingt im Nachhinein nicht wirklich abwechslungsreich, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals gehungert haben.
Wir fuhren von Spanien bis nach Rom, drei Wochen brauchten wir bis nach Wien. Meine ältere Schwester nahm dort bei einem Geigenlehrer Privatunterricht und der Rest der Truppe spielte den lieben langen Tag in der Fußgängerzone. Auch wenn wir richtig schief gesungen haben, sind wir stets so aufgetreten, als wären wir total wichtig, obwohl keiner den Rhythmus halten konnte. Und trotzdem fanden es die Leute so faszinierend, dass da eine Großfamilie gemeinsam musiziert. Dieses grenzenlose Mitleid – das war damals unser größter Profit.
Eines Tages sah uns dort Bernhard Paul, der Chef vom Zirkus »Roncalli«. Er sprach meinen Vater an, ob wir nicht Lust hätten, mit unseren Liedern in seinem Zirkus aufzutreten, statt bei Wind und Wetter auf der Straße rumzustehen. Schon am nächsten Tag parkten wir unseren T1 hinterm Zirkuszelt. Für uns Kinder war das der absolute Wahnsinn. Da konnte man Elefanten, Tiger und Affen sehen, tollpatschige Clowns und muskulöse Akrobaten, die sich gegenseitig durch die Luft wirbelten. Es war für uns die größte Show der Welt.
Nach einem Jahr hatte mein Vater wieder eine ganz neue Idee: Er wollte nach Irland, in seine alte Heimat, wo wir alle unsere Wurzeln haben. Wir schifften uns mit dem T1 auf die Fähre nach Dover ein und in London versuchten wir es wieder auf der Straße. Da verdienten wir so wenig, dass wir am Ende in einem Obdachlosenheim landeten. Das verlängerten wir dann nicht unnötig, auch weil meine Mutter zu der Zeit mit Paddy hochschwanger war. Also zogen wir weiter nach Irland.
Unser Bulli befand sich mittlerweile in einem katastrophalen Zustand, die Bremsen waren komplett runtergeschliffen, so dass mein Vater parallel zum Fußpedal immer die Handbremse mit hochreißen musste. Eigentlich lebensgefährlich. Einmal wurden wir von einem Autofahrer überholt, der wie ein Wahnsinniger hupte und nur nach hinten zeigte. Da drehte sich mein Vater um und sah, wie es hinten raucht. Aber nicht nur ein bisschen, sondern es qualmte richtig. Wir rechts ran, mein Vater nach hinten, macht die Haube auf, da schießen Flammen aus dem Motorraum. Cleverer Weise hatten wir noch nie einen Feuerlöscher im Auto. Meine Mutter hat dann in voller Panik meinem Vater zwei Milchflaschen von uns Kids gegeben und er schüttete die Pullen direkt in den Motor rein. Die Flammen waren gelöscht und fünf Minuten später ging es weiter.
Wahrscheinlich gab es ein Leck im Tank und ein paar Tropfen Benzin hatten sich entzündet, denn der Tank vom T1 liegt gleich hinter dem Motor, ohne Zwischenwand. Vierzig Liter Benzin passen da rein, selbst wenn der Tank nur halb voll ist, kann man sich ausmalen, wenn das Ding explodiert wäre.
Da hätte es nie auch nur einen einzigen »Kelly«-Hit gegeben.
Später auf den Straßen von Dublin waren wir tatsächlich erfolgreicher, wir traten sogar das erste Mal in einer TV-Show auf. Es gab zu dieser Zeit nur zwei Programme und dadurch kannte uns am nächsten Tag jeder Ire. Von unserem kleinen, kurzen Ruhm völlig beseelt, nahmen wir mit ein paar Mikros unsere gängigsten Straßen-Songs auf. Damit hatten wir unsere erste eigene Kassette. Auf dem Cover posiert unsere Großfamilie, darunter der T1. Als mein Vater diese erste Edition fertig gebastelt hatte, malte er noch ganz bescheiden drauf: »Tours Europe«.
Paddy war geboren und Polizist Matt, ein Freund von meinem Vater, empfahl uns, mit dem erhöhten Kinderaufkommen mal über ein größeres Gefährt nachzudenken. Zum Beispiel über ausrangierte Stadtbusse, die konnte man im guten Zustand für wirklich kleines Geld bekommen. So kaufte mein Vater für tausend Pfund einen »Bristol Lodekka« – den ersten Doppeldeckerbus der »Kelly Family«.
Ich weiß noch, wie mein Daddy mit diesem London-Bus abends auf unseren Campingplatz rauschte, mit kompletter Festbeleuchtung. Wir Kinder rannten schreiend darauf zu, weil wir sofort wussten, das ist jetzt unser neuer Tourbus. Mein Vater hielt an, alle johlend rein und gleich hoch in die erste Etage, jeder sicherte sich sofort seinen eigenen Platz. Der Bus war für uns Kinder so groß wie ein Hochhaus, wir wussten vor Schreck gar nicht wohin. Von diesem Moment an war der alte T1 vergessen.
Meine Mutter war eigentlich eine ausgebildete Balletttänzerin, bevor mein Vater mit ihr acht Kinder in die Welt gesetzt hat. Und nun sollten die Großen, nämlich Kathy, Johnny, Patricia und Paul, für ein halbes Jahr Ballettunterricht nehmen. Dafür ging es extra nach Stuttgart, zu der berühmten Ballettschule von John Cranko.
Wir reisten natürlich mit dem London-Bus, unserem großen, neuen Zuhause. Von dem T1 wollte keiner mehr etwas wissen, der sollte aber unbedingt mit. Deshalb musste Polizist Matt den Bulli nach Deutschland fahren, weil mein Vater als einziger von unserer Familie einen Führerschein hatte. Den T1 wollten wir dann vor Ort für unser kleines »SWAT«-Team nutzen, so haben wir es genannt, nach den Jungs aus der TV-Serie »Die knallharten Fünf«, die sich als Spezialeinheit der Polizei durch Kalifornien drängelten. Nicht in jede Stadt kam man ohne Probleme mit dem Londoner Bus rein, und wenn wir den dann auf dem Campingplatz stehen lassen mussten, sind wir einfach mit dem Bulli als »SWAT«-Team in die Städte rein und wieder raus.
Wenn meine großen Geschwister in Stuttgart nicht an der Ballettstange herum hopsten, nutzten wir die Zeit zum Geld verdienen. Wir waren jedes Wochenende in ganz Baden-Württemberg unterwegs. Eines Tages holte uns auf dem Weg zum einem Straßenfest die Polizei mit dem Bulli raus. Die dachten, die fallen vom Glauben ab. Der Bus war bis unter das Dach vollgepackt, und dann hüpften da noch zehn Kinder raus, eines nach dem anderen. Wir mussten direkt mit zum Polizeirevier, dort stellten wir uns alle schön nebeneinander vor den Bulli für ein Beweisfoto, wie viele Personen da reinpassen können. So etwas hatten die Polizisten in ihrem ganzen Leben noch nie gesehen.