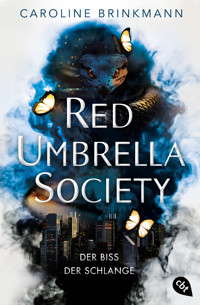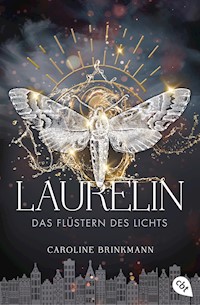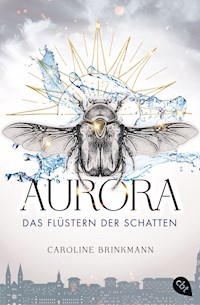12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Tokito – Stadt aus Blut und Schatten In der Megastadt Tokito herrscht das Gesetz der Clans. Nur wer für einen der sechs Clanfürsten arbeitet, hat die Chance zu überleben. Die rebellische Erin hat ihren Job beim Lotusclan verloren und ist nun schutzlos. Als sie auf der Straße verschleppt wird, lässt sie sich auf einen Deal mit einem Dämon ein, um ihr Leben zu retten. Der Dämon verleiht ihr übernatürliche Kraft, versucht aber auch, die Kontrolle über Erin zu erlangen. Als eine Mordserie Tokito erschüttert und Erins beste Freundin Ryanne verschwindet, setzt Erin alles daran, den Mörder zu finden. Aber ist es wirklich bloß ein Wahnsinniger, den sie jagt? Oder ist sie einer gefährlichen Verschwörung auf der Spur? Und was für ein Spiel bei all dem spielt ihr Dämon?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Sechs Clans gibt es in Tokito: den Lotusclan mit seinen verführerischen Geishas; die wissbegierigen Rabenkrieger; den Amphibienclan mit seinen Künstlern und Handwerkern; die Streuner, die Dieben und Bettlern Zuflucht gewähren; den wilden Affenclan und die Heiler der weißen Hand – sie alle schützen die ihren, solange man für sie arbeitet. Ohne Clan ist man schutzlos, vogelfrei für die Kriminellen dieser Stadt. Erin hat gerade ihren Job verloren, schon wird sie auf der Straße verschleppt. Um ihr Leben zu retten, geht sie einen Deal mit einem Dämon ein und wird dadurch zur Besessenen. Die Verbindung verleiht ihr übernatürliche Kraft. Allerdings hat sie auch ihren Preis. Als eine Mordserie Tokito erschüttert, gerät Erin ins Visier des Ermittlers Kiran, der Besessene jagt. Doch ausgerechnet die beiden erbitterten Feinde müssen zusammenarbeiten, wenn sie den Mörder aufhalten wollen ...
Für meine Familie.Weil Liebe die Antwort ist.
Liebeund natürlich 42 …
1
ERIN RIDER
Ich blühe im Schatten.
Es war der Moment, auf den ich gewartet hatte. Ein Methanwal schob seinen gigantischen, aufgedunsenen Körper durch die Smogwolke und tauchte hinab. Er öffnete sein Maul und zog die verseuchte Luft ein, um sie zu filtern. Lautlos glitt er durch die neonfarbenen Buchstaben, die in den Himmel projiziert wurden.
TOKITO.
Als würde man den Namen der Megametropole, in der wir lebten, je vergessen können.
Ich kauerte schon seit einer Stunde auf dem Dach. Der Lärm der belebten Straßen drang zu mir empor, doch ich hatte den Kopf in den Nacken gelegt und starrte in den trüben Himmel. Wolken und Smog überall. Und zwischen ihnen der fliegende Gasriese.
Fast streifte sein Bauch die Dächer der Hochhäuser. Er war zum Greifen nah. Allerdings hatte noch niemand, den ich kannte, einen Wal berührt, denn sie waren trotz ihres massiven Körpers schnell und schienen eine Art siebten Sinn zu haben. Es war quasi unmöglich, sie zu überraschen. Trotzdem juckte es mich in den Fingern. Vielleicht war es für eine Siebzehnjährige albern, einem Methanwal aufzulauern. Aber meiner Meinung nach gab es keine Altersgrenze für verrückte Vorhaben.
Ich mochte vielleicht keinen Methanwal-Sinn haben, aber ich hatte die Reflexe einer Katze. Sagte Mikko jedenfalls.
Ich hielt die Luft an und wagte nicht, mich zu bewegen. Mein Blick war fest auf den Gasriesen gerichtet, der über mir seine Kreise zog. Erneut senkte sich sein Körper auf das Hochhaus zu. In Gedanken zählte ich rückwärts. Drei. Die Wolken teilten sich und machten Platz für seinen massigen Körper. Zwei. Ich spürte den Luftzug. Eins. Jetzt oder nie.
Ich sprintete los.
Der Methanwal kippte zur Seite, doch ich hielt Kurs, streckte meinen Arm und sprang. Meine Finger schossen auf seinen Bauch zu. Er war aus tiefem, dunklem Blau, das fast in Schwarz überging. Wie in Zeitlupe flog ich auf seinen Körper zu, immer näher, bis meine Fingerkuppen seine Haut streiften. Sie war nicht kalt und ledrig, wie ich erwartet hatte. Sondern warm und weich wie eine Dampfnudel.
Viel zu schnell war der Moment vorbei und ich fiel zurück auf das Hochhausdach. Als meine Füße den Boden berührten, verzogen sich meine Lippen zu einem triumphierenden Grinsen.
Ich hatte es geschafft! Ich hatte einen Methanwal berührt. Wenn ich das Mikko erzählen würde. Er würde vor Neid erblassen.
Zufrieden legte ich den Kopf in den Nacken und sah ein letztes Mal in den Himmel, wo der Wal zwischen den Wolken verschwand. Fast glaubte ich, er wollte, dass ich ihn berühre. So als hätte er gewusst, wie sehr ich Aufmunterung nötig hatte.
Jäh erinnerte ich mich und meine Euphorie wich der Scham. Nicht der Methanwal war der Grund gewesen, warum ich seit Stunden auf dem Hochhaus gesessen hatte. Nein, ich drückte mich davor, nach Hause zu gehen und Mikko zu beichten, dass ich meine Arbeit verloren hatte.
Schon wieder.
Ich fuhr mir über die dunkelroten, kurzen Haare.
Verdammt! Ich hatte es mal wieder gründlich verbockt!
Mit dem Zeigefinger der linken Hand fuhr ich über das Handgelenk. Die Stelle, an der kurz zuvor noch die Lotusblüte der Geisha geprangt hatte, war nun leer. Die Tätowierung war verschwunden und somit meine Zugehörigkeit zum Lotusclan.
Die Regeln waren einfach: Nur wer Arbeit hatte, gehörte zu einem Clan. Und nur wer zu einem Clan gehörte, war in Tokito sicher, denn die Zugehörigkeit beschützte einen vor Abschaum wie Menschenhändlern.
Ich musste eingestehen, dass ich nie eine besonders gute Lotusblüte abgegeben hatte, denn die Frauen dieses Clans galten als hübsch, geheimnisvoll und verführerisch. Selbst die, die nur in einem Waschhaus arbeiteten. Als Lotusblüte war es unsere Pflicht, unserer Fürstin, der Geisha, Ehre zu machen. Und da sich der Lotusclan nun mal auf Unterhaltung verstand, war es das Ziel jeder Frau, diese Werte zu vermitteln. Auf keinen Fall würde eine Lotusblüte je aus ihrer Rolle fallen und jemandem die Fresse polieren. Auch dann nicht, wenn die Aufseherin des Waschhauses, in dem sie arbeitete, das Gemüt einer fiesen Kakerlake hatte.
Niemand, außer mir.
Was sollte ich sagen? Ich wurde nicht gerne geschlagen. Weder früher im Waisenhaus noch heute. Der Unterschied zu damals war aber, dass ich nun groß genug war, um mich gegen einen Rohrstock zu wehren.
Du hättest ihr trotzdem nicht gleich die Nase brechen müssen, Erin.
Oh doch. Ich spürte immer noch, wie mich bei der Erinnerung an ihr blutüberströmtes Gesicht die Befriedigung durchflutete.
Es war dumm, Erin, denn clanlos zu sein bedeutete, vogelfrei zu sein. Ungeschützt.
Ich kletterte die wackelige Feuerleiter hinunter, bis ich ein anderes Dach erreichte. Von da aus hangelte ich mich ein Rohr hinab und schließlich eine weitere Leiter. Es dauerte eine Weile, bis ich den Boden einer engen Gasse erreichte. Hier zog ich die Kapuze tief ins Gesicht, stellte sicher, dass mein Handgelenk verborgen war, und eilte los.
Ohne Zwischenfälle gelangte ich zu einer größeren Straße, wo Händler in bunt beleuchteten Ständen ihre Ware anboten. Frittierte Ratte. Gebratene Ratte. Geschmorte Ratte. Wenn es von etwas genug gab, dann waren es Ratten.
Mein Magen knurrte vor Hunger. Es half alles nichts. Früher oder später würde ich meine Niederlage eingestehen müssen. Allerdings konnte es nicht schaden, Mikko eine kleine Aufmunterung mitzubringen. Also hielt ich an einem der Stände, wo eine einäugige, alte Frau süße Kuchen verkaufte. Weil sie die streunenden Katzen fütterte, wurde ihr Stand von den Tieren regelrecht belagert. Das verschaffte ihr auch den Spitznamen »Katzenfrau«.
»Erin Rider.« Sie schenkte mir ein zahnloses Lächeln und ich senkte den Kopf, um eine Verbeugung anzudeuten, wie es die höfliche Art des Lotusclans war. »Wie schön, dich zu sehen. Was darf ich euch einpacken?«
»Das Übliche«, antwortete ich und zeigte auf die süßen Reiskuchen, die mit rosafarbener Zuckerkruste überzogen waren. Sie packte mir die Ware in eine Tüte und musterte mich. »Hast du wieder etwas ausgefressen?«
»Ich? Immer«, antwortete ich und zwinkerte scheinbar unbeschwert. Gleichzeitig versteiften sich meine Muskeln, jederzeit bereit wegzurennen. In Tokito konnte man als Vogelfreie niemandem trauen.
»Wie ich deinen Mikko kenne, wird er dir verzeihen.« Sie nickte mir zuversichtlich zu und ich entspannte mich wieder. Sie hatte recht. Mikko würde mir alles verzeihen, doch das änderte nichts an der Scham, die ich empfand. »Ihr zwei habt etwas Seltenes. Besonderes.«
»Ein eigenes Dach über dem Kopf?«, scherzte ich.
»Liebe«, korrigierte sie mich. »Das ist in unserer Stadt nur schwer zu finden.«
Ihr harmloses, großmütterliches Aussehen trog, denn wer hier in der Hauptstadt einen Stand hatte, brauchte Nerven aus Stahl oder einen mächtigen Beschützer. Auf den ersten Blick hatte die Katzenfrau nichts von beidem, aber ihr verblasstes Tattoo am Handgelenk verriet sie als Mitglied des Streunerclans. Und niemand verscherzte es sich mit den Streunern oder ihrem Anführer, dem Katzenkönig. Sie mochten im Gegensatz zu anderen Clans zwar kein Territorium in Tokito haben und auch keine Krieger, aber sie waren überall. Und das war ihre Stärke. Sie wohnten zwischen den Häusern und darunter in den Abwasserkanälen. In jeder dunklen Gasse und auf jedem belebten Marktplatz spürte man ihren Blick im Nacken. Und wenn sie wollten, konnten sie einen spurlos verschwinden lassen.
Es würde mich nicht wundern, wenn die Katzenfrau schon längst wusste, dass ich meine Arbeitsstelle verloren hatte.
»Wie heißt es so schön? Mit vollem Bauch verzeiht es sich leichter«, sagte ich.
»Pass auf dich auf, Erin Rider.« Ihre spröden Lippen verzogen sich zu einem unheilvollen Lächeln. »Die Schatten wachsen schnell heute Nacht.«
Wortlos verbeugte ich mich erneut zum Abschied und eilte weiter. Ohne Zwischenfälle erreichte ich das Viertel, in dem Mikko und ich wohnten. Es war eine Ansammlung aus winzigen, übereinandergestapelten Apartments. Die meisten davon hatten schon bessere Tage gesehen. Doch auch wenn es nur ein kleines Zuhause war, war es etwas, das nur uns gehörte.
Ich passierte besprühte Wände und verrostete Gerüste, an denen bunte Werbetafeln hingen. Überwiegend Slogans und Fahnen vom Federclan, der in diesem Teil von Tokito am stärksten vertreten war. Aber auch Sprüche, die uns an die Regeln erinnerten, nach denen wir alle spielen mussten.
»Wer keinen Clan hat, hat keinen Platz.«
Neben den Metallbauten und leuchtenden Tafeln versteckten sich kleine rote Schreine, die man schnell übersah. Sie wirkten fehl am Platz, wie Relikte aus längst vergessenen Tagen. Vertrocknete Blumen lagen auf ihren Dächern. Abgebrannte Kerzen standen um sie herum. Geschenke für die Spirits, die Tokito schon längst verlassen hatten.
Mein Herz sank und ich zog die Kapuze tiefer ins Gesicht. Mit jedem Schritt, der mich der Wohnung näher brachte, wurden meine Beine schwerer und mein Hals enger. Ich öffnete unsere Wohnungstür, schlüpfte aus den Straßenschuhen und verschloss die Tür hinter mir. Dann hielt ich inne und lauschte. Mit etwas Glück würde Mikko bereits schlafen.
»Erin?«
Er schlief nicht.
»Erin!« Seine rabenschwarzen Haare standen wie gewohnt in alle Richtungen. Seine Brille saß ein wenig schräg auf der Nase, als er auf mich zukam und mich fest an sich zog.
»Ich hab mir Sorgen gemacht«, sagte er leise.
Ich legte den Kopf auf seine Schulter und atmete den vertrauten Geruch ein. Er roch nach Tee und Reis. Viel zu schnell löste er sich von mir und beugte sich vor, um mir in die Augen zu sehen.
Wie ich seine Augen liebte! Ich könnte mich für immer in diesem Blau verlieren.
»Geht es dir gut?« Er hatte die Stirn gerunzelt. Ich nickte, auch wenn mir die Tränen in die Augen stiegen. Ärgerlich blinzelte ich sie weg.
Er griff nach meinem Handgelenk und wischte mit seinem Daumen über die Stelle, an der die Lotusblüte gewesen war.
»Verdammt«, fluchte er, aber er war nicht sauer. Nur besorgt.
»Wer hat es dir gesagt?«, flüsterte ich, auch wenn ich die Antwort bereits ahnte.
»Ryanne.«
Ich wusste, er würde mir keine Vorwürfe machen. Trotzdem hatte ich das Bedürfnis, mich zu erklären. »Ich hab mir wirklich Mühe gegeben, aber diese Chefin … Sie hatte es auf mich abgesehen. Du weißt, wie ich den Rohrstock hasse …«
»Ich weiß.« Er zog mich wieder an sich und strich mir zärtlich über den Kopf. »Ich bin nur froh, dass dir nichts passiert ist.«
»Tut mir leid.« Jetzt schämte ich mich dafür, mich nicht eher nach Hause getraut zu haben.
Wir waren im selben Waisenhaus aufgewachsen und kannten uns schon eine Ewigkeit. Ich konnte mich noch gut an das Gefühl erinnern, bevor ich Mikko getroffen hatte. Das Gefühl, verloren zu sein, denn ich hatte niemanden auf der Welt. Und plötzlich traf ich den Jungen mit den gütigen blauen Augen. Und zusammen waren wir weniger einsam.
Aus uns wurden schnell Verbündete, beste Freunde, Seelenverwandte und schließlich Liebende. Ein Leben ohne Mikko konnte ich mir nicht vorstellen. Er war die einzige Familie, die ich je kennengelernt hatte.
»Komm«, sagte er. »Ich hab etwas zu essen gemacht. Mit vollem Bauch lassen sich besser Pläne schmieden.«
Das erinnerte mich an die Reiskuchen, die ich nun aus der Tasche zog.
»Für dich«, verkündete ich. »Bestechung. Für alle Fälle.«
»Als ob du mich bestechen müsstest.« Er lachte. »Ich würde doch sowieso alles für dich tun.«
»Weil ich so charmant bin«, witzelte ich.
Sein Mund verzog sich zu einem Lächeln und ich konnte nicht anders, als ihn zu küssen.
»Weil du eben du bist, Moji«, flüsterte er und strich über meinen Nacken.
»Ich bin kein Moji!«, protestierte ich.
Mojis waren Luftquallen, die von Abfall lebten. Aber Mikko meinte den Spitznamen auf eine Art, die nur Liebende nachvollziehen können, positiv.
Als wir zehn Jahre alt waren, saßen wir nebeneinander auf einem rostigen Klettergerüst. Wir teilten uns eine Tüte Süßigkeiten, die wir einem verzogenen Kind des Handclans geklaut hatten. Unter uns schwebten die pink leuchtenden Quallen über dem Müllcontainer und machten sich über die Reste her. »Du schlingst dein Essen runter wie ein Moji«, hatte er gelacht. Seitdem war ich sein Moji.
Mikko schnappte sich die Tüte und marschierte in unsere Küche. Allein das Aufleuchten in seinen Augen war es wert gewesen, die Reiskuchen zu kaufen. Er liebte diese süßen Dinger über alles.
Unsere Küche war winzig. Eine kleine Arbeitsfläche, Waschbecken und Kühlzelle. Für mehr war hier kein Platz. Der Tisch war eine Plastikplatte, die wir aus der Wand klappen konnten. Ebenso wie die Sitzflächen.
Während ich mich setzte, stellte Mikko Tee auf den Tisch. Meine Finger schlossen sich um die heiße Tasse, während er eine Schale aus dem Schrank holte und Reis hineinfüllte. Er würzte ihn und verfeinerte ihn mit Taubeneiern, die ich gestern aus einem Nest erbeutet hatte, und etwas Seetang.
»Bei der Geisha kann ich mich nicht mehr blicken lassen«, gestand ich und kaute auf meiner Lippe. Eine blöde Angewohnheit, die dazu führte, dass sie meistens wund war. Doch wenn ich nervös wurde oder mich etwas bedrückte, konnte ich nicht anders, und ich hatte allen Grund, bedrückt zu sein.
»Es gibt noch andere Fürsten …« Mikko suchte schon nach einer Lösung.
Ich stocherte mit meinen Essstäbchen im Reis herum, der mir heute nicht so recht schmecken wollte. Dabei war Mikko der beste Koch überhaupt. Er schaffte es immer wieder, aus den wenigen Zutaten, die wir uns leisten konnten, die leckersten Gerichte zu zaubern.
»Ich werde mich morgen beim Federclan umhören. Mach dir keine Sorgen«, versuchte er, mich zu beruhigen. »Wir schaffen das schon.«
Unser Wohngebiet lag genau an der Grenze zwischen Lotus- und Federclan. Nur ein paar Straßen weiter lag der berühmte Freudentempel »Tanz der Blätter«, in dem einige auserwählte Mädchen ihre Ausbildung zum Schmetterling beginnen durften. Eine besondere Ehre, die nur den Schönsten zuteilwurde, so wie unserer Freundin Ryanne.
»Es wäre eh einfacher, wenn wir im selben Clan wären«, stimmte ich zu. »Aber was, wenn ich dort keine Stelle finde? Was, wenn mich niemand haben will? Ich bin nicht gerade ein unbeschriebenes Blatt.«
»Es ist nicht deine Schuld, dass du so viele Arbeitsplätze verloren hast. Na ja. Schon ein bisschen. Aber du warst noch nie eine Lotusblüte. Du warst immer schon eher …« Er überlegte und plötzlich erhellte sich sein Gesicht. »… ein Affe.«
»Na toll.« Ich machte Anstalten, ihn mit meinen Stäbchen zu piken. Die Mitglieder des Affenclans galten als Raufbolde ohne Manieren.
»Wohingegen ich schon immer eine gerissene, verwegene Feder war«, fügte Mikko grinsend hinzu, während er meinen Angriffen auswich.
»Du bist so verwegen wie der rosa Reiskuchen, den du gerade verputzt hast«, knurrte ich und traf ihn mit meinem Essstäbchen an der Schulter. »Komm, ich zeig dir den Affen in mir.«
»Ich hab Köpfchen, du die Muskeln.« Er warf mir einen entwaffnenden Blick zu.
»Und diese Muskeln drehen dir gleich den Hals um.« Ich stellte Tee und Reisschale vom Tisch. Dann klappte ich die Platte hoch, während Mikko zurückwich.
»Erbarmen«, rief er lachend.
»Affen kennen kein Erbarmen«, rief ich und stürzte mich auf ihn.
Er hob mich hoch und küsste mich. Für einen kurzen, wunderbaren Moment waren all meine Sorgen vergessen. Ich ließ die Stäbchen fallen, schlang meine Arme um Mikkos Nacken und wünschte mir, dieser Moment würde ewig währen.
~
Es war früh am Morgen, als Mikko sich aus meiner Umarmung löste. In unserem Schlafzimmer war es warm, denn es gab kein Fenster. Nur ein Bett, das den gesamten Raum ausfüllte. »Schlafschrank« nannten wir unser kleines Nest auch.
»Nein. Geh nicht«, nuschelte ich schlaftrunken und griff nach seinem Arm, doch anstelle seines warmen Körpers wehte ein kühler Luftzug unter die Decke, als er die Schiebetür aufzog.
»Ich muss los. Leider.« Er drückte mir einen Kuss auf die Stirn.
Mikko hatte Glück und eine Stelle in der Bibliothek ergattert, ein echter Traumjob für ihn.
Ich hörte, wie er seiner gewohnten Morgenroutine nachging. Die Wände in unserer Wohnung waren so dünn, dass man jedes Geräusch vernahm. Er ging auf die Toilette, dann wusch er sich die Hände, putzte sich die Zähne, gurgelte mit Mundwasser und schlüpfte in die kleine Dusche. Die Geräusche waren so vertraut, dass ich wieder eindöste. Als ich endlich aufstand und in die Küche schlurfte, saß er schon am Tisch und trank Tee.
Er hatte die legere Kleidung von gestern gegen seine Arbeitsuniform getauscht. Sie war schwarz und aus festem Stoff. Um den Hals lag ein dunkelblauer, schimmernder Federkranz. Mikko hatte sich rasiert und versucht, seine Haare mit Gel zu bändigen, aber einzelne Strähnen schafften es immer wieder zu entkommen.
»Guten Morgen.« Er rückte seine Brille zurecht und lächelte mich an, während ich nicht mehr als ein Knurren zustande brachte. Ich war im Gegensatz zu ihm kein Morgenmensch.
»Tee kommt sofort«, verkündete Mikko, trotz der Neuigkeiten vom Vortag erstaunlich gut gelaunt. Er reichte mir die Tasse und füllte meine Reisschale. Bei uns gab es immer Reis. Zum Frühstück, zum Mittag und zum Abendessen, was daran lag, dass Reis in unserem Land so günstig war. Tokito bildete auch geografisch das Zentrum unseres Inselstaates. Im Süden und im Norden herrschten kleinere Clans über die ländliche Bevölkerung. Allerdings hatten sie nicht die Ressourcen, sich gegen die mächtigen Stadtclans zu behaupten. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als Tokitos Grundversorgung zu gewährleisten.
»Was hast du heute vor?«, fragte Mikko und schob sich das Essen mit den Stäbchen in den Mund, während ich morgens aus Faulheit den Löffel benutzte.
Ich nahm einen weiteren Schluck Tee und zuckte deprimiert mit den Schultern. »Noch nichts.«
»Dann bleib lieber in der Wohnung. Hier ist es sicherer.«
»Aber wir brauchen Geld.«
Er schien zu ahnen, was ich im Sinn hatte, und schüttelte energisch den Kopf. »Nein, Erin. Keine illegalen Geschichten. Das ist viel zu gefährlich. Ich werde mich umhören, ob Stellen frei sind.« Er griff nach meiner Hand. »Sobald ich etwas weiß, melde ich mich.«
Ich nickte.
Ein zaghaftes Klopfen an der Tür ließ uns aufhorchen. Um diese Uhrzeit? Wir sahen uns an und wie immer verstanden wir uns wortlos. Mikko ging zur Tür, während ich mich mit einem Messer bewaffnete. Nur für den Fall, dass uns eine unangenehme Überraschung erwartete.
Ich war schon immer die Kämpferin von uns beiden gewesen. Auch wenn er größer war, war ich flinker und hatte einen rechten Haken, der uns schon aus einigen Schwierigkeiten geboxt hatte.
»Miiiiiiiiikkooooooo«, quiekte es und ich erkannte die Stimme sofort. Erleichtert ließ ich das Messer in der Schublade verschwinden und trat in den Flur.
»Eriiiiiiiiiin.« Schlanke Arme flogen mir entgegen und schlangen sich um mich. Ich roch ein leichtes Parfüm und hörte das vertraute Rascheln von teurer Seide. Als Ryanne von mir abließ, hielt sie eine Tüte in die Höhe. »Ich hab dir Aufmunterung mitgebracht.«
Sie zauberte eine Schale mit drei echten Erdbeeren hervor.
»Wo hast du die denn her?«, staunte Mikko.
»Wir mussten auf einer sehr exklusiven Party tanzen. Ihr glaubt gar nicht, was es da alles gab. Da hab ich natürlich gleich an meine besten Freunde gedacht und welche mitgehen lassen.«
Ryanne Cimon war ein Sonnenschein durch und durch. Sie war klein und zierlich, aber hatte das breiteste Lächeln, das ich je gesehen hatte. Ihre schwarzen Haare trug sie kinnlang, wodurch ihr puppenhaftes Gesicht noch niedlicher wirkte. Ihre Kleidung war aus azurblauer Seide, wie es für Schmetterlinge aus einem Freudentempel üblich war, und mit Perlen und Silberglöckchen verziert.
»Danke. Aber bei uns gibt es nichts zu feiern«, brummte ich, während ich einen weiteren Stuhl holte und Mikko versuchte, in der Küche etwas Platz zu schaffen, damit wir zu dritt an den winzigen Tisch passten.
»Oh doch.« Ryanne verteilte die Erdbeeren. Eine für jeden. Ich hatte schon ewig keine frische Erdbeere gegessen und beschloss, jeden Bissen zu genießen.
»Ich hab vielleicht eine neue Arbeit für dich«, fuhr sie fort und meine Augen weiteten sich. »Im Freudentempel erfährt man so etwas zuerst.«
Wie Mikko und ich war Ryanne im Waisenhaus aufgewachsen. Als wir elf wurden, mussten wir uns Arbeit bei einem der Clans suchen, um unsere erste Tätowierung zu bekommen. Mikko begann als Botenjunge beim Federclan. Ryanne und ich als Putzmädchen beim Lotusclan. Aufgrund ihrer Schönheit und ihrer herzlichen, unbeschwerten Art wurde sie schnell in einen der berühmten Freudentempel übernommen und absolvierte seitdem die Ausbildung zum Schmetterling. Angeblich hatte die Geisha selbst ein wachendes Auge über ihren Werdegang, aber ich war mir ziemlich sicher, dass Ryanne sich das mehr wünschte, als dass es der Realität entsprach.
»Im Freudentempel?«, echote ich wenig überzeugt.
Die Schmetterlinge waren die Aushängeschilder des Lotusclans. Sie waren Meister der Unterhaltung, gut ausgebildet in verschiedenen Künsten. Die Welt der Freudentempel war voller bunter Farben, Musik und betörender Düfte, in die man sich fallen lassen konnte, wenn man das Geld dazu hatte, doch ein schweres Portemonnaie alleine reichte nicht. Man musste sich eines Schmetterlings würdig erweisen, denn sonst wurde man gar nicht erst hineingelassen. Wo andere Clans auf Kämpfer setzten, setzte die Geisha auf ihre Schmetterlinge, und auch wenn sie bezaubernd schön waren, waren sie doch nicht weniger gefährlich. Das machte vermutlich ihren Reiz aus.
»Mirella hat auf dem Markt von einer Färberei aus dem Amphibienclan gehört, die Arbeiter sucht«, berichtete Ryanne mit leuchtenden Augen.
»Amphibien?«, fragte ich skeptisch. Deren Mitglieder galten als heimtückisch. »Ich weiß nicht recht.«
»Du brauchst Arbeit, Erin. Also sei nicht so wählerisch.« Ryanne griff nach meinen Händen. »Deine Aufgabe wäre es, Stoffe zu färben und zu putzen. Damit hast du doch Erfahrung.« Sie strahlte mich an, als wären das die beeindruckendsten Fähigkeiten, die ich vorweisen konnte.
»Das ist großartig. Danke«, sagte Mikko.
Eigentlich sollte die Nachricht meine Stimmung heben, tat sie aber nicht. Auch wenn ich den beiden ihre Stelle gönnte, fragte ich mich, was bei mir falsch lief. Wir alle waren unter gleichen Bedingungen ins Arbeitsleben gestartet, mit nichts anzubieten als unserem Fleiß. Und nun hatte Mikko einen sicheren Job in einer Bibliothek. Ryanne einen Ausbildungsplatz als Schmetterling. Und ich? Ich schlug mich von einer Putzstelle zur nächsten durch. Deprimiert vergrub ich mein Gesicht in den Händen.
»Wann ist der Vorstellungstermin?«, fragte Mikko für mich.
»Heute Nachmittag«, verkündete Ryanne, während sie sich ihre Erdbeere zwischen die Lippen schob und den Saft heraussaugte.
Manchmal beneidete ich sie um ihr Aussehen. Sie hatte das Gesicht eines unschuldigen Kindes, doch in ihren Bewegungen lag etwas Anmutiges und Verführerisches. Sie machte der Bezeichnung Schmetterling alle Ehre, während ich mit meinen kurzen Haaren und den verhältnismäßig breiten Schultern wirklich wie ein grober Affe wirkte.
»Lotus-, Feder- und Amphibienclan. Was für eine Kombination«, überlegte Mikko. »Darauf trinken wir.«
Er stellte drei kleine Becher auf den Tisch und griff nach einer Keramikflasche, in der er seinen Lieblingssake lagerte.
»Noch hab ich die Stelle nicht«, erinnerte ich ihn, als er uns einschenkte.
»Natürlich bekommst du sie.« Mikko und Ryanne strahlten mich an, als würden sie nicht einen Moment daran zweifeln, dass alles gut werden würde. Was ihren unerschütterlichen Optimismus anging, glichen sie sich sehr. In Momenten wie diesen fragte ich mich, warum Mikko sich ausgerechnet in mich verliebt hatte und nicht in jemanden wie die zuckersüße, wunderschöne Ryanne. Und ich wusste, was er auf eine Frage wie diese antworten würde. »Weil du eben mein Moji bist.«
»Ich kann die Kröte auf meinem Handgelenk kaum erwarten«, seufzte ich und leerte den Becher Sake mit einem Zug.
~
Ich trug mein bestes Hemd. Die Haare waren gewaschen, die Nägel geschnitten und die Schuhe geschrubbt.
Mit klopfendem Herzen machte ich mich auf den Weg zur Färberei des Amphibienclans. Als ich um die Ecke bog, erstarrte ich. Mir kamen ein junger Mann und eine Frau in weiten Gewändern entgegen, unter denen man gut Waffen verbergen konnte. Ihnen folgte ein älterer Mann mit dunkler Haut und weißen Haaren. Er stützte sich auf einen geschwungenen Holzstab, den er eigentlich gar nicht zu brauchen schien. Also handelte es sich entweder um ein Accessoire oder eine Waffe.
Phari, dachte ich abfällig. Die selbst ernannten Vertreter der Spirits! Durch ihre braunen Umhänge versuchten sie, ihre traditionellen Gewänder zu verhüllen, aber wenn man hier lange genug lebte, erkannte man sie sofort. An der Art, wie sie sich bewegten, voller Sicherheit und der Zuversicht, dass ihnen die Welt gehörte. Ihr Kinn war erhoben, als würde es ihnen missfallen, hier unten durch die Straßen zu laufen, mit dem übrigen Pöbel der Stadt. Sie gehörten nicht im eigentlichen Sinne zu einem der sechs Clans, sondern behielten sich vor, über die Clans »zu wachen«, wie sie es nannten. Den Frieden wollten sie sicherstellen. »Zum Wohle aller.« Vor allem ihrem eigenen.
Man sagte ihnen nach, dass sie Gedanken lesen konnten und andere besondere Fähigkeiten hatten. Völliger Schwachsinn. Für mich waren diese Leute bloß eingebildete Schnösel. Ihr Tempel passte perfekt zu ihnen. Ein Turm, der die restliche Stadt überragte. Die Spitze bildete ein Licht, das weit in den Himmel strahlte. Ein Leuchtturm, der verlorenen Seelen den Weg weisen sollte. So sagten sie.
Ein fetter Luxusbau, um alle in der Stadt daran zu erinnern, wer die meiste Kohle hatte, dachte ich.
Ich formte Sätze in meinem Kopf, die ich den beiden jüngeren Phari entgegenschickte. Falls ihr mich hören könnt, ihr Methanköpfe, eure Eltern waren sicher Geschwister.
In ihren Gesichtern zeigte sich keine Regung. Für mich ein klarer Beweis, dass sie keine Gedanken lesen konnten.
Mit etwas besserer Laune bog ich nach links und hatte mein Ziel erreicht: Die Straße war fest in der Hand des Amphibienclans und es fühlte sich an, als würde man eine andere Welt betreten. Sobald ich die Wachposten, zwei gelangweilte Männer mit Blasrohren und einer Batterie Giftpfeile, passierte, wurde es bunt. Die Straßen, die Geschäfte, Kleidung, Haare und Gesichtsbemalung. Alles versank in Orangerot und Giftgrün, den traditionellen Farben des Clans. Die Amphibien waren kreativ, wenn es darum ging, sich so bunt und schrill wie möglich anzuziehen. Mit meinem schlichten, farblosen Äußeren fiel ich unter ihnen auf wie eine verirrte Erdkröte unter Pfeilgiftfröschen.
In der Färberei angekommen, erkannte ich die Herrin sofort an ihrer Haltung. Sie hatte den Kopf erhoben und ragte über den Arbeitern auf, die sich über die Färbebecken beugten. Auf ihrem Kopf war ein orangefarbener Turban, um den sich eine Schlange wand. Keine echte, wie ich beim Näherkommen feststellte.
Ein strenger Geruch, der mir die Magensäure auf die Zunge trieb, lag in der Luft. Er ging von den Farbstoffen aus, die in großen Bottichen gerührt wurden. Bereits nach wenigen Minuten in der Färberei bekam ich Kopfschmerzen.
»Hey, du! Was willst du?« Die Herrin kam auf mich zu. Ihrem griesgrämigen Gesicht nach zu urteilen, taten ihr die Gerüche der Färbemittel auch nicht gut. Ihre Stirn war von Falten zerfurcht, in die sich Farbpartikel gelegt hatten.
»Ich suche Arbeit, Herrin.« Ich verbeugte mich tief, wie es von mir erwartet wurde. In dieser Haltung verharrte ich, bis sie sich räusperte.
»Name?«
»Erin Rider, Herrin.«
»Wo ist dein Empfehlungsschreiben?«
»Ich hab keins.«
»Nun …« Ihre Stimme hatte einen lauernden Ton angenommen. »Worin hast du denn Erfahrung?«
Ich konnte förmlich spüren, wie sie meinen Körper genau unter die Lupe nahm und meine Gesundheit und Stärke abschätzte, um meinen Wert zu ermitteln.
»Ich habe zuletzt im Badehaus Zur goldenen Quelle gearbeitet.«
»Wo du wahrscheinlich rausgeflogen bist.«
Mist.
»Na jaaaa.«
»Wusste ich es doch.« Sie runzelte ihre ohnehin schon faltige Stirn und hob grob mein Kinn an. »Mach den Mund auf.«
Ich gehorchte und sie überprüfte meine Zähne. Dann tastete sie ungeniert meinen Körper ab. Ich versteifte mich instinktiv, ließ es aber geschehen.
Du brauchst diesen Job, Erin.
Sie betastete meine Arme, die Schultern, das Gesäß und schließlich meine Beine, als wäre ich ein Tier. Ich spürte die Wut in mir hochsteigen.
Erneut griff sie nach meinem Kinn und zwang mich, in ihre Augen zu sehen.
»Du scheinst fest anpacken zu können, aber ich habe keine Lust auf Unruhestifter«, sagte sie schließlich und ließ mich los.
»Ich bin fleißig«, versprach ich schnell.
»Du hast keinerlei Empfehlungsschreiben.«
»Ich … habe aus meinen Fehlern gelernt, Herrin.« Ich verbeugte mich wieder artig. »Bitte. Ich verspreche, mein Bestes zu geben, und werde Euch nicht enttäuschen.«
»Sicher. Sicher«, murmelte die Herrin gelangweilt. »Warum versuchst du es nicht woanders, Mädchen? Ich habe keine Stelle offen.«
Lügnerin!
Ich biss mir auf die Zunge und verbeugte mich, damit sie mein gerötetes Gesicht nicht sehen konnte. »Seid Ihr sich…?«
»Ja, und nun verschwinde.« Sie drehte sich um und ließ mich stehen. Mit hängenden Schultern schlurfte ich aus der Färberei.
»In dem Gestank würde ich eh nicht arbeiten wollen«, murmelte ich zerknirscht.
~
Ich kauerte auf einem Stapel Kisten und fuhr mir über die leere Stelle an meinem Unterarm.
Was war ich für eine Versagerin!
Allein der Gedanke an Mikkos traurigen Blick schnürte mir die Kehle zu. Er hatte sicherlich versucht, früh nach Hause zu kommen, um mit mir auf die neue Stelle anzustoßen, und vertrieb sich in diesem Moment die Zeit damit, unser Abendessen vorzubereiten.
Ich wollte nicht, dass er sich ständig um mich sorgte. Immerhin hatte er genug mit seiner eigenen Arbeit zu tun und ich wusste, wie viel ihm seine Anstellung in der Bibliothek bedeutete.
Warum war ich so schnell von der Färberei abgewiesen worden? Lag es wirklich an meinem schlechten Ruf oder war Ryanne falsch informiert gewesen und sie suchten gar keinen neuen Arbeiter? Egal was der Grund war. Alles, was zählte, war, dass ich weiterhin arbeitslos und somit clanlos war.
Neben mir, zwischen Müllcontainern, entdeckte ich einen der roten Opferschreine. Vertrocknete Blumen und Schälchen mit Sake lagen um ihn herum, Gaben für die Geister. Ich schnappte mir eine Schale und leerte sie mit einem Zug. Angeblich sollte es Unglück und Verderben bringen, etwas aus einem Spirit-Schrein zu stehlen, aber was sollte jetzt noch schlimmer werden?
In Gedanken versunken machte ich mich auf den Weg nach Hause.
Hätte ich doch bloß besser aufgepasst, dann hätte ich bemerkt, dass es in dieser Gasse viel zu ruhig war. Keine streunenden Katzen, keine Ratten und auch keine Mojis weit und breit.
Zu spät bemerkte ich die Schritte, die sich rasch von hinten näherten. Ich fuhr herum, doch ein Elektroimpuls traf mich und setzte mich außer Gefecht, bevor ich die Chance hatte, mich zu wehren. Mein Körper erschlaffte, schwer wie ein nasser Reissack, und ich fiel zwischen einige Müllsäcke auf den Asphalt.
Verdammt!
Vor Schmerz waren mir Tränen in die Augen gestiegen und mein Herz schlug mir bis zum Hals, als schwere Stiefel auf mich zustampften.
Nein! Nein! Nein.
»Packt sie ein«, befahl ein Mann und Hände griffen nach meinen Beinen. Sie schleiften mich über den Boden, auf ein Fahrzeug zu. Mein Kopf schlug dabei immer wieder auf den Asphalt, aber das kümmerte sie nicht.
Kämpfe, Erin! KÄMPFE!
Ich musste mich wehren. Auf keinen Fall durften sie mich bekommen, doch meine Muskeln gehorchten mir nicht. Nun war es die Panik, die mir Tränen in die Augen trieb.
Wer war das?
Sadisten? Perverse, die Spaß mit mir haben wollten? Oder Verbrecher? Egal wer sie waren. Ich war in größter Gefahr. Verzweifelt versuchte ich zu schreien, um irgendwie auf mich aufmerksam zu machen. Ein gurgelnder Laut drang über meine Lippen und wurde jäh durch einen weiteren Elektroimpuls erstickt. Mein Körper stand in Flammen, als sich alle Muskeln auf einmal verkrampften und dann mit einem Schlag wieder erschlafften, als wäre jedes Leben aus ihnen gewichen.
Keiner würde mir helfen, denn ich war ein Niemand. Clanlos.
Meine Angreifer zogen mich die Rampe eines Transporters hoch, wo sie mich in eine Ecke warfen. Als wäre ich nicht mehr als eine erbeutete Ratte, die sie nun verkaufen wollten. Unwichtiger Krempel.
Doch für eine Person war ich nicht unwichtig. Für eine Person bedeutete ich alles, auch wenn ich mir keine Tätowierung verdient hatte.
Mikko.
Der Reis musste mittlerweile kalt geworden sein, doch ich war mir sicher, dass er seine Portion noch nicht angerührt hatte. Wahrscheinlich würde er genau in diesem Moment unruhig in der Wohnung herumschleichen, die Tür stets im Blick.
Ich durfte nicht sterben.
Ich hatte doch versprochen zurückzukehren.
2
KIRAN SEABORN
Es werde Licht.
Ich zog mir die Kapuze tiefer ins Gesicht, während ich meinem Meister folgte. Er hatte kaum ein Wort mit uns geredet, seitdem wir den Tempel verlassen hatten.
Seine Finger schlossen sich um den geschwungenen Holzstab, auf dessen Spitze ein seltener Lichtkristall prangte. Wir trugen breite braune Umhänge, die uns von Kopf bis Fuß einhüllten. So erregten wir weniger Aufmerksamkeit und konnten mit der gewöhnlichen Bevölkerung von Tokito verschmelzen.
Zumindest in der Theorie.
In der Praxis funktionierte es nicht sonderlich gut.
Unser Meister musste auf dem Weg bereits drei Babys, zwei Läden und vier Fahrzeuge segnen. Außerdem sollten wir zahlreiche Räucherstäbchen in den lokalen Schreinen entzünden, da die Bewohner glaubten, die Spirits wären durch unsere Anwesenheit besonders zufriedengestellt.
Wir hätten einfach den Wagen nehmen sollen. Aber nein … Der Meister wollte ja unbedingt laufen.
Ich lugte unter dem Rand der Kapuze hervor und schielte zum bewölkten Himmel empor. Weit über unseren Köpfen drehte ein Methanwal seine Kreise. Er öffnete seinen Mund und verschwand wieder im Wolkendunst. Majestätische Tiere, die man vor allem über Städten fand.
Sie erinnerten mich an meine Heimat, die weit im Norden lag. Eine kleine Fischersiedlung direkt an der Küste eines rauen, zerklüfteten Landes. Dort hatte es zwar kaum Methanwale gegeben, dafür echte Wale, die sich im Meer tummelten. Und auch wenn Luftwale genetisch gesehen nicht viel mit den Tieren im Wasser gemein hatten, erinnerten sie mich doch meine Heimat.
»Kiran«, sagte mein Meister streng und ich schrak aus meinen Gedanken. »Konzentriere dich.«
»Verzeihung, Meister«, murmelte ich und senkte meinen Kopf. Die Rüge war nicht unbemerkt geblieben. Ich konnte sehen, wie ein schadenfrohes Lächeln über Cleas Lippen schlich. Und ich musste dem Wunsch widerstehen, es ihr mit einer gemeinen Bemerkung aus dem Gesicht zu wischen. Sie war wie ich eine Novizin, die von Meister Konoha unterrichtet wurde. Aufmerksam musterte sie die Umgebung, während ihre linke Hand unter dem Umhang verborgen war. Ich war sicher, dass sich ihre Finger um den Griff ihres Dolches schlangen, jederzeit bereit zu kämpfen. Auch an meinem Gürtel hing eine Waffe, ein Kurzschwert, denn als Phari war man nicht überall in Tokito ein gern gesehener Gast.
»Hier ist es.« Unser Meister bog in eine Straße, in der es bereits von schwarz gekleideten Kriegern des Federclans wimmelte. Es war ihr Gebiet, wie der Rabe auf den Flaggen, die über die Straßen gespannt waren, zeigte.
Wir schlugen fast zeitgleich unsere Kapuzen zurück, um uns zu erkennen zu geben, als wir an den Federn vorbei zu einem bewachten Hauseingang schritten. Wir waren angekündigt, also ließ man uns passieren.
Als ich über die Türschwelle trat, schlug mir der Geruch von Tod entgegen. Er war süßlich und stechend, eine unangenehme Kombination, die mir die Gallensäure in den Mund trieb. Doch ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen, da ich Cleas spöttischen Blick spürte. Sie wartete nur darauf, dass ich mich blamierte.
~
Es war üblich für einen Phari-Wächter, zwei bis drei Schüler auszuwählen, deren Ausbildung er persönlich übernehmen wollte. Die Novizen folgten ihrem Meister, bis dieser glaubte, dass sie für die Wächterprüfung bereit waren. Meister Konoha hatte ausgerechnet uns beide erwählt. Zwei Schüler, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Clea erinnerte an einen warmen Sommertag, von denen es in meiner Heimat nicht viele gegeben hatte. Sie hatte goldbraune Haut und rotblondes Haar, das in einem geraden Pony über ihre Stirn und zu einem Zopf gebunden über ihre Schulter fiel. Ihr Wesen glich einem Feuersturm, an dem man sich nur allzu schnell verbrennen konnte.
Ich war vom Winter gezeichnet. Kinder aus Sturm und Kälte, so nannte man das Volk meiner Eltern auch. Stechende wasserblaue Augen und Haare, die von den Dunstwolken, die über unsere Inseln zogen, selbst geküsst worden waren.
Dazu ein breites Kinn, breite Schultern. Der typische Körperbau eines Fischers aus Alvane. Doch auch wenn mein Körper kräftiger als der von Clea war, konnte ich sie im Training nicht schlagen. Kein Novize konnte das, denn sie war die Beste.
»Wenn du dich übergeben musst, dann dreh dich bitte um«, sagte sie, während wir die Treppe erklommen. Wie immer schien sie meine Gedanken lesen zu können.
Mit jeder Stufe wurde der unangenehme Geruch stärker und mir gelang es nicht mehr, meinen Ekel zu verbergen.
»Wann wurde der Körper gefunden?«, erkundigte sich unser Meister. Er stützte sich auf seinen Holzstab wie ein alter Mann.
»Vor ein paar Stunden«, entgegnete die Feder, die hier das Sagen zu haben schien. Genau konnte man das beim Federclan nie wissen. Alle Soldaten trugen schwarze Kleidung mit leichter Panzerung, die die Struktur von dunkel schimmernden Federn hatte, und eine Stoffmaske, durch die man nicht mehr als ihre Augenpartie sah. »Aber liegen tut er hier wohl schon länger.«
»Gibt es irgendwelche Verdächtige?«, fragte Meister Konoha und hob seine Augenbraue.
»Nein. War bloß wieder eine dieser Blutlosen.« Der Federkrieger zuckte mit den Schultern, bevor er auf die Leiche zeigte, die in der Mitte des Raumes lag.
Eine Frau mit kurzen Haaren. Ich starrte in ihr Gesicht und kam nicht umhin zu bemerken, wie unecht es aussah. So teigig und blass. Fast so, als wäre sie bloß eine Puppe, deren Haut man aus Gummi gefertigt hatte. Aber der Geruch sagte etwas anderes, ebenso wie die Fliegen, die ihr aus Mund und Nase krochen. Leichensauger. Diese Fliegen wurden vom Tod angezogen wie Mücken vom Licht.
»Nehmt euch so viel Zeit, wie ihr wollt, Lichtbringer. Sie läuft ja nicht weg.« Der Federkrieger kicherte. Dann zogen er und seine Kameraden sich zurück. Bis auf zwei, die sich im Türrahmen postierten für den Fall, dass wir wider Erwarten doch noch etwas Interessantes finden würden.
Meister Konoha legte seine Stirn in Falten. »Was fällt euch auf, Schüler?«
Als hätte sie nur auf die Frage gewartet, stürzte Clea nach vorne und begann, die Tote zu untersuchen. »Ihr Körper zeigt Einstichstellen am Hals, den Pulsadern und der Leiste. Sie wurde wie die anderen Opfer vollständig ausgeblutet. Man kann keine Abwehrspuren sehen. Also hat sie sich nicht gegen ihren Angreifer gewehrt, möglicherweise war sie betäubt, als sie getötet wurde.«
»Sehr gut.«
Angesichts des Lobes schwoll Clea vor Stolz an und fuhr fort: »Sie hat keine Tätowierung. Eine Clanlose also.«
»Gut. Was ist mit dir, Kiran?« Der Meister wandte sich an mich.
Ich riss meinen Blick von einem Leichensauger, der gerade aus der Wunde am Hals gekrochen kam und begann, seine Flügel von Fleischpartikeln zu befreien.
»Seit wann interessieren uns Mordermittlungen wie diese? Es ist bloß eine weitere Leiche ohne Blut. Also vermutlich werden hier Organhändler zugeschlagen haben«, entgegnete ich genervt.
Die Phari kümmerten sich nur um Verbrechen, die den Frieden von Tokito gefährdeten. Bei den Blutlosen war das nicht der Fall, darum hatten wir bisher auch nicht interveniert. Bis unser Meister heute Morgen plötzlich ganz erpicht darauf gewesen war, das zu ändern.
Meiner Meinung nach verschwendeten wir hier nur unsere Zeit. Zeit, die wir in weitaus vielversprechendere Missionen mit Aussicht auf Erfolg und Anerkennung stecken konnten.
»Wenn es Organhändler waren, warum haben die Leichen dann noch ihre Organe?«, fragte mich Clea und stemmte ihre Hände in die Hüften.
Ich zuckte die Schultern. »Sie sind halt auf Blut spezialisiert. Keine Ahnung.«
»Du sagst es. Du hast keine Ahnung. Wie immer«, entgegnete sie schnippisch. »Ich habe ein bisschen recherchiert.«
Natürlich hatte sie das. Diese Streberin!
»Bisher hat es siebenundneunzig Morde gegeben, bei denen die Leichen blutlos hinterlassen wurden. Mit diesem hier sind es achtundneunzig«, berichtete sie. »Sie fanden in den Vierteln aller Clans statt, aber die Opfer waren meistens clanlos oder hatten einen sehr geringen Stand in ihrem Clan. Wer auch immer diese Morde begangen hat, wollte so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf sich ziehen.«
Das Fangen eines Mörders, der es auf Clanlose abgesehen hatte, war wenig ruhmreich. Niemand würde sich dafür interessieren.
»Das würde auch zu Organhändlern passen«, sagte ich und wandte mich an unseren Meister. »Versteht mich nicht falsch, ich finde auch, dass man solchen Kriminellen das Handwerk legen sollte. Aber das ist Clansache …«
»Die Clans haben bisher keinen Durchbruch erzielt«, redete Clea weiter, so als hätte sie bereits alles mit dem Meister besprochen. Und der stimmte ihr natürlich zu.
»Kiran. Die Phari sind dort, wo sie gebraucht werden. Und im Moment werden wir hier gebraucht.«
Ich hatte ihn noch nicht weit genug durchschaut, um zu sagen, ob er die Herausforderung suchte oder eine Schwäche für das Vernachlässigte hatte.
Wahrscheinlich das Zweite. Immerhin hat er eine Schwäche für mich …
»Allerdings muss ich Kiran recht geben«, sagte Clea überraschenderweise. »Es ist ungewöhnlich, dass wir uns hier einmischen. Darum denke ich, dass mehr dahintersteckt, als du uns bisher gesagt hast, Meister. Hat unsere Mission etwas mit deinem Ausflug gestern Abend zu tun?«
»Stalkerin«, murmelte ich, aber sie fuhr unbeirrt fort.
»Gibt es etwa einen Auftraggeber?«
Ich horchte auf. Das würde alles ändern. Dann wäre dieser Fall vielleicht doch wichtiger, als es den Anschein hatte.
Unser Meister räusperte sich. »Ich freue mich, dass du dich so für meine nächtlichen Aktivitäten interessierst, aber könnten wir uns nun erst einmal der Leiche widmen?«
Clea knirschte mit den Zähnen. Sie war hoffnungslos neugierig und hasste es, etwas nicht zu wissen.
»Ich kann es spüren. Er schämt sich für etwas«, raunte sie mir zu.
»Vielleicht haben seine nächtlichen Aktivitäten doch nichts mit dem Fall zu tun«, gab ich zu bedenken.
Sie schmunzelte. Dann hielt sie inne. »Jetzt ist er verärgert.«
Meister Konoha räusperte sich. »Vielleicht nutzt du deine besonderen Kräfte lieber für die Lösung unseres Falls, Schülerin.«
»Ja, Meister.« Immer noch grinsend schloss Clea die Augen, um sich zu konzentrieren. Zuerst sah ich die Anspannung in ihren Zügen und dann Erleichterung, gefolgt von absoluter Ruhe, als sie mit ihrem Spirit in Kontakt trat.
Clea Casapaia hatte eine natürliche Begabung für unsere Kräfte. Man könnte sagen, dass es ihr im Blut lag, denn ihre Eltern waren im Tempel wahre Berühmtheiten. Sie waren sogenannte Phari-Seher, dafür bekannt, die Intention und Gefühle ihres Gegenübers zu spüren und so deren Handlungen vorauszusehen. Eine Gabe, die einem im Kampf oder bei Verhandlungen sehr nützlich sein konnte.
Im Fall der Leiche würde ihr das wohl kaum weiterhelfen.
»Ich bemerke deine Skepsis, Fischerjunge«, sagte sie und runzelte die Stirn. »Warum versuchst du es nicht selbst?«
Ich hörte den Spott in ihrer Stimme, aber mein Meister nickte zustimmend. »Ja, versuche, deine besondere Gabe zu nutzen, Kiran.«
»Genau, wieso benutzt du nicht deine besondere Gabe?«, echote Clea herausfordernd.
Das war eine gute Frage. Ein Seher war ich nicht, so viel war sicher. Manchmal verstand ich ja nicht mal meine eigenen Gefühle, wie sollte ich da die Handlungen anderer vorhersehen?
Was für besondere Fähigkeiten schlummerten also in mir? Welche Kräfte gab mir mein Spirit? Besonders war vor allem, dass ich ihn sehen konnte. Nicht durch viel Übung und Meditation, wie es bei den übrigen Phari der Fall war, sondern einfach immer. Er war ständig da, wie ein Fettfleck auf der Brille. Egal wie sehr ich es versuchte, er verschwand einfach nicht. Niemals. Ein Spirit, der losgelöst von einem Körper existierte. Ein unglaubliches Mysterium, das niemand erklären konnte. Am Anfang waren die Meister in helle Aufregung verfallen, als ich ihnen von meinem Spirit erzählt hatte. Sie befragten mich. Wieder und wieder. Hinter geschlossenen Türen studierten sie Aufzeichnungen, um eine Erklärung für das Phänomen zu finden. Als sie keine fanden, glaubten sie, ich hätte gelogen. Und mittlerweile hatten sie das Interesse an meinem Fall verloren. Doch auch wenn niemand mehr darüber sprach.
Er war da. Immer.
Ich sah ihn an und er sah mit großen Augen zurück. Ein sanftes Leuchten ging von ihm aus, beinahe hypnotisch. Es löste die Grenzen seines Körpers auf, sodass seine Form nur zu erahnen war.
Willst du mir helfen?, fragte ich ihn wortlos.
Und wie immer hüllte er sich in Schweigen.
Nutzloser Geist!
Auch wenn mein Meister ihn für etwas Besonderes hielt, war ich mir da nicht ganz so sicher. Ich würde ihn eher als »stur« und »eigensinnig« bezeichnen.
Wenn es nach den anderen Meistern ging, war ich »talentlos«, jemand, der nur auf Basisfähigkeiten zurückgreifen konnte, jene Kräfte, die der Spirit mir durch unsere Verbindung geschenkt hatte. Es war keine Magie, wie manche glaubten, eher ein zusätzlicher Sinn, den die Phari hatten. Ein Sinn, der uns mit unserer unmittelbaren Umgebung verband.
Das Geheimnis dabei war Licht. Es war der Leiter unserer Kräfte, die sich nun im Raum ausbreiteten. Auf den Sonnenstrahlen erkundeten sie den Raum. Glühende, helle Finger, die sich über den Boden und die Wände tasteten. Auf der Suche nach einer Spur.
»Ich finde nichts«, brummte ich frustriert und schritt auf ein Fenster zu. Dabei tat ich so, als wollte ich mir einen Überblick über die Straße verschaffen. In Wirklichkeit inhalierte ich die frische Luft, die durch den Spalt strömte. Der süßliche Leichengeruch war kaum auszuhalten. Ich hatte das Gefühl, mit jedem Atemzug würde ich selbst ein Stück verwesen.
»Kiran ist genervt«, petzte Clea und ich warf ihr einen wütenden Blick zu. »Außerdem ekelt er sich vor dem Geruch.«
Auch wenn jeder Phari aus der Gestalt seines Spirits ein großes Geheimnis machte, war ich mir sicher, dass Cleas wie ein hässlicher Rattenschakal aussah.
»Ich glaube einfach nicht, dass wir hier etwas finden. Warum sollten wir mehr Glück haben als die Ermittler vor uns?«
»Weil wir Phari sind.« Clea war zuversichtlich. »Zumindest der Meister und ich … Bei dir bin ich mir nicht so sicher … Mithilfe des Lichts werden wir etwas finden.«
Natürlich fanden sie nichts.
~
Seit einiger Zeit beschäftigte Tokito das Rätsel der Blutlosen. Es gab die wildesten Theorien über diese Verbrechen. Das Werk eines einzelnen Serienmörders wurde für ebenso möglich gehalten wie die Tat einer Sekte oder einer Organisation von Bluthändlern. Einige behaupteten sogar, dass ein Dämon dahinterstecken würde.
Das Einzige, was alle Leichen gemeinsam hatten, war, dass man sie hatte ausbluten lassen. Und von diesem Blut wurde nie auch nur ein Tropfen gefunden.
Laut Cleas Recherche waren die meisten Leichen vom Handclan obduziert worden, weshalb das Hospital unsere nächste Anlaufstelle war. Die Hand war ein Clan, der sich auf Medizin und Forschung spezialisiert hatte. Seine Mitglieder galten als klug, wissensdurstig und rational. »Bei den Händen besteht selbst der Reinigungsdienst aus Akademikern«, so scherzte man.
Ihnen gehörten die besten Krankenhäuser und Apotheken von Tokito. Sie hatten als einziger Clan keine Krieger. Das mussten sie auch nicht. Ihr medizinisches Wissen war ihre Macht. Kein anderer Clan wollte es sich mit denen verscherzen, auf die sie im Notfall angewiesen waren.
~
Scheinbar waren unsere Ermittlungen nicht unbemerkt geblieben. Als wir das Hospital betraten, wurden wir bereits erwartet.
Ein Mann in eng anliegendem, gebügeltem Kittel bat uns, ihm zu folgen. Doch er brachte uns nicht zu irgendeinem niederen Stationsarzt, sondern zu einem Mann, der mit jeder Faser seines Körpers ausstrahlte, dass er wichtig war. An seinem Kittel steckte eine goldene Brosche in Form einer Hand, die verriet, wer er war. Allerdings hätte es den Schmuck nicht gebraucht.
Der Doktor war der Anführer der Hände. Ihr Fürst. Darum war jedem in Tokito sein Gesicht bekannt. Vor ein paar Monaten hatte er das Amt von seiner Mutter übernommen.
Clea und ich sahen uns an.
»Warum kümmert sich ein Fürst um die Blutlosen?«, wisperte ich.
»Weil wir Phari sind«, erwiderte Clea. »Ich vermute, das macht alles gleich wichtiger.«
»Seid gegrüßt«, sagte der Doktor. »Ich habe gehört, dass ihr euch der Mordserie der Blutlosen annehmt.«
»Ganz genau.« Meister Konoha nickte. »Haben die Obduktionen etwas ergeben?«
»Alle Opfer haben das gleiche Verletzungsmuster, was letztendlich durch den Blutverlust zum Tode geführt hat«, berichtete der Doktor.
»Es gab keine andere Todesursache?«, hakte der Meister nach. »Waren sie am Leben, als sie ausgeblutet wurden?«
Der Doktor nickte. »Im Gewebe fanden wir Rückstände eines Betäubungsmittels. Sie waren also wahrscheinlich nicht bei Bewusstsein, als es passierte.«
»Klingt, als wäre ein Fachmann am Werk«, bemerkte Clea. »Jemand, der sich mit Medizin auskennt.«
Der Doktor zog missbilligend die Stirn in Falten. Offenbar gefiel es ihm nicht, dass sich eine neunmalkluge Novizin einmischte. »In der Tat verwenden wir eine ähnliche Technik, um die Körper für unsere Medizinstudenten vorzubereiten. Wir lassen das Blut ab und befüllen die Arterien stattdessen mit Formaldehyd, um die Körper vorübergehend zu konservieren. Aber diese Menschen sind natürlich bereits tot.«
»Also könnte der Täter eine Hand sein?«, hakte Clea nach.
Die Mine des Doktors war wie eingefroren. Es war unmöglich, seine Emotionen aus ihr zu lesen. Für Clea jedoch ein Kinderspiel.
»Ihm gefällt es nicht, dass wir hier sind«, raunte sie mir zu.
»Wahrscheinlich hat er etwas Besseres zu tun«, mutmaßte ich.
»Oder er fürchtet sich vor dem Staub, den wir aufwirbeln könnten«, flüsterte sie, bevor sie ihre Frage noch mal an den Fürsten richtete: »Also, was ist Eure Einschätzung dazu?«
Wenn die Blicke des Doktors töten könnten, wäre sie tot umgefallen.
»Nein.« Seine Worte waren kalt und schneidend. »Ich denke nicht, dass eine Hand dafür verantwortlich ist.«
»Und warum nicht?«
»Ich stelle eine Gegenfrage, Novizin. Warum sollte eine Hand das tun?«
Der Meister räusperte sich, aber wenn Clea einmal Fahrt aufgenommen hatte, war sie nicht mehr zu bremsen.
»Um das Blut für die Blutspende zu benutzen, die Ihr in Euren Hospitalen anbietet«, mutmaßte sie.
»Zügelt eure Schülerin, Meister Phari«, verlangte der Doktor und wandte sich demonstrativ von ihr ab.
»Das habe ich schon oft versucht«, seufzte Konoha. »Es ist hoffnungslos.«
Clea war niemand, der sich zügeln ließ. Sie marschierte zurück in das Sichtfeld des Fürsten und baute sich dort auf. »Das Thema ist Euch höchst unangenehm«, verkündete sie. »Ich spüre Eure Furcht. Habt Ihr Angst vor dem, was wir herausfinden könnten? Außerdem seid Ihr sauer. Vermutlich auf mich.«
Ich musste auflachen, was die Aufmerksamkeit des Doktors auf mich lenkte. Schnell versuchte ich, mein unprofessionelles Verhalten mit einem Husten zu kaschieren.
»Möchtest du auch etwas dazu beitragen, Novize?«, fragte der Doktor lauernd.
»Nein. Aber ich wäre auf Eure Antwort gespannt.«
Clea hatte einen siebten Sinn für unangenehme Fragen. Vielleicht würden wir den Fall doch schneller lösen als gedacht.
Der Doktor ging auf mich zu und blieb vor mir stehen, um mit prüfendem Blick mein Gesicht und meinen Körper zu studieren. Ich wusste, dass es vor allem die Tätowierungen waren, die sein Interesse weckten. Ein blauer Pfeil auf dem Kinn. Ebenso wie auf Hand- und Fußrücken. Und Linien, die sie mit dem Kreis auf meiner Brust verbanden. Es war das Symbol des Chaos, das mich für immer zeichnete. Und das mich zum Außenseiter machte, denn jeder wusste, was das Tattoo bedeutete.
»Ich habe von dir gehört. Dem bemitleidenswerten Jungen, der in die Triade hineingeboren wurde. Ist es wahr, dass deine Eltern dich umbringen wollten?«
Mein Spirit verzog sein Maul, als habe er einen vergammelten Fisch verschluckt. Offenbar mochte er den Doktor ebenso wenig wie ich.
»Ist es wahr, dass Eure Mutter Eure Kittel bügelt?«, konterte ich.
»Wie kannst du es wagen?«, zischte der Doktor. Er wandte sich an meinen Meister. »Eure Schüler haben keinen Respekt.«