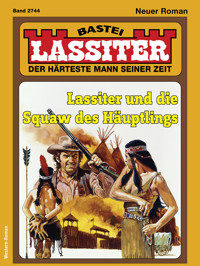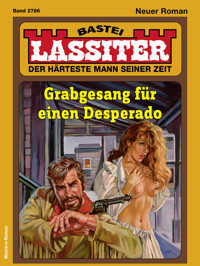1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Nach Chiricahua 1 bis 8 jetzt die große Saga um den Apachen-Häuptling
Mit seinem großen achtbändigen Epos "Chiricahua – Die Apachen-Saga" beeindruckte Pete Hackett die Freunde des historischen Western-Romans.
Doch das Schicksal der Apachen ließ ihn nie los. Jetzt lässt er mit "DIE COCHISE SAGA" eine Fortsetzung und Ergänzung folgen.
Dies ist der letzte Band der Geschichte von Cochise, dem Häuptling der Chiricahua-Apachen ... Folgen Sie Pete Hackett, diesem einmaligen Kenner der Geschichte des Westens in dieses einzigartige Abenteuer.
Umfang: 120 Taschenbuchseiten pro Band
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Die Cochise Saga Band 4
Cassiopeiapress Western-Serial um den großen Apachenhäuptling
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenDie Cochise Saga Band 4
von Chiricahua-Autor Pete Hackett
Nach Chiricahua 1 bis 8 jetzt die große Saga um den Apachen-Häuptling
Mit seinem großen achtbändigen Epos "Chiricahua – Die Apachen-Saga" beeindruckte Pete Hackett die Freunde des historischen Western-Romans.Doch das Schicksal der Apachen ließ ihn nie los. Jetzt lässt er mit "DIE COCHISE SAGA" eine Fortsetzung und Ergänzung folgen.Dies ist der letzte Band der Geschichte von Cochise, dem Häuptling der Chiricahua-Apachen ... Folgen Sie Pete Hackett, diesem einmaligen Kenner der Geschichte des Westens in dieses einzigartige Abenteuer.
Umfang: 120 Taschenbuchseiten pro Band
Ein CassiopeiaPress E-Book
© by Author
© der Digitalausgabe 2014 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
www.AlfredBekker.de
Emmett Morris, der Postreiter ritt wachsam und voller Anspannung. Am Morgen war er in Tucson aufgebrochen, um Post nach Fort Bowie zu befördern. Der Postsack hing an seinem Sattel. Morris hielt das Gewehr in der rechten Hand. Es stand mit der Kolbenplatte auf seinem Oberschenkel.
Immer wieder überfielen Cochises Krieger Postkutschen und Postreiter. Es hatte bereits sieben tote Männer auf dem Weg zwischen Tucson und dem Fort am Fuße der Chiricahua Mountains gegeben.
Unablässig waren die Augen des Postreiters in Bewegung. Weit vor ihm buckelten die Dragoons. Sie lagen in flirrender Hitze. Die Luft schien zu kochen und ließ die Konturen verschwimmen. Die Sonne stand senkrecht über dem einsamen Reiter. Das Land, das ihn umgab, mutete an wie ausgestorben. Nicht mal Vögel zwitscherten. Die unerträgliche Hitze schien jegliches Leben gelähmt zu haben.
Emmett Morris fühlte sich nicht wohl in seiner Haut. Er hatte das Gefühl, von tausend Augen beobachtet zu werden – dunkle Augen, in denen der Hass glitzerte und die tödliche Leidenschaft glomm. Seit Jahren führten die abtrünnigen Apachen unter ihrem Häuptling Cochise einen erbarmungslosen Guerillakrieg gegen die Weißen im Lande. Die Armee war machtlos. Auf Friedensangebote jedweder Art hatte Cochise nicht reagiert.
Das Pferd unter Emmett Morris stampfte nach Osten. Dumpf pochten die Hufe, ab und zu klirrte die Gebisskette, manchmal knarrte das brüchige Leder des alten Sattels. Hin und wieder verließ Morris die Poststraße, die sich wie der Leib einer riesigen, graugelben Schlange vor ihm durch die Ödnis schlängelte, um von einer Anhöhe aus einen umfassenden Blick in die Umgebung zu werfen.
Beklemmung lag in der Luft – Tod und Unheil.
Und als der Postreiter wieder einmal auf seiner Fährte zurückblickte, sah er den Trupp Apachen. Es waren etwa ein Dutzend, und sie jagten in diesem Moment über den Kamm einer Bodenwelle hinweg.
Sie hatten sich farbige Tücher um die Köpfe gebunden, darunter wehte langes, schwarzes Haar im Reitwind. Der Pulk zog eine dicht wallende Staubfahne hinter sich her. Die Hufe der Mustangs schienen kaum den Boden zu berühren.
Emmett Morris schien für einen Augenblick lang das Blut in den Adern zu gefrieren. In seinen Mundwinkeln zuckte es. Im nächsten Moment zerrte er das Pferd herum, gab dem Tier den Kopf frei und drosch ihm rücksichtslos die Sporen in die Weichen. Der Vierbeiner begann zu laufen. Die Hufe verursachten dumpfes Getrappel und rissen Staubfahnen in die heiße Luft.
Pfeilschnell jagten die Apachen hinter dem Postreiter her. Geschickt wichen sie mit ihren wendigen Pferden Felsbrocken und Sträuchern aus. Die ersten Schüsse peitschten. Für Morris begann ein Wettlauf mit dem Tod. Sein Ziel waren die Felsen weiter östlich, zwischen die sich die Poststraße bohrte. Im Labyrinth von Felsen und Schluchten hoffte er den Apachen zu entkommen. An die Möglichkeit, sich auf einen Kampf einzulassen, dachte er nicht. Denn er konnte nur den Kürzeren ziehen.
Die wirbelnden Hufe des Pferdes unter Morris fraßen Yard um Yard, eine Viertelmeile, eine halbe. Die Felsformationen im Osten aber schienen dem Postreiter unendlich fern und unerreichbar. Sein Körper wurde mit jedem Sprung des Pferdes durchgeschüttelt. Das Tier lief wie von Furien gehetzt, als wüsste es, dass Leben oder Tod von seiner Kraft und Schnelligkeit abhingen. Bald aber bildete sich vor seinen Nüstern flockiger Schaum, und Morris fragte sich besorgt, wie lange das bereits ziemlich abgetriebene Tier dieses Höllentempo noch durchzuhalten vermochte. Irgendwann würde der Hufewirbel langsamer, schwerfälliger werden, mehr und mehr erlahmen. Aber noch lief der Vierbeiner mit monotoner Gleichmäßigkeit.
Die Apachen sprengten in stiebendem Galopp etwa zweihundert Yards hinter ihm her.
Morris warf einen Blick nach hinten und konnte selbst auf diese Entfernung ihre grimassenhaft verzerrten Gesichter erkennen. Tief geduckt saßen sie auf ihren Pferden. Wild schwangen sie die Gewehre und Kriegslanzen. Und immer wieder pfiffen ihre Geschosse hinter ihm her. Er konzentrierte sich wieder nach vorn.
Der Abstand schrumpfte zusehends. Es konnte nicht mehr allzu lange dauern, bis die Mustangs den Beweis erbrachten, dass sie dem besten Rennpferd an Leistungskraft überlegen waren. Emmett Morris wusste das und gab sich keinen Illusionen hin. Unruhe und Rastlosigkeit in ihm verstärkten sich. Seine Hoffnungen, ihnen zu entkommen, verflüchtigten sich wie Morgendunst in der Tageshitze.
Wieder flog sein Kopf herum. Die Apachen hatten bereits auf hundertfünfzig Yards aufgeholt. Er glaubte schon das Weiße in ihren Augen sehen zu können. Ihre Waffen schwiegen nun. Sie hatten eingesehen, dass sie nur ihr Blei verschwendeten, weil der Weiße ein viel zu unsicheres Ziel bot. Mit zäher Verbissenheit jagten sie hinter dem Postreiter her – im erschienen sie wie eine Meute hechelnder Bluthunde, wie der personifizierte Tod.
Die Bergflanken und Felswände rückten näher. Und Emmett Morris wollte schon aufatmen, als aus dem Maul eines Canyons vor ihm ein Rudel Apachen brach. Es war, als spuckte die Felswildnis sie aus. Deutlich hoben sie sich vom rotbraunen Hintergrund der Felswand ab. Und sie hielten geradewegs auf ihn zu. Unwillkürlich fiel Morris dem Pferd in die Zügel. Sofort drosselte das keuchende Tier seine Geschwindigkeit. Triumphgeheul und trommelnde Hufschläge brandeten von hinten heran.
Wie eine reißende Flut überschwappten das Grauen und die Angst das Bewusstsein des Postreiters. Blitzschnell überdachte er seine Lage. Sie hatten ihn in der Zange. Der Weg nach Osten war ihm verlegt. Zurück konnte er nicht. Also blieb nur die Flucht nach Süden oder Norden.
In auseinander gezogener Reihe preschten die Apachen heran. Morris zerrte das Pferd halb herum und lenkte es nach Süden. Unerbittlich trieb er das erschöpfte Tier wieder an. Er hatte sich in seinem Innersten mit einem gnadenlosen Kesseltreiben abgefunden.
Von zwei Seiten stoben die Apachen nun in einem spitzen Winkel auf ihn zu. Die Horde, die von Osten heranfegte, würde vor ihm den Schnittpunkt ihrer Wege erreichen. Die ursprüngliche Verfolgerrotte war keine hundert Yards mehr entfernt. Im vollen Galopp feuerte er blindlings auf diesen Pulk. Seine Kugeln klatschten mitten hinein in die herantobende Schar. Und sie lösten ein Chaos aus. Pferde stiegen, überschlugen sich und bildeten mit ihren Reitern ein Durcheinander, das sich einige Yards über den Boden wälzte. Die anderen Mustangs rasten in das Gewirr hinein, und im Nu bildete sich ein Knäuel ineinander verkeilter Pferde- und Menschenleiber. Wütendes, enttäuschtes Gebrüll erhob sich, Pferde wieherten qualvoll, und die durcheinander wirbelnden Apachen hatten Mühe, den auskeilenden Hufen zu entgegen.
Morris jagte noch drei, vier Kugeln in den Tumult hinein und riss sein Pferd zur Seite. Es gehorchte auf der Stelle.
Schließlich zeigte die Nase des Tieres wieder nach Osten.
Die Apachen, die parallel zu ihm in südliche Richtung jagten, durchschauten seine Absicht. Sie zerrten ihre rasenden Mustangs auf die Hanken, wendeten sie in einer hochschlagenden Staubwolke und rasten wieder zurück. Aber Morris hatte bereits mehr als fünfzig Yards gutmachen können. Und er spornte das Tier unter sich noch härter und gnadenloser an.
Die Krieger eröffneten das Feuer, als sie begriffen, dass der Weiße die rettenden Felsbastionen vor ihnen erreichen würde. Doch das wilde Auf und Ab des halsbrecherischen Galopps ließ keinen gezielten Schuss zu. Ein einzelner Reiter war mit blindlings abgefeuerten Kugeln eben viel schwerer zu treffen als ein ganzer Reiterpulk. Und so blieb der Erfolg, wie ihn Morris mit seinen Schüssen erzielt hatte, den Apachen versagt. Morris schickte ein Stoßgebet zum Himmel, dass keiner der Krieger auf die Idee kam, sein Pferd anzuhalten, um ihn mit einem gezielten Schuss aus dem Sattel zu holen.
Morris erwiderte das Feuer. Er schoss von der Hüfte aus und lenkte den Rotfuchs mit den Schenkeln. Sein Blei fegte zwei Pferderücken leer, ein Mustang überschlug sich. Die anderen konnten ausweichen. Dann war Morris’ letzte Kugel aus dem Lauf. Er stieß die Winchester in den Sattelschuh, griff nach dem Colt und nahm die Zügel mit der Linken.
Sein Pferd zeigte Ermüdungserscheinungen. Aber er lief immer noch schnell genug, um vor den Apachen den Eingang der Schlucht zu erreichen, die die Felswand wie ein klaffender Riss spaltete. Morris blickte zurück, das quirlende Durcheinander in dem zweiten Verfolgerpulk hatte sich aufgelöst. Die unversehrt gebliebenen Krieger hatten die Jagd wieder aufgenommen. Die Gruppe, die von Süden heraufpreschte, wurde langsamer, als fürchtete sie, dass der Weiße weitere Pferderücken leer fegte. Zwei Minuten - Minuten, die Morris wie eine Ewigkeit erschienen, jagte sein Pferd dahin. Hinter ihm verschmolzen die Verfolgergruppen zu einer einzigen Horde. Sie brachen die Jagd ab, aber Morris wusste, dass sie sich nur berieten, um dann das mörderische Treiben wieder aufzunehmen.
Emmett Morris begriff, dass er noch lange nicht in Sicherheit war. Sein Vierbeiner schien nur noch dahinzutaumeln. Er bremste ihn ein wenig, denn es war nicht auszuschließen, dass das treue Tier noch einmal seine letzten Reserven mobilisieren musste.
Plötzlich erklang hinter dem Postreiter wieder prasselnder Hufschlag. Die Apachen hatten sich zu einer alles entscheidenden Hetzjagd aufgerafft. Schnell holten sie wieder auf. Und aus dem Pferd des Postreiters war nichts mehr herauszuholen. Er war am Ende.
Die ersten Klippen säumten Morris’ Weg. Mit weit aufgerissenem Maul und pumpenden Lungen stolperte das Pferd - mehr als dass es lief - zwischen sie. Die Hufschläge der Apachenpferde waren deutlich angeschwollen. Rücksichtslos trieb Morris sein Pferd durch dorniges Gestrüpp, hinein zwischen die haushohen Steingebilde. Immer tiefer ging er in den Canyon hinein. Die steilen Wände zu beiden Seiten schienen sich oben zu vereinen. Nur ein schmaler Streifen des blauen, ungetrübten Himmels war zu sehen. Auf der Sohle der Schlucht war es düster wie zur Zeit der Abenddämmerung. Und das Brausen, das Morris’ Verfolger ankündigte, quoll zwischen die Felsgiganten und holte ihn ein.
Er verspürte Gänsehaut.
Er jagte in einen Seitencanyon und sprang hinter der Biegung vom Pferd. Dabei verstauchte er sich den Knöchel und sein Gesicht verzog sich, als der Schmerz in ihm hochschoss. Unvermittelt fühlte sich der Postreiter elend. Er verspürte Übelkeit, die von seinem Magen hoch kroch und ihm den Hals eng werden ließ. Mit rasselnden Lungen zog er sein Pferd in den Schutz eines Felsvorsprungs, lose schlang er die Zügelleine um den Ast eines Busches. Dann lud er das Gewehr und postierte sich hinter einem Felsklotz. Mechanisch zog er den Ladehebel durch.
Unter den herantosenden Hufschlägen schien die Erde zu erbeben, drohte die Schlucht einzustürzen. Schließlich donnerten die Apachen in Morris’ Blickfeld. Er hatte keine Zeit, sie zu zählen. Der Kolben flog an seine Schulter und er begann zu feuern. Die Krieger sprangen im vollen Galopp von ihren Pferden und stürmten schreiend auf ihn zu. Eine Woge der Panik überschwemmte Morris’ Bewusstsein. Er schaute dem Tod ins höhnisch grinsende Auge. Die Angst kam wie eine alles verschlingende Flut. Und dann wurde er getroffen. Emmett Morris taumelte gegen den Felsen, seltsamerweise verspürte er nicht den geringsten Schmerz. Eine zweite Kugel bohrte sich in seinen Körper. Und dann umringten ihn die Krieger. Ein Tomahawk sauste auf seinen Kopf hernieder …
*