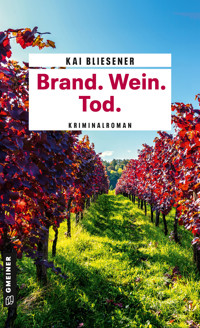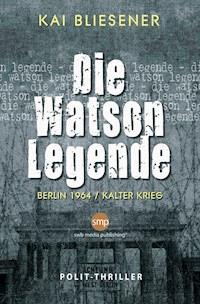Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SWB Media Publishing
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Carl Janson hatte mit seinem Agentenleben abgeschlossen und sich gemeinsam mit Martha Conrad zur Ruhe gesetzt. Doch ein Problem gab es noch, was er eher früher als später lösen musste – Marthas kleine Tochter lebte in einem sozialistischen Waisenhaus. Hilfe dabei verspricht ihm der Chef der Organisation, James Morrisson - wenn Janson einen letzten Auftrag für ihn erledigt. Er soll einen hochrangigen Pentagon-Mitarbeiter abfangen, bevor dieser geheime Unterlagen an die Sowjets übergeben kann. In Wien gerät er zwischen die Fronten und bekommt unerwartet Hilfe, doch seine Gegenspieler sind so mächtig wie brutal. Wird Janson den Verräter stoppen und kann er dann mit Martha und ihrer Tochter ein friedliches Leben führen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kai Bliesener
Die Conrad-Verschwörung
KAI BLIESENER
DIE CONRAD-VERSCHWÖRUNG
Thriller
swb media entertainment
Dieses Buch ist ein Roman. Die Handlung ist rein fiktiv und hat sich so nicht ereignet. Ähnlichkeiten zu lebenden oder verstorbenen Personen waren aufgrund der Natur der Sache nicht immer vermeidbar. Sie sind nicht beabsichtigt, aber von der grundgesetzlich geschützten Freiheit der Kunst umfasst.
Veröffentlicht im Südwestbuch Verlag,
einem Unternehmen der SWB Media Entertainment Jürgen Wagner, Waiblingen, März 2019
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2019
ISBN 978-3-96438-007-4
Jede Verwertung des Werkes außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Übersetzungen, Nachdruck, Mikroverfilmung oder vergleichbare Verfahren sowie für die Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen.
© 2019 Südwestbuch Verlag
SWB Media Entertainment, Gewerbestr. 2, 71332 Waiblingen
Printed in Germany
Umschlaggestaltung: Dieter Borrmann
Lektorat: Catrin Stankov
Satz: Julia Karl / www.juka-satzschmie.de
Druck und Bindung: Rosch-Buch Druckerei GmbH, 96110 Scheßlitz
Dieses Buch wurde auf chlor- und säurefreiem Papier gedruckt.
www.suedwestbuch.de
PROLOG
Die Frau stand schon eine viertel Stunde reglos an dem Grab. Weder die kühle Luft noch den Regen schien sie überhaupt zu bemerken. Die blonden Haare, zu einem Knoten im Nacken gebunden, waren inzwischen durchnässt und klebten in Strähnen am Kopf. Von der Schulter hing ihr eine Handtasche. Keine besondere Tasche, sie war nicht mal aus echtem Leder. Aber ihr Inhalt war von unschätzbarem Wert. Kam sie in die falschen Hände, drohte womöglich ein neuer Krieg, das wusste sie nur zu genau.
Eigentlich sollte sie hier gar nicht stehen, denn sie hatte keine Zeit, ihr Kontaktmann wartete auf sie. Doch es wäre ihr nicht möglich gewesen, nach Stuttgart zu kommen, ohne das Grab ihres Vaters zu besuchen. Es war das erste Mal seit seiner Beisetzung auf dem Waldfriedhof in Stuttgart. Aber es war viel passiert in den letzten Jahren und sie hatte keine Möglichkeit gehabt, ihm ihre Aufwartung zu machen.
Wie sehr sie ihn gemocht hatte, war ihr erst nach seinem Tod bewusst geworden. Zu Lebzeiten war ihre Beziehung bestenfalls eine funktionale gewesen. Mit dem Selbstmord der Mutter wenige Jahre nach dem Krieg war selbst diese Bindung verflossen. Jeder ging seiner Wege. Eine Karte zu Weihnachten und eine zum Geburtstag, mehr war nicht drin gewesen. Nicht einmal, als sie ihn nach ihrem schweren Autounfall auf der Solitude Strecke gebraucht hätte, war er für sie da. Zwar hatte sie selbst dafür gesorgt, dass er nichts davon erfuhr. Dennoch machte sie es ihm zum Vorwurf.
Die Nachricht vom Tod des Vaters hatte sie trotz allem getroffen. Sofort war sie in ihre alte Heimatstadt gereist, hatte alle Arrangements getroffen und ihm ein würdiges Begräbnis im kleinen Kreis der Familie organisiert. Eine Familie, die für sie längst keine mehr war.
So viel hätte sie ihm noch zu sagen gehabt. Das wurde ihr schmerzlich bewusst, als sie regungslos an seinem Grab verharrte. Doch er würde ihr nicht mehr antworten. Dabei war ihr Leben in Unordnung geraten, waren die zurückliegenden Monate eine immer währende Achterbahnfahrt von friedlichen Momenten und brüllender Gewalt.
Alles hing zusammen mit dem Mann, den sie liebte und für den sie sich entschieden hatte. Aber mit ihm war etwas in ihr Leben getreten, von dessen Existenz sie bis dahin nichts gewusst hatte. Es war eine Welt voller Verrat, Intrigen und Tod. Eine Welt, wie sie früher ansatzweise ihr Vater geschildert hatte, wenn er – was selten vorkam – vom Leben zur Zeit der Nazi-Diktatur erzählte. Lange Zeit hatte sie ihn für seine Arbeit für das Regime verurteilt, hatte mit ihm gestritten, ihm sogar an den Kopf geworfen, er hätte in Nürnberg auf die Anklagebank gehört. Doch inzwischen wusste sie es besser.
Der Regen war stärker geworden und sie warf einen verstohlenen Blick auf die Uhr an ihrem rechten Handgelenk. Die Zeit war dahingerast. Carl würde nicht kommen, obwohl sie es sich so sehr gewünscht, so sehr darauf gehofft hatte. Sie fürchtete, ihm sei etwas passiert. Eine Vorahnung und eine Welle unsichtbaren Schmerzes durchfluteten ihren Körper. Sie musste sich wieder auf den Weg machen.
In Gedanken nahm sie endgültig Abschied von ihrem Vater, da sie nicht wusste, wann und ob sie jemals zurück an sein Grab kommen konnte. Sie wusste nicht einmal, ob sie in ein paar Wochen, Tagen oder vielleicht sogar Stunden noch am Leben sein würde.
Der Scharfschütze freute sich, denn die junge Frau gab ein gutes Ziel ab, wie sie so dastand, den Kopf leicht nach vorne geneigt. Ihre Konturen, sogar die feinen und eleganten, aristokratischen Gesichtszüge, waren durch das Fadenkreuz zu erkennen. Eine sehr schöne Frau, dachte er. Der Haarknoten am Hinterkopf bildete den Mittelpunkt der vier aufeinander zulaufenden Linien, die durch zwei Kreise unterschiedlicher Größe geschnitten wurden.
Er lag gut verborgen hinter einer Steinmauer und einem Gebüsch etwas erhöht auf einer Decke, damit seine Kleider nicht schmutzig wurden, und hatte freie Sicht auf sein Ziel. Er wollte ihr den Moment lassen. Abschiede gehörten zum Leben. Sie waren wichtig. Das wusste niemand besser als er. Also sollte sie sich von ihrem Vater verabschieden, ehe sie sich von ihrem Leben verabschieden würde.
Außerdem schoss er nie jemandem in den Hinterkopf, wenn es sich vermeiden ließ. Obwohl die meisten gar nicht wussten, was mit ihnen geschah, wenn sie von einem Projektil getroffen wurden, so beobachtete er gerne den letzten Gesichtsausdruck der Menschen, deren Leben nur einen Augenblick später ausgehaucht war. Überhaupt mochte er keine Kopfschüsse, auch wenn sie in den meisten Fällen die sicherste Methode waren. Aber es war meist kein schöner Anblick.
Als er sah, dass die Frau aus ihrer Starre erwachte und sich leicht bewegte, krümmte sich sein Finger um den Abzugshahn. Sie drehte sich um, und hätte er nicht gute dreißig Meter entfernt unsichtbar in seinem Versteck gelegen, wären sich ihre Augen begegnet. Er visierte ihre Brust an. Genau an der Stelle, hinter der ihr Herz schlug und das Blut durch die Adern ihres Körpers pumpte, und drückte in dem Moment ab, als sie sich zur Seite drehte. Die Kugel traf ihren Oberkörper, wenn auch nicht mit voller Wucht. Doch der Aufprall war kräftig genug, dass sie augenblicklich zu Boden ging und ihr Körper hart auf die regennasse Erde und den Blumenschmuck klatschte. Kleine Wasserfontänen spritzten nach oben.
Der Scharfschütze überlegte einen Moment, ob ein zweiter Schuss notwendig sei. Doch als er durch das Zielfernrohr das rote Rinnsal sah, das sich mit dem Regen vermischte, war er zufrieden. Sein Job war getan. Jetzt konnte er auch den Namen lesen, der auf dem Grabstein eingemeißelt war, über den die junge Frau gestürzt war. Und von der er wusste, dass sie die Tochter des Mannes war, der hier begraben lag: Hermann von Conrad.
TEIL 1
Die Teilung der Welt
1. KAPITEL
Berlin, 18. Januar 1945
Hermann von Conrad kletterte aus dem dunklen Mercedes, der ihn von seiner Wohnung in Berlin-Köpenick zur Reichskanzlei in die Vossstraße gebracht hatte.
Es war längst dunkel geworden und die Straßen waren gespenstisch leer. Alles wirkte düster, trist und grau. Nur die gewaltigen roten Fahnen mit dem schwarzen Hakenkreuz auf weißem Grund verliehen der Szenerie surrealistisch wirkende Farbtupfer. Von Conrad schüttelte eine Zigarette aus seinem Etui, steckte sie sich an. Schnell nahm er ein paar tiefe Züge, so dass seine Lungen brannten. Während er rauchte und feststellte, wie schlecht der Geschmack des Tabaks war, schaute er die menschenleere Straße entlang. Dann warf er den Zigarettenstummel zu Boden und trat die Glut unter den missbilligenden Blicken der vier Wachmänner aus, die vor dem monumentalen Gebäude standen. Sie wirkten schon alleine durch die Größe der mächtigen Säulen des Eingangsportals verloren.
Die Neue Reichskanzlei stand für Protz, Prunk und den Größenwahn der Nationalsozialisten. Mit einer Gesamtlänge von mehr als 400 Metern demonstrierte der sich bis zur Wilhelmstraße erstreckende Bau die Macht und Herrlichkeit des Deutschen Reiches. Eines Reiches, das im Verfall begriffen war, schoss es Hermann von Conrad durch den Kopf. Das nach Entwürfen Hitlers erbaute Gebäude war ein wichtiger Mosaikstein des Reichskanzlers und seines noch nicht ausgeträumten Traums von der neuen Reichshauptstadt Germania. Er träumte weiter, während seine Truppen längst an allen Fronten auf dem Rückzug waren.
Von Conrad ging mit weit ausladenden Schritten über die Straße, den Treppenaufgang hinauf und brummte dabei dem Wachhabenden etwas zu, das »Heil Hitler« heißen mochte. Dessen rechter Arm schoss im selben Moment kerzengerade ausgestreckt zum unvermeidlichen Gruß nach oben. Gleichzeitig rief er von Conrad ein strammes »Heil Hitler!« entgegen.
Am oberen Ende der Treppe wartete ein kompakt gebauter Major der Waffen-SS. Sichtlich stolz auf seine schwarze Uniform und die rote Hakenkreuzbinde am rechten Oberarm stand er mit brutalem Gesicht und wilden Augen direkt unter dem mächtigen Reichsadler, der über den gewaltigen Türen schwebte. Mit seinen Krallen hielt der Greifvogel ein Hakenkreuz umfasst, das über der Schirmmütze des Majors aufragte. Unter der Kopfbedeckung war ein kaum wahrnehmbarer blonder Haaransatz zu erkennen. Zackig schlug der Major die Hacken mit einem Knall zusammen, der in der Weite des Portals ordentlich nachhallte. Von Conrad erwiderte den Führergruß des SS-Mannes mit dem Heben der rechten Hand. Erneut schallte ihm ein laut gebrülltes »Heil Hitler« entgegen, so dass es ihm eiskalt in die Knochen fuhr. Wie er die Nazis doch inzwischen hasste. Und der vor ihm stehende Major verkörperte alles, was sie so abstoßend machte. Selbst die fescheste Uniform machte aus einem Dummkopf keinen klugen Menschen.
»Herr von Conrad«, sagte der Major mit bayrischem Akzent. »Mein Name ist Josef Schüttler. Ich darf Sie zum Führer geleiten.«
Schon machte der Mann auf den Absätzen kehrt, verschränkte die Hände hinter dem geraden Rücken und seine blank polierten Stiefel knallten wie Peitschenhiebe über den Steinboden, während er durch die gewaltige Halle voranschritt. Von Conrad folgte ihm leicht kopfschüttelnd. Er hatte diese primitiven Kerle und ihr Gehabe sowas von satt.
»Bitte warten Sie. Ich sage dem Führer, dass Sie da sind.«
Schüttler öffnete die hohe und schwere Tür einen Spalt, nicht ohne vorher angeklopft zu haben, und verschwand dahinter.
Von Conrad wartete. Äußerlich wirkte er gelassen. Und doch hatte er Mühe, seine Nervosität zu bekämpfen. Er stand in der mehr als 140 Meter langen Marmorgalerie, die doppelt so lang wie die Spiegelgalerie in Versailles war und die deutsche Dominanz in Europa untermauern sollte. Von hier ging eine Tür zum Arbeitszimmer des Führers. Neben jedem der beiden Türflügel stand reglos ein Wachmann aus Hitlers Leibstandarte, die für die Sicherheit des Führers verantwortlich war.
Conrad, ein sehniger Mann von Ende dreißig. Mit seinem dunkelblondem Haar, das er streng zurückgekämmt hatte, wirkte er immer wie ein weltgewandter Herr mit galanten Umgangsformen. Beides war absolut zutreffend. Er entstammte einer alten Adelsfamilie, deren Verwandtschaftsgrade sowohl in die Königsfamilie jenseits des Ärmelkanals reichten, wie auch eng verzweigt mit der 1917 gestürzten russischen Monarchie waren. Wie der russische Familienzweig, war auch seine eigene Familie, wie im Übrigen fast der gesamte deutsche Adel, nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg ihrer Macht beraubt worden und musste anschließend hilflos den Wirren der Demokratie in der Weimarer Republik zusehen. Aus Angst, Deutschland könnte ebenfalls in die Hände der kommunistischen Revolutionäre fallen, war er anfangs ein glühender Verfechter des Aufstiegs der NSDAP. Die ganze Familie war früh in die Partei eingetreten, denn Adel und völkische Bewegung einte seit dem Kaiserreich der gemeinsame Antisemitismus und Militarismus. Außerdem hatten sie dieselben Feinde: die Republik, den Sozialismus und die organisierte Arbeiterbewegung. Doch schon bald nach der Machtergreifung Hitlers Ende Januar 1933, als der alte Reichspräsident von Hindenburg den österreichischen Gefreiten zum Reichskanzler ernannt hatte, waren in ihm erste Zweifel laut geworden. Längst war es den Nazis gelungen, die Massen mit dem leeren Gerede der Volksgemeinschaft in den Schlaf zu wiegen. Viele Adlige sahen in der SS ein verlockendes Angebot, weil sie ihren Machtanspruch in schneidigen Uniformen vortragen konnten und wieder Teil der herrschenden Elite waren. So war es nicht weiter verwunderlich, dass die Aristokraten rasch ihre Plätze im Staatsdienst fanden. Sie dominierten fortan wieder die Diplomatie und das Offizierskorps. Viele Mitglieder des alten preußischen Adels waren sogar töricht genug, an die Wiederkehr des Kaisers zu glauben, wenn Hitler nur lange genug an der Macht war. Von Conrad war solchen Schwärmereien nie erlegen.
Von Conrad war im Namen des Deutschen Reiches viel auf der Welt herumgekommen. Er war zunächst Konsulatssekretär in Kapstadt und später Vizekonsul in Madrid gewesen, ehe ihn Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop 1933 heim ins Reich und ins Auswärtige Amt berufen hatte. Schnell hatte er das Vertrauen des Amtsleiters erworben. Zudem war er bekannt für seine schnelle und stets pragmatische Arbeit, galt als verschwiegen und führertreu. Er gab sich alle Mühe, diesen Schein zu wahren und hatte bald schon Zugang zu militärischen und politischen Verschlusssachen.
Und doch war der Karrierediplomat eigentlich nur eine perfekte Tarnung für seine Arbeit im Verborgenen. Denn eigentlich arbeitete er für die Abwehr, den Militärgeheimdienst des Deutschen Reiches. Bereits 1929 hatte ihn der damalige Leiter des Dienstes, Oberstleutnant von Bredow, in seine Dienste gestellt. Und für Wilhelm Canaris, der seit 1935 Chef der Abwehr war, galt er als einer der erfolgreichsten Agenten des Dienstes. Canaris bezeichnete ihn immer gerne als seinen besten Mann im Osten. Denn während andere hinter den feindlichen Linien im Einsatz für Führer und Vaterland ihr Leben verloren hatten, war er noch immer ein erfolgreicher Doppelagent. Durch seine familiären Verflechtungen mit Russland war es ihm im Lauf der Jahre gelungen, sich eine ergiebige Identität als Spion zwischen den Fronten aufzubauen. Im NKWD galt der Abwehrmann als zuverlässiger Agent im Auswärtigen Amt, der wichtige Informationen nach Moskau lieferte. Und Canaris las immer wieder mit Freude die Berichte von Conrads, wenn er von einem seiner Ausflüge in die Stadt an der Moskwa zurückkam.
Dennoch war von Conrad überrascht, als ihn die Nachricht erreichte, der Führer persönlich wolle ihn sehen. Ihm war nicht einmal bewusst gewesen, dass Hitler jemals Notiz von ihm genommen hatte. Aufgrund seiner Funktion hatte von Conrad zwar immer wieder an Besprechungen teilgenommen oder mit an einer der Karten gestanden. Doch der Reichskanzler hatte lieber über das tausendjährige Reich philosophiert, als das Wort an jemanden wie von Conrad zu richten.
Nun stand eine heikle Mission bevor und es waren Canaris und von Ribbentrop, die ihn dem Führer als den richtigen Mann für diesen delikaten Auftrag empfohlen hatten. Er dachte einen kurzen Moment zurück an das Gespräch, das er am Vortag mit Canaris in dessen Büro am Tirpitzufer im Gebäude des Oberkommandos der Wehrmacht geführt hatte. Er hatte am Schreibtisch des siebenundfünfzigjährigen Mannes Platz genommen. Der schlanke, weißhaarige Admiral stand in Uniform am Fenster und sah auf die winterliche Spree hinaus.
»Hitler will Sie sehen«, hatte der ehemalige U-Boot Kommandant Canaris ohne lange Vorrede begonnen. »Gleich morgen. Sie sollen in die Reichskanzlei kommen.«
»Der Führer will mich sprechen?«, hatte von Conrad sichtlich verdutzt nachgefragt.
»Sie gelten als einer unserer besten Agenten. Zudem sind Sie mit einem großen diplomatischen Geschick ausgestattet. Daher hat er Sie für eine Mission ausgesucht, die vielleicht über das Schicksal des Reiches und die Zukunft Deutschlands entscheiden wird.«
Von Conrad hatte gespannt gewartet. Er wusste, dass Canaris im Verdacht stand, Sympathien für den Widerstand gegen Hitler zu hegen, auch wenn ihm bislang niemand etwas nachweisen konnte. Auch der von der Gestapo erhobene Vorwurf, der Abwehrchef sei in das Attentat vom 20. Juli 1944 verwickelt, blieb unbestätigt.
»Wissen Sie, von Conrad, der Krieg ist längst verloren. Vielleicht war er das vom ersten Schuss an. Und ich muss jeden Tag damit rechnen, dass mich womöglich die Gestapo abholt. Doch bis es so weit ist, will ich wenigstens versuchen, es nicht noch schlimmer zu machen.« Er machte eine kurze Pause, ehe er weitersprach. »Es war der Vertrag von Versailles, der es Hitler ermöglicht hat, an die Macht zu kommen. Die Reparationszahlungen und die damit verbundene Not in der Bevölkerung haben den Boden bereitet. Deshalb wurde die Weimarer Republik liquidiert. Hitler will einer Wiederholung von Derartigem nach einem Ende des Krieges vorbeugen. Deshalb habe ich Sie ehrlich gesagt Hitler für den Einsatz empfohlen und von Ribbentrop hat dem zugestimmt. Es geht darum, die Kämpfe an der Ostfront umgehend einzustellen. Da Hitler niemals eine Niederlage eingestehen würde, setzt er alles daran, Stalin zu einem Waffenstillstand zu bewegen. Dadurch rechnet er sich einen vielleicht entscheidenden Vorteil für die Westfront aus, da er alle Truppen dorthin verlegen könnte. Natürlich tut er dies nicht aus Nächstenliebe. Nein, nur aus Eigeninteresse. Er will sich die Option eröffnen, im Fall einer Niederlage mitsamt seiner Regierung ins Exil gehen zu können, um von dort am Wiederaufbau des Reiches zu arbeiten.«
Canaris drehte sich um und sah von Conrad an. Er wirkte wie ein freundlicher älterer Herr und ein leichtes Lächeln umspielte seinen Mund. »Wissen Sie, ich glaube der Mann ist wahnsinnig geworden. Den ersten Teil des Planes kann ich unterstützen, weil es vielleicht vielen Soldaten das Leben rettet. Ich sehe längst keinen Sinn mehr darin, sie zu opfern. Den zweiten Teil würde ich als hanebüchen einstufen. Daher meine Bitte an Sie: Reisen Sie im Auftrag des Führers nach Russland. Handeln Sie einen Vertrag aus und sehen Sie zu, dass Sie mit auf die Konferenz von Jalta kommen. Denn dort wird über unsere Zukunft entschieden, nirgendwo anders. Die Amerikaner und die Russen glauben, wir wüssten nichts von der geheimen Zusammenkunft. Aber selbstverständlich haben wir schon längst davon erfahren. Stalin, Roosevelt und Churchill werden dort die Welt unter sich aufteilen. Und Sie sollten dabei sein, damit Sie uns berichten können. Und wenn es gelingt, Stalin zu einem neuen Abkommen zu bewegen, dann hat er auch ein Pfand in der Hinterhand. Ich weiß, wir schmieden hier eine absurde politische Allianz. Aber es geht ums Überleben. Die weiteren Details wird Ihnen Hitler selbst schildern.«
Er streckte von Conrad die Hand entgegen. »Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe Sie bald wiederzusehen.«
Von Conrad hatte sich verabschiedet und war gegangen.
Zwischen dem Gespräch und seiner Unterredung beim Führer lagen nun eine beinahe schlaflose Nacht und ein unruhiger Tag im Büro. Viele Gedanken waren in seinem Kopf umhergeschossen.
Die Ironie der Geschichte lag darin, dass von Conrad längst erkannt hatte, wie verblendet er all die Jahre gewesen war. Inzwischen hielt er Hitler und seine Regierung für Pack, das sein Deutschland ins Verderben gerissen hatte. Schon seit seiner Berufung ins Auswärtige Amt war er der Überzeugung, die Diktatur in Deutschland könne nur durch eine militärische Niederlage Hitlers beendet werden. Und jetzt war er hier, um eine Mission zu erfüllen, die das Deutsche Volk von seinem Leid erlösen sollte.
Die mächtige Tür schwang auf und heraus kam der SS-Mann, der Conrad beim Führer angemeldet hatte. Er bedeutete dem Diplomaten einzutreten. Von Conrad ging an ihm vorbei und trat in den über 400 Quadratmeter großen und 10 Meter hohen Raum. Überall dominierten Marmor, Palisander und edles Rosenholz. Das Rosenholz an den Wänden, die Kassettendecke bestand aus Palisander, während der Boden mit Steinplatten ausgelegt war. Fast am anderen Ende des Raumes stand der handgefertigte, großzügig dimensionierte und mit zahlreichen Intarsien verzierte Schreibtisch Hitlers. Dazwischen der aus einer fünf Meter langen und über eineinhalb Meter breiten Marmorplatte gefertigte Kartentisch. An den Wänden hingen zahlreiche Gemälde, wie sie Hitler sicher selbst gerne gemalt hätte. Von Conrad fand sie ausnahmslos hässlich.
Auf den Kartentisch gelehnt stand der fünfundfünfzigjährige verkappte Kunstmaler aus Niederösterreich in seiner Uniform und starrte mit stechendem Blick auf eine Landkarte. Wie sehr der gebildete Aristokrat den Barbaren, dessen einziges Bildungserlebnis die Front im Ersten Weltkrieg gewesen zu sein schien, hasste, wurde ihm jedes Mal schmerzlich bewusst, wenn sie aufeinandertrafen. Hitler schien ihn gar nicht zu bemerken. Von Conrad wusste, dass es in diesen Momenten besser war, still abzuwarten. Eine Uhr tickte laut und er nahm einen süßlichen Schweißgeruch wahr, der von der Uniform des Führers auszugehen schien. Es brannte unangenehm in der Nase. Von Conrad zählte die Sekunden, da er sonst nichts zu tun fand. Ansonsten war es vollkommen still in dieser Halle der Macht des teutonischen Herrschers.
»Auch wenn wir den Krieg verlieren sollten«, drang einige Zeit später ein anschwellendes dumpfes Grollen vom Kartentisch zu von Conrads Ohren herüber, »werden wir niemals kapitulieren, das können Sie mir glauben, Herr von Conrad.«
Hitler richtete sich auf. Er wirkte gar nicht so furchteinflößend und sah von hinten betrachtet mit seinen streng gescheitelten Haaren und dem inzwischen leicht krummen Rücken wie seine eigene Karikatur aus.
»Sollten wir untergehen, dann nehmen wir die Welt mit uns«, sagte er und rollte dabei das R, wie es für ihn charakteristisch war, während er sich zu Hermann von Conrad umdrehte. Dieser erschrak beinahe, als ihm bewusst wurde, was der Mann mit dem Zweifingerbart auf der Oberlippe gesagt hatte. Hitler, tote Augen und blasse Haut, war bereit sein Volk zu opfern, um seinen eigenen Platz in der Geschichte zu sichern. Dabei glaubte von Conrad in die blitzenden Augen eines vollkommen Irren zu schauen.
Eine halbe Stunde später führte ihn Major Schüttler durch eine fünf Meter hohe Tür zunächst in eine mit rosafarbenem Marmor ausgekleidete Vorhalle und von dort in den imposanten Ehrenhof mit seinen fast siebzig Metern Länge und knapp dreißig Metern Breite. Durch die Höhe von achtzehn Metern wirkte er mächtig und markierte einer Schleuse gleich einen Übergang von Hitlers Büro zum Wilhelmsplatz.
Vorbei an den in von Conrads Augen misslungenen Plastiken des Bildhauers Arno Breker, die zu beiden Seiten des Hofes aufgestellt waren, traten die beiden Männer kurz darauf in die Nacht hinaus. Sie verabschiedeten sich mit »Heil Hitler« voneinander und Schüttler verschwand wieder in der Reichskanzlei, während von Conrad in den wartenden Mercedes 770 stieg. Im Inneren war es angenehm warm und er wies dem Fahrer das Ziel an. Dann schloss er müde die Augen und sank in die ledernen Sitzpolster. Seine Gedanken kreisten um die kommenden Tage. Er war aufgewühlt, gab sich jedoch alle Mühe, diesen Zustand, den man ihm bei der Gestapo oder Mitgliedern der SS wenigstens als Schwäche, wahrscheinlich aber sogar als Angst ausgelegt hätte, zu verbergen. Denn wer konnte wissen, auf wessen Gehaltsliste zum Beispiel der Fahrer stand.
Hitler hatte ihn also auf Empfehlung von Admiral Canaris und Amtsleiter von Ribbentrop einbestellt, weil beide ihn als absolut integer und vertrauenswürdig bezeichnet hatten. Man vertraute ihm. Oder misstraute man ihm und stellte ihm eine Falle, in die er bereitwillig getappt war? Diesen Männern war alles zuzutrauen. Also musste er vorsichtig sein, würde seinen Auftrag erfüllen und hoffen, keinen Fehler zu machen, der ihn vor ein Erschießungskommando brachte.
Von Conrad hatte nicht viel Zeit, dann würde er aufbrechen müssen. Eine lange Reise durch eine vom Krieg zerstörte Welt lag vor ihm. Und er hatte einen geheimen Auftrag des Mannes in der Tasche, von dem er sich wünschte, er wäre der Bombe seines Freundes Claus Schenk Graf von Stauffenberg zum Opfer gefallen. Aber vielleicht lag in dieser Mission auch eine Chance.
Der Fahrer steuerte den Wagen durch das Portal in den großzügigen Garten eines prächtigen Herrenhauses, das vom Krieg offensichtlich bislang verschont worden war. Von Conrad stieg aus, bedankte sich und verschwand in dem massiven Steinbau.
Margot von Conrad saß am Tisch im Esszimmer und hatte den Volksempfänger eingeschaltet. Sie lauschte gespannt einem Bericht über die Lage an der Ostfront. Hermann von Conrad wusste, dass alle Berichte seit Längerem nur das Ziel hatten, dem deutschen Volk etwas vorzugaukeln. Niederlagen und Verluste wurden in heroische Siege umgemünzt und gleichzeitig der Opferwille der Bevölkerung beschworen. Er trat an die Kommode, auf der das in dunkles Holz gefasste Gerät stand, und schaltete es an einem der beiden Drehknöpfe aus. Margot sah ihn traurig an.
»Stimmt das, was sie uns im Radio erzählen?«, fragte sie ihren Mann. »Haben unsere Soldaten Erfolge an der Front oder ist der Krieg längst verloren und Hitler verschweigt es seinem Volk?«
Sie stand auf und machte einen Schritt auf ihn zu. Er schloss sie in seine Arme. Seine Frau war schon seit einiger Zeit verstört, als Gerüchte aufgekommen waren, Stalins Truppen seien unaufhaltsam auf dem Vormarsch und würden Hitlers Armee in die Flucht schlagen. Sie hatte Angst vor der Roten Armee, von der es hieß, ihre Soldaten seien wilde Bestien, würden plündern und brandschatzen, die Männer erschlagen und die Frauen vergewaltigen.
»Liebes, du brauchst keine Angst zu haben. Der Krieg wird nicht mehr ewig dauern.«
Er wusste selbst nicht, warum ihm der Mut fehlte, seine eigene Frau mit der Wahrheit zu konfrontieren. Hitler hatte sein Volk dem Untergang geweiht, spätestens von dem Tage an, an dem er Polen überfallen hatte. Wahrscheinlich aber schon mit dem Tag seiner Machtübernahme. Daran konnten auch die anfänglichen Erfolge nichts ändern.
»Ich bin sicher, die Alliierten werden Hitler in den nächsten Monaten zur Kapitulation zwingen. Er ist mit seinem Krieg am Ende.«
Er sprach leise, denn er hatte in den letzten Monaten gelernt, niemandem mehr zu trauen. Der Fanatismus für die Faschisten im Land kannte trotz der drohenden Niederlage keine Grenzen. Die Gestapo und die SS hatten ihre Augen und Ohren überall in diesem von Paranoia durchsetzten Staat.
»Ich muss fort«, flüsterte er seiner Frau ins Ohr. »Hitler schickt mich nach Russland. Ich soll in Moskau helfen, die Kämpfe zu beenden. Es kann sein, dass ich nicht zurückkomme.«
Er spürte ihre feuchten, stummen und warmen Tränen auf seiner Haut und wusste, er brauchte nichts mehr zu sagen. Sie waren sich immer bewusst gewesen, dass dieser Moment kommen konnte. Doch jetzt, wo er da war, fühlte er sich trotz aller Vorbereitung seltsam an.
Sie standen einige Minuten eng umschlungen, stumm und bewegungslos im Esszimmer. Nur das Ticken der Wanduhr durchbrach die Stille. Dann lösten sie sich voneinander und Hermann von Conrad ging wortlos nach oben. Er packte ein paar Sachen in seinen Koffer. Dann ging er vom Schlafzimmer hinüber zum Zimmer seiner Tochter Martha, schob vorsichtig die Türe auf, schlich auf leisen Sohlen an das Bett des Mädchens und setzte sich. Ihr schmaler Körper zeichnete sich unter der warmen Daunendecke ab, die dichten blonden Haare waren auf dem weißen Kopfkissen ausgebreitet. Sie atmete ruhig und schien tief zu schlafen. Er strich ihr über die Wange und spürte, wie ihm Tränen in die Augen schossen. Sie würde ihren zehnten Geburtstag ohne ihn feiern müssen. Vielleicht musste sie sogar alle ihre kommenden Geburtstage ohne ihren Vater feiern. Für diesen Fall hoffte er, dass sie wenigstens wissen würde, dass er einen wichtigen Teil zur Beendigung dieses schrecklichen und mörderischen Krieges beigetragen hatte und ein klein wenig stolz auf ihn wäre. Als er sich nach vorne beugte und Martha einen Kuss auf die Wange gab, flatterten ihre Augenlider leicht und er fürchtete schon, sie könne aufwachen. Aber sie schlief weiter und von Conrad erhob sich und verließ den Raum.
Draußen stand Margot. Sie sah verloren aus in dem langen, hohen und hell erleuchteten Gang mit den dunklen Holztüren zu beiden Seiten. Neben ihr stand ein Koffer auf dem Teppich. Im ersten Moment dachte er, es sei sein Koffer. Doch auf den zweiten Blick erkannte er, dass es ein anderes Modell war.
»Ich … wir kommen mit, Hermann«, warf sie ihm entgegen. »Was macht das hier alles noch für einen Sinn. Und ich kann den Gedanken nicht ertragen, ohne dich unter diesen Barbaren weiterleben zu müssen. Und wenn die einen weg sind, kommen die aus dem Osten nach. Ich habe schon gepackt und muss nur noch Martha holen.«
»Das geht nicht. Es ist zu gefährlich. Ihr müsst bleiben. Ich kann euch nicht mitnehmen, so gerne ich es würde. Es geht nicht«, sagte er und sah sie flehentlich an.
Er machte einen Schritt auf sie zu, breitete seine Arme aus und murmelte: »Es tut mir leid.«
Sie nahm den Koffer auf, rannte ins Schlafzimmer und warf mit einem lauten Scheppern die Türe zu. Durch das Holz konnte er ihr Schluchzen hören. Hermann von Conrad blieb ein paar Augenblicke ratlos stehen, dann machte er kehrt, schnappte seinen Mantel und seinen Koffer und ging die breite Steintreppe hinab. An der Wand hingen mehrere Gemälde, die ihren morbiden und düsteren Charme versprühten und einige seiner Vorfahren zeigten. Er öffnete die Haustüre und machte einen Schritt nach draußen, ehe er einen Moment zögerte, sich halb umwandte, innehielt und dann doch die schwere Eichentüre hinter sich zuzog. Dann stieg er in den Wagen, der auf ihn wartete, und fuhr davon.
Ein kurzer Blick nach hinten, und er hätte Margot weinend am Fenster stehen sehen. Der Fahrer brachte ihn zum Lehrter Bahnhof, von wo er seine Reise in Richtung Osten antrat. Da er nicht auf direktem Weg reisen konnte, musste er mehrfach umsteigen. Es würde mehrere Tage dauern, bis er sein Ziel erreichen würde.
2. KAPITEL
Jalta, 4. bis 11. Februar 1945
Es war ein strahlender, aber frostiger Morgen auf der in weiten Teilen in Trümmern liegenden Halbinsel Krim. Die Fahrzeugkolonne rumpelte über die zerstörten und nur für diesen Anlass rasch instand gesetzten Straßen der einst stolzen und inzwischen heftig vom Krieg gezeichneten Landzunge im Süden der Ukraine. Es war der Sturheit Stalins zu verdanken, dass die anstehende Konferenz in der ehemaligen Sommerresidenz von Zar Nikolaus II. im Seebad Jalta am Schwarzen Meer stattfinden würde. Für den kranken Franklin D. Roosevelt war die Anreise eine Tortur. Die eigentliche Ironie lag aber in der Tatsache, dass Josef Stalin mit aller Macht darauf gedrängt hatte, die streng geheime Konferenz in dem vor der Revolution der Bolschewiki für den russischen Adel erbauten Kurort abzuhalten. Roosevelt und seine Leute hatten auf einen Ort am Mittelmeer gedrängt, um die Reise nicht unnötig zu erschweren, doch der walrossbärtige Russe war hart geblieben, hatte es mit der eigenen Gesundheit begründet. Und hatte gewonnen. Die Berater des US-Präsidenten hatten am Ende empfohlen, auf den Wunsch des russischen Machthabers einzugehen, um ihn möglichst bei Laune zu halten. Selbst der alte Winston Churchill willigte ein. So stand in den folgenden acht Tagen nicht weniger als die Teilung der Welt auf der Tagesordnung.
Marc Watson, ein junger aber erfahrener Agent des US-Geheimdienstes OSS, saß im Fonds des großen dunklen Wagens. Neben ihm James Morrisson, offiziell ein Diplomat im Dienst des Weißen Hauses. Doch in Wahrheit ebenfalls ein Offizier des OSS. Morrisson genoss das Vertrauen von Franklin D. Roosevelt, der ihm während der letzten Monate mehrere heikle diplomatische Missionen anvertraut hatte.
Watson dagegen hielt sich eher im Hintergrund und sorgte als einer von vielen Bewachern für die Sicherheit des Präsidenten. Die beiden Männer waren in dunkle Anzüge gekleidet. Sie kannten sich von gemeinsamen Einsätzen hinter den feindlichen Linien. Was sie vor allem anderen einte, war ihr Hass auf Nazis. Mehr noch als Stalin hatte Hitler die Weltordnung gestört und mit einem bisher nie gekannten Vernichtungsfeldzug überzogen und jeder von ihnen wollte seinen Teil dazu beitragen, um diesen Wahnsinn zu beenden, der Millionen von Menschen das Leben gekostet hatte.
»Was glaubst du, James«, begann Marc Watson und wandte sich an den Mann neben ihm, »werden sich die großen drei verständigen? Werden sie es schaffen, den Krieg endlich zu beenden und Hitler zur Kapitulation zwingen?«
»Es muss gelingen. Die Niederlage Hitler-Deutschlands ist unausweichlich. Zu viele Menschen haben durch den Krieg überall auf der Welt ihr Leben und ihre Heimat verloren. Alle hier haben Verantwortung zu tragen. Dessen sind sie sich bewusst.«
Morrisson sah den kahlköpfigen Mann neben sich ernst an und strich sich durch seine ergrauenden militärisch kurzen Haare.
»Wird der Alte das überhaupt durchstehen?«, fragte Watson und rückte seinen massigen Körper auf der Rückbank des Wagens zurecht. Er spielte damit auf den US-Präsidenten an. Roosevelt war seit zwölf Jahren im Amt. Der Krieg mit all seinen Strapazen für den Politiker hatte ihn gezeichnet. Dazu kam, dass er seit den frühen 1920ern an den Folgen einer Nervenkrankheit litt und die meiste Zeit an seinen Rollstuhl gefesselt war, weil er von der Hüfte abwärts beinahe vollständig gelähmt war.
Morrisson hatte darauf keine Antwort. Schließlich wusste er genau, unter welchem Stress der Präsident stand. »Ich bin sicher, er wird alles versuchen und Stalin die Architektur der Vereinten Nationen und den Kriegseintritt gegen Japan abringen. Die spannende Frage wird sein, was mit Deutschland geschieht. Wahrscheinlich müssen wir das Land aufteilen, damit von dieser selbsternannten Herrenrasse nie wieder eine Kriegsgefahr ausgeht. Aber ich schätze, der Russe verfolgt auch in dieser Frage eigene Pläne.«
»Und Churchill?«
»Er meint, wir hätten kaum einen schlimmeren Ort für die Konferenz finden können als Jalta, selbst wenn wir noch zehn Jahre danach geforscht hätten. Er gibt sich aber zuversichtlich, überleben zu können, wenn er einen angemessenen Vorrat an Whiskey zur Hand hat. Er behauptet, Whiskey sei gut gegen Typhus und tödlich für die Läuse, die in der Gegend gedeihen.«
Morrisson, der sich meist nur mit Mühe ein Lächeln abringen konnte, musste bei diesen Worten grinsen und seine stahlgrauen Augen blitzten schelmisch. Dann begannen beide zu lachen.
Doch kurz darauf verfielen sie in Schweigen und sahen die nächsten Minuten stumm aus dem Fenster, vor dem die vom Krieg zerstörte Landschaft vorbeizog. Dann tauchten die weißen Mauern des Schlosses Liwadia auf, in dem sie die nächsten acht Tage verbringen würden.
Der blendend weiße Palast erinnerte Morrisson an eine orientalische Festung. Er konnte Einflüsse arabischer Architektur sowie der Moscheen der Krimtataren erkennen. Es war diese Mischung, die den maurischen Bau märchenhaft erscheinen ließ.
Das ganze Gelände war vom Militär abgeriegelt. Die Zufahrt wurde von Panzern und Kettenfahrzeugen versperrt. Daneben standen Soldaten und schauten wachsam in die Gegend. Die Wagenkolonne wurde angehalten, Papiere mehrfach kontrolliert, ehe sich der Schlagbaum öffnete. Erst dann fuhren sie in einer Schlangenlinie um die Armeefahrzeuge und durch das Tor des einstigen Palastes des Fürsten Jusupow.
Churchill, Roosevelt und Stalin pochten jeder für sich darauf, nach der letzten Konferenz im November 1943 in Teheran endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Dafür wollten sie völlig ungestört sein. Die Planungen zur Vorbereitung waren aufwändig und hatten schon vor Monaten begonnen. Morrisson selbst hatte die entsprechenden Kontakte hergestellt.
Es war Stalin, der sich lange gesträubt hatte. Erst die Erfolge der russischen Winteroffensive an der Ostfront leiteten bei dem russischen Machthaber einen Umschwung ein. Morrisson, der den Rang eines Brigadier Generals innehatte, wusste warum. Der Mann mit dem Walrossbart war in einer komfortablen Situation. Die Truppen der westlichen Alliierten mühten sich an den Grenzen des Deutschen Reiches ab, hatten den Rhein aber noch nicht überschritten. Seine eigene Rote Armee dagegen war kaum zehn Monate nachdem die deutsche Wehrmacht von der Krim abgezogen war längst jenseits der Oder und inzwischen nur knapp 100 Kilometer von den Toren Berlins entfernt. Daher war sich Morrisson sicher, der Russe wollte das Fell des Bären verteilen – und er sah weder Roosevelt noch Churchill in der Position, Stalin Osteuropa streitig zu machen.
Ihr Wagen hielt mit den anderen vor dem Eingangsportal. Sie waren sozusagen die Vorhut, Roosevelt und Churchill würden morgen anreisen. Wann Stalin genau eintreffen würde, war bislang ein gut gehütetes Geheimnis. Womöglich war er schon da.
Ein Major der Roten Armee öffnete die Wagentür und begrüßte sie in ordentlichem Englisch.
»Guten Tag meine Herren. Man hat mir aufgetragen, Sie zu Ihren Räumen zu bringen. Außerdem bin ich Ihr Ansprechpartner für alles, was Sie brauchen.« Er war ein kleiner drahtiger Mann mit schütterem Haar und kantigem Gesicht mit kleinen Augen und schmalen Lippen.
Dann trat er zur Seite und bat sie mit einer Handbewegung, ihm zu folgen. Bei den anderen Ankömmlingen spielten sich ähnliche Szenen ab. Scheinbar gab es für jeden Wagen einen Offizier, der sich um die Personen kümmern durfte, die aus dem Wageninneren in die Kühle der Schwarzmeerinsel quollen. Überall wuselten Menschen, luden Gepäckstücke aus und beobachteten die Szenerie. Die Meisten arbeiteten wahrscheinlich für den russischen Geheimdienst.
Es war dem OSS nicht entgangen, dass zahlreiche Agenten, die Schätzungen sprachen von mindestens 100, und ein Sonderkommando des NKWD vor ein paar Tagen auf die Krim gereist waren. Alles, um den Generalissimus des Sowjetreiches zusätzlich zu seinen persönlichen Leibwächtern zu sichern. Außerdem wurde das Gelände rund um die Uhr von Soldaten und Hundestreifen bewacht. Jedoch hatte im Vorfeld keiner der Russen auch nur ein Wort darüber verloren, dass in einem Umkreis von zwanzig Kilometern in den letzten Tagen über 74.000 Menschen überprüft und 835 festgenommen worden waren. Und das in einem vom Krieg verwüsteten Gebiet. Morrisson schüttelte beim Gedanken daran den Kopf, was dem Major nicht entging.
»Mister Morrisson, stimmt etwas nicht?«
»Nein, nein, alles in Ordnung. Ich dachte nur, was es für eine logistische Leistung ist, das hier und zu dieser Zeit und mit so wenig Vorlauf auf die Beine zu stellen.« Er untermauerte seine Worte mit einer bewundernden Handbewegung.
»Oh, da haben sie recht. Der Aufwand ist gewaltig. Es wurden sogar extra Telegrafen und Hochfrequenztelefone installiert. Der Genosse Stalin muss während der Konferenz seiner Pflicht als Oberkommandierender unserer Roten Armee nachkommen«, verkündete der Major feierlich. »Außerdem haben wir erfahrene Kellner aus einigen Luxushotels in Moskau zu unserer Unterstützung auf die Krim gebracht, freiwillig versteht sich. Unsere Gäste sollen sich wie zu Hause fühlen und Russland von seiner besten Seite kennenlernen und in guter Erinnerung bewahren.«
Wahrscheinlich wurden die Kellner eher abkommandiert, nachdem man sie im Vorfeld auf Herz und Nieren geprüft hatte, schoss es Watson durch den Kopf. Einer der Vorteile, wenn einer im Staat die Befehle gab.
Der Major erzählte weiter. Er war sichtlich stolz auf das, was die Gastgeber alles auffuhren: »Das Brot wird von ausgewählten Bäckern geliefert und einige Fischer sind beauftragt, uns mit ihrem frischen Fang zu versorgen.«
Der Offizier blieb stehen, beugte sich leicht nach vorne und senkte verschwörerisch seine Stimme, so als würde er ein großes Geheimnis verraten: »Für den Notfall steht sogar ein Bunker zur Verfügung, der 500-Kilo-Bomben trotzen kann.«
Watson und Morrisson gaukelten Überraschung vor und zogen beeindruckt die Augenbrauen nach oben. Dann gingen sie weiter.
Die Richtmikrofone, mit denen der NKWD experimentierte, um seine britischen und amerikanischen Gäste zu belauschen, wurden dagegen nicht erwähnt.
Die ausländischen Delegationen waren in herrschaftlichen Häusern zwar getrennt voneinander, aber mehr als angemessen untergebracht. In jedem Zimmer fanden die Gäste Körbe mit Obst, Kaviar und Krimsekt.
Die Stunden bis zum Eintreffen des Präsidenten verbrachte James Morrisson damit, sich so gut es ging einzurichten. Danach nahm er Kontakt zu seinen Gesprächspartnern in den britischen und russischen Delegationen auf.
Zusammen mit Averell Harriman, dem US-Botschafter in Moskau, gönnte er sich am Mittag einen Spaziergang durch die prachtvolle Parkanlage. Sie gab den Blick auf das in der Sonne funkelnde Schwarze Meer frei. Als er sich umdrehte, blendete ihn das grelle Licht des Tages und er glaubte aus der Ferne die Umrisse einer Frau zu erkennen, die vor wenigen Jahren für eine kurze Zeit wichtig gewesen war in seinem Leben. Ehe sich herausgestellt hatte, dass sie eine Bolschewistin war.
Ein weiß livrierter Mann kam eiligen Schrittes auf Morrisson zu und sagte ihm, der Präsident sei eingetroffen und erwarte ihn umgehend in seinem Arbeitszimmer. James Morrisson verabschiedete sich kurz von Harriman, der sichtlich irritiert war, warum Roosevelt nach Morrisson schickte und nicht nach ihm, und eilte auf direktem Weg durch den Park zurück zum Schloss. Trotz der kühlen Temperaturen kam er dabei ins Schwitzen.
»Morrisson, mein Lieber«, begrüßte ihn kurz darauf der mächtigste Mann der westlichen Nationen freundlich. Er saß in seinem Rollstuhl, so wie es meist der Fall war. Ohne konnte er sich nur kurze Zeit und unter großer Anstrengung fortbewegen. Weißhaarig und in dunklem Anzug und Krawatte wies der Präsident auf einen Stuhl neben dem Schreibtisch und bat den Brigadier General Platz zu nehmen. Erst vor wenigen Wochen hatte Roosevelt seine vierte Amtszeit angetreten, in die ihn im vorangegangenen November die Mehrheit der Amerikaner gewählt hatte.
»Mr. President«, erwiderte Morrisson respektvoll, nickte dem schlanken Mann zu und deutete eine kurze Verbeugung an, bevor er der Aufforderung folgte. Roosevelt standen die Strapazen der letzten Monate ins Gesicht geschrieben. Dennoch strahlte der charismatische Mann eine beeindruckende Zuversicht aus. Morrisson mochte den Präsidenten, der mit seinem New Deal viel für das Land und die Menschen erreicht hatte. Obwohl er ein Demokrat war, musste selbst der stramme Republikaner Morrisson anerkennen, dass es Roosevelt zu verdanken war, dass die USA sich aus der Rezession gekämpft hatten. Für die restlichen Demokraten hatte Morrisson wenig übrig – es sei denn, sie waren ihm bei seiner Karriere von Nutzen.