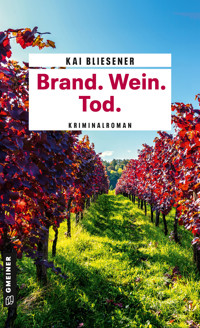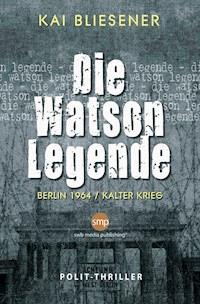Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein vielschichtiger Kriminalroman über ein bisher nicht erzähltes Kapitel Nachkriegsgeschichte. Stuttgart 1945. Der Polizeibeamte Paul Kramer muss mithelfen, im berüchtigten Hotel Silber die neue Kriminalpolizei aufzubauen – genau an jenem Ort, an dem er wenige Tage vor Kriegsende noch von der Gestapo gefoltert wurde. Doch Hass und Ideologie sind mit der Kapitulation nicht verschwunden. Als die ersten Verbrechen aufgeklärt werden müssen, zeigt sich schnell, wer auf welcher Seite steht – und Pauls Ermittlungen werden für ihn selbst zur Gefahr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kai Bliesener, geboren 1971 in Waiblingen, war als Kommunikationsexperte, Mediendesigner und Pressesprecher für verschiedene Verbände und Unternehmen tätig. Er arbeitet als Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für das Theaterhaus Stuttgart sowie als freiberuflicher Autor und Texter. Er lebt mit seiner Familie in Weinstadt.
Dieses Buch ist ein Roman. Die Handlung ist fiktiv, auch wenn teilweise Bezug auf reale Fälle und Ereignisse genommen wird. Es treten historische Persönlichkeiten auf, deren Handeln, Reden und Denken ist jedoch so frei erfunden wie das der anderen Figuren in diesem Roman.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Leonardo Magrelli
Lektorat: Lothar Strüh
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-193-5
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Für Karin, Jannik und Annika
Zuweilen habe ich den Eindruck, als ob ein Massenwahnsinn das deutsche Volk ergriffen habe und als ob ein Gehirnschwund in großem Ausmaß um sich fräße.Denken ist heute überhaupt nicht mehr Mode.
Anna Haag in ihrem Tagebuch am 24. Januar 1941
PROLOG
Stuttgart, Ende März 1945
Nervös und frierend standen sie im Schutz der zerbombten Mauerreste des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Der Schatten des sechsundfünfzig Meter hohen Turms auf der Südseite des Kopfbahnhofs bot ihnen Schutz vor der feuchten Kälte des Morgens, während sie auf Heinz Koller warteten.
Vera Wallner legte den Arm um die Schultern ihrer schlotternden Tochter. Margarete schaute aus großen Augen zu ihrer Mutter, dann zu ihrem Vater Johann. Jeder hatte nur die Kleider am Leib und ein paar Habseligkeiten in einer Tasche oder einem Koffer dabei. Mehr war ihnen ohnehin nicht geblieben. Es musste reichen. Bald würden sie in Sicherheit sein.
»Wo bleibt er denn?«, fragte Johann flüsternd in die Stille hinein und schlang sich die Arme um den Oberkörper. Ihm war kalt. Sie alle froren.
Vera zuckte hilflos mit den Schultern. Sie hatte das Zittern in seiner Stimme gehört und hoffte, dass es wegen dieser verfluchten Kälte war. Ihr rechtes Bein schmerzte höllisch vom langen Laufen und Stehen, aber sie versuchte, keine Miene zu verziehen. Sie musste stark sein. Zumindest bis sie hinter der Grenze waren. Sie alle mussten jetzt alle verbliebene Kraft aufbringen, wenn sie überleben wollten.
Vor drei Monaten hatte sie den Bescheid für die Deportation in den Osten bekommen. Oben in der linken Ecke prangte der mächtige Reichsadler, in seinen Krallen das im Land allgegenwärtige Hakenkreuz. Darunter in feinstem Amtsdeutsch und kurzen Sätzen ihr Todesurteil.
Dabei ist dieser verdammte Krieg doch schon verloren, war der erste verzweifelte Gedanke, der ihr gekommen war. Sahen die das nicht? Aber es gab noch einen Funken Hoffnung, gerettet zu werden. Auch wenn er noch so klein war, er brannte jeden Tag. Und falls alles nach Plan verlaufen würde, wären sie am Abend in Sicherheit. Alles, was sie benötigten, war etwas Zeit. Die Alliierten rückten an sämtlichen Fronten rasch voran, wie von überall hinter vorgehaltener Hand zu hören war. Man musste dennoch enorm vorsichtig sein. Wer von einer drohenden Niederlage Hitlers sprach und die Worte an jemand Falschen richtete, war automatisch in Lebensgefahr.
Doch die Gegenwehr der Wehrmacht war gebrochen. So gebrochen wie Veras Bein. Ein stechender Schmerz durchfuhr ihren Körper beim Gedanken daran. Aber Schmerzen waren ihr Ausweg gewesen, um wenigstens etwas Zeit zu gewinnen. Ein paar Tage nachdem sie den Bescheid bekommen hatte, war sie mit ihren Töchtern Margarete und Frida zu Gertrude Brandt in die Praxis gegangen. Natürlich erst, als die anderen Patienten die Räume verlassen hatten. Gertrude Brandt war Ärztin und Freundin zugleich. Sie wusste, dass sie kommen würden, und sie hatten ein Klopfzeichen vereinbart, nach dem sie die Praxistür öffnen würde. Gertrude hatte sie immer behandelt, obwohl sie wusste, dass man sie bestrafen würde, wenn es herauskam, und sie mit Repressalien zu rechnen hatte.
»Ich bin Ärztin geworden, um Menschen zu helfen. Ich habe einen Eid geschworen. Und deshalb werde ich Juden nicht anders behandeln als alle anderen, die zu mir in die Praxis kommen und Hilfe brauchen«, hatte sie Vera einmal gesagt.
Dann hatten sie an diesem kalten Januarabend im hinteren Behandlungszimmer der Praxis gesessen. Längst gab es kaum noch Verbandsmaterial und Medikamente, die gläsernen Schränke waren mehr oder weniger leer, sahen aus, als wären sie geplündert worden. Doch inzwischen gab es so gut wie keinen Nachschub mehr, und das spärliche Material wurde meist direkt an die Front geschickt, um die verwundeten Soldaten halbwegs zusammenflicken zu können, ehe man sie wieder in den Kugelhagel schickte.
Gertrude hatte sie mit durchdringendem Blick gemustert, doch Veras Entschluss stand fest.
Kurze Zeit später hielten die Töchter fest die Hände ihrer Mutter. Vera hatte einen dicken Holzstift zwischen den Zähnen, um zu verhindern, dass sie den Schmerz der Behandlung laut in die Nacht brüllte. Der Stift war Vera am Ende in zwei Teilen aus dem Mund gefallen, nachdem ihr Gertrude das rechte Bein gebrochen hatte. Vera hatte schwer geatmet, Schweiß war ihr über das Gesicht gelaufen, aber sie hatte sich alle Mühe gegeben, ihre Töchter möglichst wenig von dem Schmerz sehen zu lassen, der durch ihren Körper pulsierte.
Am nächsten Tag war sie ins Robert-Bosch-Krankenhaus eingewiesen und kurz darauf für transportunfähig erklärt worden. Damals hatte sie gehofft, dass es die Schmerzen wert waren, wenn es keine andere Möglichkeit gab, sich und ihre Familie vor der drohenden Deportation zu retten.
»Da, da kommt er«, rief Frida leise und zeigte auf eine Gestalt, die sich aus dem Dunkel löste. Sie erkannte ihn trotz der Entfernung. Es war Heinz Koller. Er trug einen abgewetzten Mantel um den ausgemergelten Körper und eine Schiebermütze auf dem runden Kopf. Im Gesicht hatte er zahlreiche Narben. Die seien von seiner Zeit im KZ, hatte er Vera erzählt, als sie ihn im Krankenhaus kennengelernt hatte. Er hatte laut seiner angedeuteten Geschichten viel durchmachen und einige Gewalt ertragen müssen, wovon sein Aussehen Zeugnis ablegte. Vera hatte den Eindruck gewonnen, als sei er eine traurige, bemitleidenswerte Gestalt, aber eine, die ihr helfen konnte. Zusammen mit ihrer Tochter Frida hatte er sie in der Klinik besucht. Tage zuvor war Frida dem Mann bei einer Bekannten zum ersten Mal über den Weg gelaufen. Sie war mit ihm ins Gespräch gekommen. Vorsichtig tastend, hatte sie sich anfangs zurückhaltend gegeben. Doch er wirkte vertrauenswürdig, hatte selbst im KZ gelitten und äußerte sich dezidiert kritisch über das Regime. Und er hatte Kontakte. Kontakte, die ihnen hoffentlich das Leben retten würden.
Er trat zu der wartenden Familie in die dunkle Ecke neben einem Pfeiler, nickte den vier hoffnungsvoll dreinschauenden Augenpaaren zur Begrüßung kurz zu und versuchte sich an einem unsicher wirkenden Lächeln.
»Haben Sie alles?«, wollte er wissen.
»Ja«, sagten Johann und Vera Wallner im Chor und warfen sich ein leichtes Schmunzeln zu. Es fehlte in diesem Moment nur ein Hauch, und es wäre eine Last von ihr abgefallen. Doch Vera Wallner war bewusst: Sie waren längst nicht am Ziel, sondern erst am Anfang ihrer gefahrvollen Reise.
Johann griff in seine Tasche, zog einen prall gefüllten Beutel heraus und warf ihn dem Mann zu. Der fing die metallisch klappernde Stofftasche mit einer geschickten Handbewegung auf. Koller öffnete die Schlaufe, die verhinderte, dass etwas herausfiel, warf einen raschen Blick hinein und zog den Beutel dann wieder zu. Er nickte zufrieden.
»Sehr gut«, sagte er.
»Unsere Pässe«, meinte Vera dann auffordernd. Plötzlich überkam sie ein ungutes Gefühl. Woher, konnte sie nicht bestimmen, doch sie mahnte sich deswegen zur Eile. »Wir müssen zum Zug.«
Johann streckte erwartungsvoll die rechte Hand aus, um die Papiere in Empfang zu nehmen. Koller hatte versprochen, sie mit gültigen Pässen zu versorgen, die sie außer Landes bringen würden, trotz Ausreiseverbot. Da das Familienvermögen durch die sogenannte Judensteuer längst von den Nazis enteignet worden war, hatten sie ihm zur Bezahlung für seine Hilfe die letzten Reste des gut versteckten Familienschmucks angeboten.
In diesem Moment tauchte wie aus dem Nichts eine Gruppe Männer auf, die sie umringten. Einige trugen die grauen Uniformen der SS, andere waren in Zivil. Gegen die Kälte waren fast alle in die ebenso grauen Mäntel gehüllt. Auf den Schirmmützen der Uniformierten prangte der Totenkopf, das Wappen der nationalsozialistischen Kampforganisation. Vera konnte nicht sehen, wie viele es waren. Ein halbes Dutzend oder mehr vielleicht. Und sie sahen nicht aus, als seien sie zufällig hier vorbeigekommen. Sie haben auf mich gewartet, schoss es ihr durch den Kopf. Sonst hätten wir sie doch kommen sehen.
Veras Hand suchte tastend den Arm ihres Mannes, während sich die beiden Töchter dichter an sie drängten. Ihr Körper begann zu zittern. Doch diesmal war es nicht nur die Kälte. Es waren Angst und Panik, die sie jetzt schlottern ließen. Sie brauchte Halt und musste gleichzeitig stark bleiben. Sie wusste, dass ihr die Furcht ebenso anzusehen war wie Johann und den Mädchen, in deren Gesichter sie nacheinander blickte. Vera realisierte als Erste, dass ihre Flucht vorbei war, ehe sie begonnen hatte. Sie waren aufgeflogen, oder man hatte sie verraten. Aber wer? Koller? Er stand teilnahmslos bei ihnen, vermied es, jemandem in die Augen zu sehen, während ein Uniformierter seine behandschuhte Hand um Kollers Oberarm gelegt hatte. Und doch hatte er sich sichtbar abgesondert, stand etwas abseits der Familie, so als wolle er demonstrieren, dass er mit den vier Personen nichts zu schaffen hatte. Auf ihn können wir nicht zählen, er rettet seine Haut.
Der Trupp hatte sie eingekreist. Es gab keine Chance zu entrinnen. Vera sah in die versteinerten Gesichter der uniformierten Männer und dann in die schreckensbleichen ihrer Kinder. Johann wirkte durch das Auftauchen der Soldaten wie gelähmt und apathisch.
»Sie sind verhaftet. Mitkommen!«, bellte einer der Männer und packte Vera grob am Arm, zog sie unsanft mit sich, sodass sofort wieder ein fürchterliches Stechen durch ihr noch nicht ausgeheiltes Bein fuhr. Johann, Frida und Margarete erging es nicht besser. Auch sie wurden angetrieben wie widerspenstiges Vieh auf der Weide. Koller hatte Vera inzwischen aus dem Blick verloren, so sehr war sie damit beschäftigt, nach den kräftigen und unsanften Stößen des SS-Mannes in ihren Rücken nicht zu stürzen.
Ihr Bein schmerzte mit jedem Schritt, den sie machte, mehr, während sie die Königstraße entlang über den Schlossplatz gestoßen wurden. Ein Fußmarsch, der ihr wie eine Ewigkeit vorkam und sich wie ein nimmer enden wollendes Martyrium in die Länge zog. Die Menschen auf der Straße warfen ihnen hasserfüllte Blicke zu oder drehten sich weg. Einige spuckten demonstrativ auf den Boden. Andere blieben stehen, um sich das Spektakel näher anzuschauen. Manche johlten sogar vor Freude und jubelten. Nur Einzelne senkten den Blick und sahen betreten weg. Aber niemand machte Anstalten zu helfen. Sie waren Gefangene.
Und dann ahnte sie, wohin sie mit gezielten Hieben und Tritten geführt wurden. Minuten später wurde daraus traurige Gewissheit. Sie erblickte das Gebäude. Der unbeschädigte Flügel des Hotel Silber ragte trotzig zwischen den Trümmerbergen auf.
Dort würden sie sie hinbringen. Zur Endstation ihrer Reise.
Einer der Männer neben ihr begann plötzlich zu brüllen. »Sofort stehen bleiben!«
Sie war so auf ihre Schritte konzentriert und in Gedanken und Sorge um ihre Familie versunken gewesen, dass sie nicht mitbekommen hatte, dass Koller sich abgesetzt hatte. Jetzt sah sie ihn in der Ferne rasch in den Trümmern des einstmals stolzen Neuen Schlosses verschwinden.
Vera drehte den Kopf und sah, dass einer der SS-Männer seine Pistole aus dem Halfter an seiner Hüfte zog. Sie zuckte einen Moment zusammen, da der Lauf für einen Augenblick direkt in ihre Richtung gerichtet war. Dann schwenkte der Mann seine Waffe, und eine Kugel pfiff an ihr vorbei. Doch sie verfehlte ihr Ziel und schlug nicht in Kollers Rücken, sondern in die Reste der Steinmauern ein. Der SS-Mann schoss ihm noch zweimal hinterher. Veras Ohren schmerzten vom Lärm. Dann war der Flüchtende endgültig zwischen den Trümmern eines zerbombten Hauses verschwunden. Niemand setzte ihm nach. Er durfte ungehindert fliehen, während auch die letzten beiden Schüsse noch wirkungslos in der Luft verhallten.
Spätestens jetzt wurde Vera schmerzhaft bewusst, dass sie einem Spitzel aufgesessen waren. Koller hatte sie verraten. Sie hatte mit ihrer Leichtgläubigkeit, mit ihrer Hoffnung nicht nur ihre ganze Familie in Gefahr gebracht, sondern sie womöglich alle dem Tode geweiht.
Die Männer stießen sie weiter erbarmungslos und grob vor sich her, durch die Eingangshalle des altehrwürdigen Hotel Silber.
Das eindrucksvolle Neorenaissancegebäude in unmittelbarer Nähe des Alten Waisenhauses lag in Sichtweite des Alten Schlosses und unweit des ausgebombten Neuen Schlosses und des komplett zerstörten Rathauses. Einen Hotelbetrieb gab es hier schon lange nicht mehr. Alle sechs Stockwerke hatte die Geheime Staatspolizei seit der Machtübernahme der Nazis für sich beansprucht. Hundertzwanzig Zimmer hatte das einstige Hotel den illustren Gästen aus aller Welt angeboten, hatte sie einmal in der Zeitung gelesen. Räume, in denen jetzt die Gestapo ihr Unwesen trieb.
Dann wurde Vera von den Soldaten auf die Treppe Richtung Untergeschoss zugeschoben. Hinter sich hörte sie ihre Töchter weinen und ihren Mann keuchen. Aber sie konnte nichts tun, um ihnen zu helfen. Und sie gab sich die Schuld dafür, ihre Familie den Nazis ausgeliefert zu haben.
Vier stählerne Zellentüren standen offen wie die Mäuler menschenfressender Fische. Jeder von ihnen wurde mit einem kräftigen Hieb durch eine davon gestoßen und dann verschluckt von einem kalten, nackten Raum, der auch den letzten Funken Hoffnung aufsaugte. Ein letzter Blick in die vor Angst aufgerissenen Augen, mehr Zeit war ihr nicht geblieben. Dann hatte sie mit ansehen müssen, wie die Körper ihres Mannes und ihrer Töchter verschwanden, die Türen krachend zugeschmissen und Schlüssel gedreht wurden. Die Tränen rannen ihr in Strömen über die Wangen, tropften lautlos auf ihre Kleider. Nun war sie an der Reihe.
Vera landete in einer dunklen, kalten Verwahrzelle auf dem Boden, so grob hatte man sie hineingestoßen. Als sie sich aufrichtete, schmerzte ihr Knie, und als sie es mit der Hand betastete, spürte sie, dass sie sich die Haut aufgerissen hatte. Ihr gebrochenes Bein protestierte lautstark mit stechenden Schmerzen, die in Wellen durch ihren Körper fluteten.
Das war sie also, die Endstation.
Der Gedanke schmerzte noch mehr als alle Verletzungen, die ihr Körper davongetragen hatte. Aber so hatte sie sich wenigstens mit einem kurzen, tränenverschleierten Blick voller Liebe, Zuneigung, Schmerz und Trauer von ihrem Mann und ihren Töchtern verabschieden können. Woher die Gewissheit kam, konnte sie nicht sagen, aber sie wusste instinktiv, dass sie ihre Familie zum letzten Mal gesehen hatte. In der Ecke kauernd, schloss sie die Augen, sank an der rauen Wand zu Boden und heulte laut schluchzend.
EINS
Stuttgart, Mitte April 1945
Wie eine Trutzburg ragte das herrschaftliche Anwesen an der Hasenbergsteige nahezu unversehrt in die Höhe. Starkes Mauerwerk mit Erkern und einem großen Balkon zum kiesbedeckten Hof mit seinen Bäumen und Sträuchern hin. Die Fenster waren noch weitgehend intakt, nur wenige bei den massiven Bombenangriffen zerborsten.
Drum herum herrschte Verwüstung. Bomben der amerikanischen und britischen Luftwaffe hatten spätestens seit den großen Angriffen 1944 verheerende Krater in die noble Wohngegend gesprengt, teilweise ganze Häuser mit starken Mauern aus kräftigen Steinen waren in sich zusammengefallen, als wären sie aus Pappmaché. Wie fast überall in Stuttgart türmten sich die Trümmer inzwischen meterhoch.
Es grenzt an ein Wunder, dass das Haus der Familie Jäger bisher verschont geblieben ist, dachte Paul Kramer, als er sich, geschützt durch die Schatten der Nacht, langsam und vorsichtig auf das einstmals prunkvolle Anwesen zubewegte. Er hielt sich in der Dunkelheit verborgen, achtete auf jede Bewegung, schob sich lautlos entlang der Mauern. Er durfte keinesfalls bemerkt werden. Wer durch die Nacht schlich, war automatisch verdächtig. Aber es war ein Gefühl, größer als die Angst, entdeckt zu werden, das ihn hierhergetrieben hatte: die Sehnsucht. Zu lange hatten sie sich nicht sehen können, seine Geliebte Hilde Jäger und er.
Hilde und er waren schon länger ein Paar. Nur wusste es außer ihnen kaum jemand. Ihre Beziehung war geprägt von geheimen Treffen und der ständigen Angst, aufzufliegen und für die Liebe mit dem Leben bezahlen zu müssen. Zumindest für ihn war diese Gefahr ein latenter Begleiter.
Paul kannte einen Weg durch den Zaun und das Gestrüpp und schlich lautlos zu der Stelle unterhalb Hildes Zimmer im ersten Stock. Es brannte kein Licht. Nachts mussten noch immer alle Fenster verdunkelt werden, um den Alliierten kein allzu bequemes Ziel zu liefern, wenn ihre Bomber von der Schwäbischen Alb oder dem Schwarzwald kommend über dem Talkessel der Stadt aufzogen, um ihre tödliche Fracht laut fauchend und heulend über der Stadt abzuwerfen. Paul sammelte eine Handvoll kleiner Kieselsteine, warf sie vorsichtig an die Scheibe, hinter der Hilde schlief, und hoffte inständig, dass sie allein war.
In der Dunkelheit meinte er eine leichte Bewegung des Vorhangs wahrzunehmen. Aber es konnte genauso gut nur eine Spiegelung des Mondes gewesen sein. Paul wartete, unsicher, ob er sich vielleicht getäuscht hatte. Doch um diese Zeit war sie bestimmt noch wach und in eines ihrer vielen Bücher vertieft. Zwar durfte sie eigentlich nur solche von Autoren lesen, deren Werke nicht am 10. Mai 1933 verbrannt worden waren, darauf achtete ihr Vater mit Argusaugen. Aber sie hatte rechtzeitig auch im Deutschen Reich verbotene Literatur versteckt, in der sie heimlich schmökerte. Bei ihren inzwischen seltenen Treffen erzählte sie Paul davon. Daher wusste er auch, dass sie selbst schrieb. Kurze Geschichten in eleganter Prosa. Kleine, emotionale Miniaturen, die von Liebe in dunklen Zeiten erzählten, von Hoffnung auf etwas Licht am Ende eines langen, finsteren Tunnels. Ihre Gedanken in Worte zu fassen, gab ihr Kraft, die Tage zu überstehen, das spürte er immer, wenn sie ihm einen ihrer Texte vorlas oder ihn mit fein gewählten Worten skizzierte, wie ein Architekt ein Haus mit wenigen Strichen auf Papier erbauen konnte.
»Und irgendwann, wenn dieser Wahnsinn einmal vorüber ist, werde ich etwas veröffentlichen. Vielleicht werde ich dann sogar Schriftstellerin. Oder zumindest Journalistin«, hatte sie ihm mit freudestrahlendem Gesicht einmal verkündet, als sie an einem lauen Abend durch den nahe gelegenen Wald gestreift waren. Er hatte nicht anders gekonnt, als ihren Optimismus zu bewundern. Aber wenn es jemand schaffte, dann sie, davon war er überzeugt.
Der Weg dorthin würde allerdings lang, steinig und beschwerlich sein. Denn die Rolle der Frau war in den Köpfen der gesellschaftlichen Mehrheit eine andere. Sie sollte Kinder gebären und nach dem Haushalt schauen. Wer aus diesem Korsett ausbrechen wollte, war schon vor dem Krieg kritisch beäugt worden. Doch Paul wünschte ihr, dass sich dies nach dem Krieg endlich wenden und die Rolle der Frau nicht weiter auf das Heimchen am Herd reduziert werden würde.
Es dauerte nicht lange, da sah er einen Schatten durch eine Seitentür im Souterrain schlüpfen. Hilde hatte nur einen dünnen Morgenmantel über ihr Nachthemd geworfen, und Paul sah im sanften Mondlicht die Konturen ihres schlanken Körpers durch den Stoff schimmern. Für einen kurzen Augenblick flammte Lust in ihm auf. Es war eine gefühlte Ewigkeit her, dass sie allein gewesen waren. Er erinnerte sich an die leidenschaftlichen Küsse, die Wärme ihres Körpers, wie er mit seinen Fingern über ihre nackte Haut gestrichen hatte und die Welt um sie herum für einige kostbare Augenblicke vergessen gewesen war.
Jetzt waren sie gezwungen, vorsichtig zu sein. Noch wachsamer als früher. Hildes Vater war ein unverbesserlicher Nazi, der wahrscheinlich noch immer unumstößlich an den vielfach proklamierten Endsieg der Deutschen glaubte. Und Paul war ein Deserteur. Wenn Hildes Vater sie zusammen entdecken würde …
Doch die düsteren Gedanken verflogen für einen Moment, sobald Hilde ihre Arme um seine Hüfte schlang, ihm einen langen Kuss auf die Lippen drückte und dann ihren Kopf an seinen Hals legte. Die offenen dunkelblonden Haare kitzelten angenehm auf seiner Haut. Paul zog Hilde eng an sich und spürte, wie sie zitterte.
»Dir ist kalt. Du musst wieder ins Haus, sonst wirst du noch krank«, flüsterte er ihr zu.
Doch sie machte keinerlei Anstalten zu gehen. »Nein, ich möchte nur hier stehen. Mit dir. Dann wird mir ganz warm«, erwiderte sie leise nach einer Zeit, und ihre Worte fühlten sich mit einem Mal an wie ein knisterndes Feuer im Kamin.
»Du weißt, das geht nicht. Jetzt nicht. Aber hoffentlich bald wieder, wenn dieser Irrsinn vorüber ist. Ich habe gehört, die Franzosen sind schon durch Freudenstadt und in Richtung Stuttgart unterwegs.«
»Ja«, sagte sie zögernd, löste sich von ihm und nahm seine Hände in ihre. »Aber mein Vater behauptet, sie hätten die Stadt dem Erdboden gleichgemacht, die Männer erschossen und Frauen und Mädchen vergewaltigt. Und das würden sie auch mit uns tun, wenn sie erst in Stuttgart einfallen würden. Deshalb müssten alle Männer an die Waffen und für unsere Freiheit und den Sieg kämpfen, meint er und schimpft auf alle, die sich nicht für unser Vaterland und den Führer erheben, um den Feind aufzuhalten.«
Paul Kramer sah sie fragend an. »Du weißt, dass das Quatsch ist. Nazi-Propaganda. Der Krieg ist längst verloren. Das weißt du. Wahrscheinlich war er es schon vor dem ersten Schuss.«
»Ja, aber was, wenn er recht hat?«
Paul hörte ein leichtes Beben in ihrer Stimme, das nach Angst klang. »Sag mir, was sie dann von uns unterscheidet? Nur, dass wir einmal ein zivilisiertes Volk aus Dichtern und Denkern waren. Es war Deutschland, das diesen grausamen Krieg begonnen, seine Nachbarn überfallen, Menschen verhaftet, gefoltert und in Lager gesteckt hat. Was ist mit den Juden passiert, die irgendwann einfach nicht mehr da waren? Mit den Kommunisten, Gewerkschaftern und Sozialdemokraten, mit allen, die sich für die fragile Demokratie der Weimarer Republik starkgemacht hatten, ein Teil dieser Ordnung waren, bevor Hitler die Macht an sich gerissen hat? Die haben sie alle längst ermordet, die Herren in ihren Uniformen mit den blitzenden Stiefeln.«
Sie legte ihm den Zeigefinger auf die Lippen, denn Paul war emotional und laut geworden. Lauter, als womöglich gut für sie war. Er ärgerte sich sofort über sich selbst und seinen Gefühlsausbruch.
»Tut mir leid, aber ich kann manchmal nicht anders, wenn ich sehe, wie diese Bagage uns in den Abgrund gestürzt hat, mit ihrer Rassenideologie und dem Traum vom Endsieg und der Weltherrschaft …« Paul beendete seine Tirade mittendrin. Er sah ein, dass es der falsche Moment für politische Reden war. Zumal er Hildes Einstellung kannte. Sie hatte immer wieder Konflikte mit ihrem Vater ausgestanden, ihm die Stirn geboten, weil sie anders auf das Land und seine Menschen schaute, als es sein Weltbild erlaubte. Doch ihr Vater war einer der führenden Nazikader der Stadt, dagegen konnte sie wenig ausrichten.
Manfred Jäger war als junger Bursche im Ersten Weltkrieg aus voller Überzeugung für den letzten deutschen Kaiser und sein Vaterland an die Front gezogen, wie er Paul schon beim ersten Aufeinandertreffen mit stolzgeschwellter Brust erklärt hatte. Und noch während Jäger geredet hatte, hatte er Paul und dessen Reaktion auf die Worte einem kritischen Blick unterzogen. Ganz so, als müsse Paul erst einen Gesinnungstest bestehen, ehe er mit Hilde ausgehen durfte.
Bilder aus dieser Zeit, die Jäger als stolzen Soldaten in ordensgeschmückter Uniform zeigten, hingen denn auch an der Wand im Esszimmer. Dass der Sturz des Kaisers und dessen Flucht ins Exil nach vier Jahren Krieg den obrigkeitshörigen Untertanen in eine tiefe Krise getrieben hatten, hatte Jäger Paul gegenüber unerwähnt gelassen, doch Hilde hatte diese Information nachgereicht.
Zwar hatte der württembergische König Wilhelm II. noch versucht, die Monarchie zu bewahren, den Lauf der Dinge jedoch nicht aufzuhalten vermocht. Seine Tage waren kurz darauf gezählt gewesen. Und für Männer wie Jäger war endgültig eine Welt zusammengebrochen, vermutete Paul. Nun musste er sich mit dem gemeinen Volk auseinandersetzen, zu dem in seinen Augen Menschen wie Paul Kramer gehörten, die sich in den von Jäger verhassten und seit 1933 verbotenen sozialdemokratischen Kreisen herumtrieben und überall nur Unruhe stifteten. Taugenichtse und Tagediebe, das waren sie in seinen Augen, wie Jäger immer wieder deutlich gemacht hatte.
Die demokratischen Strukturen der Weimarer Republik hatte Jäger von Anfang an abgelehnt. »Demokratie, das ist nichts für die Menschen. Die brauchen eine klare Führung, jemand, zu dem sie aufschauen können«, hatte er einmal gesagt. Aber mit geschickten Manövern und den richtigen Kontakten und Seilschaften war es ihm gelungen, die Irrungen und Wirrungen der Unruhen in den Jahren nach dem ersten großen Krieg für seinen raschen Aufstieg zu nutzen. Er bediente dabei die Emotionen, indem er hervorhob, worin er den Ursprung für das Leid sah. Schuld sei der Vertrag von Versailles, dessen Joch die Deutschen in seinen Augen nach dem ersten verlorenen Krieg von den Siegermächten gezwungen gewesen seien zu ertragen. Hunger, Arbeitslosigkeit und hohe Reparationszahlungen seien die Folgen gewesen.
So saugte Manfred Jäger begierig das Gift auf und war bald zum laut krakeelenden Unterstützer der Bewegung des selbst ernannten Führers geworden.
Hilde zitterte inzwischen heftiger. Sie zog Paul an der Hand Richtung der Tür, aus der sie gekommen war, und öffnete sie vorsichtig. Dahinter lag ein langer und dunkler Kellergang, der den typisch modrigen Geruch verströmte. Paul zog lautlos die Tür zu, und zusammen huschten sie so leise wie möglich nach oben. Anders, als er erwartet hatte, war die Familie Jäger heute noch nicht zu Bett gegangen. Meist schliefen sie um diese Zeit längst, weshalb Paul so lange gewartet hatte.
Auf dem Treppenabsatz im Erdgeschoss hielt er kurz inne, verborgen hinter dem Geländer, und beobachtete den Hausherrn im Wohnzimmer. Manfred Jäger stand vor dem im Kamin lodernden Feuer, nahm immer wieder ein Buch aus dem Regal daneben und warf es mit bedauerndem Blick in die Flammen.
Schon wieder eine Bücherverbrennung, schoss es Paul durch den Kopf. Doch diesmal waren es sicher nicht die Schriften von Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Thomas oder Heinrich Mann, die den Flammen geopfert wurden. Paul sah von seinem geschützten Standort aus, wie Jäger ein Bild des Führers von der Wand über dem Kamin nahm, es kurz betrachtete und dabei wirkte, als wolle er gleich die Hacken aneinanderschlagen und salutieren, ehe er es doch ins Feuer warf.
Jäger trug einen Morgenrock über seinem seiden schimmernden Schlafanzug. Die Haare waren in der Mitte des großen Schädels akkurat gescheitelt, die kräftige Nase wies den Weg zum nicht minder beeindruckenden Kinn. Darüber prangte ein mächtiger Schnurrbart, wie er eher zu Kaisers Zeiten gepasst hätte.
Paul sah Jäger zu einem neuen Buch greifen. Diesmal zögerte er länger, blätterte darin, klappte es zu und stierte auf den Umschlag. Seine Finger strichen ehrfurchtsvoll, beinahe zärtlich über den Einband. Dann warf er es mit einem entschlossenen Ruck dem Führerbild hinterher. Nun konnte Paul den Titel erkennen: Es war Adolf Hitlers Pamphlet »Mein Kampf«. So etwas wie die Heilige Schrift der Nationalsozialisten. Ein Buch des Hasses, geschrieben von einem durchtriebenen und besessenen Mann, der längst sein wahres Gesicht gezeigt hatte.
Hilde zog Paul mit einem sanften Ruck weiter und riss ihn damit aus seinen Gedanken. Paul war dankbar dafür, diesem bizarren Spektakel zu entkommen. Er wusste, was es letztendlich zu bedeuten hatte. Die Franzosen kamen, und Manfred Jäger bereitete sich auf das Leben nach dem Ende des Krieges vor. Er beseitigte alle Spuren, die allzu offensichtlich auf einen Sympathisanten, Kollaborateur oder gar Funktionär des Regimes in Hitler-Deutschland hinweisen würden. Manfred Jäger würde alles daransetzen, den Besatzern gegenüber als aufrechter Deutscher aufzutreten und seine Verstrickung in die Machenschaften des Regimes so gut es ging zu vertuschen.
Dreck schwamm leider meist oben.
Am Ende der Treppe schlichen Hilde und Paul über den Flur in Hildes Zimmer. Nebenan schlief ihre kleine Schwester, wie Paul wusste. Auch wenn diese üblicherweise einen festen Schlaf hatte, waren sie gezwungen, leise zu sein. Hildes Eltern hatten ihre Schlafzimmer im anderen Flügel des weitläufigen Gebäudes, konnten aber jederzeit auf die Idee kommen, nach ihrer Tochter zu sehen. Auf einem Tischchen stand ein Tablett mit einer mit Blumen bemalten Teekanne aus Porzellan. Der Raum duftete nach frischer Minze.
»Den hat mir Mutter vorhin gebracht. Trink ruhig, der wärmt dich etwas auf«, sagte Hilde, schenkte zwei Tassen voll und nahm selbst einen großen Schluck. Sie zitterte noch immer leicht. Im Zimmer war es zwar etwas wärmer als draußen, aber der zurückliegende kalte Winter hatte sich tief in die Mauern des Hauses gefressen, und das Heizmaterial wurde selbst für Familien wie die Jägers langsam knapp.
Den Morgenmantel hatte Hilde enger um sich geschlossen. Der Pfefferminztee war zwar dünn, schmeckte aber köstlich. Paul verdrückte hastig zwei der leckeren Plätzchen, die neben der Tasse auf einem kleinen Teller lagen. Das war mehr, als er gestern und heute zu essen gehabt hatte.
So unterschiedlich waren die Zustände in diesen Tagen. Während ein Großteil der Bevölkerung mit hungrigen Mägen in Bunkern und zwischen Trümmern leben musste, gab es für einige Familien offensichtlich noch immer genug, um satt zu werden.
Aber gut, dachte sich Paul, das Leben ging ja weiter. Man war in diesen Tagen gezwungen, mit dem zufrieden zu sein, was man bekommen konnte. Und sich am Leben zu erfreuen, solange man es hatte. Hilde Jägers Familie gehörte eindeutig zu den Privilegierten der Stadt. Eine reiche Industriellendynastie mit erstklassigen politischen Beziehungen und jeder Menge Einfluss. Garantiert würde Manfred Jäger versuchen, sich für die Zeit nach dem Krieg eine gute Startposition zu sichern, da hegte Paul nicht den geringsten Zweifel.
Hilde setzte sich neben ihn auf das Bett. Paul nahm ihren Kopf zwischen seine Hände und strahlte sie an, so glücklich war er, ihr bildhübsches Gesicht zu sehen. Trotz der herausgehobenen Stellung ihrer Familie war sie schmal geworden, wie er fand. Die Wangenknochen traten deutlich hervor. Die grünen Augen über der geraden, leicht aristokratisch wirkenden Nase blitzten für einen Moment wie eine saftige Wiese, während sich die vollen Lippen behutsam öffneten, ein herzerwärmendes Lächeln und eine weiße Linie gerader Zähne zeigten. Doch das Lächeln erstarb sogleich.
Mit einem kräftigen Ruck wurde die Tür aufgerissen, und Hildes Vater stürmte in den Raum. Vor Schreck wurden Hilde und Paul in die Senkrechte katapultiert wie zwei Sprungfedern.
Manfred Jägers Gesicht war zornesrot. Gegen wen sich die Wut richtete, wurde sofort deutlich, als er zu sprechen anfing. Doch Paul hatte es schon vorher geahnt.
»Was macht der hier?«, fuhr Jäger seine Tochter an, die sich an Pauls Arm klammerte. Er hatte sich vor Paul aufgebaut, aber zu seiner Tochter gesprochen, als wäre Paul gar nicht da.
Manfred Jäger kam noch einen Schritt näher und wirkte nun beinahe so mächtig wie die Statue eines römischen Kaisers. »An die Front gehören Kerle wie du!«, brüllte er Paul mit dröhnendem Bariton an, sodass man ihn womöglich durch die geschlossenen Fenster und den Regen bis auf die Straße hinunter hörte.
Dann herrschte er seine Tochter an: »Du wagst es, einen feigen Deserteur in mein Haus zu bringen?« Jäger schäumte vor Wut und versprühte mit jedem Wort kleine Speicheltropfen, die auf ihrer Haut landeten. »Bist du lebensmüde? Wenn das rauskommt, landen wir alle im Hotel Silber, und du weißt genau, was das bedeutet.«
Doch Hilde wehrte sich. »Jetzt an die Front zu gehen, ist Selbstmord. Das weißt du genau«, gab sie trotzig zurück. »Außerdem war Paul verletzt. Der Krieg ist doch so gut wie vorbei. Verloren. Dein Hitler hat alles zerstört. Du willst es nur nicht sehen, weil du blind bist.«
»Pass auf, was du sagst, Fräulein«, schallte es zurück. Dann klatschte die flache Hand des Vaters brutal auf die weiche Haut der Tochter.
Der heftige Schlag riss sie von den Beinen, und Hilde knallte rumpelnd gegen ihren Bettkasten. Vor Schmerz heulte sie kurz und schrill auf, ehe sie sich in die Senkrechte kämpfte und sich wieder kerzengerade zwischen Paul und ihren Vater stellte.
Paul funkelte Hildes Vater unterdessen wütend an, wie eine Raubkatze, kurz bevor sie ihre Beute erlegt.
Manfred Jäger schob seine Tochter mit einem Ruck zur Seite und stieß Paul den ausgestreckten Zeigefinger auf die Brust, als wolle er sie wie mit einem Dolch durchbohren. »Wag es nicht, in meinem Haus …« Jäger hob die Hand und rückte dem über dreißig Jahre jüngeren Paul bedrohlich nahe. Er schrie nicht mehr. Vielmehr zischte er die Worte wie eine Schlange kurz vor dem tödlichen Biss. »Raus hier! Und zwar sofort! Sonst lass ich dich abholen. Dann kommst du endlich dahin, wo du hingehörst, wo Leute wie du hingehören.«
Paul starrte Jäger ungläubig an. Was er in dessen Augen sah, war blanker Hass. Dann stieß er den Vater seiner Freundin mit heftiger Wucht von sich, sodass dieser ins Straucheln kam, gegen Hildes Kleiderschrank geschleudert wurde und überrascht kurz aufstöhnte.
Paul warf Hilde einen raschen Blick zu. Tränen flossen in Strömen über ihr Gesicht, die Haut war stark gerötet, wo die raue Hand des Vaters ihre Wange getroffen hatte, und die Finger seiner Hand zeichneten sich ab. Wahrscheinlich würde sie bald einen blauen Fleck bekommen. Sie blickte ihn flehend an.
Paul konnte in diesem Moment nichts ausrichten. Manfred Jäger war ein hochrangiges Mitglied der Stadtgesellschaft, einflussreicher Industrieller und angesehener Funktionär der NSDAP. Und die hatte noch das Sagen. Paul griff nach seinem Mantel, stürmte wortlos aus dem Zimmer und dem Haus und kam sich dabei feige vor. Doch er wusste, Hilde würde es verstehen.
Die Sirenen heulten. Wie fast jede Nacht seit den verheerenden Bombenangriffen von 1944. Paul Kramer schlich wieder im Schutz der Dunkelheit durch die zerstörten Reste der Stadt. Nur war diesmal das Ziel nicht seine geliebte Hilde, sondern sein geheimer Unterschlupf, in dem er sich verkriechen konnte.
Er war auf der Flucht. Wenn sie ihn erwischten, wäre das sein Todesurteil.
Der Klang der Sirenen ging ihm im sechsten Jahr des Krieges noch immer durch Mark und Bein. Nie würde er sich daran gewöhnen, und er sehnte den Tag herbei, an dem ihr schrilles Heulen endlich verstummt sein würde.
Immer wenn dieses schauerliche Konzert erklang, drohten neue Luftangriffe auf die malträtierte Stadt. Drei kurze, hohe Dauertöne, jeder genau zwölf Sekunden. Unterbrochen von zwei Pausen, ebenfalls zwölf Sekunden. Wenn die Sirenen zu einem einminütigen Heulton anschwollen, dauerte es nicht mehr lange, bis die Maschinen der Royal Air Force und der US Air Force ihre todbringende Fracht abwarfen. Eine unheimliche Mischung aus dem Lärm der Flugzeuge, dem betäubenden Sirren vom Himmel fallender Bomben, gefolgt vom donnernden Beben der Explosionen, legte sich dann über den Talkessel.
Paul fühlte sich schon lange fremd in der eigenen Heimat. Nie hatte er der Ideologie der Nazis etwas abgewinnen können. Aber das Land und seine Menschen waren in den Sog ihrer Machthaber geraten und so in einen Strudel gezogen worden, der unaufhaltsam nur in eine Richtung führte: den Abgrund.
Vorsichtig schlich er weiter, huschte von Schatten zu Schatten. Nur kein Geräusch machen. Unsichtbar bleiben. Das war die einzige Chance zu überleben, denn überall zogen Todeskommandos durch die Straßen. Der Führer selbst hatte einen Befehl erlassen, wonach alle Subjekte, die im Verdacht standen, die deutsche Wehrkraft zu schwächen, zu erschießen seien.
Paul blieb stehen, schaute vorsichtig durch einen ehemaligen Hauseingang, von dem nur ein gemauerter Bogen übrig geblieben war. Zwischen den herumliegenden Trümmern dahinter flackerte ein Feuer. Ein Mann schob mit einem Ast eine Blechdose aus den lodernden, knisternden Flammen und löffelte dann gierig den Inhalt. Er war alt und saß nah an der wärmenden Glut. Sein Körper gebeugt unter der Last des Lebens. Hatte er den letzten Krieg selbst als kaiserliches Kanonenfutter erlebt? Hat er überlebt, nur um in der nächsten Katastrophe alles zu verlieren?, schoss es Paul durch den Kopf.
Paul glitt weiter durch die Nacht. Das fahle Mondlicht spendete ausreichend Helligkeit, damit er sich bewegen konnte. Immer wieder hielt er inne, lauschte. Unterdessen wanderte sein Blick suchend über die verbliebenen Gerippe der ausgebombten Stadt, die sich bedrohlich dem Himmel entgegenstreckten. Auf Paul wirkten sie wie die mahnenden Knochen ausgebeinter, halb verwester Leichen auf den Zeichnungen von George Grosz. Oder erinnerten mit ihrem schauerlichen Schattenspiel an Bilder aus Murnaus Symphonie des Grauens, »Nosferatu«. Ja, dachte er, das sind sie, die Geräusche des Krieges und des Sterbens: eine fürchterliche, unerträgliche Symphonie des Grauens.
Befeuert von einem Heer an Arbeitslosen, hatten die Nationalsozialisten vor zwölf Jahren die Macht an sich gerissen. Paul war damals zwanzig gewesen. Er hörte sie noch, die Absätze marschierender Stiefel bei Nacht, sah die flackernden Flammen der Fackeln. Dann die klirrenden Scheiben, die Schreie, das Blut. Wie donnernde Peitschenhiebe hatte ihr Marsch geklungen und durch die Straßen gehallt. Dann hatten sie Türen eingetreten und Fenster eingeworfen bei denen, die ihnen nicht passten, nicht arisch waren. Und immer mehr brave Familien hatten still zugesehen und bald darauf aus ihren Fenstern nicht ohne Stolz die Hakenkreuzfahnen ausgerollt. So hatte sich das Land rasch innerlich und äußerlich verändert, wurde Licht zu Schatten und Schatten zu bedrückender Finsternis, in der alles Leben einging wie Pflanzen ohne Wasser.
Wohin sein Blick schweifte, die Bomben der Alliierten hatten in den letzten drei Jahren in Stuttgarts Mitte tiefe Krater gerissen. Wie Schorf am Rand einer Wunde türmten sich Berge aus Schutt und Asche haushoch auf.
Und dazwischen hausten Menschen.
Wie hier, in der alten Esslinger Vorstadt, der ersten Stadterweiterung des mittelalterlichen Stadtkerns. Aus der Pfarrkirche St. Leonhard waren ab dem 15. Jahrhundert die Leonhardsviertel entstanden, wie Paul wusste. Kaum ein Stein war hier auf dem anderen geblieben. Bis auf ihre Grundmauern war die Kirche im Bombenhagel niedergebrannt. Um sie herum erinnerten einige Gebäude zaghaft an die imposante Vergangenheit.
Paul hatte sich inzwischen dorthin vorgearbeitet. Er kam nur langsam voran, musste vorsichtig sein. Und hatte nicht einmal die Hälfte des Weges hinter sich gebracht. Doch Eile war gefährlich. An jeder Ecke wartete womöglich ein SS-Mann, Polizist oder die Gestapo.
Da hörte er leise Schritte aus den undurchdringlichen Schatten bei den Mauerresten zweier in sich zusammengefallener Gebäude. Ein vorsichtiges Trappeln in den wenigen Sekunden der Stille zwischen den Stößen der Sirenen. Geräusche, die klangen, als versuche jemand angestrengt, keine Geräusche zu machen. Sein Herzschlag beschleunigte und sein Körper spannte sich, vorbereitet darauf, sich zu wehren oder zu flüchten. Er zog sich in den Schatten der Reste einer zerbombten Fassade zurück und lauschte.
Dann sah Paul in das furchtsame Gesicht einer Frau. Ihr Alter war nicht zu schätzen, der Krieg hatte seine Spuren hinterlassen. An der Hand ein Kind, keine zehn, tauchte sie aus den Trümmern vor ihm auf. Sie erschrak, kaum dass sie ihn entdeckte. Bange Sekunden des Abwartens. Zwar durfte man sich in diesen Zeiten nie sicher sein, doch sie sah nicht aus, als würde von ihr Gefahr ausgehen. Große Augen starrten ihn aus dreckverschmierten Gesichtern an. Aus ihnen sprach stumme Furcht. Die Körper waren ausgemergelt, und die Kleider hingen schlaff an den dürren Leibern herab. Paul tippte auf eine Familie, deren Zuhause zerstört worden war. Ein Teil seiner eigenen Angst fiel von ihm ab. Doch ehe er den beiden etwas Beruhigendes zuzuflüstern vermochte, waren sie ebenso schnell im Schatten der Schuttberge wieder verschwunden, wie sie aufgetaucht waren.
Er wusste, sie hatten Angst, mindestens so große Furcht wie er selbst. Angst vor den Bomben. Angst vor den Nazis. Angst vor Männern wie ihm, die nachts allein durch die Ruinen streiften. Solche Begegnungen bedeuteten fast immer Konflikte, denen man lieber aus dem Weg ging.
Viel hatte der verheerende Feuersturm, der im letzten Herbst über den Talkessel hinweggefegt war, den Menschen nicht gelassen. Zwischen Mauerresten und Geröllbergen hausten sie mit ihren Familien und dem wenigen, das ihnen außer dem eigenen Leben geblieben war. Sie suchten Schutz vor Kälte, vor neuen Angriffen und vor Uniformierten.
Paul sah drei leblose Körper an Laternenmasten hängen. Deserteure, die von der SS geschnappt worden waren. Wen sie ergriff, der wurde erschossen und zur Abschreckung aufgeknüpft. Er war einer von denen, nach denen sie mit Feuereifer suchten. Und sie waren überall.
Paul hatte sein Zeitgefühl verloren. Immer wieder hielt er inne, kauerte sich zusammen, wartete ab, lauschte und beobachtete. Das war zermürbend, doch unvorsichtig sein bedeutete den Tod.
Jetzt bewegte er sich frierend und zaghaft weiter, Schritt für Schritt seinem Ziel entgegen. Augen und Ohren achteten auf Bewegungen und jedes Geräusch.
Es war ein weiter Weg nach Hause. Pauls Familie lebte in Fellbach, einem Vorort von Stuttgart, in den zwei verbliebenen Zimmern einer kleinen Wohnung, deren Fenster zerborsten und Teile des Mauerwerks herausgesprengt waren. Doch das Haus stand und war bewohnbar.
Um sie zu schützen, hatte er sich jedoch einen Unterschlupf in Stuttgart gesucht. Er wollte sie nicht in Schwierigkeiten oder gar in Gefahr bringen. Deshalb hatte er sie schon länger nicht mehr gesehen. Nur kurze Nachrichten hatte er ihnen auf handgeschriebenen Zetteln über einen Freund zukommen lassen. Er hoffte, dass sie sich an seine Anweisungen hielten und alles sofort verbrannten.
Paul hielt kurz inne, als er aus dem Augenwinkel wieder eine Bewegung wahrnahm. Sein Herz hämmerte, und der Schreck lähmte ihn erneut für einen Moment. Zwei Sekunden später streifte etwas Warmes, Pelziges seine kühle Haut. Die ausgemergelte, dunkel getigerte Katze drückte sich schnurrend an ihn.
»Na, du«, sagte Paul flüsternd und streichelte ihr über das staubige und struppige Fell. »Wir zwei. Verlorene Streuner in der Nacht.«
Eine Weile genoss er die Nähe und Wärme des Tiers, ehe er ihm einen kleinen Klaps gab und es maunzend im Dunkel verschwand. Bald der nächsten Maus oder Ratte hinterherjagend.
Paul fröstelte. Die Sonne wärmte in diesen Tagen zwar die Haut und kündigte endlich den heraufziehenden Frühling an. Doch die Nächte waren eisig kalt. Pauls dünner und an einigen Stellen zerrissener Mantel und sein Hemd wärmten ihn nur wenig. Er musste in Bewegung bleiben, damit die Kälte nicht in seine Knochen drang und er möglichst bald in seinem Versteck, dem kleinen Gartenhaus am Raichberg, unter eine löchrige, aber warme Daunendecke schlüpfen konnte.
Er schlief dort, oberhalb des Stuttgarter Ostens. Die Umgebung gab ihm ein Gefühl der Sicherheit. Nur wenige Menschen verirrten sich derzeit in diese Gegend. Es war unwahrscheinlich, dass man gerade in der Nähe des von den Nazis längst enteigneten SPD-Waldheims nach ihm suchen würde. Doch sicher konnte man nie sein, das Land war voller Denunzianten.
Die Gefahr, im Freien gesehen oder von einem Nachbarn verraten zu werden, war groß. Anfangs hatte er sich unter den Trümmern eines zerstörten Hauses im Osten versteckt. Von dort hatte er mitansehen müssen, wie sie den alten Hans Frenkel abgeholt hatten. Zitternd vor Kälte und Angst war Paul immer tiefer in sein Versteck gekrochen, aus Angst, die Hunde könnten ihn finden. Frenkel, der Alte, hatte zu laut über Hitler geschimpft. Und irgendjemand hatte ihn verpfiffen. Jetzt war er verschwunden.
Paul Kramer widerte dieses Denunziantentum an. Jeden Tag schwärzten Freunde, Nachbarn und sogar Familienmitglieder einander an und nahmen in Kauf, dass nachts die Gestapo oder die SS die Türen eintrat, sie aus dem Schlaf zerrte und in die sogenannte Schutzhaft nahm.
An dem Tag, als Hans Frenkel einem Denunzianten zum Opfer gefallen war, hatte Paul beschlossen, sich in der alten, baufälligen und abseits gelegenen Gartenlaube zu verstecken, die er bei einem seiner Streifzüge durch die Gegend entdeckt hatte.
Er schob die lähmenden Gedanken beiseite, die sich immer wieder einschlichen. Paul musste weiter. Bis zum Tagesanbruch musste er in seinem Versteck sein, wo er reglos auf einem harten Feldbett sitzen und die kahlen Wände anstarren würde.
Hilde Jäger hatte sich vor ihrem Vater aufgebaut. Sie hatte beide Fäuste in die Seiten gestemmt, und ihre Augen sprühten vor Hass. Ihr Ärger war längst in Zorn umgeschlagen. Zorn über ihren Vater und sein Verhalten ihrem Freund Paul Kramer gegenüber. Sie kannte Paul schon lange, als Kinder hatten sie gelegentlich zusammen gespielt, wenn er hin und wieder in den Ferien seine Tante Ruth in Stuttgart besucht hatte. Dann hatten sie sich aus den Augen verloren. »Zu undeutsch« war der Umgang ihren Eltern gewesen.
Lange Zeit später, der Krieg war fast im fünften Jahr, war Paul zu ihr ins Lazarett eingeliefert worden. Dort hatte sich Hilde freiwillig zum Sanitätsdienst gemeldet, da sie etwas Sinnvolles tun wollte. Und wenn sie schon diesen irrsinnigen Krieg nicht aufhalten konnte, so wollte sie wenigstens den armen Schweinen, die man als Kanonenfutter an die Front schickte, helfen. Die Soldaten, die eingeliefert wurden, waren von Mal zu Mal jünger. Teilweise noch Kinder, mit weichem Flaum da, wo später mal ein Bart wachsen würde, wenn sie denn überhaupt so alt werden, hatte sie oft gedacht.
Anfangs hatten Paul und sie sich noch zaghaft beäugt, denn er war zu sehr vom Morphium betäubt. Doch sie hatte sich liebevoll um ihn gekümmert. So war irgendwann eine sanfte Verliebtheit erblüht, aus deren Frucht dann im Laufe der Zeit echte Liebe gewachsen war. Ihr Vater jedoch hatte alles kaputtgemacht, alles zerstört, so wie seinesgleichen es immer tat. Manfred Jäger hatte zertrümmert, was sie lieb gewonnen hatte. Er hatte Paul Kramer an die Nazis verraten und somit ihren Traum von Zukunft mit einem Handstreich vernichtet.
Aus diesem Grund musste sie jetzt stark sein und durfte nicht weinen. Sie war gewillt, ihrem Vater die Stirn zu bieten, ihm zu zeigen, dass er am heutigen Abend seine älteste Tochter verloren hatte.
Was er ihr angetan hatte, war unverzeihlich. Sie wurde von einer neuen Welle aus Wut und Verzweiflung gepackt, als sie daran zurückdachte. Und obwohl all das keine zwei Stunden her war, wirkte es auf sie, als würde sie durch ein vernebeltes Fenster auf diese dunklen Momente ihres Lebens blicken.
Nachdem Paul mit einer Mischung aus Panik, Wut und Unverständnis in den Augen aus dem Zimmer und dem Haus gestürmt war, hatte ihr Vater sie mit strengem Blick gemaßregelt und mit drohend erhobenem Zeigefinger in Schach gehalten. Sie war alt genug, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Doch ihr Vater war eine übermächtige Figur, deren bloße Erscheinung jedem Anwesenden Respekt abnötigte. Auch ihr, obwohl sie ihn in diesem Moment mit größtmöglichem Abscheu betrachtete.
»Du wartest hier, Fräulein. Wir sind noch nicht fertig«, hatte er mit tiefem Bariton gegrollt, um dann mit wehendem Nachtrock aus dem Zimmer zu eilen.
Hilde hatte ihm voll Entsetzen hinterhergeblickt. Im Moment darauf war ihre Schwester Trude in der Tür erschienen und hatte sie mit furchtsamem Blick angeschaut.
Natürlich war Trude irgendwann wegen des Lärms und Geschreis aufgewacht. Es wäre verwunderlich gewesen, wenn sie nicht alles mitbekommen hätte. Doch Hilde war überzeugt, sie hatte sich nicht aus ihrem Bett und ihrem Zimmer getraut. Trude war das Nesthäkchen. Ihre kleine Schwester war acht Jahre jünger und wirkte auf sympathische Weise noch verspielt und kindlich, während Hilde längst eine erwachsene Frau war, die mit ihren achtundzwanzig Jahren nur zu Hause lebte, weil es kaum benutzbaren Wohnraum gab.
Hilde hatte den warmen Körper in die Arme geschlossen. Die Tränen waren über ihre Wangen geflossen, als hätte man die Schleuse eines Staudamms geöffnet.
Von unten hatte sie die Stimme ihres Vaters vernommen. In kurzen, abgehackten Sätzen hatte er mit jemandem gesprochen. Doch es war keine zweite Person zu hören gewesen. Also musste er im Treppenhaus stehen und telefonieren. Mit wem, konnte sie nur erahnen. In ihr war ein bisher ungekanntes Gefühl hochgestiegen: Hass. Hass auf ihren eigenen Vater und auf alles, was er war, wofür er stand. Sie empfand nur Verachtung für diesen Mann, der sie gezeugt hatte, dem sie ihr Leben verdankte. Nie war er liebevoll mit ihr umgegangen, immer nur hatte er seine Firma und die verfluchte Politik im Kopf gehabt – und sich selbst. Ja, wenn sie genau überlegte, hatten sie sich nie gut verstanden.
Ihre Mutter war ins Zimmer gekommen, hatte die Tür leise zugedrückt und ihre Töchter in die Arme geschlossen. Sie trug nur einen Morgenmantel über einem Nachthemd. Hilde wusste um ihre äußere Ähnlichkeit mit ihrer Mutter. Die war für niemanden zu übersehen. Doch während ihre Mutter in beinahe blinder Unterwürfigkeit den Regeln von Manfred Jäger folgte, hatte sich Hilde immer rebellischer gefühlt und gezeigt, ihren eigenen Kopf entwickelt und auch durchzusetzen versucht. Ihre kleine Schwester suchte ihren Weg noch, wirkte jedoch stiller, zurückhaltender als Hilde.
»Warum macht er das?«, forderte Hilde mit bebender Stimme eine Antwort von ihrer Mutter und wand sich aus der Umarmung.
»Er tut nur, was er tun muss. Er will uns, er will euch schützen.«
»Du glaubst doch selbst nicht, was du da sagst. Er schützt nur sich. Wir sind ihm egal, und Paul spielt für ihn keine Rolle. Paul ist für ihn doch gar kein Mensch. Warum kann er ihn nicht einfach in Ruhe lassen? Der Krieg ist doch ohnehin bald vorbei …«
Ihre Mutter warf ihr einen Blick zu, der sie verstummen ließ.
»Kind, dein Vater würde dich nie absichtlich verletzen. Er will dich beschützen, Liebes«, sagte ihre Mutter dann und strich ihr sanft über das Haar, während Tränen in ihre Augen traten. »Und so, wie er erzählt hat, ist der Kampf keineswegs verloren. Dein Papa hat gemeint, dass es Nachrichten aus Berlin gibt, direkt aus dem Führerhauptquartier, die sagen, dass es einen großen Befreiungsschlag geben wird, hörst du? Wir werden den Feind mit Wucht aus unserem Land werfen, neuen Atem holen und zu alter Stärke erwachsen. Es gibt immer Rückschläge. Im Leben und im Krieg. Aber am Ende werden wir siegen.«
Hilde entzog sich ihrer Mutter, wich einen Schritt zurück und starrte sie ungläubig und mit vor Entsetzen aufgerissenen Augen an. Sie konnte nicht glauben, was sie da hörte.
Doch ihre Mutter redete unbeirrt weiter. »In dieser Situation darf man nicht in den Verdacht geraten, mit Menschen zu kollaborieren, die unsere Wehrkraft zersetzen. Wir sind immerhin eine sehr privilegierte Familie. Das verstehst du doch, Kind. Es ist nur zu deinem Besten. Und wahrscheinlich auch für Paul. Er wird es verstehen, ihr werdet es verstehen. Irgendwann.«
Nein, das verstand sie nicht. Das hatte sie nie getan. Und das wollte sie auch überhaupt nicht. Für Hilde waren die Jahre ihrer Jugend von einem unbeschreiblichen Gefühl bestimmt gewesen, das seit jeher Befremden in ihr ausgelöst hatte. Anfangs hatte sie auch marschieren müssen, erst im Jungmädelbund, dann im Bund Deutscher Mädel. Als dann aber plötzlich einige ihrer Freundinnen nicht mehr zu ihr kommen wollten oder ihre Eltern ihr den Umgang verboten, war eine Unzufriedenheit in ihr gewachsen, die sie anfangs nicht hatte greifen können. Diese war mit der Zeit in Skepsis umgeschlagen, weil irgendwann Kinder und oft deren ganze Familien verschwunden waren. Natürlich wusste sie nicht, was mit ihnen geschehen war, aber niemand verschwand doch einfach so.
Der Rang ihres Vaters hatte sie davor bewahrt, in den Ostgebieten des Reichs oder in Krankenhäusern und Lazaretten eingesetzt zu werden. Stattdessen hatte sie im Rathaus tippen gelernt, seitenlange Protokolle geschrieben und dem Roten Kreuz ihre Hilfe angeboten. Im Lauf der Zeit hatte sich ihre Skepsis gegen die Regierung, den Führer und seinen Krieg verstärkt.
Mit ihren Eltern hatte sie nie darüber sprechen können. Ihre Mutter war ihren Fragen immer ausgewichen, wie sie überhaupt dazu neigte, alle kritischen Themen totzuschweigen. Und der Vater hatte sie stets angeherrscht, sie solle gefälligst den Mund halten und sich als junge und unwissende Frau nicht mit unbotmäßigen Fragen an Führer und Vaterland versündigen.