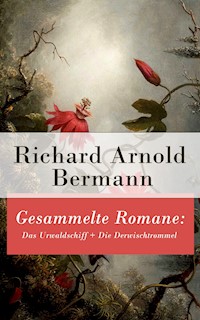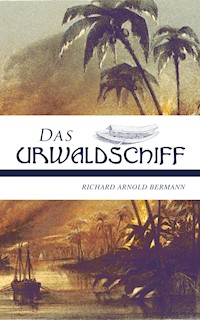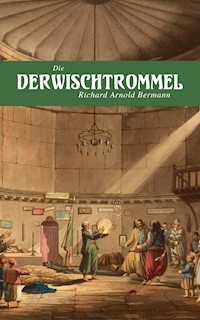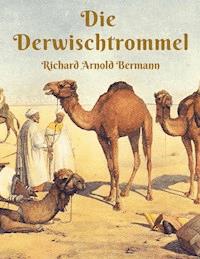
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ende des 19. Jahrhunderts wird der Sudan von der Kolonialmacht Ägypten beherrscht. Von 1881 und 1899 kommt es zu einer Rebellion gegen die Besatzer, bekannt als der Mahdi-Aufstand. Der Aufstand wird angeführt von Muhammed Ahmad, der sich zum Mahdi erklärt hatte. »Die Derwischtrommel« von Arnold Bermann aus dem Jahr 1931 ist eine spannend geschriebene Biographie des Rebellenführers. Für seine Recherchen bereiste Bermann den Sudan und besuchte die Originalschauplätze. »Die Derwischtrommel« erzählt auch von dem Abenteuer, das eine Sudanreise in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch bedeutete.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Derwischtrommel
TitelseiteAus den Notizen des ReisendenDie StadtDas JochDie InselDer StorchDie SchaleDer HeldDer FreundDas GesichtDie WarnungDie FluchtDer BergAus den Notizen des ReisendenDer BoteDie SchlachtDer BaumDas KleidDer PilgrimDas DachDas HauptDer SiegDie KanzelDer EngelAus den Notizen des ReisendenAnmerkungImpressumDie Derwischtrommel
Richard Arnold Bermann
Aus den Notizen des Reisenden
Khartum, den 10. Januar 1929.
Die Veranda des Grand Hotels ist jetzt, so bald nach dem Lunch, noch menschenleer. Zu heiß noch im Freien. Hierher entwische ich dem Touristengeschwätz in der Halle. Der Wüstenexpreß Wadi Halfa-Khartum ist vor einigen Stunden angekommen, der zweimal wöchentlich während der »Season« aus den großen Hotels von Luksor und Assuan Touristen-Menschheit her nach Khartum bringt; wieder in ein Hotel zu Whiskysoda und Jazz am Abend.
Die Veranda längs der Hotelfront ist um eine Stufe über den Garten erhöht und nach vorne offen. Unten, auf einem bekiesten Streifen, hocken schon jetzt die Händler, die später, zur Teezeit, auf dem Rand des Verandabodens ihre Waren auslegen dürfen.
Da ich mir einen Liegesessel zurechtschiebe und, den Fliegenwedel in der einen Hand, in einem Buch zu lesen beginne – einem Buch aus der Geschichte des Sudans –, nähern sich mir einige dieser Händler, gemischte Orientalen, lassen aber, auf einen ungeduldigen Wink, gleich wieder von mir ab. Entweder ist es noch zu heiß zum Zudringlichwerden, oder, und das ist eher der Fall, gehöre ich nach ungeschriebenem Recht dem einen Händler, der schon vorher gegenüber der Stelle gehockt hat, an der ich Platz nahm. Dieser eine läßt sich nicht winken, sondern packt unbeirrbar seine Waren aus einem Wachstuch und breitet sie vor mir aus, allerlei Andenken und Kuriositäten, die ich erwerben soll. Da ich den Kerl, einen grünlich dunkelbraunen, noch jüngeren Menschen, nicht loswerden kann – ich schätze, er ist ein Hindu oder ein Parse – und er mich nicht lesen läßt, beschließe ich, ihn zu ärgern, und verstehe keine der vielen Sprachen, in denen er gleich auf mich einspricht. Erstaunlich, wie viele europäische Sprachen er irgendwie kennt!
Er will mir, auf englisch, Zigarettendosen aus Messing verkaufen, billigen Schund aus den Basaren von Agra und Delhi; Musselinschals, wie sie aus England nach Benares gebracht und dort den Touristen angedreht werden. Da ich, scheint es, nicht Englisch verstehe, versucht es mein Kerl mit Spanisch, er muß auf Trinidad oder in Panama gewesen sein, wo so viele Inder leben. Ich verstehe auch nicht Spanisch, für ihn nicht, und kaufe die ceylonesischen Elefanten nicht, aus tiefschwarzem Holz. Ich verstehe keinen Ton von dem Portugiesisch von Goa und zeige kein Interesse für Elfenbeinschnitzereien (obwohl ein Püppchen, einen Krieger der Schilluk darstellend, mit einem Speer in der Hand, mir gefällt, im Grunde). – Auf kapholländisch weiß ich nicht zu begreifen, daß ich Lederarbeiten kaufen soll, prachtvolle grellrote Kissen aus kunstvoll gefärbter Gazellenhaut, mit vielen Farben benäht, wie sie drüben in Omdurman gearbeitet werden.
Endlich, da ich keine einzige Sprache verstehe, winkt mir der Parse geheimnisvoll, holt ein Bündel. Das spricht für sich selbst! In dem Bündel sind Waffen, Speere, barbarische Keulen und Schilde, Dolche, die statt in Scheiden in toten kleinen Krokodilen stecken, so daß der Griff aus dem Rachen herausragt. Und vor allem Schwerter von unverkennbarer Form. Die ledernen Scheiden enden in seltsamen Rhomboiden, der Kreuzgriff ist mit Silber beschlagen – die Klingen, wenn man sie sieht, gerade und breit, nicht sarazenische Säbel, sondern Kreuzfahrerschwerter.
Auch diese Waffen mögen gefälscht sein.Das heißt: sie sind es. Schon in dem geheimnisvoll-schönen Basar von Assuan bietet man sie den Touristen an, als Derwischwaffen, Trophäen von den alten Schlachtfeldern im Sudan – –.
Der indische Händler steht vor mir auf dem Rasen des Gartens, mit einem großen, entblößten Schwert in seiner Hand; die Goldstickerei seines Käppchens blitzt in der Sonne, und er ruft mir Worte zu, die ich, in welcher seltsamen Sahibsprache immer ich denken möge, die ich, hier im Sudan, verstehen muß.
»Derwisch, Sahib! El Mahdi, Sahib!«»The sword, la espada, Sahib, Mijnheer, of the Mahdi!«
Khartum, den 11. Januar 1929.
Ich mache einen Ausflug auf die Hochebene von Kerreri, den Schauplatz der Schlacht vom 2. September 1898, in der Kitchener die Mahdisten vernichtet hat.
Auf dem Schlachtfeld steht der Marmorobelisk zu Ehren der Gefallenen vom 21. Lancer-Regiment, das hier seine herrische und vielleicht etwas unweise Attacke geritten hat. (Ein sehr tapferer junger Leutnant, der mitritt, hieß Winston Churchill.) – Oberhalb des Denkmals gewinne ich die Höhe eines kleinen Wüstenberges, des Dschebel Surgham. Von hier hat am Tag vor der Schlacht der Sirdar, Herbert Kitchener, das Gelände geschaut und das Heer des Khalifa heranmarschieren sehen, mit tausend Bannern. Dahinter sah er den Umriß einer fernen, leuchtenden Kuppel. Das war das Grab des Mahdi in Omdurman.
Ich sitze auf einem Felsblock, habe Bücher und Karten vor mir und suche die letzte große romantische Schlacht des neunzehnten Jahrhunderts recht zu verstehen, vielleicht den letzten epischen Ansturm des Islams gegen die westliche Zivilisation.
Vor mir der ruhig strömende Nil. Der Höhenzug, auf dessen Kamm ich jetzt sitze, begegnet dem Nil an der Stelle, wo Kitchener lagerte. Ein befestigtes Lager, am linken Flügel mit einem »Seriba«-Wall aus dornigem Mimosenreisig und sonst von Schützengräben umgeben. Im Lager sind zweiundzwanzigtausend Mann, Ägypter und Engländer. Das ist nicht eine von den phantastisch improvisierten Expeditionen, mit denen man immer wieder vergeblich die Derwische niederzuwerfen versucht hat, seit siebzehn Jahren. 1885 ist Khartum dem Mahdi erlegen und General Gordon hat sterben müssen, weil die Ersatzarmee auf pittoreske Weise hoch zu Kamel durch die Wüste kommen wollte. Diesmal hat Kitchener sich die Bahn gebaut, eine erstaunliche Eisenbahn quer durch den nackten, glühenden Sand. Dieser Fluß im Rücken des Lagers ist voll von modernen Kanonenbooten. Im Lager selbst die beste, die neueste Artillerie. Maschinengewehre in Mengen. Die englischen Truppen aus den bewährtesten Regimentern, vortrefflich verpflegt und gerüstet, mit neuen Lee-Enfield-Gewehren. Wichtiger: die ägyptischen Truppen, die auch diesmal die Masse des Heeres bilden, sind nicht mehr das, was sie waren; jetzt werden sie nicht wieder kompanieweise rennen, wenn der Speer eines Derwisches sichtbar wird. Sie zeigen sich, nicht nur die Negersoldaten, sondern auch die gelben Fellachen, vollkommen diszipliniert wie europäische Truppen.
Da ist also, in dem befestigten Lager General Kitcheners, das Fin de siècle: Europa mit seinen tödlichen Waffen, Europa schon vorbereitet auf seinen gräßlichen Bruderkrieg, die Technik des neuen Zeitalters fast schon fertig, das vollendete neunzehnte Jahrhundert, großartig, prunkvoll und mordbereit. –
Dann ertönen arabische Trommeln, und Mohammeds siebentes Jahrhundert marschiert heran, fast unverändert – – –
Das letzte wirkliche Heer des Islams, denn später hat höchstens der moderne Nationalismus mohammedanischer Völker Armeen ins Feld geschickt, die letzten Sarazenen, die letzte Welle der großen Flut, die der Prophet von Mekka dreizehn Jahrhunderte vorher aufgewühlt hatte.
Vierzigtausend dunkelhäutige, heiße Menschen, die meisten von arabischem Blut – noch genau so gläubig, fanatisch, allahtrunken wie zur Zeit des Propheten, ganz unberührt vom Wandel der Zeiten. Menschen mit Schild und Lanze, mit Zweihänderschwertern, manchmal in dem altsarazenischen Kettenpanzer. Sie haben moderne Gewehre erbeutet und gebrauchen sie kaum, das ist etwas Fremdes, dem man kein rechtes Vertrauen schenkt. Drüben in Omdurman ist das Arsenal des Khalifa voll von guten Beutegeschützen, von Krupp-Kanonen, von Mitrailleusen. Aber abgesehen von einigen wenigen, elend gezielten Schüssen greift die Derwisch-Artillerie nicht in den Kampf ein. Diese Leute wollen mit Kreuzfahrerschwertern das Fin de siècle in Stücke hacken!
Was für ein Anblick (träume ich, auf meinem Felsblock vor der leeren Landschaft, auf der die Sonne brütet) – welch ein epischer Anblick, wie ein Gesang aus dem Rolandslied! Das arabische Heer kommt über die Höhen, langsam. Im Zentrum die Baggara, Stammesgenossen des Khalifa Abdullahi, der diese wilden Haufen selber führt. Sein riesiges schwarzes Banner, das einzige schwarze, ist hoch in der Luft, die frommen Texte, mit denen es ganz benäht ist, verkünden den Sieg, unfehlbaren, sicheren Sieg für die Gläubigen – –.
Und Fahnen, Fahnen, zu Hunderten. Jeder Emir führt seine Fahne, es gibt weiße und blaue und grüne und gelbe. Wie eine Blumenwiese erscheint das Feld, wie eine Blumenwiese, in der ein fruchtbarer Wind wühlt – –.
Sie kommen näher. In diesen Herzen ist gar kein Zweifel. Daß hier bei Kerreri die große Entscheidung gegen die Engländer fallen soll, weiß der ganze Sudan schon seit dreizehn Jahren: der Mahdi hat es vor seinem Tode prophezeit, und seither hat man auf eben diesem Gelände alljährlich die große Heerschau gehalten und den Sieg, den gewissen, schon vorher gefeiert – –
Und dann: der Angriff des Glaubens gegen Lee-Enfield-Gewehre, Kanonenboote, Schnellfeuerbatterien. –
– Niemals nachher, nicht während all der blutigen Greuel des Weltkrieges, hat man Ähnliches mehr gesehen. Durch ein Feuer, das Festungsmauern erschüttert hätte, kommen sie näher und näher – –
Gemetzel sondergleichen, Heldentum ohne Zweck. Bei alledem kommt dieser ???episclie Heersturm dem Gegner nicht nah genug, um die blanke Waffe zu brauchen; die Verluste des anglo-ägyptischen Heeres sind winzig, während die Derwische sterben, sterben – –. Da der große Sturm auf das Lager endlich gebrochen ist, liegen sie da in ihren hellen Gewändern, wie eine Wiese voll weißer Blumen, die eine Maschine gemäht hat – –. Es ist fast unglaublich, daß noch ein Derwischkrieger am Leben ist; dennoch wiederholt sich, da Kitchener nun den Befehl zum Vorrücken gibt, auf Omdurman, auf Khartum, wiederholt sich noch zweimal das gleiche unfaßbare Schauspiel, dieser Angriff der wilden Romantik auf eiserne Technik, dieser Kampf zwischen Schlachtgesängen und Lydditgranaten, zwischen Bannern und Panzerschiffen – –.
Ich schlage eines der Bücher auf, die ich mitgebracht habe, Bücher von Augenzeugen, die mir das schwer Glaubliche schildern, und lese dies:
»Von der Armee der Schwarzen Flagge kamen jetzt nur noch in den Tod verliebte Desperados, schlenderten einzeln gegen die feuernden Flinten; blieben stehen, um eine Lanze zu schwingen, um einen Toten zu agnoszieren. Dann, von plötzlicher Wut erfaßt, schnellten sie vorwärts, hielten inne, fielen haltlos zu Boden. Jetzt standen unter dem Schwarzen Banner, das in einem Ring von Leichen wehte, nur noch drei Derwische den dreitausend Mann der dritten Brigade gegenüber. Sie falteten ihre Arme um die Flaggenstange und starrten geradeaus. Zwei fielen. Der letzte Derwisch richtete sich auf, füllte die Lungen mit Atem, er schrie den Namen seines Gottes, warf einen Speer – – Dann stand er vollkommen still und wartete.«
Elftausend Tote des Derwischheeres fand man auf dem Schlachtfeld; viele Tausende, die mit der Todeswunde flohen, fand man nicht. Von den Soldaten Kitcheners sind in der Schlacht keine fünfzig gestorben.
*
Mein arabischer Führer kommt, läßt mich nicht mehr sitzen und denken. Ich soll mir Gebeine von Derwischen ansehen. Sie kommen immer wieder, immer wieder aus dieser verfluchten Erde.
Aber ich kann noch nicht zurück in die Gegenwart. – Dieser Tag vor drei Jahrzehnten, wie lang ist das her! Ich war ein Gymnasiast, ich verschlang in der Zeitung die Schlachtberichte, es war besser als der »Lederstrumpf«! Ein Landsmann von mir, Rudolf Slatin, war unter den glorreich-romantischen Helden dieser Schlacht. Er war im Lager der Mahdisten gefangen gewesen, zwölf Jahre hindurch, war ein Diener, ein Sklave dieses Khalifa gewesen, war dann entflohen, oh, welch eine Flucht, ein Kapitel aus einem wilden Abenteuerroman! Jetzt, am Nachmittag dieses Schlachttags, betrat ein siegreicher Oberst, Slatin Pascha, vielleicht als erster die eroberte Stadt Omdurman, um rasch den Khalifa zu suchen. Doch der war entwichen, während General Kitchener einritt – –
Welch ein Roman, welch ein Abenteuer! Den Knaben, der das gelesen hat, in seinem Elternhaus in Wien, störte der Gedanke an zwanzigtausend niedergemähte Derwische keineswegs. Dieser Krieg irgendwo in Afrika war so fern und unwirklich wie die Nibelungenschlacht, von der wir eben in der Schule lasen, nur soviel mehr aufregend, köstlich.
Krieg? Kein Gedanke an Krieg, kein Begriff von Krieg streifte die Welt eines europäischen Jungen im September 1898. Wenige Wochen später wäre um ein Haar ein europäischer Krieg entstanden, eben aus dieser fernen Derwischaffäre: Kitchener, nun schon Lord Kitchener of Khartum, war von Omdurman sofort achthundert Kilometer nilaufwärts gefahren, nach Faschoda, wo der Major Marchand die französische Flagge gehißt hatte, und hatte die britische Flagge drohend der Trikolore gegenübergestellt. Es wurde kein Krieg daraus, oder vielleicht viel später ein anderer. Der Knabe, der 1898 von den Derwischen las, konnte nicht ahnen, wie hier die Räder der Weltuhr ineinander griffen – –
Da aus dem Fall Faschoda kein englisch-französischer Krieg entstand, entstand daraus, langsam, die englisch-französische Entente Cordiale – –
*
Ich sehe mich noch einmal um auf diesem Schlachtfeld eines alten und schon halb vergessenen Kolonialkrieges. In der Geschichte, begreife ich, gibt es nicht Nebenschauplätze und Episoden. Alles ist wichtig, alles bestimmt das künftige Dasein. Hier nicht weniger als in Sarajewo oder an der Marne oder in Versailles ist das Leben meiner eigenen Generation entschieden worden, um uns hat es sich in dieser exotischen Schlacht gehandelt; der Erwartete Mahdi des afrikanischen Islams hat auf mein eigenes Schicksal Einfluß geübt.
*
Khartum, den 14. Januar 1929.
Im Gordon College, einer Schule, in der schwarzbraune Scheichsöhne zu Hilfsbeamten der Kolonialverwaltung abgerichtet werden, gibt es ein hübsches kleines Museum; es enthält ausgestopfte tropische Vögel und dergleichen, dann aber auch antiquarische Funde aus den Grabstätten und Tempelruinen des Sudans.
Ich sehe mir lange die Glaskästen an, die voll sind von dem gewohnten altägyptischen Bric-à-Brac, »Ushepti«-Statuetten, Götter aus Bronze und Elfenbein, Skarabäen, Töpfen, Halsketten, Schminkgefäßen, – dann die Sammlungen aus Gräbern der Ptolemäer-, Römer- und Christenzeit. Es ist alles ungefähr wie am unteren Nil, in Ägypten. Und dennoch anders. Im Grab des Prinzen Hepzefa, ägyptischen Statthalters von Nubien um das Jahr zweitausend vor Christi Geburt, hat man die Knochen von hundert Menschen gefunden, die mit dem Prinzen bestattet wurden, seine Weiber und Diener. Nichts Derartiges wie diese grausame Hekatombe kennt man aus den Fürstengräbern Ägyptens. Ein Einschlag von afrikanischer Barbarei ist nicht zu verkennen; diese Note beherrscht das ganze Museum. – In den Gräbern der unabhängigen Äthioperkönige, ein Dutzend Jahrhunderte später, liegen die Knochen geschlachteter Pferde. – Diese Funde aus den Pyramiden von Nuri, den Gräbern von Napata, zeigen so deutlich diese Vergröberung, diese Vernegerung, der im Sudan die Kultur der Mittelmeerländer stets ausgesetzt war. Welche groteske Entartung ägyptischer Vorbilder! Alles Geistige mißverstanden, alles Leibliche sinnlich-schwülstig verzerrt! Noch deutlicher wird es in den Funden aus Meroë (nicht so weit von Khartum), wo zur Ptolemäer-, zur Römerzeit so etwas wie hellenische, wie römische Kunst gelebt hat, nur, ihr unsterblichen Götter, wie vernegert! Venus mit wulstigen Lippen, Cäsar als Negerhäuptling – –
Es gibt noch Reste von einem byzantinischen Afrika; dann ist der Islam gekommen. Auch er war von Anfang an ein Negerislam, mit einem Strom von schwarzem Blut in nur halb arabischen Adern. Das ist der Islam des Mahdi, ein afrikanischer, ein barbarischer, ein äthiopischer Islam.
Khartum, den 17. Januar 1929.
Mit der elektrischen Straßenbahn nach Omdurman, über die mächtige neue Brücke über den Fluß, an der Stelle, wo der Weiße Nil, der träge Schlammstrom aus den Äquatorseen, sich mit dem Blauen Nil vereinigt, dem reißenden Bergfluß aus Abessinien. Hier an dieser großen Gabel ist halb Afrika zusammengekommen: Omdurman, die phantastische Stadt aus spitzen Negerhütten und lehmgebackenen Würfeln, scheint von Khartum tausend Meilen und tausend Jahre entfernt. Omdurman ist im ganzen noch so wie vor einem Vierteljahrhundert beim Zusammenbruch des Mahdismus. Jeder ältere Mann in den Straßen war einst ein Derwischkrieger im Kampf gegen Kitchener, oder er ist als Sklave hierhergekommen, mit dem Hals im Joch. Derwische und Kinder von Derwischen, befreite Sklaven und Kinder von Sklaven. Einige Mittelmeermenschen dazwischen, Griechen, Armenier, Kopten und Juden. Und mohammedanische Pilger aus dem fernsten Westafrika sind auf dem Rückweg aus Mekka hiergeblieben. Welch ein Gewimmel auf dem unvergeßlichen Markt! Ein Weib von den Niam Niam am Weißen Nil hockt vor dem Korb voll von Durrhakörnern, die weiß genau, wie Menschenfleisch schmeckt. Olivenfarbene und braune Beduinen sind da, Hadéndoa mit phantastischen Wuschelfrisuren und großen Schwertern in Scharlachscheiden und riesige nackte Schillukneger, die auf einem Bein stehn, wie die Störche in ihren verschilften Sümpfen am oberen Nil; und Abessinier, die den Blauen Fluß herabgekommen sind; – ganz Afrika. In dem Gewühl barbarischer Menschen hier und dort ein humpelnder Krüppel, dem ein Arm fehlt und ein Bein: das sind Menschen, die noch der Khalifa für irgendein Verbrechen bestraft hat. Obwohl in den offenen Buden und Hütten hier und dort eine blecherne Petroleumbüchse zu sehen ist, eine Nähmaschine, ein Grammophon, – hat sich doch nichts vom Wesentlichen verändert: das ist noch beinahe das alte Afrika, der unberührte Sudan des Mahdi und des Khalifa – –
Ich finde in dem Hüttengewirre mit Mühe das Haus des Khalifa Abdullahi, das jetzt auch eine Art Museum enthalten soll, mit Andenken an die Mahdi-Zeit.
In dem Hause finde ich viele von den Leuten aus dem Grand Hotel, die amerikanischen Misses aus dem Wüstenexpreß, den holländischen Herrn, der den Weißen Nil hinaufgeht, um womöglich vom Schiff aus Elefanten zu photographieren – wie sie, hinter dem kohlrabenschwarzen Cookschen Fremdenführer drein, durch die vielen Ziegel-, und Lehmhäuser stampfen, die diesen einfachsten aller Paläste bilden. Hier hat der Khalifa Abdullahi also geschlafen. (Ja, es ist diese kunstvolle sudanesische Bettstatt, die Slatin Pascha in seinem Buche schildert. Er, Slatin, hockt auf der Matte daneben, und der Khalifa ermahnt ihn zu Demut und Frömmigkeit.) – Ein richtiges Badezimmer hatte er, mit der Wanne aus Gordons Palast.
Mir bleibt nichts übrig, als mitzutrotten, – und ich denke währenddessen an diese große Figur des aufregenden sudanesischen Dramas, den Khalifa Abdullahi. Wer war er? Nur ein erfolgreicher Soldat, später ein Diktator, der sich ziemlich lange gehalten hat. In den Jahren des Mahdi schon offenbar der Arm dieser afrikanischen Revolution, der Organisator des Derwischheeres. Geistig niemals dem Mahdi gewachsen, an dessen Größe und Tiefe kein Zweifel ist. Der Mahdi allein ist das Hirn, das Herz dieser neuen streitbaren Kirche, die in so kurzer Zeit halb Afrika sich erobert. Der Khalifa? Der weltliche Arm, der Büttel. Er nimmt, vielleicht ist es ein heroisches Opfer, jenes Odium der blutigen Strenge auf sich, das in allen Revolutioneneinertragen muß, wird der Robespierre, der Fouquier-Tinville, der Dsershinsky des Mahdismus; der Mahdi selber bleibt gütig und lächelnd.
Dann stirbt der Mahdi, ganz kurze Zeit nach dem Sieg. Da liegt er, gegenüber dem Haus des Khalifa, in einem geheiligten Grabe (so wie Lenin an der Mauer des Kreml). Fast vierzehn Jahre noch hält sich der Khalifa. Der Weltsturm, den der Mahdi vorhergesagt hat, kommt nicht; viele fallen vom Glauben ab; aber dieser Beduine, den ein sonderbares Schicksal zum Diktator des ganzen Sudans gemacht hat, regiert, schließlich nur noch durch brutale Gewalt, dennoch weiter. Anderthalb Millionen Menschen sollen im Laufe der Jahre durch ihn gestorben sein.
War er ein ganz gewöhnlicher afrikanischer Despot, obwohl ein starker Mann? Slatin, der jahrelang an seiner Türe stand (hier, der Fremdenführer zeigt uns eben die Stelle), hat ihn als ein Ungeheuer gesehen, kalt, mißtrauisch, grausam aus Neigung. Aber er hat Slatin selbst kaum sehr schlecht behandelt, außer einmal, als der Gefangene, immerhin, bei der Korrespondenz mit dem Feind erwischt worden war und deswegen in Ketten gelegt wurde. – Der deutsche Kaufmann Karl Neufeld, der während der ganzen Khalifa-Zeit in der schrecklichsten Weise gequält worden ist, spricht dennoch mit Sympathie von dem Khalifa Abdullahi. – Fragt man heute irgendeinen Sudanesen, dann sagt er: der Mahdi war ein guter Mann, aber dann der Khalifa war ein Teufel! Ist es nicht die bequemste Auslegung? Edle Idealisten stecken mit reinen Händen ein heiliges Feuer an; wenn es dann die Welt verbrennt, ist irgendein treuer Gehilfe des Heiligen der Teufel dieser Flamme!
Ich gehe weiter durch die Räume, hinter dem schwarzen Cicerone drein. So, eine Druckerpresse hat der Khalifa auch gehabt, einen Wagen – –
Eins ist sicher, denke ich: ein Kerl aus einem Guß. Als Prophet eher schwächlich, denn nach dem Tode des Mahdi weicht alle Inspiration aus dem Mahdismus, die Lehre fällt zusammen, – als Regent ein bloßer Tyrann, der nichts kann, als seine eigenen wilden Stammesgenossen, die Baggara, im Sudan allmächtig schalten lassen und alle anderen Landesbewohner verderben, – als Organisator hilflos, aber groß und heldenhaft tragisch als Kämpfer. Am Tag von Kerreri immer hinter seinem schwarzen Banner, an der gefährlichsten Stelle der Schlacht. Am Abend flieht er wohl; ein Führer, der noch hofft, hat die Pflicht, sich zu retten. Aber wenn er dann nicht mehr hofft? Der Khalifa Abdullahi ist so gestorben: fünfzehn Monate irrte er im Lande herum, dann trieben ihn, nicht weit von der Mahdi-Insel Abba, die anglo-ägyptischen Truppen in eine Falle. Da steigt der Khalifa von seinem Kamel, breitet das Schaffell von seinem Sattel auf der Erde aus: so, da wird er stehen und sterben – –
Man findet ihn nach dem Gefecht tot auf dem Schaffell.
*
Ich bleibe mitten im ehemaligen Harem des Khalifa stehen (in dem Raum, der voll von Spiegeln gewesen ist), um eine Visitenkarte zu suchen, die ich bei mir habe. Ich bin, als ich gestern im Regierungspalast war (in General Gordons Palast, ganz nah der Stelle, wo er niedergemetzelt wurde), mit einem eingeborenen Gentleman bekannt gemacht worden, einem schmucken, noch jungen Hauptmann in der reizendsten Uniform. Wir haben höflich miteinander gesprochen, und er hat mir dann sein hübsches Kärtchen gegeben:
»M. A. Soliman El-Khalifa AbdollahiA. D. C. to Governor General.«
»Soliman, Sohn des Khalifa Abdullahi, Adjutant (Aide de Camp) des Generalgouverneurs.« – Mehrere Söhne des toten Khalifas stehen im anglo-sudanesischen Staatsdienst. Reizende Leute sicher, nach diesem einen zu schließen.
Wie das Rad rumgeht! Wie alle Räder immerzu rumgehen!
*
Eintragung im Fremdenbuch des Khalifahauses:
»24. XI. 26 Rudolf Slatin Pascha.«
Er soll, ein distinguierter älterer Herr, hinter dem Cookführer her mit den anderen Touristen durch diese Räume gegangen sein – und, dieser aufgeblasene schwarze Kerl von Führer hat die Stelle gezeigt, wie vorhin, wo Slatin Pascha zwölf oder mehr Jahre lang barfuß und im Derwischhemd stehen mußte, als der Türhüter und Adjutant des Khalifa. (Ja, er war so etwas wie ein Adjutant, bevor der Sohn des Khalifa es wurde.)
»Nein«, hat der alte Tourist dem Cookführer gesagt, »hier und nicht dort ist die Stelle, wo Slatin Pascha – –«
»Sie, ich muß es wissen! Ich bin seit Jahren Dragoman für Thos. Cook – –«
»Und ich heiße Slatin!«
Zu gut natürlich, die Anekdote, um wahr zu sein. Aber er war wieder hier, im Expreßzug, im gut ventilierten Salonwagen ist er durch die nämliche Wüste gefahren, durch die, nur ein Vierteljahrhundert zuvor, die romantische Flucht des entlaufenen Sklaven gegangen war.
Ich bin dem Helden eines der erstaunlichsten Abenteuer der neueren Zeit während der Friedenskonferenz von 1919 in Saint-Germain begegnet. Slatin Pascha war bis zum Kriegsausbruch in dem von den Engländern wiedereroberten Sudan Generalinspektor gewesen und war dann in die österreichische Heimat zurückgekehrt. Als für die Friedensdelegation ein Sachverständiger für den Austausch von Kriegsgefangenen gebraucht wurde, stellte Slatin sich zur Verfügung. Er verstand etwas von Kriegsgefangenschaft.
Jetzt lebt der alte Herr in Meran.
*
Khartum, den 20. Januar 1929.
Ich sitze die meiste Zeit unter den schönen Bäumen im Zoologischen Garten, mit Büchern über die Zeit des Mahdi beschäftigt.
In mir ist ein Gedanke emporgeschossen, so wie Dinge nur in den Tropen wachsen können: ich will das Leben des Derwischs Mohammed Achmed schreiben, des Mahdi, der Gordon besiegt hat, des Nachfolgers des Propheten, des Mannes, der die letzte große Hoffnung des Islams gewesen ist.
Während ich in den Büchern der Leute lese, die diesen Mann gekannt, diese Zeit mitgemacht haben, denke ich immer nur: aber wird man es glauben, wenn ich es wiedererzähle?
So unwahrscheinlich ist die Wahrheit dieser Geschichte! Die Wirklichkeit hat da tolle Dinge zusammenerfunden! Der äußere Umriß der Mahdi-Gestalt, der aus den Berichten der Zeitgenossen hervorscheint, ist so fremd, so unfaßbar! Eine lächelnde Maske, hinter die man nicht eindringen kann. Erst, in seiner Jugendgeschichte, scheint er menschlich, einer von uns, obwohl in einer schwarzbraunen Haut. Dann wird er fern und fremd wie eine barbarische Gottheit. Bis schließlich der Umriß des lächelnden Götzen zur grotesken Fratze zerrinnt. – – Entsetzlich. Wie ihn der Sieg auch rein körperlich mästet, auf einmal fett macht, bis er vor Sieg und gottgleicher Glorie förmlich platzt. – – Welch ein Leben, welch ein Ende! Dieser afrikanische Araber folgt in allem dem Vorbild Mohammeds, von dem abzustammen er behauptet hat. Es gelingt ihm, wirklich in fast allem zu leben wie Mohammed. Er hat seine Hedschira, seine Gesichte, sein Medina, sein wiedererobertes Mekka, seine Ansar, seine Khalifen, er stirbt so wie Mohammed, wird so begraben wie Mohammed – nur, daß doch alles irgendwie anders ist, mit diesem Einschlag von Afrika. Dieser neue Koran ist deutlich vernegert; der Rhythmus von Urwaldtrommeln klingt in den heißen Gebeten des Mahdi.
*
Khartum, den 25. Januar 1929.
Oft und lange sitze ich vor dem zerstörten Grabmal des Mahdi in Omdurman und denke das Leben des Mannes durch.
Als der Mahdi gestorben war, begrub man ihn an der Stelle, wo seine Hütte gestanden hatte; später baute der Khalifa Abdullahi ein prachtvolles Grabmal darüber, bei weitem das schönste, das höchste Bauwerk im ganzen Lande. – Der Deutsche Karl Neufeld, der in so furchtbaren Ketten im Kerker des Khalifa lebte, erzählt, daß man ihn ein Modell der Kuppel formen ließ; er muß Flüche in diesen Ton geknetet haben. Beim Bau trägt der Khalifa selbst Ziegel herbei. Für jeden Stein, den man legt, wird Allah im Jenseits einen ganzen Palast verleihen! – Mehr als ein Jahrzehnt steht das weithin leuchtende Grabmal hart neben dem Palast des Khalifa. So liegt jetzt Lenin neben dem Kreml. Aus ganz Afrika kommen zu dieser heiligen Stätte die frommen Wallfahrer, doch auch aus Arabien, aus allen Ländern des Islams.
Am Tag der Schlacht von Kerreri sieht Sir Herbert Kitchener von der Höhe des Surgham die weiße Kuppel; die goldenen Zierate funkeln – es ist ein vortreffliches Ziel für Artillerie. Schon auf dem Abbassieh-Schießplatz von Kairo hat der Sirdar zum Erproben seiner neuen Belagerungsgeschütze ein Ziel erbauen lassen, mit Mauern, die denen um Mohammed Achmeds Grabmal nachgebildet gewesen sind. Jetzt gebietet er: Feuer! Lydditgranaten!
*
Die eindringenden Engländer finden das Grabmal zerschossen, die Kuppel geborsten. Ich habe die Photos eines Kriegskorrespondenten gesehen. Im Inneren war ein kunstvolles Gitter um das Grab; auch schon verbogen, zerschmettert, man brach sich Andenken ab – – –
Aber es war noch ein Umriß da; ein zerstörtes Grab, aber ein Grab, mit dem Toten darin. Jetzt sitze ich vor einer Ruine: es steht nicht viel mehr als die Umfassungsmauer eines Vorhofs und dahinter ein letzter dürftiger Rest des einst prächtigen Kuppelbaus; alles staubgrau und schäbig und wüst.
Man hat auf den Befehl Kitcheners das Grab einige Wochen nach der Besetzung der Stadt systematisch zerstört, die Leiche des Mahdi aus der Erde gerissen, mit Petroleum begossen, verbrannt; die Asche in den Nil gestreut. Alles recht öffentlich, um dem Volk zu zeigen, daß kein Wunder geschah, daß der Mahdi, der göttlich verehrte, der so lange Erwartete Mahdi doch auch nur ein Mensch gewesen war – –
Die Leichenschänder fanden den Kopf des Mahdi vollkommen unverändert, man erkannte die Züge. Der Kopf wurde nicht mit verbrannt, sondern als eine Trophäe nach Ägypten geschickt. Winston Churchill erzählt, daß der britische Prokonsul in Ägypten, Lord Cromer, den Kopf des Mahdi schließlich in sudanesischer Erde bei Wadi Halfa begraben ließ; andere wollen wissen, daß der Kopf noch in irgendeinem medizinischen Institut in England konserviert wird.
Es darf nicht vergessen werden, daß der Mahdi selbst den Kopf seines besiegten Feindes Charles G. Gordon auf einer Lanze vor seinem Zelt stehen hatte.
*
Der Vorhof des Grabes kann durch eine Tür betreten werden, zu der die Fremdenführer den Schlüssel besorgen. Eingeborene Sudanesen dürfen den Hof nicht betreten, nur wir fremden Gaffer.
Sooft ich noch bei dem Grab war, und ich komme wieder und wieder, habe ich gesehen, was ich auch jetzt wieder sehe: dunkle arabische Menschen, die vor der Schwelle dieses vergitterten Tores beten.
Heute ist es ein herrlicher Beduine aus der östlichen Wüste; einer der Hadéndoa, die unter Osman Digna so lange und beharrlich für den Mahdismus kämpften. Er trägt nichts als eine grobe Kutte; sein langes Haar ist von keinem Turban bedeckt, aber mit einer Pomade aus Hammelfett in zahllose dünne Wuschel geklebt. Der englische Kolonialslang nennt diese Leute deswegen die Wuschelköpfe, die Fuzzy-Wuzzys.
Er ist ganz braun und stark und wild; ein sehniger junger Kerl. Den Mahdi kann er nicht mehr gekannt haben. An diesem Grab, das man brutal zerstört hat, auf daß es keine heilige Stätte mehr wäre, sehe ich diesen jungen Menschen, diesen Sudanesen von heute, sich niederwerfen. Seine Sandalen hat er abgelegt; seine Stirn berührt den Boden. Jetzt langt er mit seiner langen aristokratischen Hand über die Schwelle der verschlossenen Grabestüre. Ich sehe erst jetzt, daß diese Schwelle längst unterhöhlt ist; viele, viele Beter haben hier wie dieser ihre gierige Hand bis zu der heiligen Erde ausgestreckt, die jenseits der Schwelle ist. Jetzt kratzt die Hand den Boden auf, kommt voll Staub zurück – und der junge Beduine reibt sich den heiligen Staub in sein Antlitz; es ist die Waschung mit Sand, die der Koran gestattet.
Jetzt beginnt er sein Gebet. Das eherne Antlitz des Mannes aus der großen Wüste wird schön vor Ernst.
*
Leere Gräber, denke ich, schrecken den Glauben nicht ab und unerfüllte Prophezeiungen nicht das Vertrauen in die Propheten. Nichts von dem, was Mohammed Achmed verheißen hat, ist in Erfüllung gegangen. Nicht, daß er leben werde, bis er dem Islam die ganze Erde erobert hätte. Nicht, daß noch vor dem Tode des Erwarteten Mahdi der Sohn der Maria, Jesus, wiederkehren werde, zum Jüngsten Gericht – –
Aber die unerfüllten Verheißungen der Propheten schüren nur die Sehnsucht, aus jeder Sehnsucht kommt ein Glaube. Religionen sterben nicht.
Auch diese, begreife ich, ist nicht tot. Dieser Mann aus der Wüste, der vor dem geschändeten und leeren Grabe da betet, zeigt mir, daß diese alte Geschichte vom Mahdi noch gar nicht beendet sein muß.
Ich nehme mir vor, diese märchenhafte und wahre Geschichte noch einmal zu erzählen, mit allen Einzelheiten ohne jede Erfindung, und wenn ich es kann, will ich gerecht gegen den Mahdi sein. Bisher haben seine Geschichte nur seine Feinde erzählt. Ich aber will immer an dieses geschändete Grab da denken und an das ernste Gesicht dieses betenden Menschen aus der afrikanischen Wüste. Ich möchte die Wahrheit sagen – und diesen jungen begeisterten Beter nicht kränken.
*
Ich höre ihn beten und weiß, was er sagt. Dieses Gebet, die Fat'ha, erkennt auch ein Ungläubiger, die eröffnende Sure des Korans:
»Gelobt sei Allah, der Weltenherr. Der Allerbarmer, der Barmherzige. Der König am Tag des Gerichts –«
Ich spreche diese Sure halblaut nach in meiner ungläubigen Sprache. Über dem Grab Mohammed Achmeds brennt die Nachmittagssonne; mein schweifender Blick sieht die afrikanische Stadt, die heiße, die wüstengelbe und die maßlose Wüste am Horizont.
– –»Führ' uns den Weg, den geraden. Den Weg derer, die nicht irregehen – –«
Die Stadt
Die Geschichte des Derwischs Mohammed Achmed beginnt in der heißen Nilstadt Khartum und im Lande Sudan, vor einem halben Jahrhundert.
*
»Als Allah«, sagen die Araber, »den Sudan gemacht hat, hat Allah gelacht.«– –
Ein Scherz des Schöpfers, eher ein trüber Scherz, dieses Land zwischen Wüste und Sumpf? Der sudanesische Nil kommt in mehreren Strömen aus den großen Seen des mittleren Afrikas. Im Sudan münden sie ineinander. Beim Eintritt in das Land geht der Nil mit seinem Wasser verschwenderisch um, ergießt es in viele Kanäle, in Seen, in Moräste, durchtränkt und durchweicht die Erde, bis sie fast keine Erde mehr ist, nur noch ein Gewirr von Schilf und Schlamm, von Mücken umschwirrt. Der Elefant trompetet im hohen Sumpfgras, und riesige Neger, langbeinig wie Störche, stelzen hier oder dort herum und hetzen den Elefanten.
Dann kommt der Nil in ein Steppengebiet. Der Nil ist auf einmal sparsam geworden, gibt seinen Ufern nur wenig von seinem Wasser. Gelbgrünes Gras, eine dürre Vegetation, Mimosen, Akazien, das ist das Heim der Gazellen und Strauße und schweifender Hirtenstämme. Eng am Ufer des Nils und der Nebenflüsse, die zu Regenzeiten manchmal voll Wasser sind, wächst hier oder dort ein schöneres Grün, ein tropisch üppiger Wald, ein Feld von Durrha-Hirse oder dergleichen. Fast nirgends eine wirklich saftige Frucht, ein farbiges Blühen. Aber Staub gibt es überall, Fliegen und Mücken und Skorpione, wohin man tritt.
Dieses Land voll Sonne und Durst, überall flach und ärmlich, gerade noch fruchtbar genug, um auf dem ungeheuern Gebiet ein wenig zahlreiches Volk zu ernähren, ist ringsum von nackten Wüsten umgeben. Wüsten wie Mondlandschaften, Wüsten wie Leichenhügel! Die Erde ist wohl an keiner Stelle so starr und so tot wie zwischen Ägypten und dem Sudan. Der Nil fließt hindurch, als wäre sein Wasser nicht naß und könnte den Boden gar nicht netzen.
Durst, Durst, Durst des Sudans, der die Menschen dort glühend macht, im Verlangen maßlos und gierig, bis in ihre Seelen gedörrt!
*
Es ist fast, als hätte die Natur zwischen Ägypten und das tropische Afrika eine Zone zu legen versucht, die der Mittelmeermensch nicht überschreiten soll. Jenseits der furchtbaren Sümpfe, die voll von wilden Tieren sind, Elefanten, Nilpferden, Löwen und Krokodilen, – ist gutes Land, reiches Land. Aus den Gebieten am Rand des Sudans kommen von alters her die reichsten Schätze: Elfenbein in unermeßlichen Mengen, Straußenfedern und kostbare Gummiharze. Die kraftvollen Negernationen sind unerschöpflich als Zuchtgestüte für wertvolle Sklaven, von alters her. Seitdem es ein Menschengedenken gibt, sind durch die sudanesischen Steppen Züge gefesselter Neger getrieben worden: Sklaven für die Pyramidenbauten der Pharaonen, Sklaven, bestimmt für den Haushalt der Königin von Saba, Sklaven für Mohammed den Propheten und Sklaven für die Plantagen Virginiens. Von Negersklaven aus dem Lande Kusch hat Jeremia gesprochen; Napoleon, als er in Ägypten war, hat für seine Armee zweitausend sudanesische Schwarze gekauft, denn durch all die Jahrhunderte hat man Negersklaven bewaffnet. Sie geben die besten Soldaten ab; schon in den Pharaonengräbern hat man ganze Bataillone von schwarzen Püppchen gefunden, Negersoldaten des ägyptischen Heeres versinnbildlichend. Von diesen Negern ist durch die Jahrtausende jeder einzelne in Ketten oder im schweren Joch quer durch den Sudan getrieben worden, und die Beduinen haben das Treiben besorgt. Diese sudanische Erde ist ärger mit dem blutigen Schweiß von Menschenwesen gedüngt denn sonst ein Boden der Welt.
*
Der Sudan ist das andere Ufer der Araber; über das Rote Meer gelangen sie leicht dahin. Durch die Jahrtausende schwärmen die Wüstenstämme von Asien nach Afrika aus. Seit der Prophet die Seinen zum Erobern der Menschenerde ausgeschickt hat, sind die Araber Herren des Sudans. Sie haben sich mit uralten und geheimnisvollen Stämmen vermischt; afrikanische Sprachen, die unter König Ramses gesprochen wurden, hört man noch im Sudan von Menschen, die sich Araber nennen. Es gibt nubische Araber, arabisierte Berber und arabische Stämme, die gänzlich vernegert sind. Gleichviel: der Araber ist im Sudan arabisch geblieben, ein Nomade, ein Händler, ein Räuber. Hier oder dort am Fluß mag er wie der ägyptische Nilbauer siedeln und Datteln ernten oder Durrha-Hirse. Meistens ist er in diesem Land der Wüstensohn aus Mohammeds Zeiten, Karawanenführer oder Karawanenräuber. Das Schwert, die Lanze, ja selbst Kettenpanzer und stählerne Helme tragen sie, wie die alten Sarazenen, die sie sind. Das sind nicht die halb europäisch gewordenen Araber der Mittelmeerländer. Noch die gleichen arabischen Menschen, die Mohammed gegen die Welt geführt hat: primitive Barbaren, stark und grausam, heldenhaft in der Schlacht, wollüstig im Harem, auf Krieg und Beute bedacht, fanatisch im Glauben und Aberglauben. Die Christen verabscheuen sie, und seitdem Mehemed Ali, der erste Khedive, den Sudan für Ägypten erobert hat, rechnen sie all diese türkischen Paschas und tscherkessischen Beys, die aus Kairo kommen, den Ungläubigen gleich. Der Türke, der »Turk«, sagen sie, ist nicht nur der Unterdrücker, sondern auch noch von Europa verseucht, ein Christengenoß.
Unterdessen lebt im Süden, im Elefantenland, der Neger, ganz Urwaldmensch geblieben, Menschenfresser mitunter, stets Elefantenjäger. Der Neger hetzt den Elefanten, der Araber hetzt den Neger, beide hetzt und schindet der Türke. Das ist der Sudan der siebziger Jahre, in dem die Geschichte des Mahdi beginnt.
*
(O dunkler Elefant, schwerer, geduldiger, gewaltiger! Dickfellig, träge, viel zu ertragen gewohnt, aber furchtbar, wenn plötzlich die Wut kommt, die maßlos ungeheure, die den grausamen Quäler zertrampelt!
O dunkler Elefant, Sinnbild Afrikas!)
*
Der Winkel zwischen dem Weißen Nil und dem Blauen Nil ist geformt wie ein Elefantenrüssel. Seit einem Jahrhundert steht hier die Stadt, die Khartum genannt wird, das heißt: Elefantenrüssel.
Das Khartum der siebziger Jahre: mehr ein Aussatz als eine Stadt. Der Vizekönig Ägyptens schickt einen Pascha in den Sudan, damit er von den Schwarzen Steuern erhebe. Der Pascha hat Eile, er träumt von seinem schönen Landsitz im Delta, vielleicht von einer Pariser Reise und Tänzerinnen der Oper. Unterdessen bewohnt er einen Palast aus Backstein am Ufer des Blauen Nils. Das Haus ist zwei Stockwerke hoch; vom Dach blickt man weit in die Runde, sieht Karawanen aus der Wüste kommen und die Sklavenschiffe den Nil herab. Ein paar Amtsgebäude sind da, weitläufig und schmutzig. Eine Kaserne muß sein, ein Gericht, ein Gefängnis, ein Steueramt. In diesen Häusern langweilen sich die Effendis der Provinzregierung. Türken oder Tscherkessen die meisten; ein paar Kopten und Griechen und Levantiner. Das Volk nennt alles, was einen Fes trägt: Turk.
Der Turk in Khartum ist gelblich- und grünlichbleich. Er erträgt das Klima schwer, die Hitzen, die Fieber. Der Turk kennt Besseres als dieses trübe Exil: Alexandrien, Kairo, Beyrouth, Stambul. Sobald der Turk reich wird, geht er wieder dahin und lebt in Freuden. Hier im Sudan sind die schwarzen Frauen des Harems sein Trost, in der Zwischenzeit.
Man wohnt, der mächtige Bey und der christliche Händler, in ein paar besseren Häusern, die aus ZiegeIn gebaut sind; andere sitzen in kleinen Würfeln aus Lehm und Schlamm, von denen viele um einen Hofraum geklebt sind. Am Ufer des Blauen Flusses gibt es die grünen Gärten der Mächtigen. Kamele und schwarze Sklaven drehen das Schöpfrad, das das kostbare Wasser in die Dattelhaine hebt. Landeinwärts, zum Markt hin, sieht nur eine einzige Straße einer Straße gleich. Das schlichte Minarett der Moschee steht darüber. Der Laden des griechischen Kaufmanns hat ein Vordach. Darunter kann man, vor dem Geschäft, den Griechen sehen, wie er mit seinen Freunden und Kunden dasitzt und Mastixschnaps trinkt. Ein paar Europäer schlendern durch die einzige Straße, gelangweilt und schwitzend. Ein Forschungsreisender, der auf den Markt geht, um Proviant für seine Träger zu kaufen und Baumwolltücher als Tauschartikel für Negerfürsten. Ein Pater von der österreichischen Mission. Vor dem kleinen arabischen Café lümmeln Soldaten der Garnison, anatolische Baschi-Bosuks, wild aussehende Irreguläre, von denen jeder die Nilpferdpeitsche am Handgelenk trägt. Manchmal sieht man auch auf der engen Straße plötzlich ein schönes Pferd, das zum Gouverneurpalast trabt; darauf sitzt eine Art Halbgott, mit goldenen Tressen und Orden bedeckt, mit einem goldenen Säbel, mit einem müden gelben Gesicht unter dem grellroten Tarbusch: ein Pascha, ein Bey. – – Aber die meisten Menschen auf dieser Straße sind dunkel-tiefbraun und schwarz, Araber und Neger von hundert Stämmen.
*
Schon ist die Stadt des Elefantenrüssels der große Markt für halb Afrika. Vom Westen her, aus Kordofan und vom Rand der Sahara, kommen Karawanen mit Gummiharz. Den Nil herab fahren Dampfer und Segelschiffe und bringen aus dem innersten Land am Äquator Elfenbein, Straußenfedern und die Felle von wilden Tieren; im stinkenden Schiffsraum der Segelbarken liegen, aneinandergepreßt wie leblose Ballen und wie Ballen gebunden, außerdem schwarze Sklaven; – das weiß ein jeder, sieht jedermann in Khartum, obgleich nicht die Regierung, die aus Kairo Befehl hat, den Sklavenhandel nicht länger zu dulden, diese Schmach eines sonst schon aufgeklärten Jahrhunderts. Die Dahabiehs landen beinah vor dem Gouverneurspalast; am hellichten Tage wirft man die Leichen der toten Neger in den Nil. Soundso viel Prozent der Ware vertragen den Transport nicht. Wenn ein Viertel am Leben blieb, war das Geschäft schon nicht schlecht. In den Seriben, das heißt Gehegen, in den mit Palisaden umhegten Faktoreien im Süden, hat man das menschliche Vieh verwahrt, bis zur Verfrachtung. Jetzt treibt man es, junge Männer und Frauen und Kinder, durch Khartum, dann durch die Wüste zum Roten Meer und schließlich auf die Sklavenmärkte im Osten. Der Sklavenhändler bezahlt dem Pascha Prozente, demselben Pascha, der den Sklavenhandel vernichten soll. –
In Khartum hat jedermann Sklaven; kein arabisches Lehmhaus ist so ärmlich, daß nicht ein nacktes Negerweib an der Schwelle hockte, Getreide mahlend. Menschenfresser aus den Äquatorsümpfen sind in Khartum zu finden und Neger aus den fernsten afrikanischen Ländern. Eine unsägliche Stadt von elenden Hütten verliert sich formlos in die Dürre, den Staub der Wüste; eine Stadt von flachen Dächern oder spitzigen Kegeln aus Durrha-Stroh; in den gewundenen Wegen zwischen Hütte und Hütte sind überall tiefe Löcher, in denen Abfälle faulen und Aas. Der Gouverneur von seinem Palast und der Muezzin vom Minarett der Moschee schauen tief hinab auf all das dunkle Gewimmel, auf die sinnlose Enge der schwarzen Stadt.
*
Die Moschee: Eine Festung des Islams am Rande der Heidenländer. Durch das Gewimmel des Marktes geht der Mufti, eine Art höheres Wesen, mit einem Glanz um den breiten Turban. Der Scheich eines Derwischordens genießt hier so viel Ehren wie der Generalgouverneur; das niedere Volk küßt schon den Fikihs die Hände, zerlumpten Lehrern der Schrift und Rezitatoren des Buchs und Schreibern von Amuletten, wandernden Eiferern mit Bettelschale und Stab. Im Hof der Moschee sieht man sie zu Dutzenden hocken. Es sind Muselmanen aus vielen Ländern darunter, aus Marokko und Tunis, und andere, die spitze Mützen aus Lammfell tragen, schiitische Ketzer aus Persien, die die Sunna verwerfen. Das Rote Meer, das die großen Sekten des Islams trennt und verbindet, ist so nahe. Alle Lehren der muselmanischen Welt gelangen hierher, in das Völkergewimmel Khartums. Der strenge Eifer der Wahabiten, der alle Lebensgenüsse verbietet, und die mystische Gottergebenheit, Gottverschmelzung, die der Orden der Sûfi lehrt, und der neue glühende Glaube der Senussi-Klöster im Westen der arabischen Welt. Das alles mischt sich hier in Khartum. Zu den vierundzwanzig Orden der Derwische, die man in Kairo kennt, kommen hier andere, seltsame, die eigene Riten haben, besondere Übungen, die zur Verzückung führen, der Verschmelzung mit Allah. Dunkle Magie, uralter afrikanischer Aberglauben ist hier in den Islam geflossen. Die Foggara, das ist: die Armen, die Derwische, sind Priester, Lehrer, Ärzte und Zauberer. Ihre Bettelschale füllen Menschen, die selber hungern, mit Hirsemehl und mit saurem Brei. Dem niedern Volk sind die Derwische heilig, aber auch der großmächtige Pascha ruft sie des Abends in seinen mit festlichen Lämpchen beleuchteten Hof, damit sie vor seinen Gästen aus dem Koran rezitieren oder, wie sie es verstehen, durch Singen, Tanzen und Wirbeln in jene Krämpfe geraten, in jene wilden Ekstasen, die Allah gefällig sind und für den Menschen ein Weg in seine geistige Welt. Aus den tausend Geräuschen der heißen afrikanischen Stadt hebt sich das Tomtom, Tomtom der Derwischtrommel deutlich hervor, ein berauschender Rhythmus, in dem eine magische Kraft liegt.
Das Joch
Einmal um die Stunde des Mittaggebetes – das weiß gekalkte Minarett bohrt sich lanzengerade in einen vor Hitze flimmernden Himmel und wirft keinen Schatten auf die glühende Erde – ist ein Menschengewimmel um die Moschee, mehr als sonst, man wartet auf einen Festzug, der aus dem Hause Allahs kommen wird.
*
Es gibt in diesen Tagen einen Streit in dem Viertel um die Moschee, ein Ärgernis, wie es die Frommen lieben.
Ein junger Derwisch, Mohammed Achmed, Sohn des Abdallah, hat sich offen gegen seinen Meister aufgelehnt, den großen Ordensscheich Mohammed Scherif!
Mohammed Scherif, aus einem hochheiligen Hause, steht jetzt an der Spitze des großen Derwischordens, der »Sammanîjja Tarîka« heißt: »Der Pfad zu Gott, so wie ihn der Heilige Es Sammân gewiesen hat.« Mohammed Scherif, dessen Ahnen schon den Gebetteppich der Sammanîjja in großen Ehren verwaltet haben, ist ein Mann von großer Heiligkeit. Nach ihm wird sein junger Sohn den Gebetteppich erben und die mystischen Gaben des Scheichtums. Der Knabe wächst heran, das Fest seiner Beschneidung soll vollzogen werden, und der glückliche Vater, Scheich Mohammed Scherif, hat schon lange vorher die Ordensmitglieder zur Stadt entboten: sie kommen aus den fernsten Provinzen, die sie sonst mit Bettelschale und Stab durchwandern. An dem festlichen Tag, hat der Scheich verkünden lassen, wird auch den Frömmsten, den Strengsten vielerlei Freude gestattet sein: Musik und Gesänge, reichliche Speise; selbst die Schauspiele weltlicher Lust sollen nicht ganz verpönt sein, die Tänze der Tanzmädchen und der geschmückten Knaben.
*
Die Menge um die Moschee, die jetzt in der dumpfen Hitze auf den Festzug wartet, spricht mit großer Lust, wen freute so etwas nicht, von dem Ärgernis, das gefolgt ist: Vor ganz Khartum, vor der feierlichen Versammlung der Fikihs und Derwische, hat der bevorzugte Lieblingsschüler des Ordensscheichs ihm, dem Heiligen, laut widersprochen: Was Allah verboten habe, Schwelgerei und weltliche Freuden, könne selbst der Scheich der Sammanîjja niemals gestatten!
Der Scheich Mohammed Scherif, maßlos erzürnt, hat den verwegenen jungen Eiferer darauf einen Verräter genannt, einen Eidbrüchigen. Er hat ihn aus dem Orden gestoßen, als einen, der das große Gelübde des Gehorsams verletzt hat.
– Ja, Mohammed Achmed heißt der junge Mensch, erklären in der wartenden Menge die mit dem Moscheeklatsch vertrauten Stadtleute einigen Fremden, Reisenden aus der Wüste. Mohammed Achmed, Sohn des Abdallah. Er stammt aus Dongola.
*