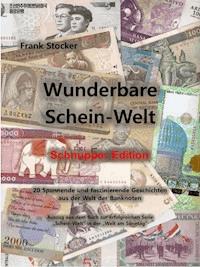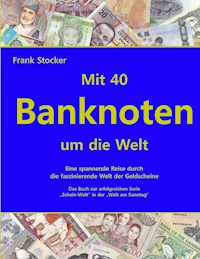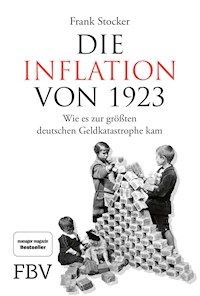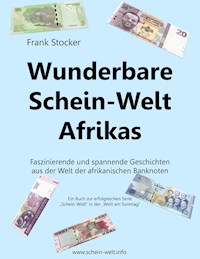22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der grüne Zwanziger, der braune Fünfziger, der blaue Hunderter – Millionen Deutschen sind die Banknoten aus D-Mark-Zeiten noch gut in Erinnerung. Es war das Geld, mit dem sie groß wurden, mit dem sie einen gewissen Wohlstand erreichten. Aber die D-Mark ist nicht nur in der individuellen Rückschau positiv besetzt, sie hatte auch für die Gesellschaft eine wichtige Funktion: Endlich hatten die Deutschen wieder etwas, auf das sie stolz sein konnten. Die D-Mark war weltweit berühmt für ihre Stabilität und entwickelte sich international zur wichtigsten Währung nach dem Dollar. Sie trug wesentlich dazu bei, dass die Deutschen nach den Verheerungen, die zwei Weltkriege und die NS-Diktatur mit sich gebracht hatten, wieder wirtschaftlichen Aufschwung genießen konnten und im Ausland respektiert wurden. Frank Stocker nimmt Sie mit auf eine spannende Reise in die deutsche Nachkriegsgeschichte. Dabei beschreibt er nicht nur historische Ereignisse und erklärt finanz- und währungspolitische Entscheidungen, sondern es gelingt ihm auch, das gesellschaftliche Klima zu erfassen und dem Mythos nachzuspüren, der sich um die D-Mark rankt. Denn die Deutsche Mark war schon immer mehr als ein Zahlungsmittel: Zum Zeitpunkt ihrer Einführung war sie ein Symbol der Hoffnung und des Neuanfangs, heute steht sie für den märchenhaften Wiederaufstieg Deutschlands – und ist zu einem Sehnsuchtsort vieler Deutscher geworden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Frank Stocker
DIE DEUTSCHE MARK
Wie aus einer Währung ein Mythos wurde
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
1. Auflage 2023
© 2023 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Lektorat: Daniel Bussenius
Korrektorat: Anja Hilgarth
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer
Fotos auf dem Umschlag: Shutterstock.com/aLittleSilhouetto
Satz: Daniel Förster
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95972-617-7
ISBN E-Book (PDF) 978-3-98609-162-0
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-98609-164-4
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de.
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1 Die Stunde Null, die keine war
Kapitel 2 Hunger, Schwarzmarkt und Zigarettenwährung
Kapitel 3 Auf dem Weg in den Kalten Krieg
Kapitel 4 Die Wegbereiter der D-Mark
Kapitel 5 Mit 40 DM in eine neue Ära
Kapitel 6 Licht und Schatten der Wirtschafts- und Währungsreform
Exkurs Die Währungsreform in der sowjetischen Zone
Kapitel 7 Die neue deutsche Notenbank und der Beinahe-Tod der jungen Währung
Kapitel 8 Die Entstehung des deutschen Erfolgsmodells
Kapitel 9 Der Kampf um die Unabhängigkeit der Deutschen Bundesbank
Kapitel 10 Der Streit über die Aufwertung der D-Mark
Exkurs Die ersten Banknoten der Bundesbank und ihre Geheimserie
Kapitel 11 Die erste Wirtschaftskrise der Bundesrepublik
Kapitel 12 Der erneute Streit über die Aufwertung der D-Mark und das Ende von Bretton Woods
Kapitel 13 Die Inflation der 1970er-Jahre und die Stabilisierung der D-Mark
Kapitel 14 Der Weg zur Gründung des Europäischen Währungssystems
Kapitel 15 Die deutsch-deutsche Währungsunion
Exkurs Die letzte Banknotenserie der D-Mark
Kapitel 16 Der turbulente Weg nach Maastricht
Kapitel 17 Die Krise des EWS und der Schwarze Mittwoch
Kapitel 18 Die letzten Hürden auf dem Weg zum Euro
Exkurs Die Euro-Banknoten und -Münzen
Kapitel 19 Der Euro kommt, die D-Mark geht
Kapitel 20 Die D-Mark – eine Bilanz
Die Präsidenten der Bank deutscher Länder und der Bundesbank
Literaturverzeichnis
Anmerkungen
Vorwort
Der grüne Zwanziger, der braune Fünfziger, der blaue Hunderter –Millionen Deutsche erinnern sich noch gut an die Banknoten aus D-Mark-Zeiten, und sie erinnern sich gerne. Das war das Geld, mit dem sie groß geworden sind, mit dem sie einen gewissen Wohlstand erreichten, mit dem sie international respektiert wurden. Denn die D-Mark wurde auch im Ausland gern genommen, wurde sogar international zur zweitwichtigsten Währung neben dem Dollar.[1] Sie war weltweit berühmt für ihre Stabilität, war das Symbol des deutschen Wiederaufstiegs nach dem Zweiten Weltkrieg. Auf die D-Mark konnten die Deutschen stolz sein.
Doch das Wissen um ihre Geschichte verblasst. Kaum jemand erinnert sich noch, dass die D-Mark eine Schöpfung der Alliierten war und Ludwig Erhard, der vermeintliche Vater der D-Mark, daran herzlich wenig Anteil hatte. Wenige wissen, dass die Deutsche Bundesbank ihre starke Stellung nur gegen starke Widerstände, insbesondere vom ersten Kanzler der Bundesrepublik, Konrad Adenauer, erreichte. Kaum jemand kennt noch jenen 5-Mark-Schein, der in den 1950er-Jahren in Verdacht geriet, Unzucht zu verbreiten, und noch weniger sind sich bewusst, dass die Bundesbank sogar zeitweise das machte, was den Notenbanken heute viele vorwerfen: Geld drucken. Diese Details machen die Geschichte der D-Mark aber nur noch schillernder und spannender.
Die D-Mark war das Geld der Deutschen. Und schon der Ökonom Joseph Schumpeter schrieb, dass sich im Geldwesen eines Volkes alles spiegele, was »dieses Volk will, tut, erleidet, ist«. Nichts sage »so deutlich, aus welchem Holz ein Volk geschnitzt ist, wie das, was es währungspolitisch tut«.1 Das gilt für die D-Mark in ganz besonderem Maße. Sie repräsentiert die Nachkriegsgeschichte der Deutschen geradezu idealtypisch.
Die D-Mark hat die Deutschen geprägt, und die Deutschen haben die D-Mark geprägt – im doppelten Sinne. Sie haben die Münzen und die Banknoten hergestellt, aber auch den Charakter dieser Währung – wenn es so etwas gibt – geformt: stark, erfolgreich, dominant. All das, was Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg militärisch und politisch nicht mehr sein konnte und sein wollte.
Vor allem aber war die D-Mark ein großes Glück. Denn sie trug wesentlich dazu bei, dass die Deutschen nach zwei Weltkriegen und zweimaliger Zerstörung ihres Geldes, nach Weltwirtschaftskrise und NS-Diktatur, nach Hunger und Elend der Nachkriegszeit Jahrzehnte wirtschaftlichen Aufschwungs und politischer Stabilität genießen konnten.
Die D-Mark gibt es nicht mehr. Doch der Mythos, der sich um sie rankt, lebt fort in der Erinnerung an die grünen Zwanziger, braunen Fünfziger und blauen Hunderter. Manches verklärt sich in der Rückschau, aber vieles bestätigt sich auch. Vor allem aber bietet der Blick zurück eine spannende Reise durch die Geschichte der erfolgreichsten Währung, die die Deutschen je hatten.
Kapitel 1
Die Stunde Null, die keine war
Mai 1945
Es war weit nach Mitternacht, 2:29 Uhr am Morgen des 7. Mai 1945, als die ersten Vertreter der Alliierten den Raum betraten. An den hellblauen Wänden hingen Landkarten, die die Lage an den Fronten des Zweiten Weltkriegs dokumentierten. Graphiken zeigten die Fortschritte bei den Luftschlägen gegen Deutschland. Eine Art »Thermometer« auf einem Hakenkreuz veranschaulichte den Anstieg der Zahl der deutschen Kriegsgefangenen. Die Szene spielte sich in einer alten Mittelschule in der Rue Jolicœur im nordfranzösischen Reims ab. Hier residierte das Oberste Hauptquartier der Alliierten Expeditionsstreitkräfte und hier sollte der Schlusspunkt unter den grauenhaftesten Krieg der Geschichte gesetzt werden. Hier sollten die Vertreter der deutschen Wehrmacht ihre bedingungslose Kapitulation erklären.
Um 2:34 Uhr gesellte sich auch General Walter Bedell Smith, Stabschef des Alliierten Oberkommandeurs Dwight D. Eisenhower, zu den bereits versammelten Militärs, unterhielt sich ein wenig mit ihnen, bevor fünf Minuten später schließlich der deutsche Generaloberst Alfred Jodl, dessen Adjutant Wilhelm Oxenius sowie Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg hereingeführt wurden. Sie begaben sich zu einem rund sechs Meter langen Tisch in der Mitte des Raums, Jodl und Oxenius in der grauen Uniform des Heeres, Friedeburg im Blau der Marine. Sie machten eine leichte Verbeugung in Richtung der Vertreter der Alliierten, dann setzten sie sich auf helle Stühle aus billigem Holz. Vor jedem stand ein Namensschild, in der Mitte des Tisches befand sich ein großes Mikrophon, das alle Äußerungen aufnehmen sollte. Einige Aschenbecher standen herum, aber rauchen wollte niemand.
Die Stimme von General Smith durchbrach die Stille. Vor ihnen lägen die Dokumente zur bedingungslosen Kapitulation. »Sind Sie bereit zur Unterzeichnung?«, fragte er. Jodl nickte, nahm einen braunen Füller mit goldener Kappe und unterschrieb um 2:41 Uhr. Für die Alliierten setzten daraufhin US-General Smith und der sowjetische General Iwan Susloparow ihren Namen unter das Dokument sowie als Zeuge François Sevez, Generalmajor der französischen Armee.
Der Korrespondent der New York Times schilderte die folgenden Momente:
»Dann stand Jodl mit seinen arroganten, vor Anstrengung glasigen Augen steif und stramm, und das grelle Licht ließ die abgenutzten Stellen seiner grauen Uniform sichtbar werden. ›Ich möchte ein Wort sagen‹, sprach er zu General Smith auf Englisch. Dann redete er auf Deutsch weiter:
›General! Mit dieser Unterschrift haben sich das deutsche Volk und die Wehrmacht auf Gnade und Ungnade dem Sieger ausgeliefert. Beide haben in diesen über fünf Jahren Krieg mehr erduldet und mehr geleistet als vielleicht je ein Volk auf der Erde. Ich kann jetzt in dieser Stunde nur die Bitte aussprechen, dass ihm die Sieger gnädig sein mögen.‹
General Smith, dessen Gesicht von Müdigkeit gezeichnet war, sah ihn an. Er gab keine Antwort.«2
Auf sowjetischen Wunsch wurde die Ratifikation zwei Tage später wiederholt. Am 9. Mai um 0:16 Uhr unterzeichneten Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel für das deutsche Heer, Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg für die Kriegsmarine und Generaloberst Hans-Jürgen Stumpff für die Luftwaffe am Sitz des Oberkommandierenden der Roten Armee in Deutschland, Marschall Georgi Konstantinowitsch Schukow, in Berlin-Karlshorst erneut die Kapitulation, rückwirkend zum 8. Mai, 23:01 Uhr mitteleuropäischer Zeit beziehungsweise 00:01 Uhr des 9. Mai nach geltender deutscher Sommerzeit.
Damit schwiegen die Waffen.
Der Zweite Weltkrieg, der mehr Menschenleben gekostet hatte als je ein Krieg zuvor, war zumindest in Europa beendet, das mörderischste Regime, das die Welt je gesehen hatte, war erledigt, die schlimmsten Verbrechen aller Zeiten fanden ein Ende. Deutschland lag am Boden, war besiegt, stand vor dem Nichts. Die Städte waren zertrümmert, die Industrie zerbombt, die Infrastruktur zerstört. Politisch, moralisch, kulturell und wirtschaftlich erfuhr das Land seine »Stunde Null«.
Zumindest sahen das damals viele so. Die Metapher gelangte in den allgemeinen Sprachgebrauch, wurde in zeitgenössischen Berichten gerne zitiert. Sie traf das Empfinden der Zeitgenossen auf das Genaueste, wie der Historiker Heinrich August Winkler feststellte: »Nie war die Zukunft in Deutschland so wenig vorhersehbar, nie das Chaos so allgegenwärtig wie im Frühjahr 1945.«3
Der Schrecken der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft war vorüber, die Verfolgung und Ermordung Andersdenkender, von Juden und anderen Minderheiten war beendet, das Gemetzel des Krieges vorbei. Beseitigt war auch das politische System, das Kommando hatten die Alliierten übernommen, die Nazi-Schergen waren auf der Flucht, festgenommen oder untergetaucht.
Und doch gab es diese »Stunde Null« nicht, wie Winkler betont und wie Bundespräsident Richard von Weizsäcker das in seiner berühmten Rede anlässlich des 40. Jahrestags der Kapitulation im Jahr 1985 dargelegt hatte. Es war nicht auf einmal alles Alte verschwunden, es gab kein leeres Feld, auf dem neu aufgebaut wurde. 65 Millionen Deutsche waren am 8. Mai keine anderen Menschen als am 7. Mai 1945. Ihre Ansichten, ihre Einstellungen, ihre Gedanken veränderten sich nicht über Nacht.
Unverändert war insbesondere auch das wirtschaftliche System. Landwirtschaft, Industrie und Dienstleister arbeiteten weiter wie gehabt. Bauern molken ihre Kühe, bestellten ihre Felder, ernteten die ersten Früchte. Züge fuhren, wo die Gleise noch vorhanden waren, Fabriken arbeiteten, wo sie nicht zerstört waren, Geschäfte verkauften das wenige, das sie hatten, und sie erhielten dafür die gleichen Reichsmark-Banknoten wie all die Jahre davor. Eine wirtschaftliche Stunde Null gab es nicht.
Auch die wirtschaftlichen Grundlagen waren weit weniger zerstört als oft vermutet. Die Bilder von totaler Vernichtung aus Berlin, Dresden, Hamburg oder Frankfurt am Main, die jeder kennt, dürfen nicht auf das ganze Land übertragen werden. Zwar waren von 18,8 Millionen Wohnungen 4,8 Millionen zerstört oder beschädigt,4 14 Millionen waren aber unversehrt. In den Dörfern, wo ein Drittel der Menschen lebte,5 war die Infrastruktur in Takt, Ähnliches galt für die meisten Kleinstädte. Selbst in den Großstädten gab es durchaus Viertel, die wenig zerstört waren. Aber vor allem war die deutsche Industrie weniger von den alliierten Bombardements beeinträchtigt worden als gedacht.
Dies hatte eine Gruppe amerikanischer Ökonomen schon 1945 festgestellt. Sie waren von der US-Luftwaffe beauftragt worden zu ergründen, wie wirksam die Bombardements im Hinblick auf die Zerstörung der deutschen Kriegswirtschaft waren. Ihr Abschlussbericht zeigte, dass es nur in geringem Maße gelungen war, die Produktion zu beeinträchtigen.6 Der Zusammenbruch der Kriegswirtschaft geschah vielmehr erst, als die Transportwege zerstört wurden.
Die Produktionsanlagen waren folglich zu einem beträchtlichen Teil noch vorhanden. Das zeigen auch Berechnungen des Wirtschaftshistorikers Werner Abelshauser. Demnach war das Brutto-Anlagevermögen der deutschen Industrie im Mai 1945 sogar 20 Prozent größer als 1936. »Westdeutschland war noch immer eines der am höchsten entwickelten Länder der Welt und nicht so stark zerstört, wie viele noch heute glauben«, stellte er fest.7
Deutschland lebte. 65 Millionen Deutsche lebten. Die deutsche Wirtschaft lebte. Menschen kauften und verkauften Dinge, es wurde gehandelt, es wurde produziert. Und all das fand in jenem wirtschaftlichen und geldpolitischen Rahmen statt, den die Nationalsozialisten seit 1933 geschaffen hatten. Auch hieran änderte der 8. Mai 1945 nichts. Denn dieser Rahmen wurde von der Militärverwaltung der Alliierten unverändert übernommen.
Die deutsche Währung war nach wie vor die Reichsmark, die seit Herbst 1924 von der Reichsbank herausgegeben wurde. Die Notenbank war damals durch das Bankgesetz vom 30. August 1924 neu organisiert worden,8 was als Schlusspunkt der Phase der Hyperinflation betrachtet werden kann.9 Das Bankgesetz hatte insbesondere die Unabhängigkeit der Notenbank garantiert, und ein Generalrat war eingesetzt worden, um ihre Arbeit zu überwachen.
Dieses stabile Fundament der deutschen Währung untergruben die Nationalsozialisten direkt, nachdem ihnen die Macht übergeben worden war. Das Gesetz zur Änderung des Bankgesetzes vom 27. Oktober 1933 schaffte den Generalrat und damit die unabhängige Aufsicht über die Notenbankpolitik ab.10 Im Februar 1937 wurde das Reichsbankdirektorium sogar direkt dem »Führer und Reichskanzler« unterstellt.11
Parallel dazu begann die Notenbank wieder, die Staatsausgaben zu finanzieren, wie schon während der Hyperinflation zehn Jahre zuvor, diesmal jedoch zunächst in verschleierter Form. Das geschah über sogenannte Mefo-Wechsel. Hinter dem Kürzel verbarg sich die Metallurgische Forschungsgesellschaft m.b.H. (Mefo), ein Scheinunternehmen, das im Juli 1933 gegründet worden war und keinerlei eigene Aufgaben hatte, schon gar nicht irgendwelche Forschungen durchführte. Es diente lediglich dazu, die besagten Wechsel herauszugeben. De facto war damit eine ungedeckte Parallelwährung entstanden, auf einem klandestinen, völlig intransparenten Weg.
Gleichzeitig besorgte sich der NS-Staat über einen zweiten verdeckten Weg das nötige Geld, um Beschäftigungsprogramme und Aufrüstung zu finanzieren. Ab 1935 verkaufte das Reich seine Staatsanleihen, also die staatlichen Schuldscheine, nicht mehr an private Investoren, sondern direkt an Banken, Sparkassen und Versicherer. Diese setzten dazu ihre Kundengelder ein.
Aufgrund dieser von außen kaum erkennbaren, verschleierten Form der staatlichen Verschuldung und des verdeckten Ratterns der Notenpresse sprechen die Historiker auch von der »geräuschlosen Kriegsfinanzierung« durch die Nationalsozialisten. Die wenigsten Deutschen bemerkten, wie hier die Stabilität ihrer Währung ausgehöhlt wurde. Die Konstruktion der diversen Instrumente ermöglichte es zudem, dass vieles nicht in den Bilanzen ausgewiesen werden musste.
Einer, dem die Gefahren dieser Staatsfinanzierung durchaus bewusst waren, war Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht. Am 7. Januar 1939 warnten er und seine Direktoriumskollegen in einem Brief an Hitler, dass die Staatsfinanzen vor dem Zusammenbruch stünden und dies die Zerrüttung der Notenbank und der Währung zur Folge hätte. Sie forderten daher eine Rückkehr zu einem ausgeglichenen Haushalt und die Zusage, dass geldpolitische Entscheidungen wieder ausschließlich von der Reichsbank getätigt würden, dass sie also ihre Unabhängigkeit zurückerlange.12
Doch damit hatten Schacht und seine Kollegen ihre Stellung und ihren Einfluss maßlos überschätzt. Hitlers Reaktion auf das Schreiben war einfach und brutal: Er entließ Schacht und das gesamte Direktorium und machte Reichswirtschaftsminister Walther Funk zum neuen Reichsbankpräsidenten. Dieser hatte keinerlei Probleme mit der Staatsfinanzierung durch die Notenpresse.
Im Juni 1939 wurde schließlich ein neues Gesetz über die Deutsche Reichsbank erlassen, das schon im Vorwort erklärte, Zweck der Notenbank sei, der »Verwirklichung der durch die nationalsozialistische Staatsführung gesetzten Ziele im Rahmen des ihr anvertrauten Aufgabenbereichs« zu dienen. Paragraph 1 lautete von nun an: »Die Deutsche Reichsbank ist dem Führer und Reichskanzler unmittelbar unterstellt«, und Paragraph 16 besagte, dass die Deutsche Reichsbank dem Reich Betriebskredite gewähren durfte, »deren Höhe der Führer und Reichskanzler bestimmt«.13 Die Notenbank war damit endgültig ein Instrument des Regimes geworden, das ohne jede Beschränkung zur Staatsfinanzierung eingesetzt werden konnte.
Die Folge war, dass die Geldmenge zwischen Mitte 1939 und Kriegsende von 10 auf 73 Milliarden Reichsmark stieg, also auf mehr als das Siebenfache kletterte.14 Eigentlich hätte dies zu steigenden Preisen führen müssen, zu Inflation, so wie zu Beginn der 1920er-Jahre. Doch dem beugten die Nationalsozialisten durch gesetzlich verordnete Preisobergrenzen15 und rigide Kontrollen sowie durch einen allgemeinen Lohnstopp vor.16
Mit Kriegsbeginn am 1. September 1939 verlor das Geld dann sogar weitgehend seine Bedeutung als Tauschmittel, denn nun wurde die Wirtschaft komplett umgestellt. Basis dafür war die »Verordnung über die Wirtschaftsverwaltung« vom 27. August 1939.17 Damit wurden auf allen Ebenen der Verwaltung Wirtschafts- und Ernährungsämter geschaffen, die die Versorgung der Bevölkerung organisieren sollten. Die »Verordnung über die öffentliche Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen«18 unterstellte die landwirtschaftlichen Produzenten sowie Klein- und Großbauern diesen Ämtern. Sie mussten nun alle ihre Erzeugnisse abliefern und durften nicht mehr selbst darüber verfügen. Die Ämter wiederum rationierten und verteilten die Produkte. Dazu wurde mit einer dritten Verordnung ein System von Bezugsscheinen eingeführt.19 Schon ab 28. August 1939 galten diese für Fleisch, Fett, Zucker, Marmelade, aber auch für Seife, Kohlen, Textilien und Schuhe. Mit der Zeit kamen fast alle Produkte des täglichen Lebens hinzu. Die Menschen konnten nun nicht mehr kaufen, was sie wollten, sondern nur noch das, was ihnen zugeteilt wurde.
Die Zuteilungsmengen waren zu Beginn noch großzügig bemessen. Doch je länger der Krieg dauerte, desto kleiner wurden die Rationen. Die Löhne und Gehälter blieben währenddessen gleich oder stiegen sogar leicht, die Menschen konnten sich von dem Geld jedoch immer weniger kaufen. Als Folge davon erhöhten sich die Ersparnisse der Bevölkerung. Allein bei den Sparkassen stieg beispielsweise zwischen 1939 und 1943 der Einzahlungsüberschuss auf über 40 Milliarden Reichsmark,20 und dieses Geld schöpfte wiederum der Staat über die geräuschlose Kriegsfinanzierung ab. Die Geldinstitute finanzierten also mit den Kundeneinlagen die Schulden des Staates und damit den Krieg. Zusätzliche Mittel besorgte sich der Staat über die Auspressung der besetzten Länder.
Bei Kriegsende beliefen sich die Staatsschulden auf etwa 380 Milliarden Reichsmark, die umlaufende Geldmenge im weiteren Sinne (Bargeld, Sicht-, Termin- und Spareinlagen) erreichte rund 300 Milliarden Reichsmark. Der Wert aller produzierten Güter betrug jedoch nur einen Bruchteil davon – aufgrund fehlender Statistiken ab 1939 ist dieser Wert nicht genau zu ermitteln, selbst im letzten Friedensjahr 1938 hatte das Bruttosozialprodukt jedoch nur bei knapp 100 Milliarden Reichsmark gelegen. 1945 dürfte es maximal die Hälfte davon erreicht haben.21 Das lässt darauf schließen, dass die Geldmenge in Deutschland nach der Kapitulation die jährliche Wirtschaftsleistung um das Sechsfache übertraf.
Ein Teil davon wurde zwar in den Tagen und Wochen nach Kriegsende aus dem Verkehr gezogen, als die sowjetische Besatzungsmacht im Osten die Guthaben blockierte. Doch gleichzeitig gaben die Alliierten in den ersten Monaten der Besatzung auf Reichsmark lautendes Besatzungsgeld aus, das die Geldmenge wiederum vergrößerte.
Wie hoch die Geldmenge in der zweiten Hälfte des Jahres 1945 genau war, lässt sich nicht feststellen. Sie war jedoch, so viel ist sicher, in den Jahren bis 1945 rasant gestiegen, das Warenangebot aber gleichzeitig drastisch geschrumpft. Am Ende des Krieges verfügte Deutschland folglich zwar noch über eine erstaunlich starke wirtschaftliche Substanz, mit größeren Produktionskapazitäten, als man denken würde. Zudem waren die Arbeiter gut ausgebildet, der technologische Stand hoch. Doch gleichzeitig war die Währung völlig zerrüttet. Nicht durch eine offene Inflation, wie dies Anfang der 1920er-Jahre geschehen war. Vielmehr war ihr innerer Wert ausgehöhlt. Es bestand ein riesiger Geldüberhang, der in einem freien Markt zu einer Hyperinflation führen musste.
Doch diesen freien Markt gab es eben nicht, das Wirtschaftsleben basierte auf einem zentral organisierten Kommandosystem, mit dem der Mangel verwaltet wurde und in dem Erzeugnisse nur über Lebensmittelkarten zu erwerben waren. Dies verhinderte, dass es zu einer Inflation im offiziellen Handel kam – diese fand nur auf dem Schwarzmarkt statt, wo aber stets nur ein kleiner Teil des Warenangebots gehandelt wurde.
Sowohl die Reichsmark als auch die Kommandowirtschaft blieben nach der Kapitulation erhalten. Die amtliche Güterbewirtschaftung wurde von den alliierten Besatzern fortgesetzt, die Ernährungsämter fuhren mit ihrer Arbeit einfach fort wie bisher. Der Lohnstopp blieb bestehen, und auch die amtlich festgesetzten Preise wurden nicht angetastet. Das war in jenen Tagen die einzig mögliche Entscheidung. Denn Millionen Deutsche waren auf der Flucht oder waren ausgebombt. Sie hatten alles verloren, standen mittellos da. Andere dagegen verfügten nach wie vor über Haus und Hof oder sogar ein regelmäßiges Einkommen. Letztere hätten bei einem Ende der Zwangsbewirtschaftung und einer Freigabe der Preise recht problemlos das wenige, das es zu kaufen gab, erstehen können, während die anderen dem Hunger ausgeliefert gewesen wären. Die einzige Möglichkeit, einen darwinistischen Kampf ums Überleben zu verhindern, war daher, das wenige, das zur Verfügung stand, möglichst gerecht zu verteilen.
Doch dieses System führte dazu, dass alle gleich arm waren, und verhinderte, dass die deutsche Wirtschaft wieder in Gang kommen konnte, um Armut und Hunger zu beseitigen. Das wurde schon bald zum größten Problem.
Kapitel 2
Hunger, Schwarzmarkt und Zigarettenwährung
Winter 1946/1947
Der Sommer 1945 schien eine Zeit des Aufbruchs zu sein, auch und gerade in wirtschaftlicher Hinsicht. Die Versorgung mit Lebensmitteln besserte sich zunächst einmal deutlich, wie der Regierungspräsident von Hildesheim, Wilhelm Backhaus, in einem Bericht über jene Zeit schrieb:
»An allen Orten regten sich die Kräfte des Aufbaues. Überraschend schnell begannen viele Industrien mit der Friedensproduktion. In den Geschäften gab es Dinge, die man jahrelang vermißt hatte. Der Verkehr belebte sich, die Eisenbahn fuhr unbeschränkt nach allen Orten. Befreit von der drückenden Todesfurcht und von dem lähmenden politischen Druck begannen die Menschen, sich des Daseins zu freuen. […]
Im Sommer haben viele von uns besser gegessen als in den zurückliegenden Jahren. Bei der Aufteilung der Läger war manches unter die Leute gekommen, was den mageren amtlichen Speisezettel angenehm verbesserte. Die Erzeuger und Verteiler haben zudem einige Wochen lang nicht mehr daran geglaubt, daß die Abgabe- und Markenwirtschaft bestehen bleiben würde.«22
Aber das kleine Glück währte nur einen Sommer, wie auch Backhaus beschrieb:
»Mit unverantwortlichem Leichtsinn sind viele Erzeugnisse weggegeben und verzehrt worden, die man hätte für den Winter sammeln müssen. Jetzt fehlen die Zugaben und auch die Vorräte. Man muß sich wieder auf die vorgeschriebene Ration einstellen. […]«23
Doch die Rationen waren nun kleiner als je zuvor. Denn zum einen hatte das Nazi-Regime während des Krieges lange Zeit die besetzten Gebiete ausgebeutet und darüber die Versorgung der Bevölkerung in Deutschland verbessert. Dies endete schon im Laufe des Jahres 1944. Nun wurden aber auch noch die deutschen Gebiete östlich von Oder und Neiße der Sowjetunion beziehungsweise Polen zugeschlagen, rund 113.000 Quadratkilometer. Das entsprach knapp einem Viertel der Fläche Deutschlands, und weite Teile davon waren landwirtschaftlich geprägt.
Im Durchschnitt der letzten Friedensjahre hatte dieses Gebiet 13,5 Millionen von insgesamt 56 Millionen Tonnen an landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die Deutschland produzierte, geliefert – zum Vergleich in einheitliche Nährwerte, sogenannte Stärkewerte, umgerechnet. Ein Drittel dieser Produktion war als Überschuss in das übrige Deutschland gegangen. Darunter waren 2,75 Millionen Tonnen Getreide und fast 8 Millionen Tonnen Kartoffeln. Diese Kartoffelmenge hätte 1947 genügt, um die Versorgung der deutschen Bevölkerung mit dem Grundnahrungsmittel um zwei Drittel zu erhöhen.24
Stattdessen sanken die Rationen nun auf ein Niveau, das zu viel zum Sterben und zu wenig zum Überleben war. Berechnet wurden die Zuteilungen, seit die Alliierten die Kontrolle übernommen hatten, in Kalorien, und so betrug die Ration für den Normalverbraucher im August 1946 in der britischen Zone gerade mal 1270 Kalorien, in der amerikanischen 1240 und in der französischen sogar nur 1163. Im Winter davor waren die Rationen in der französischen Zone zeitweise sogar unter 1000 Kalorien gefallen.25
Doch die zu geringe Produktion war nur die eine Hälfte des Problems. Zugleich waren die Ernährungsämter ihrer Aufgabe mit der Zeit immer weniger gewachsen. Die Reichsbankleitstelle Hamburg sprach in ihrem Bericht vom Dezember 1947 schließlich von einer »allgemeinen Auflösung des gegenwärtigen Systems der Scheinbewirtschaftung«.26 Die Zuteilung der Lebensmittel wurde dadurch immer schwieriger, die Rationen konnten meist nicht mehr voll ausgegeben werden, sodass die wahren Zuteilungsmengen oft nur 800 bis 1000 Kalorien erreichten.27
Besonders dramatisch wurde die Lage im Winter 1946/1947, der als »Hungerwinter« in die Geschichte einging. Es war nicht nur einer der kältesten Winter des vergangenen Jahrhunderts, die tiefen Temperaturen führten auch dazu, dass vielerorts die Lebensmittelversorgung völlig zusammenbrach. Mehrere Hunderttausend Menschen sollen damals in Deutschland an den Folgen gestorben sein. Die wenigsten davon sind allerdings verhungert, die meisten wurden vielmehr von Krankheiten wie Typhus oder Tuberkulose dahingerafft, die sie sich aufgrund ihrer schwachen Verfassung zugezogen hatten, und diese lag in der Nahrungsmittelknappheit begründet.
In jener Zeit hielt der Kölner Erzbischof Joseph Kardinal Frings seine berühmt gewordene Silvesterpredigt, in der er sagte:
»Wir leben in Zeiten, da in der Not auch der Einzelne das wird nehmen dürfen, was er zur Erhaltung seines Lebens und seiner Gesundheit notwendig hat, wenn er es auf andere Weise, durch seine Arbeit oder durch Bitten, nicht erlangen kann.«28
Das verstanden viele als kirchlichen Segen für Mundraub, also für das Stehlen von Lebensmitteln oder Heizstoffen, die für den Eigenbedarf und für das eigene Überleben benötigt wurden. Allerdings schränkte Frings seine Aussage einige Tage später ein, indem er sagte, es müsse sich »um höchste Not handeln, das heißt um unmittelbare Gefahr des Todes, schwerer Gesundheitsschädigung oder des Verlusts der Freiheit«.29 Das fand jedoch weit weniger Beachtung. Vielmehr wurde das Stehlen von Lebensmitteln nunmehr zum Volkssport und im Volksmund als »fringsen« bezeichnet, benannt nach dem Erzbischof.
Auch im Frühjahr wurde die Lage nur langsam besser. So listete der Münchener Oberbürgermeister im März 1947 in einem Schreiben an den bayerischen Ernährungsminister auf, dass in der 99. Zuteilungsperiode vom 3. bis 30. März pro Kopf statt der zugesagten 10.500 Gramm Brot, 800 Gramm Fleisch und 1000 Gramm Nährmittel gerade einmal 600 Gramm Fleisch, 600 Gramm Nährmittel und »mit Hängen und Würgen schließlich zu guter Letzt wenigstens noch 8000 Gramm Brot zur Verteilung« gekommen waren.30 Das entsprach pro Tag 21 Gramm Fleisch, 21 Gramm Nährmittel und 285 Gramm Brot. Und es wurde nicht besser, im Gegenteil, im Frühsommer sank die Brotration auf 214 Gramm pro Tag.
Es herrschte Hunger, und die Menschen nahmen überall im Land jede Strapaze auf sich, um Nahrung zu besorgen, wie ein Bericht in der Leipziger Volkszeitung vom August 1947 beispielhaft zeigt:
»Der kleine Wolfgang von gegenüber bringt die Nachricht: heute wird oberhalb Wachau in der Landstraße nach Güldengossa das große Weizenfeld eingefahren … Da heißt es laufen bei 38 Grad in der Sonne. Den Rucksack um, eine Flasche mit Kaffee drin, die alten Tennisschuhe an den Füßen, das Kopftuch weit ins Gesicht gezogen, so saust man los. Die Sonne liegt wie eine glühende Platte auf dem Schädel, aber man beeilt sich immer mehr und beobachtet mißtrauisch einige Frauen, die in der gleichen Richtung mit verdächtiger Unauffälligkeit vorwärtsstreben … Wir rennen das letzte Stück und drängen uns zwischen die Wartenden, die den Zuwachs mit mißgünstigen Blicken beobachten und die winzigen Lücken vollends abdichten. Die Ablenkung durch das sich darauf erhebende giftige Gezeter benutzend, stehen wir plötzlich in der vorderen Reihe – und in diesem Augenblick wird das Feld freigegeben. Wie eine Woge spült die Menge nach vorn, die Rücken krümmen sich in einem Augenblick bei allen zur Erde, die Hände greifen, das Stroh fliegt weg, die kostbaren Ähren verschwinden in Schürzen, Taschen und Beuteln… Man erhebt sich nicht aus der gebückten Stellung beim Laufen, die Hitze drückt einen noch mehr zu Boden, und die Füße schmerzen. In zwanzig Minuten ist das Feld leer. Bestimmt ist keine einzige Ähre mehr darauf. Gruppen stehen noch und besprechen die Aussichten bei anderen Feldern. Man ist erschöpft. Groß ist die Ausbeute nicht, dazu waren es zuviel Menschen, aber auch für das wenige ist man dankbar … Wird ein Feld eingefahren, lesen oft erst die Angehörigen des Bauern, oder die bei ihm beschäftigten Frauen, oder die ortseingesessenen Ährenleserinnen gefallen sich in Gehässigkeiten gegenüber den Großstädtern, die der weite Weg bei der Hitze auch nicht gerade umgänglicher gemacht hat.
Wenn man Glück hat, dann kann man fünf Pfund Korn von einem mal Ährenlesen heimbringen. Fünf Pfund Korn! Das wird im Winter die Kleinen daheim eine ganze Reihe von Tagen sattmachen können, wenn es nichts anderes gibt. Und man läuft wieder und wieder, läuft vergeblich und mit Erfolg, bei Hitze und Wind – um ein Stück Brot und ein wenig Suppe für die Kinder. Frauen aller sozialen Schichten sind draußen, fahren und laufen stundenweit, unterernährt und übermüdet, eine Tagesarbeit noch vor sich, wenn sie am späten Nachmittag erschöpft heimkommen. Und ist auch die noch getan, während die Kinder längst schlafen, dann legen sie den schmerzenden Kopf auf die Hände, denken an den Mann, der vielleicht noch in Gefangenschaft ist, sorgen sich um die Ernährung ihrer Lieben im kommenden Winter und können sich nur das eine zum Trost sagen: sie haben getan, was sie konnten!«31
Besonders schwer hatten es in jenen Monaten die Millionen aus dem Osten vertriebenen Deutschen, die mit nichts als dem, was sie tragen konnten, im Westen angekommen waren, so wie die Familie von Margot K., die 1933 in Schneidemühl/Posen-Westpreußen (heute Pila, Polen) geboren wurde:
»Im Mai 1946 musste auch meine Familie unsere alte Heimat verlassen. Mitnehmen durften wir nur das, was wir tragen konnten; Wertsachen wurden bei Durchsuchungen auch noch abgenommen. Ein Sammeltransport in Güterwaggons brachte uns über die deutsch-polnische Grenze. Nach mehreren Zwischenstopps landeten wir schließlich in einem großen Barackenlager in Kiel. Dort lebten wir mit circa 40 Personen in einem Raum, wir schliefen auf Verwundetentragen. Hier fanden wir auch meinen Vater in einem Lazarett wieder.
Der Pfarrer unseres Heimatortes, der auch unter uns war, meldete sich dann beim Bistum in Osnabrück. Er erhielt eine Pfarrstelle im Münsterland – und holte seine Schäfchen aus der alten Heimat nach. So landeten wir im Juni 1946 schließlich in Lienen, einem Ort zwischen Münster und Osnabrück. Dort kamen wir bei einem Kötter unter, also einem Kleinbauern mit einer kleinen Kate und wenig Landbesitz. Wir lebten in der sogenannten Upkammer, das waren zwei Räume über dem Keller, die etwas höher lagen. Als wir ankamen, waren diese Zimmer komplett leer, nur eine Glühbirne hing von der Decke. Hier wohnten wir nun die nächsten Jahre zu fünft, meine Eltern, meine Großmutter, meine Schwester und ich. In unserer alten Heimat waren wir nicht arm, gehörten zur Mittelschicht. Doch hier begannen wir nun neu, in tiefster Armut. Aber wir waren froh, noch am Leben zu sein.
Der Kötter, bei dem wir lebten, besaß zwei Kühe und ein Schwein. Von ihm bekamen wir regelmäßig Milch und Kartoffeln. Mein Vater verdiente ein bisschen Geld als Hilfsarbeiter, meine Großmutter konnte spinnen und bot ihre Dienste den Bauern an, die ihr dafür Lebensmittel gaben. Meine Mutter nähte für die Familie eines Schreiners, und so kamen wir nach und nach zu einigen Möbelstücken. Wir Kinder sammelten Waldbeeren oder auch Bucheckern, um daraus Öl pressen zu lassen. Ansonsten lebten wir vor allem von dem, was es auf Lebensmittelkarten gab. Ab und zu kamen auch Care-Pakete von den Amerikanern an.
Dann war da noch Heinz, ein Bauernsohn aus der Nachbarschaft, der uns ab und zu ein paar Eier gab und notfalls ein Stück Butter in der Hosentasche brachte. Dafür ging ich ab und zu mit ihm spazieren.«32
Etwas besser hatten es jene, die noch etwas besaßen, das sie auf dem Schwarzmarkt anbieten konnten. Dadurch konnten sie ihre Versorgung zumindest im Westen ein wenig aufbessern. Zwar war der Schwarzmarkthandel überall in Deutschland illegal, in den westlichen Zonen wurde er jedoch weit weniger stark verfolgt als in der sowjetischen Zone und fand daher überall statt.
Die Preise auf dem Schwarzmarkt waren allerdings bis zu hundertmal höher als die offiziellen Preise. Dies galt vor allem für besonders begehrte Güter wie Butter oder Fett.33 Dennoch beteiligten sich Befragungen in der britischen Zone zufolge 1947 rund 40 Prozent der Städter am Schwarzmarkt.34
Dazu gehörte auch Familie B. aus Berlin, deren Lage im September 1947 die Soziologin Hilde Thurnwald schilderte:35
»Familie B. besteht aus dem Ehepaar, einer Tochter von 16 Jahren, einem Sohn von 15 und einem Sohn von 5 Jahren. Der Vater ist gelernter Arbeiter in einer Fabrik. Wochenverdienst: brutto 57,80 RM, netto 51,60 RM; im Monat netto 231,20 RM, monatliche Lehrvergütung des Sohnes 30 RM, der Tochter 32 RM, zusammen 293,20 RM.«
Dann listet sie die monatlichen Ausgaben auf:
• »Miete
33,66 RM
• Gas
9,80 RM
• Licht
4,90 RM
• Ration. Lebensmittel, Karte II (Vater)
14,79 RM
• Ration. Lebensmittel, Karte III (Mutter)
11,34 RM
• Ration. Lebensmittel, Karte II (erwachsener Sohn)
14,79 RM
• Ration. Lebensmittel, Karte III (erwachsene Tochter)
11,34 RM
• Ration. Lebensmittel, Karte IV (Kind)
13,76 RM
• Kleine Sonderzuteilung
2 RM
• Obst laut Karte (Kind)
7,38 RM
• Kartoffeln, 60 kg, laut Karte
7,20 RM
• Gemüse laut Karte
5,30 RM
• Schuhreparaturen
19,20 RM
• Waschmittel
4,50 RM
• Beiträge, Zeitungen
7,20 RM
• Taschengeld für 2 erwachsene Kinder
20 RM
• Fahrgeld, Haarschneiden, Kino
18 RM
• Rauchwaren
9,60 RM
Summe
214,76 RM
Zusätzliche Ausgaben auf dem Schwarzen Markt
• 2 Pfund Mehl, Puddingpulver
49 RM
• 4 Brote je 1500 g
160 RM
• Waschmittel
10,50 RM
• Petroleum für den Winter
36 RM
• Kohle für den Winter, bisher 2 Zentner
120 RM
Summe
375,50 RM
Die Familie hat nach dieser Aufstellung im Monat September insgesamt verausgabt
590,26 RM
Durch das Gehalt des Ehemannes und die Vergütungen der Kinder konnten gedeckt werden
293,20 RM
Es blieben aus anderen Einnahmequellen zu decken
297,06 RM
Im Sommer 1947 verkaufte das Ehepaar ein Dutzend silberne Bestecks für 1500 RM. Hiervon wird monatlich zugesetzt. Frau B. holt jeden Monat dreimal Gemüse und Kartoffeln von ihren Eltern aus der britischen Zone. Die Reisekosten werden mit 16 RM veranschlagt. Für die Lebensmittel gibt sie den Eltern durchschnittlich 25 bis 30 RM. Sie verkauft an Bekannte Gemüse zu mäßigen Schwarzmarktpreisen, um mindestens die Unkosten zu decken.«
Wertgrundlage waren auf dem Schwarzmarkt zunehmend nicht mehr Reichsmark, sondern Zigaretten. Diese Entwicklung hatte bereits während des Krieges in den von Deutschen besetzten Gebieten begonnen. Mit Zigaretten als Hilfswährung wurde oft der Warenaustausch der deutschen Soldaten mit der lokalen Bevölkerung abgewickelt. Schon in den letzten Wochen und Monaten des Krieges, als das Vertrauen in die Reichsmark allmählich schwand, breitete sich diese Praxis auch in Deutschland selbst aus. In der Nachkriegszeit schließlich wurde die Zigarette zur allgemein gebräuchlichen Währung. Wie dieser Schwarzmarkt funktionierte, beschrieb Der Spiegel im Januar 1947 in einem Artikel:
»Eine Razziawelle ging wieder einmal durch Frankfurt am Main. Die Schieber im Hauptbahnhof und die Schwarzhändler der in der Nähe liegenden Kneipen hatten es wirklich nicht leicht: zweimal am Tage wurden sie auf Lastkraftwagen verladen und in das Polizeipräsidium gebracht. Dort wartete eine ausgezeichnete Kartei auf sie und mancher der Verladenen entpuppte sich als ein alter Bekannter. Auf Grund der Kartei konnte man feststellen, daß die Schwarzhändlerei sich schon stark differenziert hat und ganz bestimmte ›Berufe‹ entstanden sind.
Unzählig ist das Heer der ›kleinen Schieber‹. Sie kaufen bei den Zentralen in kleinen Mengen etwa 100 englische oder amerikanische Zigaretten, das Stück zu 5 Mark. Auf Bahnhöfen und in Bunkern werden die Zigaretten dann für 6 oder 7 Mark abgesetzt. Aber das Handwerk blüht nur kurze Zeit. Ihre Freunde von der Kripo haben sie bald am Kragen, getreu nach der Devise: die Kleinen hängt man und die Großen läßt man laufen.
Da sind die ›Schlepper‹ schon geriebener. Sie haben grundsätzlich keine heiße Ware bei sich und lächeln nur verschmitzt, wenn ihnen – zum wievielten Male? – bei einer Razzia die Blechmarke unter die Nase gehalten wird und ihre Taschen durchsucht werden. Die Schlepper sind die Agenten und Adressenvermittler des Schwarzen Marktes. Sie lotsen die ›Kunden‹ in die Privatwohnungen der Schieber en gros. Für abgeschlossene Geschäfte gibt es dann Prozente.
Die Schieber en gros: Neben Ihrem Namensschild an der Wohnungstür steht Versicherungsagent oder ähnliches. Natürlich haben sie Telephon und erstklassige Verbindungen. ›Einen halben Zentner Zucker? Moment bitte‹. Ein kurzes Telephongespräch, in dem von allem möglichen die Rede ist, nur nicht von Zucker. ›Heute abend nach Beginn der Dunkelheit, Kostenpunkt fünfzehn Scheine‹. (Falls es tatsächlich einige Leser nicht wissen: ein Schein gleich 100 Reichsmark.)
Aber wehe, wenn der Schieber en gros den ›Spritzern‹ in die Hände fällt. Dann wird er ausgezogen, er muß ›Haare lassen‹. Spritzen, das ist die neueste und einträglichste Erwerbsmethode auf dem Schwarzen Markt. Und das geht so: Zwei oder drei gutgekleidete Männer geben sich als Großeinkäufer aus. Sie kaufen alles und zu jedem Preis. Etwa: ›Wir brauchen dringend einige Mille englische Zigaretten, wir gehen morgen in die russische Zone.‹
Der Schwarzhändler wittert ein großes Geschäft und beißt an. Während einer der Spitzbuben großartig einen Haufen Scheine vorzählt, prüft ein anderer die Ware und packt sie in seinen Koffer. Und jetzt kommt der Clou: ganze zwanzig Mark und die Faust werden dem Schieber unter die Nase gehalten. ›Stimmt’s? Was, es stimmt nicht? Du weißt doch, daß du jetzt hochgehen kannst, du alter Gauner! Da drüben steht die Polente. Stimmt’s jetzt?‹
Die Rechnung geht todsicher auf. Auch der hartgesottenste Schieber verliert die Nerven, bei der Aussicht, ein Jahr ›Urlaub‹ antreten zu müssen. So haben im Handumdrehen diese Piraten des Schwarzen Marktes Tausende verdient.«36
Nicht nur die Verbraucher hatten Probleme, ihren Lebensbedarf zu decken, nicht nur sie mussten auf Schwarzmarkt und Tauschhandel zurückgreifen. Ebenso erging es den Unternehmen. Denn für diese hatte die Reichsmark die Geldfunktion ebenfalls verloren. Zudem waren auch viele Grundstoffe oder andere Güter, die sie benötigten, rationiert. Die industrielle Produktion beruhte auf sogenannten Bezugsberechtigungsscheinen für Rohstoffe, Halb- und Fertigfabrikate und der Überwachung des Systems durch amtliche Stellen. Auch dieses System war spätestens nach dem Krieg so schwach, dass sich kein Unternehmen mehr darauf stützen wollte. Güter einzuführen, war gleichzeitig unmöglich, da die Reichsmark nicht konvertibel war und im Ausland nirgends akzeptiert wurde.
Wenn ein Unternehmen überhaupt noch produzieren wollte, musste es auf den sogenannten Kompensationshandel zurückgreifen, also Ware gegen Ware tauschen, an der offiziellen Güterbewirtschaftung vorbei. Das war nicht nur äußerst aufwendig – schließlich musste erst einmal der richtige Tauschpartner gefunden werden, mitunter mussten sogar umfangreiche Tauschketten gebildet werden –, es war zudem verboten, schon seit 1942 unter den Nationalsozialisten, und der Alliierte Kontrollrat bestätigte dieses Verbot im März 1947 ausdrücklich. Dennoch war das in weitem Umfang geübte Praxis. Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 50 Prozent des Handels der Unternehmen untereinander in den ersten Nachkriegsjahren in Form des Kompensationshandels erfolgten.37
Ein Schlaglicht auf diese Praxis warf ein aufsehenerregender Prozess.38 Es war der Gründonnerstag des Jahres 1947, der 5. April, als in Kassel Erich Reimann verhaftet wurde. Er war ein geachteter Bürger der Stadt, hatte zudem offenbar eine tadellose politische Vergangenheit, weshalb die amerikanische Militärverwaltung ihn zum Chef der Spinnfaser AG ernannt hatte. Doch nun saß er hinter Schloss und Riegel. Von »Großschiebungen« war die Rede, von »Warenhortung« und »Kompensation«. Einige Tage später wurde Reimann aufgrund einer Haftbeschwerde wieder entlassen, am 9. Juli jedoch erneut verhaftet, wegen Verdunklungsgefahr.
Am 25. August wurde er schließlich im Tanzsaal des Gasthauses Wilhelmshöher Hof vorgeführt – das Kasseler Gerichtsgebäude war im Krieg zerstört worden. Der ursprüngliche Anklagepunkt, der zu seiner Verhaftung geführt hatte, war ein Kompensationsgeschäft. Die Spinnfaser AG hatte sich demnach 500 Liter Benzin beschafft, im Tausch gegen Stoffe. Diese waren dann auf dem Schwarzmarkt wieder aufgetaucht, und von dort hatten die Behörden deren Ursprung bis zu der Kasseler Firma zurückverfolgt. Außerdem, so die Anklage, seien 112 Meter Stoff gegen 85 Glühbirnen getauscht worden, die zur Aufrechterhaltung der Produktion notwendig waren.
Der Prozess wurde nun zu einer »umfassenden Untersuchung der gegenwärtigen Art der Verwaltung im deutschen Geschäfts- und Wirtschaftsleben«, wie es ein Beobachter der amerikanischen Militärregierung beschrieb.39 40 Zeugen wurden gehört, Wirtschaftsvertreter, Beamte, Vertreter der Wirtschaftsverwaltung aller Ebenen. Die Verteidiger versuchten von Beginn an, das System der Kompensationsgeschäfte als allgemein üblich darzustellen. Gestützt wurde diese Sicht auch vom prominentesten Sachverständigen, der gehört wurde, dem ehemaligen hessischen Wirtschaftsminister Rudolf Müller. »Die Planwirtschaft ist, das ist wohl hier niemandem ein Geheimnis, auf weiter Strecke zusammengebrochen«, sagte er am achten Verhandlungstag am 2. September. »Die Folgen dieses Zusammenbruchs reichen von der erlaubten Selbsthilfe der Wirtschaft bis zu der von dem Herrn Vorsitzenden erwähnten Kriminalität, dem Schwarzen Markt.«40
Das Gericht gelangte so zunehmend zu der Überzeugung, dass die Angeklagten zwar gegen die Buchstaben des Gesetzes verstoßen hatten, dass sie aber dennoch nicht zu verurteilen waren. In der Urteilsbegründung sagte der Vorsitzende Richter schließlich: »In diesem Prozess liegt der extreme Fall vor, daß um des Rechtes willen das Gesetz hinter der Idee der Gerechtigkeit zurücktreten muß.«41 Er verurteilte Reimann zu 20.000 Reichsmark Geldstrafe, andere Angeklagte erhielten kurze Gefängnisstrafen oder kleinere Geldstrafen auferlegt. Alles in allem war das Urteil milde, und es tadelte eher die Bedingungen, unter denen die Unternehmen arbeiten mussten und in denen sie gefangen waren.
Besonders pikant wurde die Lage dadurch, dass sich zeitweise auch staatliche Stellen an den Kompensationsgeschäften beteiligten. Von einem Beispiel berichtete im Frühjahr 1947 Der Spiegel.
»Der Bulgare Dr. Gosbodin Russek ist ein smarter Bursche. Trotzdem verurteilte ihn das englische Militärgericht in Hannover vor einigen Tagen zu zehntausend RM. Geldstrafe wegen versuchter Zigarettenschiebung. Dr. Russek kann den zweifelhaften Ruhm für sich in Anspruch nehmen, das erste staatliche Kungelgeschäft abgeschlossen zu haben. Allerdings mit dem Verlust von den erwähnten 10.000 RM. und der polizeilichen Beschlagnahme von 300.000 (in Worten: dreihunderttausend) Zigaretten.
Vor kurzem rollte durch die Straßen Hamburgs ein Lastkraftwagen mit den in Norddeutschland selten zu sehenden polizeilichen Kennzeichen der französischen Zone. Unter der Wagenplane türmten sich Kisten um Kisten. In der Brieftasche des gut gekleideten Herrn, der vorn neben dem Fahrer saß, steckte wohlverwahrt eine amtliche Bescheinigung des badischen Wirtschaftsministeriums.
In Hamburg gibt es Fabriken, die einige in anderen Gegenden Deutschlands sehr gefragte Dinge herstellen – Autoreifen zum Beispiel. Diese Reifen waren es auch, die den benzineselreitenden badischen Boten nach der Wasserkante lockten. Der Lastwagen hielt vor einem Fabriktor. Der Fahrer langweilte sich eine Stunde, und dann wurden einige Kisten abgeladen. Der geschäftstüchtige Gosbodin machte sich darauf mit der schriftlichen Zusage einer großen Lieferung von Autoreifen und restlichen 190.000 Zigaretten wieder auf den Weg.
In Hannover wiederholte sich die Szene in einer bekannten Gummifabrik. Der badische Abgesandte zeigte bei der Geschäftsleitung größte Zuvorkommenheit und eine Anzahl gestempelter Papiere und bot während der Verhandlung – bei der es wieder um Autoreifen ging – freizügig von seinen mitgebrachten Zigaretten an.
Die Geschäftsleitung war interessiert, verwünschte die Fabrikkontrolle der Militärregierung, die jeden Warenausgang überwacht, und fragte vorsichtshalber an, ob man dürfe. Man durfte nicht. Der badische Sonderbeauftragte wurde mitsamt seinen Zigaretten eingelocht, getrennt natürlich.
Im Laufe der Verhandlung stellte sich heraus, daß das hohe Ministerium in Baden die amtliche Art der Reifenbeschaffung satt hatte, nachdem es an den verschiedenen Hürden des ›normalen‹ Beschaffungsweges gescheitert war. Es griff zur Selbsthilfe, um an diese Mangelware heranzukommen, und tat damit nichts anderes, als diejenigen Praktiken nun auch in den Bereich staatlicher Kommunalpolitik zu übernehmen, die bereits seit langem im Handel üblich sind.
Dieser erste verschämte Versuch einer hohen Behörde, sich aktiv am allgemeinen Kungelspiel zu beteiligen, endete mit einem Fiasko, und Gosbodin zieht unverrichteter Dinge heim gen Baden.
Die beschlagnahmten 189.600 Zigaretten (einige hundert gingen als Spesen drauf) liegen noch auf dem Polizeipräsidium in Hannover. Über ihre Verwendung ist noch nichts bekannt. Anfragen sind zwecklos.«42
Doch nicht nur die Engpässe bei der Beschaffung von Rohstoffen lähmten die industrielle Produktion. Hinzu kam, dass es schwierig war, Mitarbeiter zu finden, wenn diese zu den offiziellen Löhnen bezahlt wurden. Denn der Lohn eines Hamburger Facharbeiters betrug im Frühjahr 1948 beispielsweise 10 Reichsmark pro Tag. Auf dem Schwarzmarkt kostete jedoch ein Ei 8 Reichsmark und ein Kilo Roggenbrot 9,50 Reichsmark.43
Viele Firmen gingen daher dazu über, einen Teil des Lohnes in Form von Erzeugnissen aus der eigenen Produktion auszuzahlen oder in Form von Gütern, die über Kompensationsgeschäfte eingekauft worden waren. Manche Arbeiter, die begehrte Produkte wie beispielsweise Zement erhielten, konnten damit erhebliche Gewinne auf dem Schwarzmarkt erzielen, während andere Berufe leer ausgingen.
Jene Arbeitnehmer, die einen Teil ihres Lohns in Naturalien erhielten, waren aber wiederum einen Gutteil ihrer Zeit damit beschäftigt, diese in Produkte des täglichen Bedarfs zu tauschen – und zwar oft während ihrer eigentlichen Arbeitszeit. Diese lag zwar offiziell bei 48 Stunden pro Woche, tatsächlich wurde jedoch meist nur 40 Stunden oder weniger gearbeitet.44 Die übrige Zeit verwendeten die Arbeitnehmer, um ihren Tauschgeschäften nachzugehen, unter stillschweigender Billigung durch den Arbeitgeber.
Die drei ersten Nachkriegsjahre waren folglich einerseits von allgemeiner Not und Hunger geprägt, andererseits von einem extrem dysfunktionalen Wirtschaftssystem. Da die Reichsmark ihre Geldfunktion weitgehend eingebüßt hatte, war an ihre Stelle der Tauschhandel getreten, bei dem die Zigarette als Ersatzwährung fungierte. Der Tausch von Waren war jedoch organisatorisch aufwendig und kostete sowohl Verbraucher als auch Unternehmen enorm viel Zeit. Zudem schwebte über diesem Handel stets das Damoklesschwert der Illegalität. All dies hemmte die Produktivität und erhöhte für die Firmen die Kosten. Sie konnten auf dieser Basis kaum sinnvoll kalkulieren, Investitionen waren ein Vabanquespiel und wurden selten getätigt. Deutschlands Wirtschaft konnte daher kein dynamisches Wachstum erzielen, und so stieg die Produktion in Deutschland in dieser Zeit kaum, obwohl die industrielle Basis, wie gezeigt, durchaus nicht so schlecht war.
Den amtlichen Zahlen zufolge erreichte die Produktion in den drei von den westlichen Alliierten verwalteten Zonen Deutschlands im zweiten Quartal 1948 gerade einmal die Hälfte des Standes von 1936. In Dänemark, Finnland, Jugoslawien und Norwegen lag sie dagegen schon 1947 wieder über dem Niveau von 1937, in Belgien, Italien, den Niederlanden und Frankreich war sie immerhin wieder bis auf 90 Prozent gestiegen.45 Ähnlich sind die Verhältnisse, wenn man einzelne Länder nach der Wirtschaftsleistung pro Kopf vergleicht.
Wirtschaftsleistung pro Kopf in Dollar (Wert des Jahres 2015)46
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Belgien
USA
1937
7.468
7.152
9.911
4.879
8.660
7.908
11.295
1945
7.195
4.101
11.247
2.831
4.281
6.907
16.478
1946
3.534
6.145
10.751
3.805
7.104
7.291
14.822
1947
3.883
6.596
10.527
4.498
8.046
7.651
14.312
1948
4.517
7.002
10.753
4.814
8.751
8.008
14.734
Neben den genannten Hemmnissen wirkte in Deutschland aber ein weiterer Faktor: die allgemeine Erwartung einer Währungsreform. Spätestens seit 1946 machten Gerüchte die Runde, dass die Reichsmark bald durch eine neue Währung abgelöst würde. Viele Unternehmen hielten daher Ware zurück oder produzierten nur halbfertige Produkte. So lagerten in den Maschinenfabriken der amerikanischen und der britischen Zone Mitte 1947 nach Schätzungen des Verwaltungsamtes für Wirtschaft rund 65.000 Tonnen Maschinenteile, die zu 50 Prozent fertiggestellt waren. Diese hätten nach Aussagen des Amtes mit 10.000 Tonnen an Stahl fertiggestellt werden können – was jedoch nicht geschah.47 Die Unternehmen warteten lieber darauf, dass sie ihre Produkte in einem befreiten Markt mit einer neuen Währung zu besseren Bedingungen absetzen konnten. Sie glaubten, dass dieser Tag X nicht mehr allzu fern läge. Und für diese Annahme hatten sie gute Gründe. Denn über eine Währungsreform wurde bereits seit Längerem intensiv diskutiert.
Kapitel 3
Auf dem Weg in den Kalten Krieg
Frühjahr 1947
»Er sieht aus wie ein römischer Kaiser und handelt auch so«, soll ein britischer Offizier einmal über Lucius D. Clay gesagt haben.48 Und auch John McCloy, später Hoher Kommissar der USA in Deutschland, blieb gedanklich im alten Rom, als er Clays Aufgabe als Militärgouverneur der amerikanischen Besatzungszone in Deutschland beschrieb. Diese sei ziemlich berauschend gewesen. »Es war wohl das, was dem Amt eines römischen Prokonsuls am nächsten kam. Man konnte sich an seinen Sekretär wenden und sagen: ›Mach ein Gesetz.‹«49
Eigentlich hatte Lucius DuBignon Clay aber gar nichts Römisches an sich, außer natürlich dem Vornamen. Er wurde 1898 in Marietta im Bundesstaat Georgia als jüngstes Kind eines Rechtsanwalts geboren. Dieser war kurz zuvor in den US-Senat gewählt worden. Politik spielte in der Familie daher stets eine große Rolle, insbesondere der Amerikanische Bürgerkrieg von 1861 bis 1865, der in Georgia schwere Verwüstungen angerichtet hatte, war Thema. Als Lucius elf Jahre alt war, starb sein Vater. Er ging daher auf die Militärakademie von West Point – alle anderen Formen der höheren Bildung konnte sich die Familie nicht leisten. 1918 legte er sein Examen ab, zu seiner Enttäuschung wurde er anschließend aber nicht im Feld, sondern als Militäringenieur eingesetzt. Er beaufsichtigte diverse Projekte, wie den Bau von Dämmen und Flughäfen, insbesondere zur Zeit des New Deals in den 1930er-Jahren, als Präsident Franklin D. Roosevelt das Land durch landesweite Infrastrukturinvestitionen aus der tiefen Wirtschaftskrise holte.
Clay zeichnete sich durch ein großes Organisationstalent aus und galt fortan als eine Art Universalwaffe, wenn es darum ging, Ordnung ins Chaos zu bringen. Ein Biograph schrieb Clay fast übermenschliche Züge zu:
»Sein Scharfsinn, seine Klugheit, seine brillante Art, schwierige Fragen offen anzugehen, seine außergewöhnliche Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu erklären, sein enormes Fakten- und Zahlengedächtnis – das alles beeindruckte Kongressausschüsse ebenso stark wie seine Verhandlungspartner, seine politischen Gegner und die Journalisten. Kaum jemand blieb von seiner Intelligenz und seinem Charme unbeeindruckt.«50
Während des Zweiten Weltkriegs war Clay zunächst für den Bau von Militärflughäfen, anschließend für die Ausstattung und Versorgung der Truppen verantwortlich, was er erneut mit Bravour meisterte. »Er könnte General Motors führen, oder aber General Eisenhowers Armee«, soll der spätere Außenminister James Byrnes zu Präsident Roosevelt gesagt haben.
Nach dem D-Day, der Invasion der Alliierten an der französischen Atlantikküste am 6. Juni 1944, holte Eisenhower Clay tatsächlich zu sich, damit er den Nachschub organisierte. Schließlich wurde er nach der Kapitulation Deutschlands Stellvertreter von Joseph T. McNarney, dem Militärgouverneur für die amerikanische Besatzungszone. McNarney zeigte wenig Interesse an der Aufgabe, das besetzte Gebiet zu verwalten, sodass Clay von Anfang an die Geschicke im Wesentlichen führte, ab März 1947 auch offiziell als Nachfolger McNarneys.
Wie diese Verwaltung konkret aussehen und was aus dem besetzten Deutschland werden sollte, war in den ersten Monaten nach der Kapitulation noch völlig unklar.
Im August 1944 hatte US-Finanzminister Henry Morgenthau einen Plan vorgelegt, der die Demilitarisierung Deutschlands und dessen Zerschlagung in drei Staaten sowie die weitgehende Zerstörung der Industrie vorsah.51 Dieser Plan stieß zwar auf breite Ablehnung, im Juli 1945 verließ Morgenthau auch das Kabinett, dennoch schien diese Grundhaltung noch in der Direktive vom 10. Mai 1945 durch, die dem amerikanischen Oberbefehlshaber in Deutschland vorgab, welchen Ansatz er zu verfolgen habe: »Sie unternehmen keine Schritte, um die deutsche Finanzstruktur zu erhalten, zu stärken oder in eigene Verantwortung zu übernehmen, außer insoweit als es für die Zwecke dieser Direktive notwendig ist.«52
Clay drängte jedoch von Anfang an darauf, diese restriktiven Vorgaben zu lockern und Deutschland stattdessen zu unterstützen, wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Eine Rolle dürfte dabei auch seine persönliche Erfahrung gespielt haben. Denn die Zeit nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg, die in seiner Kindheit so präsent gewesen war, wurde von der Frage geprägt, wie mit den Besiegten umgegangen werden sollte, ob der siegreiche Norden Milde walten oder ein strenges Kontrollregime errichten und die Südstaaten rücksichtlos ausbeuten sollte. Letzteres hielt Clay nie für angemessen, weder nach dem Sezessionskrieg noch nach dem Zweiten Weltkrieg. Sein Ziel war daher von Anfang an der wirtschaftliche Wiederaufbau Deutschlands.
Clay war somit ein echter Glücksfall für Deutschland, zumindest für den Westteil. Er beendete schon nach einem Jahr die Demontagen für Reparationszwecke und setzte früh die ersten Landesregierungen ein. Er führte mit harter Hand, aber bestens organisiert und stets mit dem Ziel vor Augen, das Elend zu verringern, der Bevölkerung wieder ein menschenwürdiges Leben zu geben und den Aufstieg aus der Asche zu ermöglichen.
Lucius D. Clay wurde zu einem der Gründungsväter der Bundesrepublik Deutschland. Und der D-Mark. Denn Clay erkannte auch früh, dass für den Wiederaufbau eine Währungsreform unabdingbar war. Auf sein Drängen hin brachten die Amerikaner schon im November 1945 das Thema einer Währungsreform erstmals im Alliierten Kontrollrat auf – dieser war die oberste Besatzungsbehörde für Deutschland, bestehend aus den Militärgouverneuren der vier Besatzungszonen. Die Idee scheiterte jedoch vor allem am Widerstand der Briten, die der Meinung waren, dass zunächst einmal ausgeglichene Haushalte in den jeweiligen Besatzungszonen erreicht werden müssten, bevor über ein solches Projekt überhaupt diskutiert werden könnte.53
Doch die US-Seite wollte es dabei nicht bewenden lassen. Im Januar 1946 schickte die Washingtoner Regierung eine Expertengruppe unter Leitung der beiden deutschstämmigen Ökonomen Gerhard Colm und Ray Goldsmith nach Deutschland. Dort befragten sie zusammen mit Joseph Dodge, einem US-Bankier und Vertrauten von Clay, deutsche Fachleute dazu, wie das Währungsproblem gelöst werden könnte. Auf dieser Basis entwickelten sie einen Plan. Anfang April 1946 legten sie ihren ersten Entwurf vor, am 20. Mai überreichten sie Clay die endgültige Fassung des sogenannten Colm-Dodge-Goldsmith-Plans (CDG-Plan).54 In diesem Plan wurde zunächst die Notwendigkeit einer Währungsreform begründet:
»Ein sich verbreitender Tauschhandel und eine wachsende Unwilligkeit, für Reichsmark zu arbeiten und zu verkaufen, bringt die Gefahr einer weiteren Einschränkung der legalen Versorgung und einer Desintegration des Arbeitspotenzials mit sich. Nicht ein plötzlicher Zusammenbruch, sondern eine schleichende Lähmung des Wirtschaftskörpers ist heute die eigentliche Gefahr. Die Geld- und Finanzreform ist nicht nur – und auch nicht hauptsächlich – erforderlich, um den Zusammenbruch der Preiskontrolle zu verhindern, sondern zum Schutz der Produktion und zur Vermeidung eines wirtschaftlichen Chaos.«55
Aufgrund dieser Lage müsse die Reform »definitiv« sein und der Geldüberhang müsse radikal beseitigt werden. Daher schlugen die Autoren des Plans vor, alle Reichsmark-Guthaben im Verhältnis 10 zu 1 auf die neue Währungseinheit umzutauschen, die Besitzer von Geldvermögen müssten also einen Währungsschnitt von 90 Prozent hinnehmen. Löhne, Mieten und Steuern sollten dagegen weiter in der gleichen Höhe wie bisher entrichtet werden.
Gleichzeitig sah der Plan einen Lastenausgleich vor. Denn natürlich wären von einem solchen Währungsschnitt nur die Besitzer von Sparguthaben betroffen gewesen, die Sachwertbesitzer wären dagegen außen vor geblieben. Daher sollte alles erhalten gebliebene Sachvermögen mit einer fünfzigprozentigen Zwangshypothek belegt werden, sprich, wer ein Haus im Wert von 100.000 Reichsmark hatte, sollte über die kommenden Jahre eine Hypothek über 50.000 Reichsmark abtragen. Die Einnahmen aus Zinsen und Tilgung sollten in einen Fonds fließen, der wiederum Zertifikate an die vom Währungsschnitt Betroffenen ausgeben sollte, gestaffelt nach der Höhe ihrer Verluste und ihrer Bedürftigkeit. Schließlich sollte dem Fonds auch eine Kapitalabgabe auf das verbliebene Nettovermögen zufließen.56 Diese beiden Maßnahmen waren direkt miteinander gekoppelt und bedingten sich gegenseitig, wie es in dem Plan hieß:
»Denn jede Lösung, die dem Gerechtigkeitsgefühl eines großen Teiles der deutschen Bevölkerung entgegensteht, wird ernste Schwierigkeiten für die junge demokratische Regierung zur Folge haben, wie etwa die unglückliche Lösung der Inflationsprobleme in den Jahren 1919–1923 die Existenz der Weimarer Regierung aufs Spiel setzte.«57