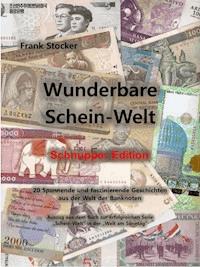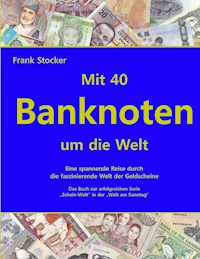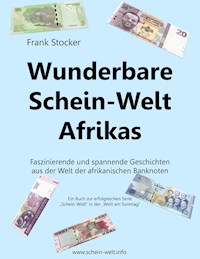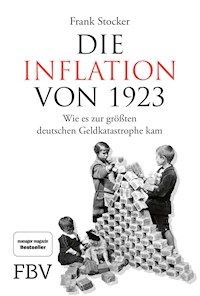
22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Vor 100 Jahren fand in Deutschland eine Geldvernichtung unvorstellbaren Ausmaßes statt. Kein anderes westliches Land hat in seiner jüngeren Geschichte eine Hyperinflation dieser Intensität erlebt. Obwohl die Zeitzeugen längst tot sind, werden in fast jeder Familie die Geschichten aus der Zeit, als das Kilo Rindfleisch 2,6 Billionen Mark kostete und die Großmutter den Ofen mit Millionenscheinen beheizte, bis heute weitererzählt. Die Ängste und Nöte haben sich tief ins kollektive Gedächtnis der Deutschen eingebrannt. Doch wie konnte es überhaupt zu jener gigantischen Geldentwertung kommen? Welche Entscheidungen der Finanzpolitiker und Notenbanker haben dazu geführt? Warum konnte die Regierung die Inflationsspirale nicht stoppen? Und wie erlebten die Menschen diese Zeit im Alltag? Frank Stocker liefert Antworten auf diese Fragen. Er erzählt, wie das Land zunächst allmählich und dann immer schneller in den Strudel des Geldverfalls geriet, was ihn verursachte und was ihn beschleunigte, wie die Verantwortlichen um einen Ausweg rangen und ihn erst spät fanden. Und er wirft einen Blick in die Zukunft: Kann so etwas tatsächlich noch einmal passieren? Und sind wir vielleicht schon auf dem Weg dorthin? Frank Stocker gelingt es auf meisterhafte Weise, die politischen Kräfteverhältnisse zu skizzieren, die finanzpolitischen Entscheidungen zu erklären, die volkswirtschaftlichen Folgen zu beleuchten und zugleich das gesellschaftliche Klima zu erfassen. In 50 kurzweiligen Kapiteln nähert er sich der größten deutschen Geldkatastrophe auf solch spannende Weise, dass Sie vergessen werden, dass Sie ein Sachbuch in den Händen halten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Frank Stocker
DIE INFLATION VON 1923
Wie es zur größten deutschen Geldkatastrophe kam
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
2. Auflage November 2022
© 2022 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Lektorat: Daniel Bussenius
Korrektorat: Anja Hilgarth
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer
Foto auf dem Cover: © akg-images
Satz: Daniel Förster
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-95972-564-4
ISBN E-Book (PDF) 978-3-98609-119-4
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-98609-120-0
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de.
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1 Der Auftakt 1914 bis 1918
Kapitel 2 Der belastete Neubeginn 1918
Kapitel 3 Der Versailler Vertrag Juni 1919
Kapitel 4 Die Erzberger’sche Steuerreform 1919/1920
Kapitel 5 Der kurze Aufschwung 1920/1921
Kapitel 6 Der Londoner Zahlungsplan März 1921
Kapitel 7 Der Mord an Matthias Erzberger August 1921
Kapitel 8 Die verzweifelten Sparversuche Sommer/Herbst 1921
Kapitel 9 Das Moratorium Januar 1922
Kapitel 10 Der Coup von Rapallo April 1922
Kapitel 11 Der Mord an Walther Rathenau Juni 1922
Kapitel 12 Die Hyperinflation beginnt Sommer 1922
Kapitel 13 Gustav Stresemann – Der neue Hoffnungsträger Oktober 1922
Kapitel 14 Die Regierung Cuno November 1922
Kapitel 15 Die Besetzung des Ruhrgebiets Januar 1923
Kapitel 16 Der Kampf gegen Schlemmerei und Wucher Januar 1923
Kapitel 17 Der Blut-Karsamstag März 1923
Kapitel 18 Der Mark-Crash April 1923
Kapitel 19 Hugo Stinnes – Der Napoleon der Wirtschaft April 1923
Kapitel 20 Die strauchelnde Regierung Frühjahr/Sommer 1923
Kapitel 21 Das vermurkste Devisengesetz Frühjahr/Sommer 1923
Kapitel 22 Der Beginn der Hungerrevolten Juli 1923
Kapitel 23 Das Ende Cunos Juli/August 1923
Kapitel 24 Die Regierung Stresemann August 1923
Kapitel 25 Der Kampf um die neue Währung – Karl Helfferich gegen Rudolf Hilferding August 1923
Kapitel 26 Die Devisenrazzien August/September 1923
Kapitel 27 Die Not bringt das Notgeld September 1923
Kapitel 28 Vom Hilferding-Plan bis zu Hans Luthers Idee einer Bodenmark September 1923
Kapitel 29 Der Sparkommissar September 1923
Kapitel 30 Das Ende des passiven Widerstands September 1923
Kapitel 31 Rechtsruck in Bayern September/Oktober 1923
Kapitel 32 Der erste Bruch der Koalition Oktober 1923
Kapitel 33 Das rote Sachsen Oktober 1923
Kapitel 34 Die Rheinland-Separatisten Oktober 1923
Kapitel 35 Die Armenspeisungen Oktober 1923
Kapitel 36 Das Ermächtigungsgesetz Oktober 1923
Kapitel 37 Die neue Währung Oktober 1923
Kapitel 38 Der Reichsbankpräsident Oktober 1923
Kapitel 39 Der Kahlschlag bei den Beamten Oktober 1923
Kapitel 40 Der Reichswährungskommissar November 1923
Kapitel 41 Der zweite Bruch der Koalition November 1923
Kapitel 42 Der Hitler-Putsch und das Treuegelübde im Rheinland November 1923
Kapitel 43 Die Billionen-Gänse November 1923
Kapitel 44 Die neue Währung November 1923
Kapitel 45 Das Ende der Regierung Stresemann November 1923
Kapitel 46 Das »Wunder der Rentenmark« Winter 1923/1924
Kapitel 47 Der Dawes-Plan Frühjahr 1924
Kapitel 48 Die neue Reichsbank Herbst 1924
Kapitel 49 Die Nachwirkungen 1920er-Jahre
Kapitel 50 Die Frage nach der Schuld Heute
NachwortKann das wieder passieren?
Die weitere Entwicklung der wichtigsten Personen
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Vorwort
150 Milliarden Mark für ein simples Straßenbahnticket. 356 Milliarden für ein Roggenbrot. Und 2,6 Billionen Mark für ein Kilo Rindfleisch – die große deutsche Inflation, die vor hundert Jahren, im Jahr 1923, ihren Höhepunkt erreichte, war eine geradezu surreale Zeit. Die Preise stiegen in rasendem Tempo, verdoppelten sich innerhalb von Stunden, übersprangen alle Schwellen des bis dahin Vorstellbaren.
»Kein Volk der Welt hat etwas erlebt, was dem deutschen ›1923‹- Erlebnis entspricht«, schrieb der Schriftsteller und Journalist Sebastian Haffner 1939 über diese Zeit. »Den Weltkrieg haben alle erlebt, die meisten auch Revolutionen, soziale Krisen, Streiks, Vermögensumschichtungen, Geldentwertungen. Aber keins die phantastische, groteske Übersteigerung von alledem auf einmal, die 1923 in Deutschland stattfand.«[1]
Ob man das heute noch so stehen lassen kann, sei dahingestellt. Hyperinflationen gab es seither immer mal wieder, in verschiedenen Gegenden der Welt. Und dennoch war jene deutsche Inflation etwas Besonderes, was ihren Ursprung angeht, was den Verlauf betrifft und nicht zuletzt im Hinblick auf die Nachwirkungen.
Denn diese Zeit hat sich tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Jeder Deutsche kennt Geschichten aus jener Zeit. Sie werden bis heute in den Familien weitergegeben, auch wenn die Zeitzeugen längst nicht mehr leben. Da war der Großvater, der mit einem Koffer voller Geld als Arbeitslohn nach Hause kam. Da war die Großmutter, die sich den Koffer sofort schnappte und auf den Markt rannte, um mit den Banknoten irgendetwas zu kaufen, bevor das Geld schon wieder wertlos war. Da war der Urgroßonkel, der sein ganzes Vermögen, das er in Lebensversicherungen investiert hatte, verlor. Da war die Großtante, die mit Millionenscheinen den Ofen beheizte.
In den Ereignissen jener Zeit gründet jene extreme Inflationsangst, die die Deutschen bis heute von den meisten anderen Nationen unterscheidet und die auch in den letzten Jahren, seit die Notenbanken in aller Welt wieder Geld drucken, zu einem beständigen, angstvollen Raunen unter deutschen Sparern führt.
Doch wie kam es überhaupt zu jener gigantischen Geldentwertung vor hundert Jahren? Welche Entscheidungen der Finanzpolitiker und Notenbanker führten dazu? Warum konnte die Regierung die Inflationsspirale nicht stoppen? Und vor allem: Wie erlebten die Menschen diese Zeit im Alltag?
Darauf liefert dieses Buch eine Antwort. Es erzählt, wie das Land zunächst allmählich und dann immer schneller in den Strudel des Geldverfalls geriet, was ihn verursachte und was ihn beschleunigte. Es zeigt anschaulich, wie die Verantwortlichen um einen Ausweg rangen und ihn erst sehr spät fanden. Viele Augenzeugenberichte und Zitate aus jenen Monaten unterstreichen das und zeichnen ein eindrückliches Bild dieser Zeit. Einer Zeit, die die Deutschen, die sie erlebten, nie wieder vergessen konnten. Und die niemand von uns jemals erleben möchte.
KAPITEL 1
Der Auftakt
1914 bis 1918
Die Menschenmassen standen Spalier, sie jubelten den vorbeimarschierenden Soldaten zu, deren Gewehre mit Blumen geschmückt waren. Euphorisch begrüßten viele Deutsche im August 1914 den Beginn des Ersten Weltkriegs. Selbst Thomas Mann sprach begeistert von einer »Reinigung«, die der Krieg bedeute, von einem Ausstieg des Künstlers aus der »Friedenswelt, die er so satt, so überaus satt hatte«.1
Als »Erster Weltkrieg« wurde das folgende Schlachten und Töten erst Monate danach erstmals bezeichnet. Im August 1914 war noch niemandem klar, wie allumfassend dieser Krieg werden würde und dass dies der Beginn einer Epochenwende war, die den Sturz alter Monarchien und Mächte auslöste, sei es in Deutschland, Österreich-Ungarn oder Russland, und die den Aufstieg neuer Weltmächte wie der USA und der Sowjetunion sowie neuer Ideologien wie des Kommunismus und des Faschismus beförderte. Als »Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts« wurde dieser Krieg später bezeichnet. Er legte die Basis für viele der gewaltigen Umbrüche des 20. Jahrhunderts.
Doch in jenen Hochsommertagen des Jahres 1914 ahnte niemand all diese Folgen. Die meisten Deutschen glaubten an einen kurzen, schnellen Waffengang, der natürlich siegreich enden würde. Sie fühlten sich erinnert an das, was etwas mehr als vier Jahrzehnte zuvor passiert war. 1870/1871 hatten die deutschen Truppen Frankreich binnen weniger Wochen niedergerungen, und gestützt auf die Bajonette war danach das Deutsche Kaiserreich gegründet worden.
Doch diesmal verlief der Krieg bekanntlich anders. Deutschland unterlag nach vier zermürbenden Jahren, die Millionen Menschenleben kosteten. Und es folgte kurz danach die große Inflation, die schließlich 1923 die Deutschen all ihrer Ersparnisse beraubte, die nationale Wirtschaft völlig zerrüttete und das Land fast auseinanderfallen ließ. Die Basis hierfür wurde genau in jenen Augusttagen des Jahres 1914 gelegt. Damals begann das Unglück.
Ein Krieg kostet nicht nur stets viele Menschenleben, er kostet auch viel Geld, das war damals nicht anders als heute. Mit dem Attentat von Sarajevo am 28. Juni 1914, bei dem der österreichische Thronfolger und seine Frau ermordet wurden, eskalierte die zuvor bereits angespannte Lage in Europa nach und nach endgültig. Das Kaiserreich begann nun, sich intensiv auf einen Krieg vorzubereiten, und erklärte schließlich am 1. August Russland und am 3. August Frankreich den Krieg. Begleitet wurde all das von einer großen Begeisterung im Volk.
»Der Lustgarten war den Nachmittag von einer dichtgedrängten Menschenmenge besetzt«, beschrieb das Berliner Tagblatt die Szenerie des 1. August. »Etwa um 5 ½ Uhr wurde dem Publikum durch Adjutanten, Offiziere und Schutzmannswachtmeister die erfolgte Mobilmachung bekanntgegeben, worauf es zu großen Begeisterungskundgebungen kam.« Dann wälzte sich die Menge zum kronprinzlichen Palais. »Plötzlich zeigten sich der Kaiser und die Kaiserin auf dem Mittelbalkon des Schlosses. Sogleich wurde die Absperrung aufgehoben und die Menge eilte im Laufschritt unter unaufhörlichen Hochrufen über die Brücke vor das Schloss, ›Heil dir im Siegerkranz‹ und ›Deutschland, Deutschland über alles‹ singend.« Der Kaiser hielt eine kurze Ansprache, die in den Worten gipfelte, er kenne »keine Parteien und auch keine Konfessionen mehr«, stattdessen seien »heute alle deutsche Brüder und nur noch deutsche Brüder«. Stürmische Hochrufe folgten.2
Doch die Begeisterung konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch diese Phase der Mobilmachung, als der Krieg noch gar nicht richtig begonnen hatte, bereits enorme finanzielle Mittel erforderte, Geld für Soldaten, Material und Transport. Geld, das der Staat nicht hatte.
Denn so groß und mächtig das Deutsche Kaiserreich auf der Bühne der Weltpolitik auftrumpfte, so kompliziert und dünn war gleichzeitig sein finanzielles Fundament. Die Reichsverfassung von 1871 war explizit so angelegt, dass die Finanzmacht bei den Bundesstaaten lag – der preußische Finanzminister soll den Staatssekretär des Reichsschatzamtes gar lange Jahre wie einen zu Gehorsam verpflichteten Untergebenen behandelt haben.
Das Reich selbst hatte nur die Zollhoheit und durfte zudem indirekte Steuern erheben, die damals jedoch die unbedeutenderen Abgaben darstellten und im Staatshaushalt dieser Zeit nur einen Bruchteil ausmachten, beispielsweise auf Tabak, Branntwein oder Salz. Direkte Steuern, beispielsweise die Einkommensteuer, waren dagegen den Bundesstaaten vorbehalten. Zwar traten sie dem Reich von ihren Einnahmen jedes Jahr über sogenannte Matrikularbeiträge einen Teil ab. Doch große Summen waren auch das nicht.
Denn die Steuern, die die Länder erhoben, waren extrem niedrig. In Preußen betrug der Satz der Einkommensteuer für Jahreseinkommen von 900 bis 1.050 Mark sage und schreibe 6 Mark, also rund 0,6 Prozent. Das Durchschnittseinkommen lag 1913 nur knapp darüber, bei 1.182 Mark.3 Der Steuersatz stieg dann schrittweise bis auf 4.000 Mark für Einkommen zwischen 100.000 und 105.000 Mark, also rund 4 Prozent4 – davon kann heute jeder Arbeitnehmer nur träumen.
Über Steuererhöhungen Geld für den Krieg zu beschaffen, wäre also ein kompliziertes Unterfangen gewesen, da dies über die Bundesstaaten hätte geschehen müssen, und es hätte auch nur wenig gebracht, selbst wenn die Sätze vervielfacht worden wären. Denn die Kriegskosten wuchsen exorbitant. Im letzten Fiskaljahr vor dem Krieg, von April 1913 bis März 1914, hatte das Deutsche Reich gerade einmal 3 Milliarden Mark ausgegeben. Im Fiskaljahr 1914/1915 war es dann mit 9 Milliarden schon dreimal so viel. Im Jahr darauf stiegen die Ausgaben sogar auf 28 Milliarden, danach auf 52 Milliarden. Erst 1918/1919 gingen sie wieder leicht auf 44 Milliarden Mark zurück.5 So verwundert es nicht, dass bis Kriegsende nur etwa 14 Prozent der gesamten Kriegskosten Deutschlands über Steuern finanziert wurden.6
Die Weichen, um das Geld auf anderem Wege zu beschaffen, stellte die Reichsregierung gleich in den ersten Kriegstagen. Am 4. August kam der Reichstag zusammen, um die entsprechenden Gesetze zu beschließen. »Was uns auch beschieden sein mag, der 4. August 1914 wird bis in alle Ewigkeit hinein einer der größten Tage Deutschlands sein«, kommentierte Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg begeistert, als die Beschlüsse gefasst waren.7
Tatsächlich sollte dieser Tag bis in alle Ewigkeit in Erinnerung bleiben – allerdings in einem ganz anderen Sinne, als von Bethmann Hollweg dies vermutlich gedacht hatte. Es war der erste Tag auf der Rutschbahn Richtung Inflation. Denn die Beschlüsse des Reichstags stellten die Finanzverfassung des Reiches auf den Kopf.
Diese war einst mit der Gründung der Reichsbank 1876 auf ein stabiles und wohldurchdachtes Fundament gestellt worden. Seither war die Währung des Kaiserreiches durch Gold gedeckt – sie wurde daher auch als Goldmark bezeichnet. Die Bürger konnten ihre Banknoten jederzeit in eine entsprechende Menge des Edelmetalls umtauschen. Dazu war ein Drittel des gesamten in Umlauf befindlichen Bargeldes bei der Reichsbank in Form von Gold hinterlegt. Zu zwei Dritteln bestand die Deckung aus Handelswechseln der privaten Wirtschaft, also verbrieften Zahlungsansprüchen, die Kunden ihren Lieferanten ausgestellt hatten. Im Gegensatz zu Gold konnte deren Wert zwar schwanken, doch sie bezogen sich ebenfalls auf reale Güter, die produzierten Waren.
Das war eine außerordentlich kluge Konstruktion. Denn rein goldgedeckte Währungen haben einen entscheidenden Nachteil: Sie können Deflation verursachen. Wenn die Wirtschaft rasant wächst – wie es am Ende des 19. Jahrhunderts der Fall war –, dann steigt auch der Bargeld- und Kreditbedarf von Unternehmen und Privathaushalten schnell. Wenn die Banken dann jedoch kein zusätzliches Gold in ihre Tresore füllen können, dürfen sie auch kein zusätzliches Geld ausgeben. Sie können der wachsenden Wirtschaft nicht die notwendigen finanziellen Mittel bereitstellen. Dann gibt es zwar immer mehr Waren, die Geldmenge bleibt jedoch konstant. Die Folge: Der Preis der Waren sinkt, es kommt zu einer Deflation. Das wiederum führt dazu, dass sich Firmen und Privatpersonen beim Einkauf zurückhalten. Schließlich könnte die Ware ja in Kürze noch günstiger zu haben sein. Die Nachfrage geht zurück, als Folge davon bricht die Produktion ein, und die Wirtschaft gerät in einen Abwärtsstrudel. Genau das passierte im 19. Jahrhundert in verschiedenen Ländern immer wieder.
Abb. 1: Banknote zu 100 Mark
Quelle: privat
Indem die Bargeldmenge im Kaiserreich jedoch zu zwei Dritteln an Handelswechsel gebunden war, deren Volumen natürlich von der Konjunktur abhing, konnte die Bargeldmenge leichter mit dem Wirtschaftswachstum Schritt halten: Je mehr produziert wurde, umso mehr Handelswechsel gab es. Zwar musste entsprechend auch die Goldmenge, die die Reichsbank vorhielt, erhöht werden, aber eben deutlich weniger stark als bei einer reinen Goldbindung. Die Geldmenge konnte sich also elastischer mit der Wirtschaft entwickeln und wachsen.
Und tatsächlich hatte die Bargeldmenge im Kaiserreich über die Jahre langsam, aber stetig zugenommen, parallel zu den Goldreserven der Notenbank und den hinterlegten Handelswechseln. 1876 hatte der gesamte Bargeldumlauf noch etwas mehr als 3 Milliarden Mark betragen, für das Jahr 1913 wird die Summe auf rund 6,5 Milliarden Mark geschätzt.8 Die Wirtschaftsleistung lag damals bei rund 56,6 Milliarden Mark.9 Zum Vergleich: Ein ungelernter Arbeiter in der Textilindustrie verdiente im Schnitt gerade mal etwas mehr als 21,38 Mark pro Woche und ein Roggenbrot kostete 29 Pfennige.10
Vor diesem Hintergrund erscheinen die Summen, die nun nach Kriegsbeginn gebraucht wurden, umso gigantischer. Allein in den ersten sechs Tagen der Mobilmachung benötigte die Oberste Heeresleitung 750 Millionen Mark.11 Und um diese Summe zu besorgen, beschloss der Reichstag am 4. August die sogenannten Währungsgesetze.12 Diese basierten im Wesentlichen auf Plänen, die schon über zwei Jahrzehnte in den Schubladen lagen, für den Kriegsfall. Nun trat er ein, und die Pläne konnten umgehend umgesetzt werden. Schon zehn Tage später traten sie in Kraft.
Die Gesetze brachten drei wesentliche Neuerungen. Erstens wurde die Pflicht der Notenbank, Banknoten jederzeit in Gold umzutauschen, aufgehoben. Damit war die Bindung der Währung an Gold, also der Goldstandard, außer Kraft gesetzt. Der erste Sargnagel für die Mark. Zweitens durfte die Reichsbank neben den Handelswechseln nun auch Schatzanweisungen und Schatzwechsel, also Schuldscheine des Staates, zur Deckung entgegennehmen und für diese die entsprechende Summe an Geld ausgeben. Der Staat konnte sich somit direkt bei der Reichsbank verschulden – das war nichts anderes als die Finanzierung des Reiches über die Notenpresse. Der zweite Sargnagel. Und drittens wurden sogenannte Darlehnskassen gegründet. Sie waren zwar formal von der Reichsbank getrennt, griffen aber auf deren Verwaltung und Logistik zu. Daher konnten über Nacht im ganzen Land über einhundert solcher Darlehnskassen ihre Arbeit aufnehmen, als Untermieter der Reichsbank.
Die Reichsbank sollte sich von nun an auf die Finanzierung des Staates konzentrieren. Die Finanzierung von Wirtschaft, Bundesstaaten und Kommunen sollten dagegen die Darlehnskassen übernehmen. Dazu gaben sie eigenes Geld heraus, sogenannte Darlehnskassenscheine, und schufen damit de facto einen zweiten Geldkreislauf. Denn diese Scheine waren zwar keine gesetzlichen Zahlungsmittel, alle öffentlichen Stellen nahmen sie aber zum Nennwert in Zahlung. Man konnte sie also wie normale Geldscheine benutzen, und damit waren sie den Reichsbanknoten gleichgestellt. Gedeckt waren sie zunächst durch Wirtschaftsgüter, später konnten Bürger bei den Darlehnskassen jedoch auch Kriegsanleihen hinterlegen und dafür einen Kredit in der entsprechenden Höhe erhalten. Dies war der dritte Sargnagel für die Mark.
Der Grund dafür erschließt sich bei einem genaueren Blick auf die Kriegsfinanzierung: Um das Geld zu beschaffen, legte das Reich Kriegsanleihen auf, insgesamt neun bis 1918. Diese sollten die Bürger zeichnen, sie sollten also ihr Erspartes geben und dafür einen verzinsten Schuldschein erhalten. Bis 1. Oktober 1924 sollten sie regelmäßig Zinsen einstreichen können und dann ihr eingezahltes Geld zurückerhalten. Anfangs war die Bevölkerung freudig dabei. 2,632 Milliarden Mark wollte das Reich beispielsweise im September 1914 einsammeln. Doch die Nachfrage nach den Anleihen war so groß, dass sogar 4,5 Milliarden Mark zusammenkamen, zwei Drittel mehr als angepeilt.
Die Bürger hielten die Anleihen für ein lukratives Investment, denn ihnen wurden 5 Prozent Zinsen versprochen. Zweifel an der Rückzahlung der Anleihen hatte niemand – schließlich herrschte die Überzeugung, dass Deutschland schon nach kurzer Zeit als Sieger aus dem Krieg hervorgehen würde, ganz wie aus dem Krieg gegen Frankreich von 1870/1871. Damals hatte Frankreich Reparationen in Höhe von 5 Milliarden Franc an Deutschland zahlen müssen, das entsprach rund 1.450 Tonnen Gold beziehungsweise dem Anderthalbfachen des gesamten Geldumlaufs im Deutschen Reich zu jener Zeit. Dieses Geld nutzte das Kaiserreich für Investitionen, beispielsweise in den Eisenbahnbau, aber auch zur Rückzahlung von Kriegsanleihen.
So sollte es auch diesmal sein, wie Karl Helfferich, ab 1915 Staatssekretär im Reichschatzamt, ganz offen aussprach. Er war maßgeblich für die Finanzierung des Krieges verantwortlich, und er sollte auch später, in der Weimarer Republik, noch eine doppelte Rolle spielen – eine unrühmliche und eine konstruktive. Noch 1915 erwartete er wie viele andere einen Sieg mit anschließender Tilgung der deutschen Kriegsschulden durch den Feind: »Wie die Dinge liegen, bleibt also vorläufig nur der Weg, die endgültige Regelung der Kriegskosten durch das Mittel des Kredits auf die Zukunft zu verschieben, auf den Friedensschluss und auf die Friedenszeit«, sagte er in einer Reichstagsrede im August 1915:
»Und dabei möchte ich auch heute wieder betonen: Wenn Gott uns den Sieg verleiht und damit die Möglichkeit, den Frieden nach unseren Bedürfnissen und nach unseren Lebensnotwendigkeiten zu gestalten, dann wollen und dürfen wir neben allem anderen auch die Kostenfrage nicht vergessen; [lebhafte Zustimmung] das sind wir der Zukunft unseres Volkes schuldig. [›Sehr wahr!‹-Rufe]
Die ganze künftige Lebenshaltung unseres Volkes muss, soweit es irgend möglich ist, von der ungeheuren Bürde befreit bleiben und entlastet werden, die der Krieg anwachsen lässt. [weitere ›Sehr wahr!‹-Rufe]
Das Bleigewicht der Milliarden haben die Anstifter dieses Krieges verdient; [›Sehr richtig!‹-Rufe] sie mögen es durch die Jahrzehnte schleppen, nicht wir. [›Sehr gut!‹-Rufe]«13
Doch je länger der Krieg dauerte, desto stärker wuchsen im Volk die Zweifel, sowohl am Sieg als auch an der wirtschaftlichen Überlebensfähigkeit des Deutschen Reiches und der Sicherheit der Kriegsanleihen. Schon Anfang 1915 verbot daher die Regierung die Veröffentlichung der Kurse von Kriegsanleihen, die an den Börsen gehandelt wurden14 – so sollte niemand sehen, dass deren Renditen allmählich stiegen, das Vertrauen also schwand. 1916 wurde sogar Unternehmen die Ausgabe von Anleihen verboten – Investoren sollten keine Anlagealternativen mehr haben, die Kriegsanleihen sollten so mehr oder weniger zur einzigen Anlagemöglichkeit werden.
Dennoch wollten immer weniger Bürger dem Reich noch ihr Geld leihen, je länger der Krieg dauerte. Die Begeisterung war verflogen, der Optimismus dahin, und viele hatten auch schlicht nichts mehr, das sie hätten geben können. Schon ab 1916 konnten daher die angepeilten Emissionsbeträge nicht mehr erreicht werden.
Doch jetzt geschah noch etwas, das dramatische Folgen haben sollte. Denn solange die Bürger einfach nur ihr Geld gegeben und dafür Schuldscheine erhalten hatten, war die umlaufende Geldmenge gleich geblieben. Das Geld hatte nur den Besitzer gewechselt. Nun aber hinterlegten immer mehr Deutsche ihre Kriegsanleihen bei den Darlehenskassen, um bei diesen dafür Kredite aufzunehmen, die in Darlehnskassenscheinen ausbezahlt wurden. Damit jedoch wurden aus einer Mark plötzlich zwei.
Die neun Kriegsanleihen des Deutschen Reiches
Kriegsanleihe
Angestrebte Summe in Millionen Mark
Investiertes Kapital der Anleger in Millionen Mark
Saldo
September 1914
2.632
4.460
+1.832
März 1915
7.209
9.060
+1.851
September 1915
9.691
12.101
+2.410
März 1916
10.388
10.712
+324
September 1916
12.766
10.652
-2.114
März 1917
14.855
13.122
-1.733
September 1917
27.204
12.626
-14.578
März 1918
38.971
15.001
-23.970
September 1918
49.414
10.443
-38.971
Ein Beispiel soll das verdeutlichen: Angenommen ein Bürger zeichnete Kriegsanleihen für 1.000 Mark, so gab er dem Staat diese Summe in Form von Reichsbanknoten und erhielt dafür einen Schuldschein. Die umlaufende Geldmenge war unverändert. Wenn er nun aber diesen Schuldschein bei einer Darlehenskasse hinterlegte und einen Kredit aufnahm, so erhielt er 1.000 Mark in Form von Darlehenskassenscheinen ausgezahlt. Diese konnte er wie Bargeld einsetzen, damit einkaufen und bezahlen, denn die Darlehenskassenscheine waren ja ein ganz normales, gleichberechtigtes Zahlungsmittel. Er hatte also sein einst eingezahltes Geld zunächst einmal zurück, auch wenn er den Kredit irgendwann bei der Darlehenskasse zurückzahlen musste.
Damit hatte sich nun schlagartig die Geldmenge verdoppelt. Denn der Staat besaß weiterhin die 1.000 Mark, die ihm der Bürger in Form von Reichsbanknoten gegeben hatte. Der Bürger hatte aber von einer anderen staatlichen Institution ebendiese 1.000 Mark wieder erhalten – formal zwar nicht als Banknoten, sondern als Darlehenskassenscheine. Da diese aber gleichberechtigt neben den Banknoten galten, war das egal. Auf diese Weise waren aus 1.000 Mark plötzlich 2.000 Mark geworden – die Geldmenge hatte sich wie von Zauberhand verdoppelt.
Abb. 2: Darlehenskassenschein zu 50 Mark
Quelle: privat
De facto wurde damit Geld gedruckt, ungedeckt, und zwar in beträchtlicher Höhe. Schon Ende 1916 waren 32 Prozent aller Kredite, die die Darlehenskassen ausgegeben hatten, durch Kriegsanleihen gedeckt. 1,1 Milliarden Mark an Krediten hatten sie bis dahin schon auf diese Weise ausgegeben, damit also 1,1 Milliarden Mark an zusätzlichem Geld in Umlauf gebracht. Das war eine bedeutende Summe, vor dem Krieg hatte die gesamte Geldmenge, wie gesagt, gerade mal 6,5 Milliarden Mark betragen.
Der Umweg über die Darlehenskassen verschleierte diesen Vorgang allerdings, sodass die wenigsten durchschauten, was hier passierte. Noch viel weniger ahnten sie, dass darin die Saat für die Inflation und die Zerstörung der Währung steckte.
Diese Zerstörung strebte natürlich niemand an. Vielmehr gingen die Verantwortlichen davon aus, dass es sich bei all dem um Maßnahmen für eine kurze Übergangsphase handelte, um einen Überbrückungskredit bis zum Sieg. In Kriegszeiten, so hatte es schließlich schon in der Begründung zur Änderung des Bankgesetzes vom 4. August 1914 geheißen, sei »eine außerordentliche Steigerung des ungedeckten Notenumlaufs eine wirtschaftliche Notwendigkeit«.15 Doch gerade am Finanzmarkt ahnten viele, dass das alles böse enden würde. So schrieb der Bankier Max M. Warburg 1916 über sein Bankhaus: »Sollte Deutschland den Krieg verlieren, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben, als eine Annonce folgenden Wortlauts in die Zeitung zu setzen: Auf dem Felde der Ehre stellten ihre Zahlungen ein M. M. Warburg & Co.«16
Immer weniger Menschen zeichneten die Kriegsanleihen, immer häufiger tauschten sie diese in Darlehenskassenscheine um, immer stärker wuchs die Geldmenge. Langsam und schleichend führte dies zur Geldentwertung. Doch auch das bekamen die meisten zunächst nicht mit. Denn der Lebensmittelmarkt blieb lange stabil – dafür sorgte ein Gesetz, das gleichzeitig mit den Währungsgesetzen im August 1914 verabschiedet worden war.17 Offenbar war bereits damals den Verantwortlichen klar, welche Auswirkungen die Veränderung des Währungsgefüges haben würde. Denn sie führten Preishöchstgrenzen für viele Produkte ein, und eigens eingerichtete Preisprüfungsstellen waren für die Überwachung zuständig. Wer diese Preisgrenzen missachtete, konnte mit harten Strafen belegt werden. Je länger der Krieg dauerte, desto mehr Produkte wurden von den Preishöchstgrenzen erfasst.
Abb. 3: Kurs des Dollars in Mark während des Ersten Weltkriegs von 1914 bis 1918
Quelle: Statistisches Reichsamt
So war der Verfall der Mark tatsächlich nur an einem Markt direkt abzulesen: dem Devisenmarkt, dem Markt für den Handel mit ausländischen Währungen. Seit 1871, über 40 Jahre lang, hatte ein Dollar[2] unverändert 4,20 Mark gekostet. Doch 1915 war der Kurs im Jahresmittel bereits auf 4,88 Mark angestiegen. 1916 lag er bei 5,63 Mark, 1917 bei 6,63 Mark, bis Ende 1918 stieg der Wechselkurs schließlich auf rund 7,50 Mark. Innerhalb von vier Jahren hatte die Mark also fast die Hälfte ihres Wertes verloren.
Doch das war noch nichts im Vergleich zu dem, was folgte.
KAPITEL 2
Der belastete Neubeginn
1918
»Das deutsche Volk hat auf der ganzen Linie gesiegt. Das alte Morsche ist zusammengebrochen; der Militarismus ist erledigt! Die Hohenzollern haben abgedankt! Es lebe die deutsche Republik!«18 Es waren große Worte, die der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann am 9. November 1918 vom Balkon des Reichstags in die Menge rief. Er besiegelte damit nicht nur das Ende des Kaiserreiches und rief den Beginn einer neuen Epoche aus. Er wollte auch Aufbruchsstimmung verbreiten, Vorfreude auf das Neue. Dafür gab es allerdings wenig Anlass. 17 Millionen Menschen waren bis zum Waffenstillstand am 11. November 1918 weltweit Opfer des Krieges geworden, in den Schützengräben war eine ganze Generation junger Männer verheizt worden, die Reste des deutschen Heeres waren erschöpft und ausgelaugt. Verantwortlich dafür waren der Kaiser und seine Militärs. Doch diesen gelang es geschickt, sich aus der Verantwortung zu stehlen.
Zunächst war Anfang Oktober Max von Baden neuer Reichskanzler geworden. Er reformierte die Verfassung, die das Amt des Reichskanzlers nurmehr vom Votum des Reichstags abhängig machte, also de facto eine parlamentarische Monarchie einführte und somit die Verantwortung für die Politik voll dem Parlament übertrug. Als sich die Ereignisse überschlugen, verkündete Max von Baden eigenmächtig die Abdankung des Kaisers und trug Friedrich Ebert, dem Führer der Sozialdemokraten im Reichstag, an, das Amt des Reichskanzlers zu übernehmen. Dieser sah es als seine Verantwortung, das Land jetzt, in dieser schweren Zeit, nicht führungslos zu lassen. Gleichzeitig war das natürlich die Chance für die Sozialdemokraten, endlich ans Ruder zu kommen und das Land in ihrem Sinne zu gestalten. Ebert nahm das Amt daher an, der Kaiser floh ins Exil in die Niederlande und Eberts Kollege Scheidemann vollendete die Revolution, indem er die Republik ausrief und damit eine neue Ära einläutete.
Doch diese neue Ära der deutschen Geschichte stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Die erste Handlung der republikanischen Regierung bestand ausgerechnet darin, einen demütigenden Waffenstillstand zu unterzeichnen. Zwar hatte sie gar keine andere Wahl, dennoch führten die rechten Kräfte dies später stets gegen die Demokraten ins Feld. Aber auch von ganz links kam sofort Gegenwind. Denn kurz nach Scheidemann hatte am 9. November auch der Führer des kommunistischen Spartakusbundes, Karl Liebknecht, die Republik ausgerufen, allerdings eine »freie sozialistische Republik«. In ihr sollten Arbeiterräte das Sagen haben, nach dem Vorbild der russischen Revolution von 1917. Die verschiedenen Lager lieferten sich über Wochen brutale Auseinandersetzungen. Der linke sogenannte Spartakus-Aufstand wurde im Januar 1919 blutig niedergeschlagen, Liebknecht und seine Mitstreiterin Rosa Luxemburg wurden ermordet. Als dann im Februar die Verfassungsgebende Deutsche Nationalversammlung zusammentrat, musste sie das in Weimar tun, da Berlin weiterhin durch Unruhen und Kämpfe erschüttert wurde – daher auch die Bezeichnung »Weimarer Republik« für den Staat, der nun entstand.
Die Nationalversammlung wählte den Sozialdemokraten Friedrich Ebert zum ersten Reichspräsidenten und seinen Parteigenossen Philipp Scheidemann zum Reichsministerpräsidenten. Erst allmählich beruhigte sich die politische Lage.
EXKURS: Die Verfassung der Weimarer Republik
Am 19. Januar 1919, schon zehn Wochen nach dem Waffenstillstand, fanden die Wahlen zur Verfassungsgebenden Nationalversammlung statt. Diese trat am 6. Februar im Weimarer Nationaltheater erstmals zusammen. Am 31. Juli 1919 beschloss sie die neue Verfassung, am 14. August wurde sie verkündet. Dies war die erste demokratische Verfassung Deutschlands, die tatsächlich in Kraft trat. Sie führte ein gemischt präsidiales und parlamentarisches Regierungssystem auf Basis eines Bundesstaates ein. Sie enthielt auch unveräußerliche Grundrechte.
Die gesetzgeberische Gewalt hatte der Reichstag, der alle vier Jahre gewählt wurde. Dieser hatte das Haushaltsrecht und konnte Reichskanzler und Minister jederzeit durch ein Misstrauensvotum absetzen. In der heutigen Bundesrepublik ist die Abwahl des Kanzlers nur durch die Wahl eines neuen Regierungschefs möglich, in der Weimarer Republik konnte dies auch geschehen, ohne dass man sich zuvor auf eine Alternative verständigt hatte – einer der problematischen Aspekte der Verfassung.
Der Reichsrat beteiligte die Länder an der Gesetzgebung, ähnlich dem Bundesrat heute. Der Staatsgerichtshof, der 1922 eingerichtet wurde, war für Verfassungsbeschwerden zuständig, vergleichbar mit dem heutigen Bundesverfassungsgericht, jedoch mit weniger Kompetenzen.
Ein anderer problematischer Aspekt der Weimarer Verfassung war die herausgehobene Stellung des Reichspräsidenten. Er wurde auf sieben Jahre direkt vom Volk gewählt, er ernannte den Reichskanzler und konnte diesen jederzeit absetzen. Außerdem konnte er im Einvernehmen mit dem Reichskanzler Notverordnungen ohne Zustimmung des Reichstags erlassen und durch diese sogar Grundrechte zeitweilig außer Kraft setzen. Zudem konnte der Reichspräsident den Reichstag jederzeit auflösen, und er hatte den Oberbefehl über die Reichswehr.
Die große Macht des Reichspräsidenten war ein Überbleibsel der Staatsidee des Kaiserreiches. Nicht umsonst wurde der Präsident daher oft als Ersatz-Kaiser gesehen. Die Bundesrepublik verabschiedete sich von dieser Idee und beschnitt die Rechte des Bundespräsidenten im Vergleich zum Reichspräsidenten der Weimarer Republik ganz erheblich. Der Bundeskanzler wird heute vom Bundestag gewählt. Den Oberbefehl über die Bundeswehr hat im Friedensfall der Verteidigungsminister und nur im Verteidigungsfall der Bundeskanzler.
Doch die neue Regierung und der neue Staat starteten 1918/1919 nicht nur äußerst unruhig, sie begannen auch mit einer gigantischen finanziellen Last. Die Kosten des Krieges hatten sich auf rund 164 Milliarden Mark aufgetürmt. Davon waren nur etwa 10 Milliarden Mark durch Steuererhöhungen und Kriegsabgaben finanziert worden. 97 Milliarden Mark waren durch Kriegsanleihen, 57 Milliarden Mark über Schatzwechsel, Schatzanweisungen und ähnliche Schuldverschreibungen besorgt worden. Die Schulden des Reiches waren daher zwischen 1914 und 1918 von 5 auf 156 Milliarden Mark explodiert,[3]19 und das, während die Wirtschaftsleistung gleichzeitig um fast ein Drittel geschrumpft war.20 Die Verschuldung des Staates lag schätzungsweise bei circa 200 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).21
Parallel dazu hatte sich die umlaufende Geldmenge von 6,5 Milliarden Mark unmittelbar vor Kriegsbeginn auf über 33 Milliarden Mark erhöht22 – und das hatte nun Folgen. Denn ab dem Frühjahr 1919 wurden die Preise, die zuvor durch die Preishöchstgrenzen in Schach gehalten worden waren, allmählich freigegeben.23 Eine Teuerungswelle, die sich in den Kriegsjahren aufgestaut hatte, rollte über Deutschland hinweg. Für ein Roggengraubrot, das im Januar 1919 fast überall im Reich noch rund 50 Pfennige gekostet hatte, mussten im Oktober in Berlin 58, in Frankfurt 60 und in Weimar sogar 80 Pfennige bezahlt werden. Das war ein Aufschlag von 16 bis 60 Prozent innerhalb von zehn Monaten. Der Preis für ein Kilo Kartoffeln stieg im selben Zeitraum in Berlin von 20 auf 30, in Frankfurt von 22 auf 30 und in Weimar von 16 auf 25 Pfennige.
Die unterschiedlichen Preisniveaus hingen mit der jeweiligen Lebensmittelversorgung vor Ort zusammen, die aufgrund der Wirren in den ersten Monaten der Weimarer Republik höchst unterschiedlich war. Doch überall kletterten die Preise rasant. Und immer häufiger begehrten die Menschen dagegen auf. So beispielsweise auch am Morgen des 8. September 1919, einem Montag, in Breslau. Am Wochenende hatte es auf dem Markt der Stadt bereits Auseinandersetzungen gegeben. Kunden hatten Händler bedroht, sie zu Preissenkungen gezwungen. Ein Bauer, der sich weigerte und demonstrativ Eier zerschlug, wurde sogar verprügelt. Nun waren die hohen Lebensmittelpreise wieder das Gesprächsthema in diversen Grüppchen, die sich ab 8 Uhr morgens im Zentrum der Stadt bildeten, aber auch die Kosten von Zigarren und Schuhen wurden eifrig debattiert. Gegen 10 Uhr stürmten die Menschen dann plötzlich das Schuhgeschäft von Dohndorf am Blücherplatz, andere rannten in ein benachbartes Zigarrengeschäft. Beide Läden wurden ausgeplündert. Die Nachricht davon verbreitete sich wie ein Lauffeuer, und die anderen Geschäfte der Stadt schlossen vorsorglich. Kurze Zeit später marschierte die Polizei auf, postierte Einsatzkräfte mit Maschinengewehren, und allmählich gelang es ihr, die Ordnung wieder herzustellen.24 Ähnliche Vorkommnisse gab es auch in anderen Städten. Überall war das die Folge der drastischen Preissteigerungen in den Monaten zuvor. Der auf Pump finanzierte Krieg und die aufgeblähte Geldmenge forderten ihren Tribut.
Die hohe Schuldenlast und die steigenden Preise waren ein großes Problem für die junge Republik, doch das wäre zu lösen gewesen. Die Verschuldung wäre bei gutem wirtschaftlichen Wachstum im Laufe der Jahre abzutragen gewesen, erst recht bei einer starken Inflation – dadurch reduzieren sich die Staatsschulden praktisch von selbst. Und wäre Deutschland nun zu einem ausgeglichenen Haushalt zurückgekehrt, hätte auch die Inflation in absehbarer Zeit wieder nachgelassen. Doch das war eben nicht das einzige Problem, vor dem das Land nun stand. Noch weit schwerer wogen die Entschädigungen, die die Sieger des Krieges von Deutschland verlangten.
KAPITEL 3
Der Versailler Vertrag
Juni 1919
Es hatte etwas von einer Hinrichtung. Nur, dass der Verurteilte sie überlebte. Am 28. Juni 1919 um 15 Uhr nachmittags hatten sich die Vertreter der alliierten und assoziierten Staaten des Ersten Weltkriegs im Spiegelsaal von Versailles versammelt, saßen bereits auf ihren Plätzen. Monatelang hatten sie zuvor, fast bis zum Schluss ohne deutsche Beteiligung, die Einzelheiten des Friedensvertrags mit dem Deutschen Reich ausgehandelt. Nun lag er fertig da, nur die Unterschriften fehlten noch. Dann öffnete sich die Tür, die Vertreter Deutschlands wurden von sechs rangniederen Offizieren hereingeführt und an die für sie bestimmten Plätze geleitet. Sie mussten das akzeptieren, was ihnen präsentiert wurde, hatten zuvor nur durch Eingaben einige wenige kleine Verbesserungen erreichen können. Der Vorsitzende der Pariser Friedenskonferenz, der französische Ministerpräsident George Clemenceau, erhob sich und forderte die Deutschen auf, nun, nachdem sie alle Bedingungen akzeptiert hatten, dies durch ihre Unterschrift zu bekunden.
Um genau 15 Uhr und 12 Minuten unterschrieben Reichsaußenminister Hermann Müller und Verkehrsminister Johannes Bell, auf sie folgten die Vertreter der anderen Staaten. Kurz vor 16 Uhr war der Akt vollendet. Clemenceau erklärte den Frieden für beschlossen, doch er bat die Vertreter der Alliierten, auf ihren Sitzen zu verbleiben. Denn zunächst wurden die Deutschen wieder aus dem Saal geleitet und von Militärs zu ihrem Hotel gebracht.25
Die Inszenierung sollte die Deutschen bewusst demütigen. Clemenceau wollte Rache für 1871, das zeigte auch die Wahl des Ortes: Im Spiegelsaal von Versailles war 1871 nach dem Sieg über Frankreich das Deutsche Kaiserreich begründet worden. Entsprechend war die Aufnahme des Vertrags in Deutschland. Als »Versailler Diktat« wurde er von praktisch allen gesellschaftlichen Gruppen und Schichten gesehen. Der Unterschied zwischen den politischen Lagern bestand nur darin, dass die einen sich in das Unabänderliche zu fügen bereit waren, während die anderen gegen den Vertrag polemisierten, ohne eine echte Alternative aufzuzeigen.
Denn die Alliierten hatten mit einer Wiederaufnahme des Krieges gedroht, sollte Deutschland sich nicht beugen. Und selbst Paul von Hindenburg, formal immer noch Chef der Obersten Heeresleitung, hatte der Regierung signalisiert, dass die deutsche Armee in einem neuen Krieg den Alliierten kaum etwas entgegenzusetzen hätte. So schrieb Hindenburg in einem Telegramm an den Reichspräsidenten:
»Wir sind bei Wiederaufnahme der Feindseligkeiten militärisch in der Lage, im Osten die Provinz Posen zurückzuerobern und unsere Grenzen zu halten. Im Westen können wir bei ernstlichem Angriff unserer Gegner angesichts der numerischen Überlegenheit der Entente und deren Möglichkeit, uns auf beiden Flügeln zu umfassen, kaum auf Erfolg rechnen. Ein günstiger Ausgang der Gesamtoperationen ist daher sehr fraglich, aber ich muss als Soldat den ehrenvollen Untergang einem schmählichen Frieden vorziehen.«26
Ohne es gesagt zu haben, hatte Hindenburg damit indirekt zur Annahme des Ultimatums geraten, auch wenn er mit seinem letzten Satz das Gegenteil behauptete. Denn ein Soldat kann seinen Untergang vielleicht als Option in Betracht ziehen, eine verantwortungsvolle Regierung den Untergang eines ganzen Volkes wohl kaum. Aber auch im Ausland, insbesondere in Großbritannien, galt der Vertrag vielen als zu hart gegenüber Deutschland. Der bekannte Ökonom John Maynard Keynes, der als Vertreter des britischen Schatzamtes an den Verhandlungen teilgenommen hatte, trat sogar noch vor deren Ende aus Protest von seinem Amt zurück.
Konkret sah der Vertrag vor, dass Deutschlands Heer auf 100.000 Mann, die Marine auf 15.000 Mann beschränkt wurde, der Besitz schwerer Waffen und von Luftstreitkräften wurde verboten. Zudem musste Deutschland weite Gebiete abtreten: Elsass-Lothringen ging an Frankreich, fast ganz Westpreußen und die Provinz Posen fielen an das wiedererstandene Polen. Nordschleswig wurde Dänemark zugeschlagen, Eupen-Malmedy Belgien. Das Saargebiet wurde für 15 Jahre unter die Verwaltung des Völkerbundes gestellt und zollrechtlich Frankreich unterstellt. Danzig wurde vom Reich abgetrennt und zum Freistaat erklärt, das Memelgebiet kam zunächst ebenfalls unter Völkerbundverwaltung, fiel 1923 dann an Litauen. Rund 13 Prozent seiner Fläche und 10 Prozent seiner Bevölkerung verlor Deutschland dadurch, also rund 70.000 Quadratkilometer Land und 6,5 Millionen Einwohner.27 Hinzu kam der Verlust sämtlicher Kolonien.
Besonders schmerzlich war, dass die verlorenen Territorien eine entscheidende Rolle für die Schwerindustrie gespielt hatten, die wichtigste Branche der frühen Industrialisierung. 75 Prozent des deutschen Eisenerzvorkommens waren verloren, 68 Prozent des Zink- und 26 Prozent des Steinkohlevorkommens.28 Zusätzlich mussten auch noch neun Zehntel der Handelsflotte abgegeben werden.
Schließlich hatten die Alliierten schon unmittelbar nach dem Waffenstillstand die linksrheinischen deutschen Gebiete besetzt, drei rechtsrheinische Brückenköpfe mit 30 Kilometer Radius um Köln, Koblenz und Mainz sowie einen kleineren Brückenkopf um Kehl. In diesen Gebieten lebten rund 6,3 Millionen Menschen,29 mehr als 10 Prozent der Einwohner des Deutschen Reiches in seinen Grenzen nach dem Versailler Vertrag.
Diesem zufolge sollte diese Besatzung bis 1935 dauern, die Verwaltung dieser alliierten Besatzungszonen, die Interalliierte Rheinlandkommission, saß ab 1920 in Koblenz. Die Alliierten hatten jedoch jeweils eigene Besatzungszonen, und vor allem die französischen Besatzer übten ihre Macht ziemlich brutal aus, stellten beispielsweise die Chemiewerke Höchst bei Frankfurt unter Zwangsverwaltung. Teile der Produktion mussten als Reparationen abgeliefert werden.30 Andere Firmen konnten Teile der Produktion oder zumindest wichtige Unterlagen noch rechtzeitig in die unbesetzten Gebiete verlagern. Dennoch lastete auch diese Besatzung auf der Wirtschaftskraft des Landes.
Aber immerhin: Noch gab es mit dem Ruhrgebiet ein wichtiges schwerindustrielles Zentrum, außerdem ging die wirtschaftliche Entwicklung zu Beginn der 1920er-Jahre in eine neue Phase über. Technologische Neuerungen spielten eine zunehmend wichtigere Rolle, und diese waren nicht an Kohle und Eisenerz gebunden.
Weit schwerer als die territorialen Bestimmungen wog daher letzten Endes Artikel 231 des Versailler Vertrags. Dieser lautete:
»Die alliierten und assoziierten Regierungen erklären, und Deutschland erkennt an, daß Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste und Schäden verantwortlich sind, die die alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des Krieges, der ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungen wurde, erlitten haben.«31
Damit musste Deutschland die Alleinschuld an dem Krieg anerkennen. Heute sind sich Historiker weitgehend einig, dass die Dinge komplexer waren, dass das Kaiserreich sicher eine wesentliche, aber eben nicht die alleinige Schuld an dem Krieg trifft. Und wahrscheinlich war das auch damals schon den Staatenlenkern, die den Vertrag aufgesetzt hatten, klar. Doch der Satz hatte nicht nur eine moralische Bedeutung, sondern auch eine juristische: Damit konnten Reparationsforderungen an Deutschland begründet werden. Diese sollten in den kommenden Monaten das alles beherrschende Thema der deutschen Politik – und zu einem der Haupttreiber der Inflation – werden.
Reparationsforderungen an sich waren nichts Ungewöhnliches – auch Deutschland hatte 1871 nach seinem Sieg Frankreich Zahlungen auferlegt, und auch in Deutschland hatte man ja während des Krieges lange Zeit darauf gesetzt, die eigenen Kriegskosten eines Tages durch Reparationen auf den Feind abwälzen zu können. Doch was auf den Versailler Vertrag folgte, erreichte ganz neue Dimensionen. Der Vertrag selbst hatte noch gar nicht festgelegt, wie hoch die Reparationen insgesamt ausfallen sollten. Nur eine Abschlagzahlung war vorgesehen: 20 Milliarden Goldmark für die Jahre 1919, 1920 und die ersten vier Monate von 1921, zu zahlen in Form von Devisen und Sachleistungen.
Mit »Goldmark« war der Wert der Mark im Jahr 1913 gemeint. Denn zu diesem Zeitpunkt war sie noch an Gold gebunden, eine Mark hatte damals genau 0,358423 Gramm Gold entsprochen. Die Rechengröße Goldmark wurde daher in den folgenden Jahren stets genutzt, um einen klaren Vergleichswert zu haben. Im Gegensatz dazu steht der Begriff »Papiermark«, der sich in jenen Jahren für die Mark ohne Goldbindung einbürgerte – sie war schließlich nur noch das Papier wert, auf dem sie gedruckt war.
Die 20 Milliarden Goldmark entsprachen folglich 7.168 Tonnen Gold – schon das war das Fünffache dessen, was Frankreich 1871 nach dem deutsch-französischen Krieg an Deutschland gezahlt hatte. Und das war nun nur eine Abschlagszahlung. Die endgültige Summe sollte auf jeden Fall weit höher ausfallen und am 1. Mai 1921 durch eine sogenannte Wiedergutmachungskommission der Alliierten festgelegt werden.
Bis dahin war nicht mehr viel Zeit. Es galt daher, das Land auf das vorzubereiten, was da noch kommen sollte. Und einer machte sich daran: Matthias Erzberger.
KAPITEL 4
Die Erzberger’sche Steuerreform
1919/1920
Buttenhausen ist ein kleines verschlafenes Dörfchen auf der Schwäbischen Alb, das heute zur Stadt Münsingen gehört. 1875 kam dort Matthias Erzberger als Sohn eines Schneiders zur Welt. Er hatte keinen leichten Start, doch er war ein kluger Kopf, wurde zunächst Lehrer, dann Redakteur bei einer katholischen Zeitung. Schließlich ging er in die Politik, saß ab 1903 für die katholische Zentrumspartei im Reichstag.
Erzberger war sicher eines der größten politischen Talente seiner Partei. Er war zwar ein Konservativer, aber er nahm sich auch der Nöte der Arbeiter an. Ebenfalls machte er von sich reden, als er die Kolonialverbrechen des Kaiserreiches anprangerte und die unmenschlichen Bedingungen in den deutschen Kolonien kritisierte.
Während des Krieges war er nach anfänglicher Kriegsbegeisterung etwa ab Mitte 1916 für einen Verständigungsfrieden eingetreten. Kurz vor Kriegsende, im Oktober 1918, wurde er in die Regierung berufen, und auf ausdrücklichen Wunsch von Paul von Hindenburg, der die Oberste Heeresleitung führte, unterzeichnete er am 11. November 1918 den Waffenstillstand von Compiègne. Das machte ihn fortan zum Zielobjekt völkischer und nationalistischer Gruppierungen, die ihn als Volksverräter brandmarkten, wegen dieser Unterschrift – obwohl er im Auftrag der Obersten Heeresleistung gehandelt hatte. Dennoch sollte Erzberger das knapp drei Jahre später das Leben kosten.
Doch nun, am 21. Juni 1919, war Erzberger zum Finanzminister ernannt worden. Als er seinen Dienst antrat, tat er das in dem Bewusstsein, dass der Frieden für Deutschland teuer werden würde. Da waren zum einen die 1,5 Millionen Kriegsbeschädigten und die etwa 1,7 Millionen Kriegshinterbliebenen – zusammen rund 5 Prozent der Bevölkerung –, die dauerhaft vom Staat versorgt werden mussten.32 Finanziell gewichtiger waren jedoch die drohenden Reparationszahlungen. Eine Woche nach seiner Ernennung zum Finanzminister wurde der Versailler Vertrag unterzeichnet, und damit war klar, dass Deutschland schon bald gehörige Summen abverlangt würden.
Erzberger machte sich daher sofort an die Arbeit. Innerhalb weniger Monate setzte er die umfangreichste Reform der deutschen Steuer- und Finanzgeschichte um. Es begann damit, dass er zunächst einmal reinen Tisch machte. Er sprach aus, was bis dahin viele nicht wahrhaben wollten: »Der Krieg ist der Verwüster der Finanzen«, stellte er in seiner ersten Rede als Reichsfinanzminister vor der Weimarer Nationalversammlung am 8. Juli 1919 fest.
Das war der Auftakt für nicht weniger als 16 grundlegende Finanz- und Steuergesetze, die er in den folgenden zwölf Monaten durchs Parlament brachte. Er krempelte die deutsche Finanzverwaltung komplett um, machte sie schlagkräftig und modern und stellte die staatlichen Finanzen auf ein solides Fundament.33 Dazu gehörte die Zusammenfassung der Steuerverwaltungen der 25 Bundesstaaten in einer einheitlichen Reichsfinanzverwaltung. Den Ländern wurde ihre Steuerhoheit genommen, jene Matrikularbeiträge, über die sich das Reich bis dahin finanziert hatte, wurden abgeschafft. Stattdessen führte Erzberger neue, reichseinheitliche Steuern ein, die es bis heute gibt: Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer, Grunderwerbssteuer. Auch der direkte Abzug der Steuern vom Lohn, wie er bis heute praktiziert wird, wurde mit seinen Reformen eingeführt, und erstmals wurden nun Steuerbeamte in die Unternehmen zur Außenprüfung der Bücher geschickt.
Erzberger erhöhte die Erbschaftssteuer, ebenso Verbrauchssteuern und die Einkommensteuer. Bei dieser stieg der Spitzensatz bis auf 60 Prozent, der von den höchsten Einkommen zu bezahlen war – nach 4 Prozent, die zuvor in Preußen gegolten hatten.
Am umstrittensten war jedoch das sogenannte Reichsnotopfer, das am 31. Dezember 1919 vom Reichstag beschlossen wurde. Alle Bürger mit einem Vermögen von mehr als 5.000 Mark sollten einen Teil davon an den Staat abführen. Berücksichtigt wurden Immobilien, Maschinen, Wertpapiere, Bargeld und Bankguthaben. Der Steuersatz begann bei 10 Prozent und stieg dann progressiv an – je mehr jemand besaß, umso größer war der Anteil, den er abführen musste. Für Vermögen über 2 Millionen Mark waren es unglaubliche 65 Prozent. Allerdings wurden die Zahlungen über viele Jahre gestreckt, und im Nachhinein war es für die Betroffenen eine glückliche Fügung, dass das Gesetz aufgrund der Inflation letztlich ins Leere lief – am Ende entsprachen die zu zahlenden Beträge nur noch den sprichwörtlichen Peanuts.
Abb. 4: Preisentwicklung für Roggenbrot in Berlin von Juli 1914 bis Mai 1921, in Mark pro Kilo
Quelle: Statistisches Reichsamt
Doch selbst ohne das Notopfer hatte Erzberger viel erreicht. Er hatte den Staat auf ein gesundes finanzielles Fundament gestellt. Das Steueraufkommen verdoppelte sich bis 1925 nahezu. Und gleichzeitig schien sich die Lage an der Preisfront in den ersten Monaten nach seinen Reformen zu stabilisieren.
So hatte sich im Winter 1919/1920 der Preis für ein Kilo Roggenbrot zwar weiter drastisch erhöht, war von 58 Pfennigen im Oktober 1919 bis auf 2,37 Mark im Mai 1920 gestiegen. Doch auf diesem Niveau blieb er dann mehr als ein Jahr. Auch der Außenwert der Mark war zwar von Juni 1919 bis März 1920 weiter abgestürzt, von 14 Mark auf über 100 Mark je Dollar. Doch danach erholte sich der Kurs wieder deutlich, pendelte sich bei 40 bis 60 Dollar ein.
Die Zeichen standen auf Entspannung. Und es folgte das Jahr 1921, in dem alles gut zu werden schien.
Daten und Ereignisse 1914 bis 1921
28. Juli 1914: Mit der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien beginnt der Erste Weltkrieg.
1. August 1914: Deutschland erklärt Russland den Krieg.
3. August 1914: Deutschland erklärt Frankreich den Krieg.
4. August 1914: Der Reichstag beschließt die Währungsgesetze.
September 1914: Das Deutsche Reich begibt die erste Kriegsanleihe.
9. November 1918: Philipp Scheidemann ruft die Republik aus.
11. November 1918: Matthias Erzberger unterzeichnet als Vertreter der Reichsregierung den Waffenstillstand von Compiègne; Kaiser Wilhelm II. geht ins Exil in die Niederlande.
November 1918: Das Stinnes-Legien-Abkommen zur Regelung der Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften wird geschlossen.
19. Januar 1919: Deutschland wählt die Verfassungsgebende Nationalversammlung.
21. Juni: Matthias Erzberger wird zum Finanzminister ernannt.
28. Juni 1919: Mit der Unterzeichnung des Versailler Vertrags endet formal der Erste Weltkrieg.
31. Juli 1919: Die Verfassungsgebende Nationalversammlung beschließt die neue Verfassung.
31. Dezember 1919: Der Reichstag beschließt das Reichsnotopfer.
5. Februar 1920: Der Dollarkurs überschreitet erstmals die Marke von 100 Mark.
12. März 1920: Finanzminister Matthias Erzberger tritt zurück.
21./22. Juni 1920: Die Alliierten diskutieren in Boulogne-sur-Mer über die Höhe der deutschen Reparationen.
25. Juni 1920: Die Regierung Fehrenbach aus Zentrum, DDP und DVP tritt ihr Amt an.
KAPITEL 5
Der kurze Aufschwung
1920/1921
»Der Schatten schwatzt«, überschrieb Victor Auburtin in der Berliner Tageszeitung seinen Bericht über einen Kinobesuch, der ihn offenbar zutiefst beeindruckte:
»Auf der Leinwand erscheint ein schönes Weib, groß, in Brustformat, und fängt an, mit den Lippen Übungen zu vollführen. Gleichzeitig ertönt aus dem Nebenzimmer die Stimme von jemandem, der durch die Nase spricht und einen Kloß im Hals hat. Nach einer Weile beginnt das Publikum zu merken, dass die Dame mit der Gymnastik und die Stimme mit dem Kloß ein und dieselbe Person ist. Die Dame selber spricht; und nun achten wir scharf darauf, ob die Bewegungen und die Stimme genau zueinander passen. Sie passen genau zueinander.«34
Auburtin erlebte eine der ersten Tonfilmpräsentationen. Ermöglicht hatten dies deutsche Techniker und Ingenieure, die ein Verfahren entwickelt hatten, um das gesprochene Wort synchron zum Bild zu präsentieren – heute eine Selbstverständlichkeit, damals eine Revolution, erstmals aufgeführt 1922.
Die ersten Monate nach dem Krieg waren in Deutschland von Unruhen und gewaltsamen Auseinandersetzungen geprägt gewesen, von rapide steigenden Preisen und Armut. Doch bald schon legte sich dies, und im Laufe des Jahres 1919 begann eine Trendwende. Es folgte eine Zeit des technologischen Fortschritts und des wirtschaftlichen Aufschwungs. Im Jahr 1920 wuchs die Wirtschaft um 12 bis 16 Prozent, wie Wirtschaftshistoriker schätzen. Genaue Zahlen gibt es aus jener Zeit leider nicht, sie wurden vom Statistischen Reichsamt nicht ermittelt. Auch 1921 und 1922 legte die Wirtschaftsleistung noch einmal um 6 bis 8 beziehungsweise um 6 bis 7 Prozent zu.35
Das hatte natürlich damit zu tun, dass die Wirtschaft in den Jahren bis 1919 dramatisch eingebrochen war. Die Produktion der Industrie war bei Kriegsende auf das Niveau von 1888 zurückgeworfen, die gesamte deutsche Wirtschaftsleistung lag 1919 um 30 bis 40 Prozent unter dem Niveau von 1913.36 Diese Zahlen sind bereits gebietsbereinigt, der Beitrag der verlorenen Territorien wurde also herausgerechnet. Das Volkseinkommen war während des Krieges somit um etwa ein Drittel zurückgegangen. Allein die Normalisierung des Lebens nach dem Krieg sorgte daher für einen gewissen Aufschwung.
Doch das war es nicht allein. Hinzu kam, dass in den Betrieben die alte Feindschaft zwischen Unternehmern und Arbeitern einer neuen, stärker auf Konsens ausgerichteten Atmosphäre wich. Die Sozialdemokraten hatten nach dem Sturz der Monarchie auf Verstaatlichungen verzichtet, im Gegenzug akzeptierten die Unternehmen die Gewerkschaften als Partner. Das schuf einen gewissen Ausgleich, aus Gegnern wurden allmählich Sozialpartner. Dieser innerbetriebliche Frieden setzte neuen Elan frei, ließ Raum für frische Ideen.
So verwundert es nicht, dass die Zahl der Patenterteilungen ab 1920 beständig deutlich über dem Niveau von vor dem Krieg lag.37 Deutsche Ingenieure glänzten mit neuen Erfindungen. Sie brachten den ersten Tonfilm ins Kino, in Berlin wurde 1921 die AVUS eingeweiht, auf der die deutsche Automobilindustrie in den kommenden Jahren ihre technologischen Leistungen unter Beweis stellen konnte. Diverse neue Firmen wurden gegründet, beispielsweise die Flugzeugbauer Junkers und Dornier oder der Glühbirnenhersteller Osram.
Die Steuerreformen Erzbergers beförderten die Aufbruchsstimmung zusätzlich, und auch die Einführung des Acht-Stunden-Tages wirkte positiv, denn gerade in arbeitsintensiven Branchen brauchten die Fabriken nun mehr Arbeitskräfte. Die Arbeitslosigkeit in der Industriearbeiterschaft sank so bis 1922 auf eine Quote von gerade mal 1,5 Prozent.38
Vor allem aber profitierte die deutsche Wirtschaft davon, dass in Deutschland Notenbank und Regierung den inflationären Tendenzen keinen Einhalt geboten – im Gegensatz zu den ehemaligen Kriegsgegnern. Die US-Notenbank hatte 1919 eine Hochzinspolitik eingeleitet, um der Teuerung Herr zu werden. Das war zwar erfolgreich, doch sie löste damit gleichzeitig eine schwere Rezession aus. Ganz ähnlich war es in Großbritannien. Die Arbeitslosenquote unter den Industriearbeitern war als Folge davon bis 1921 in den USA auf 16,9 Prozent gestiegen, in Großbritannien auf 17 Prozent.39 Deutschland schien für viele da der bessere Ort, auch und gerade für internationale Investoren. Sie kauften nun plötzlich Mark an den Devisenbörsen und trieben so den Kurs wieder in die Höhe. Nach dem Tief bei über 100 Mark je Dollar im März 1920 kletterte er bis auf 35 Mark je Dollar im Mai, gab dann wieder etwas nach, hielt sich aber etwa ein Jahr konstant bei 40 bis 60 Mark.
Abb. 5: Kurs des Dollars in Mark von Ende 1918 bis Mitte 1921
Quelle: Statistisches Reichsamt
Einer derjenigen, die schon ab 1919 in Mark investiert hatten, war der britische Ökonom John M. Keynes, der Zeit seines Lebens eigentlich ein gutes Händchen hatte, wenn es um seine privaten Finanzen ging. 1921 schrieb er über jene Zeit:
»Jeder in Europa und Amerika kaufte Markscheine. Sie wurden von jüdischen Wanderhändlern in den Straßen der Hauptstädte gehandelt und von Friseurgehilfen in den entlegensten Städten in Spanien und Südamerika feilgeboten (…) Das Argument war dasselbe (…) Deutschland sei ein großes und starkes Land; eines Tages werde es sich erholen; wenn das geschieht, werde sich auch die Mark erholen, was einen riesigen Gewinn einbringen werde.«40
Sie sollten sich irren, und auch Keynes sollte am Ende 20.000 Pfund mit seiner Investition verlieren, was heute einem Wert von rund einer halben Million Pfund entspricht.41
Anfang 1921 jedoch war das für die meisten noch nicht abzusehen. Die Preise in Deutschland stiegen zwar weiter, aber das schien für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt eher von Vorteil zu sein. Und gleichzeitig ließ die Inflation die Schulden, die der Staat während des Krieges bei der Notenbank und über die Kriegsanleihen bei den Bürgern gemacht hatte, wie von Zauberhand verschwinden. Aber auch private Schuldner profitierten, vor allem Unternehmer, die die Expansion ihrer Firmen im Nachkriegsboom mit Krediten finanzierten – sie konnten sich schnell und einfach entschulden.
Diese Erfahrung jedoch hatte fatale Folgen. Denn vor allem führende Vertreter der Wirtschaft warnten nun davor, es den USA und Großbritannien gleichzutun und auf Antiinflationskurs zu gehen. Sie fürchteten, dass dann auch die deutsche Konjunktur abgewürgt würde. So sagte der AEG-Chef Walther Rathenau bei einer Besprechung im Auswärtigen Amt im Januar 1921, er fürchte die Inflation nicht. Vielmehr solle man, wenn die Krise, die in Großbritannien schon ausgebrochen sei, nach Deutschland überschwappe, »die Notenpresse noch etwas mehr arbeiten lassen und im Lande zu bauen anfangen, damit wir durch diese Beschäftigung der Krise einen Damm entgegensetzen können«.42
Es war also eine ganz bewusste Entscheidung der deutschen Regierung, die Inflation nicht zu zügeln, um einen Abschwung zu verhindern. Denn dadurch schuf sie jene deutsche Sonderkonjunktur, während der Rest der Industrieländer in der Rezession steckte.
Doch dieser kurze Frühling sollte bald wieder vorbei sein. Denn eine wesentliche Triebkraft des wirtschaftlichen Aufschwungs waren die Exporte, und diese wurden vor allem von der schwachen Mark getrieben. Vor dem Krieg war der Wechselkurs zum Dollar bei 4,20 Mark festgezurrt, jetzt lag er zwischen 40 und 60 Mark, die Mark war also nur noch höchstens etwa ein Zehntel wert. Die Löhne hatten sich jedoch nicht verzehnfacht, weshalb deutsche Exporteure ihre Produkte im Ausland in den jeweiligen Währungen nun deutlich günstiger anbieten konnten.
Entsprechend wuchs Deutschlands Exportvolumen zwischen 1920 und 1922 um zwei Drittel von rund 3,7 auf knapp 6,2 Milliarden, und zwar nicht in inflationiertem Papiergeld gerechnet, sondern im Wert der Mark von 1913, also in Goldmark. Überdurchschnittlich stark legten in diesen Jahren die Ausfuhren nach Großbritannien und in die USA zu. Der Anteil der Lieferungen auf die Britischen Inseln am gesamten Export stieg von 1920 bis 1922 von 6,4 auf 7,7 Prozent, in die USA etwas schwächer von 7,2 auf 7,6 Prozent.43