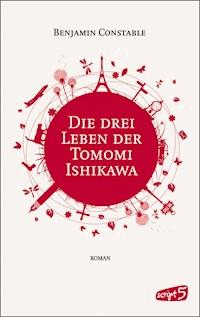
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Tomomi Ishikawa ist tot. Sie hat sich umgebracht, so steht es in dem Abschiedsbrief an ihren Freund Ben Constable. Doch Tomomi weigert sich hartnäckig, in Frieden zu ruhen. Stattdessen hinterlässt sie Ben eine Menge rätselhafte Botschaften, die ihn, ähnlich wie bei einer Schnitzeljagd, durch Paris, New York und Tomomis Vergangenheit führen. Bald weiß Ben nicht mehr, was Fiktion und was Realität ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EINE EINFÜHRUNG IN DAS ALLES
»Ich würde gern ein Buch schreiben, in dem du und ich die Hauptfiguren sind«, sagte ich zu Tomomi Ishikawa und schob gedankenverloren die Sachen auf dem Tisch zurecht.
»Oh toll«, erwiderte sie und fing an zu husten. »Ich könnte schwindsüchtig sein. Und wir könnten nach Italien ziehen und du würdest deine Abende Absinth trinkend mit Frauen zweifelhaften Rufs verbringen und schrecklich kitschige Liebesgedichte schreiben, die du mir an meinem Totenbett vorlesen würdest, und ich würde sagen, dass die Anmut deiner Verse mich dahinrafft.«
Ich hörte auf zu lachen. »So hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt.«
»Nein?« Sie klang überrascht. »Wieso, woran hattest du denn gedacht?«
»An eine Geschichte über zwei Leute, die sich hin und wieder zum Plaudern treffen.«
»Ah, okay, gut«, sagte Tomomi Ishikawa. »Und was ist der Witz bei der Sache?«
»Es gibt keinen Witz. Es gibt keine Romantik, keine Abenteuer, keine …«
»Warte mal, warte mal, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das wäre ja total langweilig. In so einem Buch muss auf jeden Fall ein bisschen Niedertracht vorkommen oder zumindest ein gestohlenes Gemälde oder ein sprechender Hund (oder Affe).«
»Ach so.« Ich hatte erwartet, dass sie von meiner Idee begeistert wäre. »Na ja, vielleicht könnte man ja irgendein Rätsel einbauen. Eine Mordserie, die wir lösen müssen, oder so was.«
»Vielleicht«, sagte Tomomi Ishikawa, »aber wer sollte denn der Täter sein?«
»Du!« Ich grinste.
»Ich? Verbindlichsten Dank, Ben Constable. Dann lege ich mir aber auch einen echten Gangsterbrautnamen zu, Mimsie oder so, und das Buch könnte dann Mimsie, die Mörder-Mieze heißen!«
»Was? Autsch!« Jetzt lachte ich. »Nein. Ich werde Ben Constable heißen und du Tomomi Ishikawa.«
»Aber das sind doch unsere echten Namen.«
»Darum geht’s ja.«
»Oh, ach so. Aber du könntest mich einfach weiter Butterfly nennen, das klingt nicht so förmlich.«
»Ein Spitzname wäre okay«, versicherte ich ihr. »Und der verworrene Plot würde den Leser in die Straßen von Paris entführen und dann nach New York.«
Sie beugte sich über den Tisch. »Und möglicherweise endet Ben Constable als das letzte Mordopfer?«
Ich lehnte mich ihr entgegen. »Das hättest du wohl gern.«
»Willst du dir denn gar nicht helfen lassen?«
»Na ja …«
»Meinst du …«, wir hielten beide inne, um den anderen weiterreden zu lassen, doch schließlich ergriff Tomomi Ishikawa das Wort. »Meinst du, du könntest mir vielleicht den Galgen ersparen? Das ist immer so ein jämmerliches Ende nach einem ruhmreichen Verbrecherleben.«
»Ein Galgen kommt überhaupt nicht vor«, entgegnete ich. »Vielleicht auch noch nicht mal ein Mord. Ich glaube, du hast ein ganz anderes Buch im Kopf als ich, Tomomi Ishikawa. Ich will über eine ungewöhnliche Freundschaft schreiben und das Buch nicht mit irgendwelchen abgehobenen Ideen und hanebüchenen Wendungen verderben.«
»Aber du hast doch gesagt …«
»Es geht um so etwas wie unser Gespräch jetzt gerade.«
»Also machen sie nichts als plaudern und trinken und lachen bis spät in die Nacht.«
»Genau«, sagte ich. »Unsere Realität ist genauso packend wie jeder Roman.«
»Natürlich ist sie das.« Sie lächelte. »Aber könnte die fiktionale Tomomi Ishikawa auf dem Heimweg nicht wenigstens ein oder zwei Frauen aus der Bar verfolgen«, sie warf einen kurzen Blick zu den Leuten am Nebentisch und senkte dann die Stimme, »sie nacheinander ermorden und die nackten Leichen mit ihren herausgerissenen Eingeweiden dekorieren?«
»Vielleicht solltest du lieber dein eigenes Buch schreiben.«
Sie dachte einen Moment darüber nach. »Ja. Vielleicht sollte ich das.«
TEIL 1
15.MÄRZ BIS 17.AUGUST 2007
1
EIN UNERWARTETER BRIEF VON BUTTERFLY, DER ALLES VERÄNDERTE
Paris, 15.März 2007
Lieber Ben Constable,
wahrscheinlich wunderst du dich, warum ich dir einen Brief schreibe und keine SMS oder E-Mail; warum ich nicht einfach fröhlich bei dir durchgeklingelt oder darauf gewartet habe, dass wir mal wieder an einem Tisch in der Ecke irgendeines trubeligen Cafés sitzen, seitwärts auf unseren Stühlen, um einander nicht unseren Rauch ins Gesicht zu pusten, unsere Mäntel, schwach nach Regen duftend, auf dem Garderobenständer an der Tür, bis wir uns schließlich, während die Tropfen wässrige Schlieren auf die Fensterscheiben zeichnen, doch einander zuwenden, vielleicht weil unsere Unterhaltung intensiver geworden ist und wir, vorsichtig, um nicht die Kaffeetassen umzustoßen – oder, besser noch, die Weingläser –, die Ellbogen auf den Tisch stützen. Und warum, fragst du dich vielleicht, ist der Brief getippt und nicht handgeschrieben (was persönlicher wäre), in kunstvoll geschwungener Schönschrift?
Ich bin sicher, dir ist zumindest kurz durch den Kopf gegangen, dass die Mühe, die es erfordert, einen Brief zu schreiben und ihn auf den Weg zu schicken, auf einen bedeutenswerteren Anlass hinweist als lediglich auf den Versuch, mir in einer schlaflosen Nacht die Zeit zu vertreiben, auf einen dringlicheren Inhalt als den Wunsch, dir mit einem Beweis dafür zu schmeicheln, dass ich gerade an dich gedacht habe.
Doch unterschätzt du dabei nicht das Gefühl echten Papiers unter den Fingern, Ben Constable? Kann es nicht sein, dass ich diese Zeilen rein um des sinnesübergreifenden Erlebnisses willen verfasse, um mich den Wonnen geschriebener Worte hinzugeben oder schlicht um der tausendjährigen, nein, Tausende von Jahren alten Tradition des Briefeschreibens willen?
Aber natürlich hast du recht; es gibt eine andere Erklärung, obwohl ich sie dir nur widerstrebend liefere, denn ich weiß, dass sie dir nicht gefallen wird. Ach, hätte ich doch etwas Fröhlicheres zu verkünden, könnte ich dich mit hübschen Metaphern überhäufen und in Staunen versetzen. Doch ich fürchte, solch eine Art von Brief ist dies nicht, und ich verstricke mich schon jetzt in meinen eigenen Worten, sobald ich auch nur versuche, sie zu verwässern oder mit Honig zu überziehen. Ich wünschte, ich könnte dir ein Lächeln entlocken, trotz dessen, was ich dir zu sagen habe.
Nachdem nun die schlimmsten Vorahnungen geweckt sein müssen, sollte ich nicht länger vor dem Wesentlichen zurückscheuen. Dieses aber sitzt irgendwo zwischen dem Kloß in meinem Hals und meinen zitternden Fingern fest. Wenn ich es nur lange genug ignorieren könnte, würde es sich vielleicht einfach auflösen oder wie ein böser Traum in die Erinnerung herabsinken. Doch leider wird es so schnell wohl nicht verblassen.
Ach, wie schlimm kann es denn schon werden? Wir sind kein Paar, also kann ich mich nicht von dir trennen wollen. Ich bin nicht deine Vorgesetzte, also kannst du nicht gefeuert werden. Du hast nichts falsch gemacht, du hast mich nie verletzt, ich bin nicht wütend auf dich, ich liebe dich (was übrigens auch nicht der wesentliche Punkt ist. Ich bin nicht im Begriff, mich dir in einem Ausbruch entwürdigender Theatralik zu Füßen zu werfen und dich anzuflehen, dass wir unsere jämmerliche Existenz in stumpfsinniger Eintracht fristen, um in den Armen des anderen alt und gebrechlich zu werden).
Und sosehr ich den Grund meines Schreibens auch mit sinnlosem Geschwafel zu verschleiern suche, desto deutlicher wird doch, dass dies alles nur ein Behelf ist, um das Unvermeidliche aufzuschieben. Wie du weißt, bereitet es mir seit jeher ein geradezu schamloses Vergnügen, wesentliche Punkte jeglicher Art zu umschiffen. Der Punkt ist oft ein Leckerbissen, den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss, die Vorfreude darauf eine süße Qual, während er sich mit aufreizender Langsamkeit seinen Weg an die Oberfläche bahnt, jede Verzögerung die Ungeduld nur noch schürt und das Glücksgefühl in immer größere Höhen treibt.
Dennoch, was ich zu sagen habe, ist wichtig und birgt leider wenig Grund zur Freude. (Am Rande bemerkt: Diese Art, niemals auf den Punkt zu kommen, spiegelt auf gewisse Weise unsere Freundschaft wider. Keinem von uns beiden ist der ewige Strom von Gesprächen fremd, der sich durch Auen schlängelt, auf ebenem Gelände träge vor sich hin plätschert, über Felsen hüpft, in tiefen Becken zur Ruhe kommt oder sich zu schäumenden Wirbeln und den unwahrscheinlichsten Stromschnellen formt, und das alles, weil das eigentliche Vergnügen in der Reise selbst liegt und die Mündung ins Meer ihr Ende signalisiert. Möglicherweise haben wir uns der Illusion hingegeben, dass unsere Zeit nie zur Neige gehen, dieser Fluss nie versiegen, die Langeweile uns nie heimsuchen würde, so als könnte die Randbemerkung endlos weiterlaufen, als müsste die Klammer nie geschlossen, der Eröffnungssatz nie zu Ende geführt werden, auf dass der wesentliche Punkt in einem anderen, nicht näher definierten Moment in der Ewigkeit zu klären bleibe und selbst dieser Satz mit einer Ellipse ende … Ich habe sogar das Gefühl, wir hätten es schaffen können, wenn uns nicht diese eine, alles überschattende Tatsache im Weg stünde, die jede Hoffnung zunichtemacht. Es ist eine offensichtliche Tatsache, die dir absolut bewusst ist, Ben Constable. Und diese Tatsache ist, dass der Tod unserem Gespräch ein Ende setzen wird, lange bevor die Ewigkeit auch nur in erreichbare Nähe rückt.)
Und dies bringt mich zu meinem leidigen Punkt zurück. Ach, wenn ich doch schon viel früher damit herausgerückt wäre – einmal habe ich es sogar versucht, als ich dich noch nicht so gut kannte, damals erschien es mir leichter. Erinnerst du dich, Ben Constable, wie du einmal mit Freunden in einer Bar ein paar Straßen weiter gewesen bist und ich dich angerufen habe, nur um Hallo zu sagen (mir ging es gerade nicht besonders)? Du hast mich überredet zu kommen und ich wollte dir nicht die Stimmung vermiesen, ich wollte schnell wieder gehen, aber du hast dich die meiste Zeit nur mit mir unterhalten, bis deine Freunde irgendwann zu einer Party weiterzogen und wir allein sitzen blieben und Wein tranken, bis die Bar zumachte. Danach sind wir durch Ménilmontant spaziert und ich habe dir die kleine Kopfsteinpflasterstraße am oberen Ende gezeigt, das versteckte Plätzchen, an dem wir dann saßen und ein paar Zigaretten rauchten, aber bis dahin war der Punkt schon wieder ein Stück in die Ferne gerückt. Ich fand es schön, einfach dort mit dir zu sitzen und zu lachen, leise, um die Anwohner nicht zu stören, und ich war kein bisschen mehr traurig und irgendwann war der Punkt vollkommen außer Reichweite. Vielleicht markiert dieser Abend den Anfang all unserer Gespräche, dieses einzigen wortüberladenen, endlosen Satzes (des lockeren, fröhlichen Abschweifens, der stetigen Flucht vor dem Punkt). Ich bin gerade ziemlich stolz; wie es aussieht, habe ich einen weiteren Absatz zustande gebracht, ohne dir zu verraten, warum ich dir eigentlich schreibe.
Aber dies hier ist kein Spiel, denn dieses eine Mal ist der Punkt nicht das Ende. Er ist der Anfang von etwas Neuem, etwas Großem, der Auftakt zu einem Abenteuer, Ben Constable. Tja, jetzt ist es wohl so weit (ich suche krampfhaft nach einer weiteren drängenden Ablenkung, mit der ich den Moment hinauszögern kann, aber es gibt keine mehr): Der Punkt ist, dass ich sterben werde.
Natürlich ereilt uns alle irgendwann der Tod, aber bei mir wird es schneller gehen. Ich habe nicht vor, die Angelegenheit in die Länge zu ziehen und mich verzweifelt an das schwindende Licht meiner letzten Tage zu klammern; ich werde mich umbringen. Tut mir leid. Ich kann mir vorstellen, wie wenig vergnüglich das alles für dich ist. Aber ich wollte mich von dir verabschieden.
Und außerdem wollte ich dir von meinem Plan erzählen: Du sollst etwas erben – oder vielmehr eine ganze Menge –, etwas, woran ich schon vor Jahren angefangen habe zu arbeiten, lange bevor ich dich überhaupt kannte – seit meiner Kindheit, um genau zu sein. Was es ist, kann ich dir noch nicht verraten, das würde alles verderben. Es ist eine Überraschung.
Wenn dich dieser Brief erreicht, werde ich schon ein paar Stunden tot sein. Während ich das hier schreibe, Ben Constable, bin ich traurig, weil du mir jetzt schon fehlst. Es ist ein Jammer, dass nun alles enden muss. Aber ich wünsche mir nun mal ein selbstbestimmtes, würdiges Ende. Ich glaube, du verstehst das, weil du weißt, dass ein Ende nicht immer ein Abschluss sein muss und das alles bloß eine Frage der Definition ist, ein Punkt, an dem sich die Handlung ändert, das Thema oder das Tempo.
Hey, kann ich dir was erzählen? Nur ein bisschen Blödsinn, nichts Aufregendes. Aber selbst in diesem Moment gehen mir alle möglichen Dinge durch den Kopf, die mir etwas bedeuten, Dinge, die ich als so etwas wie Schätze betrachte. Die würde ich dir gern zeigen. Es würde mich so freuen, wenn du davon wüsstest.
Der erste Schatz ist der Blick, der sich mir bietet, während ich dies schreibe. Ich liebe die gezackten Umrisse der Bäume bei Nacht und ebenso die sonnigen Tage, an denen ich durch die kahlen Äste dabei zusehen kann, wie sich auf dem Platz die Leute um den verschnörkelten Trinkwasserbrunnen versammeln oder draußen vor dem Salon de thé sitzen und rauchen. Ich liebe die große Freitreppe vor der Kirche, die sich über dem Viertel erhebt wie ein Wachposten. Ich liebe den ganzen Krimskrams, der sich in meiner Wohnung angesammelt hat, jedes Stück davon mit einer kleinen Geschichte verbunden, die zusammen mit mir sterben wird, und die kaputte Uhr an der Wand, die mir kostbare Sekunden spart. Ihre Zeiger stehen auf zwanzig nach drei und räumen mir voller Optimismus Zeit ein, um eine letzte Sache zu erledigen. Diese Uhr werde ich vermissen und ich stelle mir gern vor, dass sie auch mich vermissen wird.
Und während ich diese Worte tippe, wird mir bewusst, wie sehr ich das Schreiben liebe. Natürlich hätte ich meinen Brief auch per Hand verfassen können, damit du mein unleserliches Gekritzel bewundern kannst, außerdem hat das Kratzen einer Feder, die Tinte auf dem Papier verteilt, wirklich eine persönlichere Note, doch während ich vor meinem Computer sitze und die Wörter in stetem Silbenfluss aus mir herausströmen, habe ich das Gefühl, mich im Klicken jedes einzelnen Buchstabens wiederzufinden, und in solchen Momenten bin ich ganz bei mir.
Vor dem Fenster fällt ein feiner Sprühregen, der die Straßenlaternen mit goldenen Lichthöfen versieht, und ich wünschte, ich wäre draußen und das Wasser durchnässte mein Haar und liefe mir langsam bis zur Nasenspitze, wo ich versuchen würde, den Tropfen wegzupusten oder mir mit dem Ärmel über das Gesicht zu wischen, was einer Dame natürlich nicht unbedingt geziemt, aber ich habe schließlich auch nie behauptet (na gut, bis auf ein Mal), eine zu sein. Paris und der Regen haben ebenfalls einen festen Platz in meiner Schatzkiste der geliebten Dinge.
Erinnerst du dich an den Tag, als plötzlich der Himmel schwarz wurde und du mich von irgendwo weiter oben, ich glaube, es war Montmartre, anriefst, um mir zu sagen, dass ein Unwetter auf mein Haus zukäme und du den Regen niederprasseln sehen könntest, während die Wolke über die Stadt zog? Am Telefon hast du verkündet, in zwei Minuten würde es anfangen zu regnen, dann in einer, in einer halben, und schließlich hast du von zehn die Sekunden runtergezählt, und als du bei null angelangt warst, hast du gefragt, ob es schon regnet, und ich habe Nein gesagt, aber dann, einen Moment später, brach draußen vor meinem Fenster ein wahrer Wolkenbruch los und du hast wahrscheinlich vor Stolz übers ganze Gesicht gestrahlt oder zumindest habe ich mir das so vorgestellt, denn, seien wir mal ehrlich, jeder hat gern recht. Ich war wirklich beeindruckt.
Es gibt noch etwas, das ich liebe, etwas ziemlich Außergewöhnliches. Auf der Metrolinie 7bis, zwischen den Haltestellen Buttes-Chaumont und Bolivar, machen die Gleise eine Rechtskurve und nach ungefähr hundert Metern sieht man auf der linken Seite des Tunnels einen Garten. Zugegeben, Garten ist ein bisschen übertrieben; er besteht nämlich nur aus einer einzigen kleinen Pflanze, irgendeinem Unkraut, das sich von oben durchgezwängt hat oder vielleicht in der Mauer unter irgendeiner Lampe gekeimt ist, aber es ist die einzige unterirdisch wachsende Pflanze, die ich kenne. Es gelingt mir nie, sie mir genauer anzusehen, aber sie ist da. Manchmal fahre ich sechsmal mit der Metro hin und her, nur um einen Blick darauf zu erhaschen. Ich liebe die Vorstellung, dass du ein Foto davon machst oder dich vielleicht sogar in der Metrostation versteckst, bis sie schließt, und dich dann in den Tunnel schleichst, um ihre sonnenhungrigen Blätter zu berühren. Das wäre ein richtiges Abenteuer – die Sicherheitsleute würden dich auf ihren Überwachungskameras sehen und sich auf die Jagd nach dir machen und du müsstest fliehen und dir einen Weg durch die Schächte nach draußen suchen und dann würdest du, siegreich, in irgendeiner schummrigen Gasse aus einem Gully kriechen.
Alles, was ich jetzt noch tun muss, ist auf Drucken zu klicken und diese Seiten in einen Umschlag zu stecken. Und dann, wenn du bei der Arbeit bist, werde ich zu deiner Wohnung gehen und den Brief unter deiner Tür durchschieben. Obwohl es noch so viel mehr zu sagen gäbe; viel, viel mehr. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht muss ich mich einfach damit abfinden, dass der Brief nun fertig ist und das hypnotische Klappern der Tasten verstummen wird, dass unser Gespräch nie beendet werden, der Eröffnungssatz nie einen Abschluss finden wird, und doch wünschte ich, ich könnte diesen Moment noch ein bisschen weiter hinauszögern. Vielleicht, weil ich ein Feigling bin und nicht zu sterben brauche, wenn ich einfach bis in alle Ewigkeit weiterschreibe, doch, um ganz ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, was ich noch schreiben soll. Ich glaube nicht, dass es dich interessiert, wie ich zu meinen beiden Ledersesseln gekommen bin, oder dass ich die Pflanzen im Blumenkasten vor meinem Fenster aufzählen sollte. Ja, der Blumenkasten, wieder so ein außergewöhnlicher Garten – ein grüner Fleck, an dem ich verweilen kann. Ach, oder habe ich dir erzählt, dass … Und habe ich dir erzählt, wie …?
Es ist zwanzig nach drei (immer noch) und mir bleibt noch ein wenig Zeit, doch ich muss jetzt aufhören.
Ben Constable, dir stehen große Abenteuer bevor und es tut mir leid, dass du nie die Gelegenheit haben wirst, mir davon zu erzählen, und dass wir nicht mehr bis spät in die Nacht trinken und im Regen spazieren gehen und unter Bäumen in kleinen kopfsteingepflasterten Straßen Schutz suchen und an unserem Geheimplatz sitzen und rauchen können.
Du fehlst mir jetzt schon.
Leb wohl,Butterfly X O X O X
Freitage bringen mich zum Lächeln. Wenn ich mir vor dem Nachhauseweg die Woche von den Händen wasche, ertappe ich mich im Spiegel beim Lachen. Ich liebe das Wochenende mit all seinen Überraschungen, die wie aus dem Nichts über einen hereinbrechen. Ich rufe den anderen einen Abschiedsgruß zu und mache mich auf den Weg, die Straße entlang, dann hüpfe ich die Rolltreppen zur Metro hinunter. Ich lasse anderen Leuten den Vortritt und helfe einer Frau auf der Treppe mit ihren schweren Einkaufstüten, ein Bettler bekommt mein Kleingeld und ich biete einem Fremden meinen Sitzplatz an. Im Stehen lehne ich mich an die Seitenwand des Waggons und überlege, ob ich mein Buch herausholen soll, doch ich beobachte lieber die ein- und aussteigenden Leute und lausche den zusammenhanglosen Fragmenten ihrer Gespräche.
In meiner Hosentasche klingelte mein Handy.
»Et alors?« Wenn ein Gespräch an einem Freitag so beginnt, dann bedeutet es: Und, hattest du eine gute Woche?, und es bedeutet: Und, wollen wir jetzt einen draufmachen? Heute Abend, so erfuhr ich, würden wir (ein paar Freunde und ich) essen gehen und danach auf eine Party – mit Musik und Tanz und lauter Leuten, die keiner von uns kannte. Das Treffen war für halb acht angesetzt, zum Aperitif, sodass wir schon ein bisschen angeheitert im Restaurant ankommen würden, um dort unter viel Gelächter über Politik und Kunst zu diskutieren. Mir blieb also noch genug Zeit, in aller Ruhe nach Hause zu gehen, eine kleine Siesta zu halten, zu duschen, danach, während ich mich fertig machte, Musik zu hören, irgendeine Kleinigkeit, die mir gerade durch den Kopf ging und keinen Aufschub duldete, im Internet nachzugucken, und mich dann, etwa gegen neun, zu den anderen zu gesellen. Das Zuspätkommen ist für mich keine besondere Masche oder so was; ich gebe in meinem Leben nur gern selbst das Tempo vor. Hektik ist nicht so mein Ding. Heute war ich, aus keinem bestimmten Grund, ziemlich zufrieden. Aber das ist auch nichts Außergewöhnliches.
Als ich nach Hause kam, wartete ich auf den Aufzug, und während er sich die sechs Stockwerke hinaufquälte, zappelten meine Finger ungeduldig in meinen Hosentaschen. Ich inspizierte meine Zunge im Spiegel, denn dazu sind Spiegel in Aufzügen schließlich da.
Im Flur vor meiner Wohnung saß Cat, was mich überraschte, denn normalerweise ist er nicht darauf angewiesen, dass ich ihm irgendwelche Türen öffne.
»Hallo, Cat, was machst du denn hier?«, sagte ich zu mir selbst und musterte ihn, während ich aufschloss. »Wenn du schlechte Nachrichten bringst, dann will ich sie nicht hören.« Er stand auf und strich mir um die Beine und plötzlich wurde mir mulmig zumute, denn Cat besucht mich eigentlich nie ohne guten Grund.
Als ich die Tür aufdrückte, hörte ich das Schaben von Holz auf Papier – jemand musste etwas unter meiner Tür durchgeschoben haben. Cat lief an mir vorbei und stolzierte in die Wohnung wie ein Monarch in sein Königreich. Ich bückte mich indessen, um einen dicken Umschlag aufzuheben, auf dem in einer krakeligen Handschrift, die ich sofort erkannte, mein Name stand. Der Brief war von Tomomi Ishikawa (auch Butterfly genannt), obwohl ich keine Ahnung hatte, warum sie mir hätte schreiben und dann extra zu meiner Wohnung kommen und den Brief unter meiner Tür durchschieben sollen, während ich nicht da war. Aber Butterfly war eben immer für eine Überraschung gut.
Ich hängte meinen Mantel auf, ging ins Schlafzimmer und warf mich aufs Bett. Dann kickte ich meine Schuhe von den Füßen und spielte eine Weile mit dem Umschlag herum, bevor ich ihn schließlich aufriss und einen Stapel getippter Seiten herauszog.
Cat sprang neben mir aufs Bett und ich konnte nur hoffen, dass seine Pfoten sauber waren. Er streckte sich aus wie eine Sphinx – für eine normale Katze war er viel zu groß. Ich streichelte ihn mit dem Fuß, aber er beachtete mich gar nicht, sondern starrte bloß aus dem Fenster. Ich begann zu lesen.
Tomomi Ishikawa war meine Freundin. Tomomi Ishikawa lag tot in meinen Händen. Mein Kopf machte komplett dicht, während ich die Seiten las. Kein Gedanke konnte entweichen. In meinen Augen standen Tränen, doch sie wollten nicht fließen. Ich sah auf meinen Brustkorb hinunter und beobachtete meinen Atem. Er ging langsam, gleichmäßig. Ich konnte mein Herz klopfen sehen, harte, kraftvolle Schläge. Schnell. Sehr schnell. Tomomi Ishikawa war tot und wie bei einer tiefen, entsetzlichen Wunde war mir der Schmerz bewusst, ohne dass ich ihn spürte.
Ich versuchte, mir die fünf Phasen der Trauer ins Gedächtnis zu rufen: Schock, Verweigerung, Wut, Depression und Akzeptanz? Und was war mit Schuld, gehörte die auch dazu? Das hier musste die Schockphase sein. Ich stand absolut unter Schock. Ich wusste kaum, wie mir geschah. Ich wusste nicht, was ich denken sollte, was ich tun sollte. Warum hatte ich sie bloß am Tag zuvor nicht angerufen? Es wäre so einfach gewesen. Wir hätten etwas trinken gehen können.
Ich sah Cat an und er drehte mir den Kopf zu und blickte mir in die Augen. In diesem Moment wünschte ich mir, er wäre die Art von Katze, die sich neben einen quetscht und die negative Energie aus einem herauszieht oder was Katzen eben so machen. Aber Cat ist nicht so und das hat mehrere Gründe. Nummer eins: Cat ist keine normale Hauskatze. Er ist irgendeine Art von Wildkatze oder ein Luchs (oder etwas Ähnliches) und so groß wie ein Hund, ein ziemlich kleiner Hund zwar, aber immer noch ein ganzes Stück größer als eine gewöhnliche Katze. Er hat riesige Pfoten und macht sich nicht viel aus Streicheleinheiten. Außerdem gehört er nicht mir. Er kommt einfach hin und wieder mal vorbei und hängt ein bisschen bei mir rum. Grund Nummer zwei: Er existiert gar nicht. Er ist eine imaginäre Katze, aber das ist eigentlich ein Geheimnis.
Ich stand auf, suchte nach meinem Handy und fand es schließlich in meiner Manteltasche. Mit dem Daumen scrollte ich durch meine Kontakte bis zu Butterfly (Fr), drückte auf die grüne Taste und hielt mir das Telefon ans Ohr. Zunächst hörte ich gar nichts und sah auf das Display, um mich zu vergewissern, dass es auch wählte, dann lauschte ich weiter und es klingelte. »Komm schon, Butterfly, geh an dein Scheißtelefon!« Etwa nach dem fünften Klingeln meldete sich die Mailbox und ihre vertraute Stimme informierte mich auf Französisch, dass sie im Moment nicht erreichbar sei, mich aber so bald wie möglich zurückrufe. Im Hintergrund hörte ich mich selbst lachen, denn ich war dabei gewesen, als sie die Nachricht aufgenommen hatte. Ich legte auf. »Was soll ich denn jetzt machen, Cat?«
Cat blickte mich an. Man sollte meinen, dass er als imaginäre Katze nicht unbedingt den Beschränkungen der Realität oder den Gesetzen der Wissenschaft unterliegt. Aber so ist es. Er kann zum Beispiel nicht sprechen, oder zumindest tut er es nie. Manchmal ist es, als könnte ich spüren, was er gerade denkt, und dann stelle ich mir vor, was er sagen würde, wenn er sprechen könnte, aber das ist dann quasi doppelt imaginär. Man könnte wohl sagen, Cats Existenz ist an die Regeln der realen Imagination gebunden.
»Ach, Cat, hilf mir doch, ich weiß nicht, was ich machen soll.« Ich drückte mir die Fingerspitzen auf die Augenlider, als könnte ich dadurch mein Gehirn entlasten und wieder klar denken. Ich legte mich zurück aufs Bett, zog mir ein Kissen über den Kopf und presste es mir aufs Gesicht. In letzter Zeit hatte ich nicht besonders oft an Butterfly gedacht. Sie war ziemlich beschäftigt gewesen und ich hatte … irgendwelchen Kram gemacht. Sie musste verzweifelt gewesen sein und ich hatte irgendwelchen Kram gemacht. Kram. Verdammt. Ich spürte Cats Gewicht, als er über mich hinwegkletterte und meine Beine unangenehm in die Matratze drückte.
Ich griff erneut nach meinem Handy und wählte Tomomi Ishikawas Nummer, doch diesmal sprang die Mailbox sofort an. Ich rief siebenmal in Folge an und jedes Mal hörte ich nur diesen Moment Stille und dann ihre Stimme vom Band. Das konnte nicht sein; beim ersten Mal hatte es doch auch geklingelt. Ihr Telefon hatte doch wohl kaum in den paar Minuten zwischen meinem ersten Anruf und den folgenden den Empfang verloren oder war kaputtgegangen. Vielleicht war ja der Akku leer. Und wenn es jemand ausgeschaltet hatte?
Ich zog eine kleine Kiste voll verschiedenstem Plunder aus dem Regal. Nach einer Weile Wühlen fand ich einen Schlüssel an einem kurzen roten Band. Ich hatte einen Schlüssel zu Tomomi Ishikawas Wohnung, um ihre Blumen zu gießen, wenn sie mal nicht da war, oder für Notfälle.
Ich zog meine Schuhe an, schnappte mir meinen Mantel und ging nach draußen, wobei die Tür einen Tick lauter hinter mir zufiel als beabsichtigt. In der Hoffnung, Cat nicht einen imaginären Kopf kürzer gemacht zu haben, sah ich mich um, doch er stand schon am Aufzug. »Wir nehmen die Treppe«, sagte ich zu mir selbst und Cat war einverstanden, denn er fährt nicht gern Aufzug. Er fährt auch nicht gern mit der Metro, dennoch folgte er mir bis nach unten auf den Bahnsteig und dann in den Waggon, wo er es sich zwischen meinen Füßen bequem machte. Als imaginäre Katze hat man es in der Metro nicht ganz leicht, weil einen niemand sehen kann und die Leute einem oft unhöflich dicht auf den Pelz rücken, aber er war trotzdem mitgekommen und das rechnete ich ihm hoch an.
An Butterflys Haustür angekommen, kämpfte ich eine Weile mit dem Tastenfeld und versuchte, mich an den Code zu erinnern. Ich tippte alle möglichen vierstelligen Zahlenkombinationen ein, die mir durch den Kopf schwirrten, gefolgt von dem Buchstaben A, bis endlich ein Klicken ertönte. Wir gingen ins Haus und die Treppe hoch. Ich klopfte, aber niemand öffnete, darum zog ich den Schlüssel aus der Tasche und schloss auf. Cat, der in solchen Situationen mutiger ist als ich, ging vor. Ich rief »Hallo?«, doch niemand antwortete. Im Wohnraum sah es aus wie immer, nur auf dem Tisch lag ein Zettel, beschwert mit einem Kugelschreiber aus Edelstahl. Ich ging direkt weiter ins Schlafzimmer. Alles wirkte normal, das Bett war gemacht. Eigentlich war es sogar auffallend ordentlich. Ich sah im Badezimmer nach und auch dort war niemand, also nahm ich den Zettel vom Tisch und las die Nachricht, während Cat sich hinsetzte und seine rechte Vorderpfote leckte.
Ben Constable,
es ist zwanzig nach drei, und wie es scheint, gibt es nichts mehr zu tun. Ich werde nicht mehr da sein, wenn du kommst; ich habe mir einen besonderen Ort ausgesucht, um es zu vollbringen, damit sich niemand die Hände schmutzig machen muss (der Tod kann eine ziemlich unschöne Angelegenheit sein). Ich habe dafür gesorgt, dass jemand kommt und sich um meine Sachen kümmert, du kannst also alles so lassen, wie es ist, nur meinen Computer nimm mit – der ist für dich. Im Kühlschrank ist noch Essen, falls du etwas möchtest. Die Joghurts sind schon abgelaufen, aber jeder weiß ja, dass Joghurt sowieso nichts anderes ist als abgelaufene Milch, stimmt’s? Es gibt auch noch Obst, falls man dich damit locken kann. (Meine Güte, wieso nerve ich dich jetzt eigentlich so mit Essen? Entschuldige – ich kann bloß die Vorstellung nicht ertragen, dass hier alles vergammelt, und da du nicht unbedingt zu den dicksten Menschen der Welt gehörst, denke ich immer, du könntest gut ein bisschen mehr Hüftspeck vertragen. (Speck ist keiner dabei.))
Ich hoffe, es geht dir gut, und das alles tut mir wirklich leid. Ich muss jetzt aufhören, weil ich noch einen anderen Brief schreiben muss. (An dich, du Trottel.)
X O X O X Butterfly
PS: Hey, nimm doch vielleicht auch diesen Stift mit, der war immer mein Lieblingskuli.
Ich holte mir eine Banane und begann zu essen. Einen Moment lang stand ich einfach da und starrte auf die Uhr an der Wand. Seit ich Tomomi kannte, hatte sie immer zuverlässig zwanzig nach drei angezeigt, aber warum sie sie überhaupt behalten hatte, war mir ein Rätsel. Cat stand auf und streckte sich. Wo war sie wohl hingegangen, um es zu vollbringen, und wen hatte sie damit beauftragt, sich um ihre Sachen zu kümmern? Einen Anwalt? Eine Entrümpelungsfirma? Hatte sie sich ein Zimmer in einer Schweizer Selbstmordklinik mit Premium-Service gebucht (Sterben Sie ruhig – wir kümmern uns um den Rest)? Gibt es so etwas überhaupt? Es schien mir schwer vorstellbar, dass sie so gut organisiert gewesen sein sollte. So wie ich sie kannte, wäre sie auf die Website der Klinik gegangen, hätte die klaren Linien des Gebäudekomplexes bewundert, die sie an den Architekten Albert Frey erinnert hätten, und im nächsten Moment wäre sie in einen Artikel über Desert Modernism vertieft gewesen und hätte alles andere vergessen.
Cat saß mit dem Gesicht zur Tür, um keinen Zweifel daran zu lassen, dass er gehen wollte. Im Schrank fand ich einen Krug, füllte ihn mit Wasser und goss ein bisschen in jeden Blumentopf in der Wohnung. Dann packte ich Butterflys glänzenden Laptop, ihre Nachricht und den Kugelschreiber in meine Tasche und ging. Die Bananenschale warf ich in den Mülleimer am Fuß der Treppe.
Tomomi Ishikawa war tot und ich hatte keine Ahnung, was ich tun sollte. Ich schaltete mein Handy aus und ging nach Hause.
2
TOMOMI ISHIKAWAS COMPUTER
Als ich aufwachte, fühlte ich mich einen Moment lang wie neugeboren. Die Sonne war über die Gebäude auf der anderen Straßenseite gestiegen und die schmiedeeisernen Ziergitter vor den Fenstern warfen scharfe, klare Schatten auf den Stoff der Vorhänge. Ich wusste nicht, wo ich war. Die Luft war kühl, roch aber trocken, nach Heizung. Die Bettdecke war sauber und ich mochte das Gefühl von Baumwolle auf meiner Haut. Ich mochte den ganzen Raum. Ich weiß nicht, woran er mich erinnerte. Er wirkte exotisch. Von irgendwoher hörte ich Autos, nicht allzu nah, und Vögel. Es klang nach Frühling. Alles war ruhig. Alles war in Ordnung.
Es war kein Flüstern, denn es machte kein Geräusch, aber irgendetwas riet meinem Kopf lautlos, genau so zu bleiben. Nicht bewegen. Nicht denken. Gar nichts. Antworten (auf Fragen, die ich nie gestellt hatte) sickerten durch den Schleier und formten sich zu Tropfen. Sie klatschten mir ins Gesicht. Ich war in meiner Pariser Mietwohnung, das Zimmer war mein Schlafzimmer. Schhh. Es war Samstag, der 17.März 2007. Schhh, nicht weiter. Ich hatte lange geschlafen, bestimmt zehn Stunden. Ich sah auf mein Handy, aber es war ausgeschaltet. Das überraschte mich. Dann riss der Schleier auf und mein Leben strömte zu mir herein. Ich schloss die Augen. Ich wünschte, ich würde wieder schlafen. Tomomi Ishikawa war tot und wir würden nie wieder zusammensitzen und reden und lachen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























