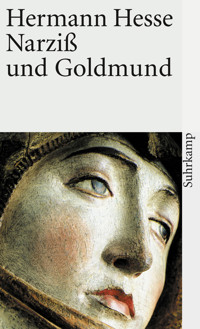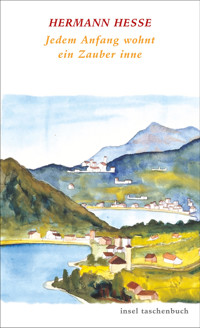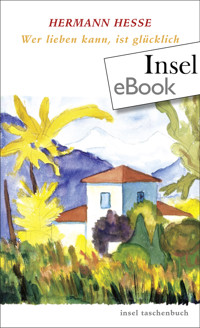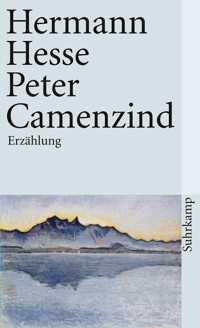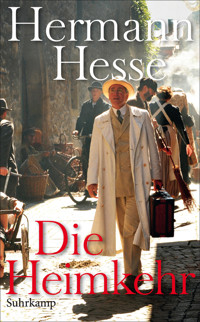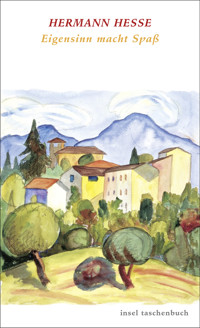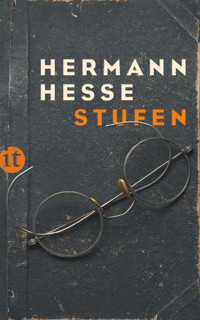13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ich glaube an nichts in der Welt so tief, keine andere Vorstellung ist mir so heilig wie die Einheit, die Vorstellung, daß alles Leiden, alles Böse nur darin besteht, daß wir Einzelnen und nicht mehr als unlösbare Teile des Ganzen empfinden, daß das Ich sich zu wichtig nimmt«, heißt es in einem zentralen Text dieses Lesebuches, das die Wege und Umwege zeigt, die den protestantischen Missionarssohn Hesse aus dem »Nationalismus« der dogmatischen Konfessionen und Weltanschauungen zu einer überkonfessionellen Religiosität geführt haben. Die hier wiedergegebenen Betrachtungen, ob sie sich nun mit den frühesten Religionen und Mythen der Menschheit, den altägyptischen, chinesischen, buddhistischen, christlichen, islamischen oder den modernen Formen des ideologischen Religionsersatzes beschäftigen, versuchen zu ergründen, »was allen Konfessionen und allen menschlichen Formen der Frömmigkeit gemeinsam ist, was über allen kulturellen und nationalen Verschiedenheiten steht, was von jeder Rasse und jedem Einzelnen geglaubt werden kann.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Hermann Hesse
Die Einheit hinter den Gegensätzen
Religionen und Mythen Ausgewählt von Volker Michels Insel Verlag
Inhalt
Die Einheit hinter den Gegensätzen
Quellennachweise
Zu dieser Ausgabe
Die Einheit hinter den Gegensätzen
Über die Einheit
Ich glaube an nichts in der Welt so tief, keine andere Vorstellung ist mir so heilig wie die der Einheit, die Vorstellung, daß das Ganze der Welt eine göttliche Einheit ist und daß alles Leiden, alles Böse nur darin besteht, daß wir einzelne uns nicht mehr als unlösbare Teile des Ganzen empfinden, daß das Ich sich zu wichtig nimmt. Viel Leid hatte ich in meinem Leben erlitten, viel Unrecht getan, viel Dummes und Bitteres mir eingebrockt, aber immer wieder war es mir gelungen, mich zu erlösen, mein Ich zu vergessen und hinzugeben, die Einheit zu fühlen, den Zwiespalt zwischen Innen und Außen, zwischen Ich und Welt als Illusion zu erkennen und mit geschlossenen Augen willig in die Einheit einzugehen. Leicht war es mir nie geworden, niemand konnte weniger Begabung zum Heiligen haben als ich; aber dennoch war mir immer wieder jenes Wunder begegnet, dem die christlichen Theologen den schönen Namen der »Gnade« gegeben haben, jenes göttliche Erlebnis der Versöhnung, des Nichtmehrwiderstrebens, des willigen Einverstandenseins, das ja nichts anderes ist als die christliche Hingabe des Ich oder die indische Erkenntnis der Einheit. Ach, und nun stand ich wieder einmal so völlig außerhalb der Einheit, war ein vereinzeltes, leidendes, hassendes, feindliches Ich. Auch andre waren das, gewiß, ich stand damit nicht allein, es gab eine Menge von Menschen, deren ganzes Leben ein Kampf, ein kriegerisches Sichbehaupten des Ich gegen die Umwelt war, welchen der Gedanke der Einheit, der Liebe, der Harmonie unbekannt war und fremd, töricht und schwächlich erschienen wäre, ja, die ganze praktische Durchschnittsreligion des modernen Menschen bestand in einem Verherrlichen des Ich und seines Kampfes. Aber in diesem Ichgefühl und Kampf sich wohlzufühlen, war nur den Naiven möglich, den starken, ungebrochenen Naturwesen; den Wissenden, den in Leiden sehend Gewordnen, den in Leiden differenziert Gewordnen war es verboten, in diesem Kampfe ihr Glück zu finden, ihnen war Glück nur denkbar im Hingeben des Ich, im Erleben der Einheit …
Die Einheit, die ich hinter der Vielheit verehre, ist keine langweilige, keine graue, gedankliche, theoretische Einheit. Sie ist ja das Leben selbst, voll Spiel, voll Schmerz, voll Gelächter. Sie ist dargestellt worden im Tanz des Gottes Shiva, der die Welt in Scherben tanzt, und in vielen anderen Bildern, sie weigert sich keiner Darstellung, keinem Gleichnis. Du kannst jederzeit in sie eintreten, sie gehört dir in jedem Augenblick, wo du keine Zeit, keinen Raum, kein Wissen, kein Nichtwissen kennst, wo du aus der Konvention austrittst, wo du in Liebe und Hingabe allen Göttern, allen Menschen, allen Welten, allen Zeitaltern angehörst.
Wäre ich Musiker, so könnte ich ohne Schwierigkeit eine zweistimmige Melodie schreiben, eine Melodie, welche aus zwei Linien besteht, aus zwei Ton- und Notenreihen, die einander entsprechen, einander ergänzen, einander bekämpfen, einander bedingen, jedenfalls aber in jedem Augenblick, auf jedem Punkt der Reihe in der innigsten, lebendigsten Wechselwirkung und gegenseitigen Beziehung stehen. Und jeder, der Noten zu lesen versteht, könnte meine Doppelmelodie ablesen, sähe und hörte zu jedem Ton stets den Gegenton, den Bruder, den Feind, den Antipoden. Nun, und eben dies, diese Zweistimmigkeit und ewig schreitende Antithese, diese Doppellinie möchte ich mit meinem Material, mit Worten, zum Ausdruck bringen und arbeite mich wund daran, und es geht nicht. Ich versuche es stets von neuem, und wenn irgend etwas meinem Arbeiten Spannung und Druck verleiht, so ist es einzig dies intensive Bemühen um etwas Unmögliches, dieses wilde Kämpfen um etwas nicht Erreichbares. Ich möchte einen Ausdruck finden für die Zweiheit, ich möchte Kapitel und Sätze schreiben, wo beständig Melodie und Gegenmelodie gleichzeitig sichtbar wären, wo jeder Buntheit die Einheit, jedem Scherz der Ernst beständig zur Seite steht. Denn einzig darin besteht für mich das Leben, im Fluktuieren zwischen zwei Polen, im Hin und Her zwischen den beiden Grundpfeilern der Welt. Beständig möchte ich mit Entzücken auf die selige Buntheit der Welt hinweisen und ebenso beständig daran erinnern, daß dieser Buntheit eine Einheit zugrunde liegt; beständig möchte ich zeigen, daß Schön und Häßlich, Hell und Dunkel, Sünde und Heiligkeit immer nur für einen Moment Gegensätze sind, daß sie immerzu ineinander übergehen. Für mich sind die höchsten Worte der Menschheit jene paar, in denen diese Doppeltheit in magischen Zeichen ausgesprochen ward, jene wenigen geheimnisvollen Sprüche und Gleichnisse, in welchen die großen Weltgegensätze zugleich als Notwendigkeit und als Illusion erkannt werden. Der Chinese Lao Tse hat mehrere solche Sprüche geformt, in denen beide Pole des Lebens für den Blitz eines Augenblicks einander zu berühren scheinen. Noch edler und einfacher, noch herzlicher ist dasselbe Wunder getan in vielen Worten Jesu. Ich weiß nichts so Erschütterndes in der Welt wie dies, daß eine Religion, eine Lehre, eine Seelenschule durch Jahrtausende die Lehre von Gut und Böse, von Recht und Unrecht immer feiner und straffer ausbildet, immer höhere Ansprüche an Gerechtigkeit und Gehorsam stellt, um schließlich auf ihrem Gipfel mit der magischen Erkenntnis zu enden, daß neunundneunzig Gerechte vor Gott weniger sind als ein Sünder im Augenblick der Umkehr!
Aber vielleicht ist es ein großer Irrtum, ja, eine Sünde von mir, wenn ich der Verkündigung dieser höchsten Ahnungen glaube dienen zu müssen. Vielleicht besteht das Unglück unsrer jetzigen Welt gerade darin, daß diese höchste Weisheit auf allen Gassen feilgeboten wird, daß in jeder Staatskirche, neben dem Glauben an Obrigkeit, Geldsack und Nationaleitelkeit, der Glaube an das Wunder Jesu gepredigt wird, daß das Neue Testament, ein Behälter der kostbarsten und der gefährlichsten Weisheiten, in jedem Laden käuflich ist und von Missionaren gar umsonst verteilt wird. Vielleicht sollten solche unerhörte, kühne, ja erschreckende Einsichten und Ahnungen, wie sie in manchen Reden Jesu stehen, sorgfältig verborgen gehalten und mit Schutzwällen umbaut werden. Vielleicht wäre es gut und zu wünschen, daß ein Mensch, um eines jener mächtigen Worte zu erfahren, Jahre opfern und sein Leben wagen müßte, so wie er es für andere hohe Werte im Leben auch tun muß. Wenn dem so ist (und ich glaube an manchen Tagen, daß es so ist), dann tut der letzte Unterhaltungsschriftsteller Besseres und Richtigeres als der, der sich um den Ausdruck für das Ewige bemüht.
Dies ist mein Dilemma und Problem. Es läßt sich viel darüber sagen, lösen aber läßt es sich nicht. Die beiden Pole des Lebens zueinander zu biegen, die Zweistimmigkeit der Lebensmelodie niederzuschreiben, wird mir nie gelingen. Dennoch werde ich dem dunklen Befehl in meinem Innern folgen und werde wieder und wieder den Versuch unternehmen müssen. Dies ist die Feder, die mein Ührlein treibt.
Wie bekannt, liegt einem Teil der alten östlichen Lehren und Religionen der uralte Gedanke der Einheit zu Grunde. Die Vielgestaltigkeit der Welt, das reiche, bunte Spiel des Lebens mit seinen tausend Formen wird zurückgeführt auf das göttliche Eine, das dem Spiel zu Grunde liegt. Alle Gestalten der Erscheinungswelt werden empfunden nicht als an sich seiend und notwendig, sondern als Spiel, als ein flüchtiges Spiel von rasch vergänglichen Bildungen, die mit Gottes Atem aus- und einströmend das Ganze der Welt zu bilden scheinen, während doch jede dieser Gestalten, Ich und Du, Freund und Feind, Tier und Mensch nur augenblickliche Erscheinungen, nur flüchtig inkarnierte Teile des uranfänglichen Einen sind und stets in dasselbe zurückkehren müssen.
Diesem Wissen um die Einheit, aus dem der Gläubige und Weise die Fähigkeit schöpft, das Leid der Welt als vergänglich und nichtig zu empfinden und sich, der Einheit zustrebend, davon zu lösen – ihm entspricht als Gegenpol der entgegengesetzte Gedanke: daß dennoch, und trotz aller jenseitigen Einheit, im Diesseits eben doch das Leben uns nur in abgegrenzten, fremd nebeneinander stehenden Gestaltungen wahrnehmbar wird. Trotz aller Einheit ist, sobald dieser andre Standpunkt eingenommen wird, eben doch der Mensch ein Mensch und kein Tier, ist der eine gut, der andre böse, ist die ganze verwirrte und bunte Wirklichkeit eben doch vorhanden.
Für asiatische Denker nun, welche Meister der Synthese sind, ist es ein gewohntes und bis zur hohen Vollendung gezüchtetes Geistesspiel, entgegengesetzte Betrachtungsweisen abwechselnd zu üben, beide bejahend, beiden zustimmend. Aus dieser Übung stammt das Bild, das ich hier gebrauchen will.
Man stelle sich vor: ein paar buddhistische Priester oder Gelehrte führen eine spirituelle Unterhaltung. Sie sitzen beisammen und sprechen, in vielerlei Bildern, davon, daß die sogenannte Wirklichkeit ein Trugbild ist, daß alles Wahrnehmbare nur Schein, alle Gestaltung nur Trug, alle Gegensätze nur kurzsichtige menschliche Einbildung sind, sie lösen die Welt, die sie umgibt und unter der sie leiden, vollkommen auf und festigen in sich den Gedanken jener jenseitigen Einheit, jenes ewigen göttlichen Lebens. Wenn sie das nun zur Genüge getan haben, so kann einer von ihnen, nach einigem Lächeln und Schweigen, den Spruch anstimmen: ›Die Weide ist grün, die Rose ist rot, der Rabe macht kra kra.‹
Dieser einfältige Satz bedeutet, jedem Beteiligten sofort verständlich, nichts anderes als: ›Nun ja, gewiß ist die Erscheinungswelt nur Trug, gewiß gibt es in Wahrheit keine Weide, keine Rose, keinen Raben, sondern nur das ewige göttliche Eine - aber außerdem ist für uns, die wir vergänglich sind und im Vergänglichen leben, dies Vergängliche auch Wirklichkeit, ist die Rose rot, macht der Rabe kra kra.‹
Jener Standpunkt nun, für welchen die Rose eine Rose, der Mann ein Mann, der Rabe ein Rabe ist, für welchen die Grenzen und Formen der Wirklichkeit feste und heilige Gegebenheiten sind, jener Standpunkt ist der klassische. Er anerkennt die Formen und Eigenschaften der Dinge, anerkennt die Erfahrung, er sucht und schafft Ordnung, Form, Gesetz.
Der andre Standpunkt dagegen, der an der Wirklichkeit nur den Schein, nur das Wandelbare sieht, für den der Unterschied zwischen Pflanze und Tier, zwischen Mann und Frau höchst zweifelhaft ist, der bereit ist, jeden Augenblick alle Formen sich auflösen und ineinander übergehen zu lassen, er entspricht dem romantischen Standpunkt.
Als Weltbetrachtung nun, als Philosophie, als Grundlage für die Einstellung der Seele ist jede dieser Betrachtungsarten so gut wie die andre, es läßt sich nichts dawider sagen. Die klassische Einstellung wird Grenze und Gesetz betonen, wird Tradition anerkennen und schaffen helfen, wird sich bemühen, den Augenblick auszuschöpfen und zu verewigen. Die romantische Einstellung wird die Gesetze und Formen verwischen, dafür den Urquell des Lebendigen verehren und Frömmigkeit an die Stelle der Kritik, Versenkung an die Stelle des Verstandes setzen, sie wird auf das Zeitlose zielen und von der Sehnsucht nach der Rückkehr ins göttliche Eine erfüllt sein, ebenso wie der klassische Mensch von dem Willen, das Vergängliche zur Dauer zu erheben, erfüllt ist …
Beider Einstellungen bedarf die Welt, jede wird die andre tausendfach ergänzen und korrigieren.
Ich halte den Gedanken einer Einheit der gesamten Menschheit durchaus nicht nur für den holden Traum einiger schöner Geister, sondern für ein seelisches Erlebnis, also für das Realste, was es geben kann. Dieser Gedanke ist ja auch die Grundlage unseres ganzen religiösen Fühlens und Denkens. Jede höhere und lebensfähige Religion, jede künstlerischschöpferische Weltanschauung hat als einen ihrer ersten Grundsätze die Überzeugung von der Würde und geistigen Bestimmung des Menschen, des Menschen schlechthin. Die Weisheit des Chinesen Laotse und die Weisheit Jesu oder die der indischen Bagavadgita weisen ebenso deutlich auf die Gemeinsamkeit der seelischen Grundlagen durch alle Völker hindurch wie die Kunst aller Zeiten und Völker. Die Seele des Menschen in ihrer Heiligkeit, in ihrer Fähigkeit zu lieben, in ihrer Kraft zu leiden, in ihrer Sehnsucht nach Erlösung, die blickt uns aus jedem Gedanken, aus jeder Tat der Liebe an, bei Plato und bei Tolstoi, bei Buddha und bei Augustinus, bei Goethe und in Tausendundeiner Nacht. Daraus soll niemand schließen, Christentum und Taoismus, platonische Philosophie und Buddhismus seien nun zu vereinigen, oder es würde aus einem Zusammengießen aller durch Zeiten, Rassen, Klima, Geschichte getrennten Gedankenwelten sich eine Idealphilosophie ergeben. Der Christ sei Christ, der Chinese sei Chinese, und jeder wehre sich für seine Art, zu sein und zu denken. Die Erkenntnis, daß wir alle nur getrennte Teile des ewig Einen sind, sie macht nicht einen Weg, nicht einen Umweg, nicht ein einziges Tun oder Leiden auf der Welt entbehrlich. Die Erkenntnis meiner Determiniertheit macht mich ja auch nicht frei! Wohl aber macht sie mich bescheiden, macht mich duldsam, macht mich gütig; denn sie nötigt mich, die Determiniertheit jedes anderen Wesens ebenfalls zu ahnen, zu achten und gelten zu lassen.
Für mich, der ich zwar christlich-protestantisch erzogen, dann aber an Indien und China geschult bin, sind alle Zweiteilungen der Welt und der Menschen in Gegensatzpaare nicht vorhanden. Für mich ist erster Glaubenssatz die Einheit hinter und über den Gegensätzen. Natürlich leugne ich nicht die Möglichkeit, solche Schemata aufzustellen wie »aktiv« und »kontemplativ«, und leugne nicht, daß es nützlich sein kann, die Menschen auf Grund solcher Typenlehren zu beurteilen. Es gibt Aktive und es gibt Kontemplative. Aber dahinter steht die Einheit, und wirklich lebendig und im günstigen Fall vorbildlich ist für mich nur der, der beide Gegensätze in sich hat. Ich habe nichts gegen den rastlosen Arbeiter und Schaffer und habe auch nichts gegen den nabelbeschauenden Einsiedler, aber interessant oder gar vorbildlich kann ich beide nicht finden. Der Mensch, den ich suche und erwünsche, ist der, der sowohl der Gemeinschaft wie des Alleinseins, sowohl der Tat wie der Versenkung fähig ist. Und wenn ich in meinen Schriften, wie es scheint (ich selbst kann mich ja nicht von außen sehen) dem beschaulichen Leben den Vorzug vor dem tätigen gebe, so ist es vermutlich deswegen, weil ich unsre Welt und Zeit voll von aktiven, tüchtigen, rührigen, der Kontemplation aber unfähigen Menschen sehe. In jüngeren Jahren nannte ich diesen einseitig aufs Aktive gerichteten Menschentyp abendländisch, aber es ist ja längst auch der Osten »erwacht« und aktiv geworden …
Daß Gut und Böse, Schön und Häßlich und alle Gegensatzpaare in eine Einheit auflösbar sind, das ist eine esoterische, geheime, den Eingeweihten zugängliche (und auch ihnen oft wieder entgleitende) Wahrheit, aber nicht eine exoterische, allen verständliche und bekömmliche. Es ist die Weisheit des Lao Tse, wenn er die Tugenden und guten Werke verachtet (man denkt dabei auch an den jungen Luther). Aber auch Lao Tse hätte sich sehr gehütet, diese Weisheit dem Volk anzubieten.
Wir haben die Aufgabe, den übernationalen Gedanken, den Gedanken der Einheit der Menschheit und ihrer Kultur, fördern zu helfen, und haben jedem Nationalismus Widerstand zu leisten: dem dummstolzen Patriotismus und Größenwahn des Durchschnittsdeutschen, Durchschnittsamerikaners etc. wie umgekehrt den Ressentiments gegen ganze Nationen in unsern eigenen Herzen. Wir Geistigen haben, allen Dampfwalzen und Normierungen zum Trotz, das Differenzieren zu üben und nicht das Verallgemeinern.
In einem guten Parlament brauchen der Konservative und der Oppositionsmann bei allem aktuellen Streit nie zu vergessen, daß sie beide einem Ziel dienen und, wenn auch kämpfende Brüder, doch eben Brüder sind.
Bekenntnis
Holder Schein, an deine Spiele
Sieh mich willig hingegeben;
Andre haben Zwecke, Ziele,
Mir genügt es schon, zu leben.
Gleichnis will mir alles scheinen,
Was mir je die Sinne rührte,
Des Unendlichen und Einen,
Das ich stets lebendig spürte.
Solche Bilderschrift zu lesen,
Wird mir stets das Leben lohnen,
Denn das Ewige, das Wesen,
Weiß ich in mir selber wohnen.
Die Religion des alten Ägypten
In dem bedeutsamen Sammelwerk »Religiöse Stimmen der Völker« ist soeben ein umfangreicher Band »Urkunden zur Religion des alten Ägypten« erschienen, besorgt von Günther Roeder. Dies wertvolle Buch wird, außer den Fachleuten, wohl vor allem alle jene interessieren und anziehen, die auf dem Umwege über die altägyptische Kunst zur Beschäftigung mit dem Geist Altägyptens gekommen sind. Auch ich bin diesen Weg gegangen, und so sehr ich typische Grundzüge der ägyptischen Kunst nun in den religiösen Dokumenten desselben Volkes bestätigt und wiederholt finde, so gestehe ich doch, daß die Eindrücke aus dieser Welt nicht entfernt so stark und mächtig sind wie die aus der ägyptischen Skulptur. Dennoch war ich dankbar, an Hand eines guten Führers auch diese etwas düstere Welt einigermaßen kennen zu lernen. Vor allem bin ich Roeders schönen Übersetzungen und seiner sehr klaren, vorsichtigen, klugen Einleitung zu Dank verpflichtet.
Wenn wir von ägyptischer Religion oder ägyptischer Mythologie sprechen hören, so steigen ganz bestimmte, wenn auch nicht klare Bilder vor uns auf. Vor allem denken wir an das, was wir von ägyptischen Bauten und Skulpturen kennen, an Pyramiden, Tempel, Säulengänge, Grabmäler, Sarkophage. Dann ein wenig an das theaterhafte Ägypten einer alten romantischen Tradition, wie es uns aus der Zauberflöte, aus der Aida und aus historischen Romanen vorschwebt. Mit den Namen Isis und Osiris verbindet sich für den gebildeten Laien seit Mozart eine Vorstellung von schönem, leicht antiquiertem Humanismus mit freimaurerischem Anstrich, auch erinnern wir uns dunkel, daß heute noch eine schäbig-volkstümliche Schundliteratur sich gelegentlich mit ägyptischen Zeichen schmückt; namentlich gibt es heute noch wie seit Jahrhunderten die »ägyptischen Traumbücher«.
Daß wir so wenig Wirkliches über das alte Ägypten wissen, während Kulturen wie die des asiatischen Ostens uns verhältnismäßig viel bekannter sind, das geht zum Teil einfach darauf zurück, daß die Wissenschaft selbst noch gar nicht lange imstande ist, die Hieroglyphenschrift zu lesen. Lange Zeit war dies Gebiet der Tummelplatz vager, oft phantastischer Vermutungen und romantischer Imaginationen, erst in unseren Tagen sind die Dokumente altägyptischen Glaubens und Denkens nicht nur ziemlich reichlich gefunden und zugänglich gemacht, sondern kritisch erforscht und gedeutet worden. Es gibt jetzt an Stelle einer traditionellen Phantastik eine wirkliche Wissenschaft der ägyptischen Religionsgeschichte, und mag sie noch so voll von Unaufgeklärtem sein, sie hat Boden und Richtung gewonnen und steht auf den festen Füßen einer kritischen Methode.
Roeders schönes Buch ist wohl das erste, aus dem der Laie so reichlich und so zuverlässig mit den Quellen bekannt gemacht wird. Es sind prächtige und ergreifende Stücke in diesen Dokumenten, die zumeist aus den Inschriften von Pyramiden, Tempeln, Grabstätten und Stelen herkommen. Es fehlt nicht an Poesie, an wuchtigem Pathos, es fehlt auch nicht ganz an menschlich rührenden Zügen. Aber alles in allem ist das, was uns als ägyptische Religion entgegentritt, unendlich weit von jenem Geheimnisvollen entfernt, das wir auf Grund überlieferter Vorstellungen dabei meinten ahnen zu dürfen. Die Religion des alten, klassischen Ägypten ist zwar reich an Einzelmythen, aber in ihrer Gesamtprägung ist sie merkwürdig bescheiden, um nicht zu sagen arm. Die offizielle Religion erweist sich als ein Stück staadicher Einrichtung und scheint eigentlich bloß für den Pharao und für die Priester dagewesen zu sein. Aus lokalen Mythen der primitiven Vorzeit zusammengeflossen, sieht die älteste ägyptische Religion wenig anders aus als jeder primitive Glaube, sie beschränkt sich auf das Ausgestalten von Mythengestalten, denen Sonne und Nacht, Gewitter,Tod und andre urtümliche Erfahrungen und Anschauungen zugrunde liegen. Ein eigeneres Gepräge erhält das Mythengemisch durch den Fortschritt der Bodenkultur, wobei der Nil mit seinen periodischen Überschwemmungen so unendlich wichtig wird, und dann durch die politische Gestaltung, durch den Kult des Pharao, für welchen allein eigentlich die Tempel und Götter da sind.
Der Pharao allein darf mit den Göttern sprechen, darf zu ihnen beten, darf ihnen Gebäude und Inschriften errichten, er ist ihr Abkömmling und wird nach seinem Tode selbst ein Gott. Die Priesterschaft herrscht im ganzen Staatswesen. Vom Volk erfahren wir überhaupt nichts. Die Vorstellung eines allen Menschen Gemeinsamen, einer Seele, eines Erlösungsbedürfnisses existiert in dieser steinharten Staatsreligion nicht! Ähnliche Gedanken tauchen nur allmählich auf, spät und scheu, und niemals amtlich anerkannt. So müssen wir zwar annehmen, daß neben der Pharaonenreligion das ägyptische Volk eine unaufgeschriebene, zufällige, naive Religion der Erfahrung und des seelischen Bedürfnisses gehabt habe; aber wir sehen niemals Gedanken aus dieser lebendigeren Unterschicht aufsteigen und das Dogma siegreich beeinflussen. Es fehlt an Leben, es fehlt an Heiligen, an Persönlichkeiten, an Reformatoren in dieser steinernen Religion. Dafür finden sich gewisse Grundvorstellungen und rituelle Vorgänge durch die ewige Wiederholung zu einer gewaltigen Festigkeit des Ausdruckes, zu höchst pathetischer Form gesteigert.
Von Anfang an war die Sonne und waren eine Reihe von Sonnengöttern im Glauben der Ägypter obenan gestanden. König Amenophis der Vierte, eigentlich der einzige nennenswerte Reformator der ägyptischen Religionsgeschichte, hat später die Vielheit der Götter offiziell abgesetzt (im Volksglauben bestand sie natürlich weiter) und den gesamten Kult auf eine einzige Gottheit, auf die Sonne, konzentriert. Die Hymnen dieses neuen Sonnenkultes gehören zum Großartigsten, was die religiösen Urkunden Altägyptens enthalten:
»Erweist Verehrung dem Re, dem Himmel des Himmels, dem Fürsten, der die Götter schuf. Betet ihn an in seiner schönen Gestalt bei seinem Erscheinen in der Manzet-Barke: Dich verehren die Oberen, dich verehren die Unteren. Dein Feind ist dem Feuer überantwortet, und deine Gegner sind niedergefallen; seine Schritte sind gefesselt, seine Arme hat Re gebunden. Die Götter jauchzen, wenn sie Re bei seinem Erscheinen sehen und seine Strahlen die Länder überfluten. Die Majestät des ehrwürdigen Gottes schreitet weiter und vereinigt sich mit der Erde am Westberg; allmorgendlich wird er geboren, wenn er seine Stelle von gestern erreicht hat.«
Neben Re, dem Sonnengott, der auch als Amon und unter anderen Namen erscheint, wird namentlich Osiris verehrt, der Beherrscher des Totenreiches. Der Gedanke an den Tod, die Furcht vor dem Tod, der Wille, den Tod zu überwinden, zu vergessen, zu bestechen, kehrt im ägyptischen Glauben überall wieder. Diese Menschen hingen am Leben mit ungeheurer Inbrunst, und eine reiche Menge von Zaubern und Amuletten mußte sie schützen, erst im diesseitigen Leben, dann in der Schattenwelt, wo sie weiter zu leben und neue Freuden zu genießen dachten. Größte Sorgfalt erfuhr der Körper des Gestorbenen – viele von ihnen sind über die Jahrtausende weg ja noch heute erhalten. Merkwürdig ist die Anschauung vom Totengericht, wo jede hingeschiedene Seele vor den 42 Richtern sich rechtfertigen muß. Merkwürdig aber ist namentlich dies, daß wohl das Bewußtsein von schlimmen Möglichkeiten, von Strafe, von Hölle, von ewiger Vernichtung vorhanden war, daß man aber hierüber mißtrauisch schwieg. In den Texten kehrt die Erzählung vom Totengericht stets wieder, aber stets wird auch das Totengericht durch Anwendung von Zaubern und Schutzmitteln überstanden, nie ist direkt davon die Rede, wie es dem Nichtbestandenen, dem Sünder, dem Gerichteten ergeht. Davon auch nur zu sprechen wird vermieden, und das läßt auf eine unendlich tiefe Angst, auf eine unendlich bange Todesfurcht schließen. Hingegen wird der Gestorbene eifrig mit allem ausgerüstet, was er im Schattenreiche brauchen kann, mit Speise, Gerät und Schmuck und mit gesprochenen und geschriebenen Zaubersprüchen für sein Schattenleben. Das Leben im Jenseits ist dem irdischen ganz ähnlich, man baut Getreide im »Gabenfeld«, nur ist man drüben auch nach bestandenem Totengericht immerzu von Dämonen bedroht, welche mit Messern in den Türen lauern, und denen nur durch die Kunde wirksamer Zauber zu entkommen ist. An solchen Zaubern und Gebeten ist die ägyptische Literatur überreich.
Weiter ist aus dem ganz ungeheuren Überwiegen des Jenseitsglaubens und der Todesfurcht auch die große Sorgfalt zu erklären, welche die Ägypter ihren Gräbern angedeihen ließen. In den Pharaonenzeiten wurde dem Bau und der Einrichtung einer Pyramide für den König durch viele Jahre eine Summe von Menschenkraft, Geld und Überlegung gewidmet, die uns phantastisch erscheint. In der Heimat oder in der Nähe schützender Heiligtümer begraben zu sein, war jedes Ägypters wichtigste Sorge, für Grabmäler gab man sein Vermögen hin.
Rührend ist es zu sehen, wie in den Grabinschriften und Gebeten volkstümlicher Art sich da und dort etwas zeigt, was ganz außerhalb der offiziellen Religion liegt, ein Zug zu Bekenntnis und Beichte, ein Durst nach Verständnis und Erlösung. Hier sieht man, wie auch in einer kristallisch abgeschlossenen Religion die innersten Sorgen und Bedürfnisse der Seele ihr Recht suchen und ihr banges Leben führen! Hier zeigt sich, nachdem uns der Glaube der Ägypter so fremd, so abgesondert und andersartig erschienen ist, das Gemeinsame, jene Schicht seelischen Lebens, welche schlechthin allen Menschen gemeinsam ist.
In einer Sammlung ägyptischer Bildwerke
Aus den Edelsteinaugen
Blicket ihr still und ewig
Über uns späte Brüder hinweg.
Nicht Liebe scheint noch Verlangen
Euren schimmernd glatten Zügen bekannt.
Königlich und den Gestirnen verschwistert
Seid ihr Unbegreiflichen einst
Zwischen Tempeln geschritten,
Heiligkeit weht wie ein ferner Götterduft
Heut noch um eure Stirnen,
Würde um eure Knie;
Eure Schönheit atmet gelassen,
Ihre Heimat ist Ewigkeit.
Aber wir, eure jüngeren Brüder,
Taumeln gottlos ein irres Leben entlang,
Allen Qualen der Leidenschaft,
Jeder brennenden Sehnsucht
Steht unsre zitternde Seele gierig geöffnet.
Unser Ziel ist der Tod,
Unser Glaube Vergänglichkeit,
Keiner Zeitenferne
Trotzt unser flehendes Bildnis.
Dennoch tragen auch wir
Heimlicher Seelenverwandtschaft Merkmal
In die Seele gebrannt,
Ahnen Götter und fühlen vor euch,
Schweigende Bilder der Vorzeit,
Furchtlose Liebe. Denn sehet,
Uns ist kein Wesen verhaßt, auch der Tod nicht,
Leiden und Sterben
Schreckt unsre Seele nicht,
Weil wir tiefer zu lieben gelernt!
Unser Herz ist des Vogels,
Ist des Meeres und Walds, und wir nennen
Sklaven und Elende Brüder,
Nennen mit Liebesnamen noch Tier und Stein.
So auch werden die Bildnisse
Unsres vergänglichen Seins
Nicht im harten Steine uns überdauern;
Lächelnd werden sie schwinden
Und im flüchtigen Sonnenstaub
Jeder Stunde zu neuen Freuden und Qualen
Ungeduldig und ewig auferstehn.
Legende vom indischen König
Es war im alten Indien der Götterzeit, noch viele Jahrhunderte vor dem Erscheinen Gotama Buddhas, des Erhabenen, da wurde einstmals ein neuer König von den Brahmanen geweiht. Dieser junge König genoß die Freundschaft und Belehrung zweier Weisen, welche ihn lehrten, sich durch Fasten zu heiligen, die dem Blut innewohnenden Stürme seinem Willen zu unterwerfen und sein Denken zum Verständnis des All-Einen vorzubereiten.
Es war nämlich zu jener Zeit unter den Brahmanen ein eifriges Streiten über die Eigenschaften und Befugnisse der Götter, über das Verhältnis des einen Gottes zum andern und über das Verhältnis eines jeden zum All-Einen. Manche Denker hatten begonnen, das Dasein jeglicher Gottheiten zu leugnen, indem sie die Namen der verschiedenen Götter nur als Namen der wahrnehmbaren Teile des unsichtbaren Einen gelten lassen wollten. Andre bestritten diese Auffassung heftig, sie beharrten bei den alten Gottheiten, ihren Namen und Bildern, und sie wollten gerade das All-Eine nicht als etwas Wesenhaftes, sondern nur als einen Namen für die Gesamtheit aller Götter erklärt wissen. Ebenso wurden die in den Hymnen enthaltenen heiligen Worte von den einen als erschaffen und wandelbar, von den anderen als ur-wesenhaft, ja als das allein Unwandelbare aufgefaßt. Hier sowohl wie auf allen andern Gebieten der heiligen Erkenntnis äußerte sich das Streben nach der letzten Wahrheit in einem Zweifeln und Streiten darüber, was Geist selbst und was nur Name sei, obwohl einzelne auch diese Unterscheidung noch verwarfen und Geist und Wort, Wesen und Gleichnis für untrennbare Einheiten ansahen. Beinahe zwei Jahrtausende später haben sich die edelsten Geister des abendländischen Mittelalters über beinahe dieselben Punkte gestritten. Und hier wie dort gab es neben den ernsten Denkern und selbstlosen Kämpfern eine Menge von fetten Pfaffen, die ohne Geist und ohne Hingabe einfach sich dafür einsetzen, daß keine Schwächung des Ansehens von Opfer und Priesterschaft eintrete, daß Freiheit des Denkens und Freiheit in der Auffassung der Götter nur ja nicht dazu führen möge, die Macht und das Einkommen der Priester zu vermindern. Sie sogen das Volk nicht wenig aus; wem ein Sohn oder eine Kuh krank wurde, der bekam für Tage und Wochen die Pfaffen ins Haus und konnte sich an den Opfergaben verbluten.
Auch jene beiden Brahmanen, deren besonderen Unterricht der nach Erkenntnis dürstende König genoß, waren untereinander uneins über die letzte Wahrheit. Da sie alle beide im Rufe außerordentlicher Weisheit standen, betrübte es den König oftmals, ihre Uneinigkeit anzusehen, und häufig dachte er bei sich: »Wenn diese zwei Weisesten über die Wahrheit nicht einig werden können, wie soll da ich, der ich wenig gelehrt bin, jemals ein Wissender werden können? Wohl zweifle ich nicht, daß es nur eine einzige und unteilbare Wahrheit geben kann; doch scheint es mir selbst für Brahmanen unmöglich, sie mit Sicherheit zu erkennen.«