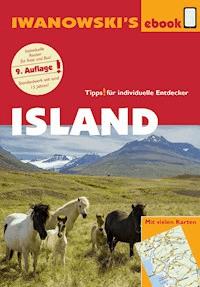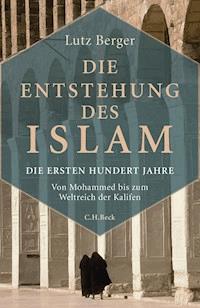
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Innerhalb von nur hundert Jahren entstanden der Islam und das Weltreich der Kalifen und veränderten tiefgreifend die politischen und kulturellen Koordinaten der Welt. Lutz Berger erklärt dieses "Wunder" aus dem Wandel der spätantiken Gesellschaften und beschreibt anschaulich, wie sich der Islam Hand in Hand mit den arabischen Eroberungen formiert hat. Über das plötzliche Auftauchen des Islams im 7. Jahrhundert ist viel spekuliert worden: Handelte es sich ursprünglich um eine christliche oder jüdische Sekte? Auf welche Quellen geht der Koran zurück? Lutz Berger zeigt auf der Grundlage neuester Forschungen, wie sich in der Konkurrenz monotheistischer Erlösungsreligionen von Mekka aus eine arabische Spielart mit eigenem Propheten und heiligem Buch verbreitete und die zersplitterte arabische Halbinsel befriedete. Dies war die Voraussetzung für weiträumige Eroberungen, die überall da erstaunlich reibungslos verliefen, wo man sich dem Zugriff des byzantinischen oder sassanidischen Großreichs entziehen wollte. Durch die Aufnahme des persischen Erbes entstand eine ganz neue Kultur, die die Zivilisation der Antike bewahrte - während der Nordwesten Europas kulturell zurückfiel. Lutz Berger vollbringt das Kunststück, den Aufstieg des Islams ganz aus den Bedingungen der Zeit zu erklären und zugleich in eine welthistorische Perspektive zu stellen, die das Buch zu einer faszinierenden Fallstudie über die Geburt von Imperien macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
LUTZ BERGER
DIE ENTSTEHUNG DES ISLAM
Die ersten hundert Jahre
Von Mohammed bis zum Weltreich der Kalifen
C.H.Beck
ZUM BUCH
Über das plötzliche Auftauchen des Islam im 7. Jahrhundert ist viel spekuliert worden: Handelte es sich ursprünglich um eine christliche oder jüdische Sekte? Auf welche Quellen geht der Koran zurück? Lutz Berger zeigt auf der Grundlage neuester Forschungen, wie sich in der Konkurrenz monotheistischer Erlösungsreligionen von Mekka aus eine arabische Spielart mit eigenem Propheten und heiligem Buch verbreitete und die zersplitterte Arabische Halbinsel befriedete. Dies war die Voraussetzung für weiträumige Eroberungen, die überall da erstaunlich reibungslos verliefen, wo man sich dem Zugriff des byzantinischen oder sassanidischen Großreichs entziehen wollte. Dabei entstand eine ganz neue Kultur, die die Zivilisation der Antike bewahrte – während der Nordwesten Europas kulturell zurückfiel. Lutz Berger vollbringt das Kunststück, den Aufstieg des Islam ganz aus den Bedingungen der Zeit zu erklären und zugleich in eine welthistorische Perspektive zu stellen, die das Buch zu einer faszinierenden Fallstudie über die Geburt von Imperien macht.
ÜBER DEN AUTOR
Lutz Berger ist Professor für Islamwissenschaft und Turkologie an der Universität Kiel. Zahlreiche Veröffentlichungen zum vormodernen Islam sowie zum Islam in der Gegenwart.
INHALT
VORWORT
I.: GESELLSCHAFT UND RELIGION IN DER SPÄTANTIKE
Das Ende der antiken Welt?
Der Erfolg des Christentums
Innerchristliche Lehrstreitigkeiten
Zoroastrismus und Manichäismus
Von Priestern zu Schriftgelehrten: Das Judentum
II.: DIE ANTIKEN GROSSREICHE IM 6. JAHRHUNDERT
1. Das Römische Reich
Die Teilung
Konstantinopel
Zentralisierung der Macht
Justinian und die renovatio imperii
2. Das Sassanidenreich
Von den Parthern zu den Sassaniden
Die Könige und der Adel
III.: DIE KRISENPERIODE DES 6. UND 7. JAHRHUNDERTS
1. Der Wandel des Klimas
2. Die Pest: ein Zeichen göttlichen Zorns?
3. Gefahr aus der Steppe
4. Der große Krieg
Ein Militärputsch mit Konsequenzen
Die Römer am Abgrund
Ein teurer Sieg
IV.: DIE EINIGUNG DER ARABISCHEN HALBINSEL
1. Die Araber
Eine Stammesgesellschaft
Grenzgänger
2. Nomaden und Sesshafte
3. Religionen in Arabien
Die Idee der Vergänglichkeit
Götter als Dienstleister
Jüdische und christliche Araber
4. Mekka
Stadt des Handels und des Kultes
Das mekkanische Heiligtum
Ein unerwünschter Prophet
5. Medina
Die Auswanderung (Hedschra)
Der Kampf gegen die Mekkaner
Krieg und Gemeinschaftsstiftung
6. Die Gläubigen und der Dschihad
Glaube und Islam
Der Dschihad
7. Krise und Stabilisierung
Der Tod des Propheten
Der «Abfall» der Stämme
V.: DIE MUSLIMISCHE EXPANSION
1. Syrien
Syrien vor dem Islam
Von Beutezügen zur Eroberung
Von der Peripherie ins Zentrum: Das Syrien der Umaiyaden
2. Der Irak
Fruchtbares Zweistromland
Von der Eroberung erzählen
Der Zerfall der sassanidischen Macht im Zentrum
Die Muslime richten sich ein
3. Das iranische Hochland
Das Ende der Sassanidenherrschaft
Alte und neue Eliten
4. Zentralasien
Kaufleute und Steppenherrscher
Schwieriger Vorstoß nach Samarkand
5. Ägypten
Eine besondere Provinz
Leichte Beute
Von indirekter Herrschaft zu direkter Kontrolle
6. Der Maghreb
Religiöse Zwistigkeiten
Die Unbeliebtheit der römischen Herrschaft
Eroberung und Widerstand
7. Al-Andalus
Eine Welt voller Konflikte: das westgotische Spanien
«Al-Andalus»: ein rätselhafter Name
Das Jahr 711
Araber und Berber
VI.: DIE ENTSTEHUNG DER MUSLIMISCHEN WELT
1. Expansion und Bürgerkriege
Die Politik der ersten drei Kalifen
Die Partei Alis (schi‛at ‛Alī)
Der Erfolg der Umaiyaden
2. Das Wachstum staatlicher Strukturen
Die Schwächung der Stammesverbände
Die Versorgung der Truppen
Vereinheitlichung und Zentralisierung
Die Rolle der Kalifen
3. Vom Koran zum Islam
War der frühe Islam eine christliche Häresie?
Auf dem Weg zur Universalreligion
NACHWORT: DIE GEBURT DES ISLAM IN DER SPÄTANTIKE
ANHANG
ZEITTAFEL
GLOSSAR
ANMERKUNGEN
Vorwort
Gesellschaft und Religion in der Spätantike
Die antiken Großreiche im 6. Jahrhundert
Die Krisenperiode des 6. und 7. Jahrhunderts
Die Einigung der Arabischen Halbinsel
Die muslimische Expansion
Die Entstehung der muslimischen Welt
Nachwort: Die Geburt des Islam in der Spätantike
LITERATUR
BILDNACHWEIS
REGISTER
Dem Andenken meines Vaters Manfred Berger, der meine Neugierde geweckt hat, dessen Neugierde nie gestillt war
Karte 1: Reiche und Religionen um 600
Karte 2: Der Siegeszug des Islam 622–750
VORWORT
Der Islam und die Muslime sind in diesen Tagen Gegenstand aufgeregter Debatten, in denen von verschiedensten Seiten – von den Feinden der Muslime, nicht selten aber auch von ihnen selbst – die im Vergleich mit anderen Religionen strukturelle Andersartigkeit des Islam hervorgehoben wird. Viele sogenannte Islamkritiker meinen, dass alles Denken und Tun der Muslime bereits in einem wörtlich zu verstehenden Koran vorgezeichnet sei und sehen im Propheten Mohammed einen direkten Wegbereiter heutiger militanter Bewegungen Konservativ-traditionalistische Muslime argumentieren ganz anders, aber oftmals genauso unhistorisch, und zeichnen von der Frühzeit des Islam das idealisierte Porträt eines Zeitalters der Glückseligkeit, von dessen Errungenschaften wir Heutigen alles lernen könnten, was wir brauchen, um die Probleme der Gegenwart zu lösen. Beiden Sichtweisen ist gemeinsam, dass sie den entstehenden Islam aus seinem historischen Kontext herauslösen, um mit ausgewählten Bildern und Versatzstücken zu erklären, warum ihre Sicht auf die Gegenwart die einzig mögliche und einzig richtige ist.
Dieses Buch möchte weder die Ursachen von Krieg und Gewalt in der gegenwärtigen islamischen Welt erklären noch zeigen, was wir von Mohammed und seinen ersten Anhängern für unser heutiges Leben lernen können. Die Denkweisen und Probleme der spätantiken Menschen unterscheiden sich grundlegend von unseren. Es gibt keinen direkten Bezug von ihnen zur Gegenwart. Aber deshalb ist ihre Welt für uns nicht unwichtig. Vieles von dem, was unsere Zeit ausmacht, hat hier angefangen. Die beiden Seiten des Mittelmeers, die über Jahrhunderte eine Einheit gebildet hatten, begannen sich auseinander zu bewegen. Manches, was damals seinen Ausgang nahm und die Geschichte über viele Jahrhunderte prägte, hat sich heute in sein Gegenteil verkehrt: In der Spätantike setzte in den Gesellschaften Westeuropas ein Rückschritt in der Entwicklung ein; der Süden und Osten der Mittelmeerwelt dagegen blieb wohlhabend und öffnete sich bis nach Zentralasien, was den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch ungemein beflügelte.
Niemand, den man im Jahr 632, kurz vor Beginn der muslimischen Eroberungen, danach gefragt hätte, hätte im Entferntesten damit gerechnet, dass innerhalb weniger Jahre das Christentum in Ägypten oder Syrien von einer Religion der Herrscher zu einer der Untertanen werden würde. Selbst wenn man das für möglich gehalten hätte, wäre man wohl davon ausgegangen, dass die iranischen Zoroastrier, deren Herrscher Anfang des 7. Jahrhunderts das Römische Reich in einem langen Krieg fast vernichtet hätten, an die Stelle der christlichen Kaiser und ihrer Bischöfe treten würden. Dass die Macht irgendwann in den Händen der Menschen der Arabischen Halbinsel liegen könnte und diese eine neue Religion mitbringen würden, die schließlich (allerdings Jahrhunderte später) das Christentum in seinen Ursprungsregionen fast ganz verdrängen würde, das hätte jeder halbwegs Vernünftige für vollkommen ausgeschlossen gehalten. Zu erklären, wie das scheinbar Unmögliche dennoch eintreten konnte, ist Gegenstand dieses Buches.
Dazu müssen wir die Entstehung des Islam als Religion und die Bildung des Weltreichs, das von den frühen Anhängern dieser Lehre gegründet wurde, aus den Bedingungen der Zeit heraus verstehen. Wir müssen die religiösen und gesellschaftlichen Gegebenheiten in den damaligen Großreichen und auf der Arabischen Halbinsel kennenlernen und uns mit den Krisen auseinandersetzen, die diese scheinbar so stabile Welt anfällig gemacht haben. Wir werden zu untersuchen haben, welche Bedingungen die arabisch-muslimischen Heere in den Ländern vorfanden, die sie eroberten, und wie die Eroberung diese Länder, jedes auf seine Weise, verändert hat. Verändert hat sich damit aber nicht nur die Welt der Unterworfenen. Macht und Reichtum brachten auch für die Muslime Konflikte mit sich, deren Folgen sie zum Teil noch heute spalten.
Wenn hier der Versuch unternommen wird, die Entstehungsgeschichte des Islam zu schreiben, dann ist das nur möglich, weil gerade in den letzten Jahren wichtige Arbeiten erschienen sind, die ein neues Licht auf die Epoche geworfen haben. Aziz al-Azmeh hat eine umfassende Analyse der Religionsgeschichte der Spätantike und des entstehenden Islam vorgelegt.[1] Von großer Bedeutung sind auch die Überlegungen Fred M. Donners zum Charakter der von Mohammed gestifteten Religion, selbst wenn ich ihm in seiner zentralen These, diese sei zunächst eine Art ökumenischer Bewegung gewesen, nicht folge.[2] Die Militär- und Ereignisgeschichte der Eroberungen haben jüngst Hugh Kennedy[3] und Robert G. Hoyland[4] neu und lesenswert dargestellt. In weiten Teilen der deutschsprachigen Islamwissenschaft war das Forschungsinteresse in den letzten Jahren ganz auf die ebenso wichtige wie komplexe Frage konzentriert, wie zuverlässig die muslimische historische Überlieferung ist. Dieser auf Albrecht Noth zurückgehende Forschungsansatz wird gegenwärtig von Andreas Görke,[5] Marco Schöller,[6] Jens Scheiner[7] und anderen weiterverfolgt. Ohne diese Sensibilisierung gegenüber den Problemen der Überlieferung bliebe jede Darstellung frühislamischer Geschichte naiv.
In diesem Buch wird aber etwas anderes im Mittelpunkt stehen. Es soll weniger um Ereignisgeschichte oder die Probleme der muslimischen historiographischen Überlieferung gehen, und auch eine Religionsgeschichte des frühen Islam im engeren Sinne ist nicht das Ziel. Ich möchte vielmehr die Geschichte frühislamischer Gesellschaften als Beispiel für die Entstehung von Imperien darstellen und sie dabei in ihre zeitgenössische Umwelt einbetten. Damit zeichnet sich eine Reihe von zentralen Fragen ab: Warum wurden die Bewohner der Arabischen Halbinsel nicht Christen wie die meisten anderen Gruppen an der Peripherie des Römischen Reiches in der Spätantike? Oder anders gefragt: Wieso entstand als letzte der großen Erlösungsreligionen auf der Arabischen Halbinsel der Islam? Warum versuchten die Muslime bald nach der Stiftung ihrer Religion weite Teile der Welt zu unterwerfen? Warum hatten sie wider alle Erwartung bei diesem Unterfangen auch noch Erfolg? Welche Rolle spielten dabei die politischen Strukturen und sozialen Verhältnisse in den unterworfenen Ländern? Schließlich, in welcher Beziehung stand das alles zum allgemeinen Wandel der Gesellschaften der Mittelmeerwelt zwischen 550 und 750, das heißt in der Zeit des Übergangs von der Antike zum Mittelalter?
Ob mein Versuch gelungen ist, müssen die Leserinnen und Leser entscheiden. Dass ich ihn gewagt habe, ist nicht zuletzt Ulrich Nolte vom Verlag C.H.Beck zu verdanken, den ich sehr schnell für dieses Projekt gewinnen konnte und der mit großer Geduld und klugen Ratschlägen die Entstehung des Buches begleitet hat.
Sabine Höllmann danke ich für aufmerksame Lektüre und stilistische Verbesserungen. Mein Dank gilt auch Dirk Pförtner, der wie immer alles, was ich geschrieben habe, mit Geduld und ohne falsche Nachsicht einer kritischen Sichtung unterzogen hat. Was ich ihm sonst schulde, weiß er selbst. Gelesen, mit wichtigen Anmerkungen versehen und kritisch hinterfragt haben den Text zudem Arash Guitoo und Judith Wiesehöfer, in Teilen Svenja Budziak, Saskia Landser, Florian Remien, Tom Schoroth und Janek Zech. Was an Fehlern und Unklarheiten verbleibt, geht selbstverständlich auf mein Konto.
Einen Teil meiner Thesen habe ich mit Josef Wiesehöfer diskutieren können, andere habe ich im Rahmen der von Robert Rollinger organisierten Melammu-Tagung in Obergurgl 2013 einem althistorischen und altorientalistischen Publikum vorstellen dürfen. Auch durch Gespräche mit Kai Ruffing und Hartmut Leppin am Rande der Tagung Empires to be Remembered in Wien im Jahr 2015 habe ich meinen Blick schärfen und einzelne Probleme der Darstellung lösen können.
Gewidmet ist dieses Buch meinem Vater Manfred Berger, dessen überraschender Tod kurz vor Fertigstellung des Manuskripts eine nicht zu schließende Lücke in meinem Leben hinterlassen hat.
I.
GESELLSCHAFT UND RELIGION IN DER SPÄTANTIKE
Das Ende der antiken Welt?
Wenn die Erde erbebt und ihre Last an Toten ausstößt und der Mensch sagt: «Was ist mit ihr?» – an jenem Tag erzählt sie, was sie zu berichten hat. Dein Herr hat es ihr eingegeben. An jenem Tag kommen die Menschen einzeln aus den Gräbern heraus, um ihre Werke zu schauen: Wer das Gewicht eines Staubkorns an Gutem getan hat, der sieht es. Wer das Gewicht eines Staubkorns an Bösem getan hat, der sieht es.[1]
So lesen wir in az-Zilzāl, «Das Beben», der 99. Sure des Koran. Mohammed und sein Umfeld waren davon überzeugt, dass das Ende der Zeiten nicht mehr fern sei. Das galt vor allem in den Anfängen seiner Predigt und gab der Aufforderung des Propheten, sich zu bekehren, eine besondere Dringlichkeit.[2] Die mekkanischen Heiden, so wird ihnen im Koran vorgeworfen, lebten sorglos im Diesseits. Dies sei ein ungeheurer Fehler, könne doch die letzte Stunde jederzeit hereinbrechen. Wer dann nicht gerüstet sei, dem drohe furchtbares Ungemach. Nur eine rasche Bekehrung zur Botschaft des Propheten könne sicheren Schutz gewähren. Die apokalyptischen Bilder, die die Anfänge der koranischen Offenbarung prägen, mögen uns fremdartig anmuten. Sie zeigen aber, wie sehr die Araber zur Zeit Mohammeds bereits mit religiösen Vorstellungen ihrer Umwelt vertraut waren. Apokalypsen und Höllenvisionen gehörten seit Jahrhunderten zum Grundstock der religiös-politischen Literatur sowohl von Christen und Juden als auch ihnen verwandter Gruppen. Im frühen 7. Jahrhundert erfreuten sie sich vor allem unter den Juden einer besonderen Konjunktur.
Die Idee des baldigen Weltendes verlor in den späteren Offenbarungen an Relevanz. Nach 622 begannen die Muslime mit immer größerem Erfolg, ihrer Sache im Diesseits Geltung zu verschaffen. Darüber geriet das Jenseits ein wenig aus dem direkten Blickfeld. Wem Gott diese Welt untertan gemacht hat, der findet nicht, dass es mit ihr ganz so eilig zu Ende gehen muss, wie jemand, der sich in die Ecke gedrängt und schwach sieht.[3] Die Gründe für den Erfolg der Muslime sind der Gegenstand dieses Buches.
Das koranische Zitat mit seiner furchterregenden Vision spricht vom Ende der Welt. In gewisser Weise war auch das Entstehen des Islam selbst Teil eines Weltendes: Sein Aufstieg gehört zu den Vorgängen, die das Ende der Antike prägten. Doch solange das große Weltende nicht eintritt, das die heute gerne als abrahamitisch bezeichneten Religionen seit vielen Jahrhunderten ankündigen, geht die Weltgeschichte weiter. Es gibt nur eine Beschleunigung von Wandlungsprozessen, deren Ursprünge oft weit vor der postulierten Epochengrenze und deren Abschluss weit danach anzusiedeln sind. Ein Einzelphänomen, und sei es so bedeutend wie die Entstehung und Ausbreitung der heute zweitgrößten Weltreligion, ist immer nur ein Baustein unter vielen in einem derartigen Prozess. Gleichzeitig ist es unabdingbar, sich diesen Prozess der Veränderung genauer vor Augen zu führen, um die Entstehung des Islam als Religion und des Weltreiches der Muslime zu erklären. Bevor wir uns mit den Muslimen beschäftigen, liegt es deshalb nahe, einen ausführlichen Blick auf jene Welt zu werfen, die den Islam und das Reich der Muslime hervorgebracht hat: die Welt zwischen Mittelmeer und Zentralasien am Übergang von der Antike zum Mittelalter.
Die Verwandlung der Zivilisation der klassischen Antike in etwas Neues fand im Westen der Alten Welt ebenso statt wie im Osten, jedoch unter ganz verschiedenen Voraussetzungen und mit unterschiedlichen Folgen. Wie bereits vor der Eingliederung in das Römische Reich wurde der Westen für einige Jahrhunderte wieder zu einer Randzone der Welt. Die Vereinfachung der politischen Strukturen ging Hand in Hand mit der Reduzierung der kulturellen Welt der Eliten. Nach dem 7. Jahrhundert waren in Westeuropa Lesen und Schreiben nicht mehr selbstverständliche Fertigkeiten eines Angehörigen der Oberschicht. Die eleganten Villen der spätantiken Aristokratie waren wenig komfortablen Behausungen gewichen; die Städte waren verschwunden. Inwieweit von einem «Ende des Wohlstandes» auch für einfache Schichten der ländlichen Bevölkerung gesprochen werden muss, ist strittig.[4]
Im Osten der Mittelmeerwelt fand trotz aller Krisen dieser Zusammenbruch staatlicher und gesellschaftlicher Strukturen zwischen dem 4. und 9. Jahrhundert nicht in gleicher Weise statt. Doch auch hier blieb nicht alles beim Alten: Die Städte veränderten ihr Gesicht. Die geraden Straßen der klassischen antiken Stadt mit ihren weithin sichtbaren Monumenten wichen engen, gewundenen Gassen. Metropolen lagen nicht mehr an den Küsten, sondern im Landesinneren. Handelskarawanen benutzten Kamele statt Wagen. Das südliche und östliche Mittelmeer, Iran und Zentralasien rückten enger zusammen. Viele dieser Prozesse hatten bereits deutlich vor dem 7. Jahrhundert eingesetzt, andere waren eine Folge der islamischen Eroberungen. Gegen Mitte des 8. Jahrhunderts war das Arabische zur Sprache der Verwaltung und der Herrschaftsschicht geworden. Als Sprache der Wissenschaft war es noch weitgehend auf die islamische Religionsgelehrsamkeit beschränkt. Der Islam blieb einstweilen fast überall die Religion einer Minderheit, doch auch in religiöser Hinsicht hatte die spätantike Welt begonnen, ihr Gesicht entscheidend zu verändern.
Die islamischen Eroberungen und ihre Folgen hatten Anteil an diesen Veränderungen wie auch an der Bewahrung antiker Strukturen. Gleichzeitig waren die Muslime und der Erfolg ihrer Eroberungen selbst in der spätantiken Welt verankert. Es gilt also die Anfänge des Islam und muslimischer Reichsbildungen nicht isoliert zu betrachten, sondern sie als Teile ihrer antiken Umwelt zu verstehen. Diese hatte sich seit der Zeitenwende in vielerlei Hinsicht einschneidend verändert. Das Römische Reich der frühen Kaiserzeit war kein Staat im engeren Sinne gewesen. Es handelte sich eher um eine recht lockere Föderation von Städten (zuweilen auch Fürstentümern und Stammesverbänden), die ihre inneren Angelegenheiten selbständig regelten. Führend waren meist Großgrundbesitzer, deren agrarischer Reichtum es ihnen ermöglichte, den Städten, in denen sie wohnten, großzügige öffentliche Gebäude zu stiften oder kultische Veranstaltungen, auch Theateraufführungen oder Wettspiele zu finanzieren. Durch die Verleihung des römischen Bürgerrechts und manchmal auch durch die Integration in die imperiale Verwaltungselite wurden diese Eliten an die Zentrale gebunden. Für den Zusammenhalt des Reiches jenseits dieser Schicht spielte darüber hinaus die Stationierung römischer Truppen eine große Rolle. Die Veteranen ließen sich vielfach am Ort ihres letzten Kommandos nieder und heirateten einheimische Frauen. Einen gewissen Abschluss fand der Prozess der politischen wie identitären Vereinheitlichung des Reiches im Jahr 212 mit der Verleihung des römischen Bürgerrechts nicht nur an die Eliten oder altgediente Soldaten, sondern an nahezu alle Reichsbewohner. Kulturelle Differenzen bestanden allerdings fort. So waren Latein und Griechisch längst nicht die Muttersprache aller geworden. Problematisch war dies kaum. Als das Reich im 3. Jahrhundert in die Krise geriet, lag das nicht am Widerstand gegen den kulturellen Homogenisierungsprozess, der in den ersten beiden Jahrhunderten nach Christus stattgefunden hatte. Grund war vielmehr der zunehmende Druck auf die Außengrenzen. Zum Teil war dies gerade ein Ergebnis des Erfolgs des Imperiums. Der von ihm vermittelte Kontakt der nördlichen Nachbarvölker mit der Kultur der Mittelmeerwelt hatte unter diesen zur sozialen Ausdifferenzierung und zur Bildung größerer und damit gefährlicherer politscher Verbände geführt. Sich gegen diese zu sichern erforderte andere Ressourcen, als es die Abwehr der schlechter organisierten Barbaren früherer Zeiten verlangt hatte.[5]
Noch problematischer war, dass auch im Osten der Mittelmeerwelt zu Beginn des 3. Jahrhunderts ein Prozess der Herrschaftsverdichtung einsetzte. Das Partherreich war mit dem Zusammenbruch der Seleukidenherrschaft östlich des Euphrat im 2. Jahrhundert vor Christus zu einem Nachbarn der Mittelmeerwelt geworden. Es erstreckte sich vom Zweistromland bis nach Zentralasien. Wir wissen über die inneren Verhältnisse des Partherreiches sehr viel weniger als über die griechisch-römische Welt. Es sieht aber so aus, als sei auch dieses Herrschaftsgebilde im Wesentlichen eine Föderation mächtiger lokaler Eliten, insbesondere von adeligen Familienverbänden, gewesen. Die Könige der Parther respektierten ebenfalls anfangs die Autonomie der im Osten im Vergleich mit der Mittelmeerwelt allerdings weniger zahlreichen Städte. Das Verhältnis zwischen Parthern und Römern war seit der Zeitenwende zwar immer wieder von Spannungen gekennzeichnet, doch letztlich stabil. Katastrophale Niederlagen oder spektakuläre Siege blieben die Ausnahme. Zu Beginn des 3. Jahrhunderts wurden die Parther durch die aus der Persis, der Region um das heutige Schiras, stammenden Sassaniden abgelöst. Welche Veränderungen der Herrschaftswechsel in der Reichsstruktur mit sich brachte, ist immer noch nicht endgültig geklärt und wird uns näher beschäftigen. Offenkundig ist jedenfalls, dass die Sassaniden bald nach ihrer Machtübernahme den Druck auf die Römer deutlich erhöhten. Sie fügten ihnen gewaltige militärische Niederlagen zu und konnten dabei Kaiser und ganze Armeen gefangen nehmen.[6]
Diese Situation des verschärften Konflikts mit den sassanidischen Konkurrenten im Osten und der zunehmenden Möglichkeiten der Barbaren an der nördlichen Peripherie hatte Konsequenzen. Eine Militarisierung des politischen Systems und eine Verschiebung von Ressourcen hin zu Staat und Armee schienen auch bei den Römern unvermeidlich. Die römische Zentrale, und nur hier können wir Zahlen wenigstens realistisch schätzen, hatte in den ersten beiden Jahrhunderten der Kaiserzeit etwa 5 Prozent des Einkommens der Reichsbevölkerung für sich beansprucht. Diese Steuerquote war im 4. Jahrhundert auf 10 Prozent angestiegen. Um die Ressourcenverschiebung zu bewerkstelligen, war eine Verstärkung der zentralen Kontrolle über die Menschen in den Provinzen zwingend notwendig. Die Autonomie der Städte wurde eingeschränkt, und die Zentralregierung versuchte, das Leben der Untertanen bis in jedes Detail zu regeln. Einschlägige Gesetze zur Berufswahl der Untertanen (als solche wurden die Bewohner des Reiches jetzt zunehmend gesehen) oder zur Festlegung von Preisen haben in der Forschung zur Vorstellung vom spätantiken Zwangsstaat geführt, der überall in das Leben der Menschen eingreift. Diese Ideen sind stark von der Erfahrung der Totalitarismen des 20. Jahrhunderts geprägt und verkennen völlig die logistischen Möglichkeiten antiker Staatlichkeit. Im Vergleich zu Staaten der frühen Neuzeit waren die Reiche der Spätantike deutlich unteradministriert. Edikte über Höchstpreise für Waren konnten hier und da durchgesetzt werden, auf Dauer und flächendeckend war das mit den zur Verfügung stehenden Mitteln indes nicht denkbar. Dennoch gab es in der Spätantike einen deutlichen Entwicklungssprung hin zu größeren zentralen administrativen Strukturen. Locker gefügte Imperien begannen sich zu Staaten zu entwickeln. Derartige Entwicklungssprünge finden nicht ohne Konflikte und auch nicht linear statt. Versuche, zentrale Verwaltungen auf Kosten lokaler Interessengruppen zu stärken, und der Widerstand dagegen prägten die Geschichte beider Großreiche in den Jahrhunderten vor der Geburt des Islam.[7]
Der Erfolg des Christentums
Die Stärkung von zentralen Strukturen stand in engem Zusammenhang mit dem religiösen Wandel, der die Welt westlich von Indien um die Zeitenwende erfasste und in seinen Konsequenzen noch weit folgenreicher war als die Verdichtung von Herrschaft.[8] Die religiösen Kulte der klassischen Antike unterschieden sich deutlich von dem, was man heute gemeinhin unter einer Religion versteht. Das gilt zunächst einmal für die Variabilität, mit der uns das Religiöse in der antiken Welt entgegentritt. Was im Folgenden gesagt wird, kann auf diese Variabilität nur unzureichend Rücksicht nehmen. Oft waren religiöse Kulte eng an eine bestimmte politische Gemeinschaft gebunden. So gab es beispielsweise Götter eines Reiches, einer Stadt oder ethnischen Gruppe. Ihre Verehrung diente sowohl der Versinnbildlichung dieser Gemeinschaft als auch der Sicherstellung ihres Wohlergehens. Genau deshalb war die Weigerung der Christen, sich am Kaiserkult und anderen römischen Staatskulten zu beteiligen, eine so große Provokation.
In die Vielgestaltigkeit der religiösen Vorstellungen wurde im Laufe der antiken Geschichte langsam Ordnung gebracht. Die lokalen Götter und Kulte wurden mühselig in die Mythen, die man seit Homer und Hesiod von den Göttern erzählte, eingepasst. Letztlich waren aber die Mythen weit weniger wichtig als der ordnungsgemäße Vollzug der Riten. Diese konnten von Ort zu Ort und von Gott zu Gott verschieden sein. Die Existenz eines Gottes oder eines Kultes schloss die anderer keinesfalls aus. Seit altorientalischer Zeit war sogar der absichtliche Import, ja selbst der Raub von Göttern mit dem Ziel, sich auch ihres Schutzes zu versichern oder ihre gehorsame Unterwerfung unter den eigenen Hauptgott zu versinnbildlichen, eine gängige Praxis.
Diese Kulte bezogen sich, wie gesagt, in erster Linie auf die politische Gemeinschaft. Für individuelle Nöte machten sie nur bedingt ein Angebot. Das galt vor allem für die Zeit nach dem Tod. In vielen Kulturen der Antike war die Idee, dass es nach dem Tod ein sinnerfülltes Weiterleben im Jenseits gebe, nicht verbreitet. Zwar war es denkbar, dass die Seelen der Verstorbenen fortbestehen. Einige wenige, die sich furchtbarer Verbrechen schuldig gemacht hatten, waren im Jenseits zu Marterqualen verurteilt, andere aufgrund ihrer Heldentaten zu den Göttern aufgestiegen. Eigentlich betraf das aber nur ausgewählte Schurken oder Heroen, die zudem, von jüngst vergöttlichten Herrschern abgesehen, meist grauer Vorzeit entstammten. Auf den durchschnittlichen Zeitgenossen wartete nach dem Tod ein vor allem sterbenslangweiliges Schattenreich.[9]
In Konkurrenz zu diesen trübsinnigen Perspektiven breitete sich in der Zeit um Christi Geburt ein Gedanke aus, der mancherorts, etwa in Ägypten, schon länger gängig war: Man meinte nun, es gebe potentiell für alle Menschen die Chance auf ein sinnvolles Weiterleben nach dem Tod. Zudem ließe sich hier auf Erden etwas für die Aufnahme in ein besseres Jenseits tun. Damit war der Weg frei für den Siegeszug solcher Kulte und Religionen, die ihren Gläubigen ein individuelles Heilsversprechen machten. Dieses Heilsversprechen mochte exklusiv für die Initiierten des jeweiligen Kultes gelten, doch das sagte nichts über die Existenz und Legitimität anderer Götter oder Kulte aus.[10]
Ortsfeste Mysterien wie die von Eleusis, die mit einem entsprechenden Angebot auf dem religiösen Markt aufwarteten, hatten aber von vornherein schlechtere Chancen als Religionen, die an verschiedenen Orten praktiziert werden konnten. Eine geringe Rolle spielten auch nach außen eher geschlossene Kulte. Im Parther- und Sassanidenreich verband sich der politische Gemeinschaftskult mit einem Erlösungsversprechen an die Angehörigen der eigenen Gruppe. Eine Mission unter Fremden wurde hier, von Ausnahmen abgesehen, nicht betrieben. Es waren folglich andere Religionen, die die größten Erfolge vorzuweisen hatten: etwa der Isis- und Osiriskult ägyptischen Ursprungs oder der des iranischen Gottes Mithras, der sich vor allem unter römischen Soldaten großer Beliebtheit erfreute.
Diese Götter waren älter als die mit ihnen verbundenen Erlösungshoffnungen und gehörten ursprünglich in das alte Konzept von lokal-politischer Religion. Sie hatten sich dann aber zu universellen Erlösungsgottheiten entwickelt. Auch der Gott Israels hatte um Christi Geburt den Wandel von der Lokal- zur Universalgottheit seit einigen Jahrhunderten zu guten Teilen vollzogen. Nachdem Kaiser Titus als Reaktion auf den jüdischen Aufstand im Jahr 70 den Tempel in Jerusalem hatte zerstören lassen, wurde das Judentum endgültig zu einer Religion, die überall praktiziert werden konnte. Anstelle der Priester prägten die Schriftgelehrten, die auch die Träger der Erlösungslehre waren, von nun an die Religion.
Über lange Jahrhunderte übte das Judentum eine ausgesprochen große Anziehungskraft auf die Menschen aus.[11] Obwohl im Gegensatz zu den Christen von aktiver Mission nicht gesprochen werden kann, hatte das Judentum in der Spätantike vom Atlantik bis womöglich nach Indien[12] und im Süden bis nach Äthiopien und Arabien Anhänger, deren große Zahl anders als durch massive Übertritte nicht zu erklären ist. Die Universalisierung der Religion nach der Lösung von einem festen Kultort litt allerdings darunter, dass unter den Juden im Römischen Reich nach dem Scheitern ihrer Aufstände eine gewisse Tendenz zur Abschließung einsetzte. Dies war auch eine Reaktion auf die aktive Missionsarbeit der Christen und die Konflikte, die die Existenz einer dem Judentum eng verwandten, aber aus der Sicht der römischen Behörden neuen und illegitimen Religion mit sich brachte. Im sassanidischen Raum, wo diese Probleme nicht bestanden, scheint die Zahl der zum Judentum Bekehrten erst im 5. Jahrhundert zurückgegangen zu sein.[13]
Das Judentum war durch die Vormachtstellung, die die Schriftgelehrten zunehmend im religiösen Feld besaßen, zu einer für Konvertiten recht anspruchsvollen Religion geworden. Viele, die mit dem Judentum sympathisierten, sahen sich nicht in der Lage, alle Regeln zu erfüllen, die nach Ansicht der Schriftgelehrten die Thora den Gläubigen auferlegte. Sie bewegten sich im Umfeld der jüdischen Gemeinden, ohne wirklich dazuzugehören. Für diese Menschen bedeutete die Herauslösung des Christentums aus dem Judentum eine große Chance. Das Christentum war ursprünglich eine jüdische messianische Gruppe gewesen, in der viele bereits wenige Jahrzehnte nach dem Tod des Religionsstifters meinten, nicht die Zugehörigkeit zum Judentum sei heilsrelevant, sondern das Bekenntnis zu Jesus. Die Christen begannen zunächst im Umfeld der jüdischen Gemeinden, bald auch darüber hinaus für ihre Glaubensvorstellungen zu werben. Nun konnte man sich in die jüdische Tradition stellen, die Heilsversprechen des jüdischen Gottes und des Messias auf sich beziehen, ohne die jüdischen Gebote vollständig erfüllen zu müssen.[14] Gegen Ende des 1. Jahrhunderts wuchs dann unter den Christen die Überzeugung, Jesus sei nicht allein der Messias gewesen, sondern in seiner Person habe sich die Gottheit selbst in der Welt inkarniert. Das späteste der vier kanonischen Evangelien, das Johannesevangelium, legt von diesem Glauben beredtes Zeugnis ab. Vieles hatte das Christentum mit den anderen genannten Religionen gemeinsam. Mit dem Judentum etwa teilte es das Erbe der Geschichtsüberlieferung und der Propheten der hebräischen Bibel.[15] Die Idee des leidenden Gottes findet (wie das Bild der liebenden Gottesmutter) ihre Parallele im Isis- und Osiriskult. Auch zur Religion des Mithras finden sich Parallelen.
Warum hat sich das Christentum, das als einzige der hier genannten Erlösungsreligionen im Römischen Reich vor dem 4. Jahrhundert nie den Status einer religio licita, einer erlaubten Religion, hatte, schließlich durchgesetzt? Eine umfassende Antwort auf diese Frage zu geben, ist nicht Gegenstand dieses Buches. Eine Rolle wird die Abschottung des Judentums gespielt haben, von der bereits die Rede war. Die Christen missionierten sozusagen im gleichen Marktsegment wie das Judentum. Da sie die Bekehrungsarbeit mit deutlich größerem Eifer betrieben und sich Neuzugängen gegenüber weit offener zeigten, ist ihr Erfolg in dieser Hinsicht vielleicht nicht verwunderlich.
Im Vergleich mit dem Isis- und Mithraskult fällt noch etwas anderes auf: Es gibt zwar zahlreiche christliche Schriften des 2. und 3. Jahrhunderts, die von einer Auseinandersetzung mit dem Judentum und vor allem der klassischen Philosophie und dem Heidentum zeugen. Polemik gegen die beiden genannten Mysterienreligionen findet sich aber kaum. Das mag mit einem Umstand zusammenhängen, den die Christen wie so vieles andere aus dem hellenistischen Judentum geerbt hatten. Bereits die Juden der hellenistischen Zeit hatten sich angesichts des damals ungewöhnlichen Exklusivitätsanspruchs ihrer Religion Anfeindungen und Assimilationsdruck ausgesetzt gesehen. Manche wie die Makkabäer oder später die jüdischen Aufständischen des ersten und zweiten Jahrhunderts reagierten darauf mit dem gewalttätigen Versuch der Abgrenzung. Andere bemühten sich, für ihre besonderen religiösen Haltungen friedlich einzutreten, sie der hellenistischen Umwelt in deren eigener Sprache verständlich zu machen. Das war die Sprache der Philosophie.
Das Christentum bestand, anders als Mithras- und Isiskult, von Beginn an nicht allein aus heilsstiftenden Riten, die sich aus einem Mythos heraus begründeten. Es suchte vielmehr ganz in jüdischer Tradition seine Lehren in der Sprache der philosophisch Gebildeten zu erklären. Mythen und Riten waren für diese nur Bilder, in denen sich die tieferen Wahrheiten manifestierten. Viele führende Christen beherrschten die einschlägigen Diskurse. Das Christentum wurde so auch für die Eliten attraktiv. Andererseits war diese «Infektion» des Christentums mit der Vorstellungswelt der hellenistischen Philosophie im weitesten Sinne Ausgangspunkt für viele der Konflikte, die die Christen in der Spätantike spalteten. Ihre Religion bestand eben nicht allein aus Riten und Mythen, die aufgrund ihres unterstellten hohen Alters unhinterfragbar waren und keinen Anspruch auf logische Schlüssigkeit erheben mussten. Das Christentum, sein Mythos und seine Riten waren in der Zeit geboren und mussten mit den Mitteln der Zeit gerechtfertigt werden. So wurde ein umfangreiches Lehrgebäude geschaffen, über dessen Ausgestaltung und Struktur sich trefflich streiten ließ. Nicht mehr allein der Vollzug der richtigen Riten, sondern auch der Glaube an die richtigen Lehrmeinungen war nunmehr entscheidend für die Zugehörigkeit zur wahren Religion.[16]
Doch ehe wir uns mit den Konflikten beschäftigen, die im spätantiken Christentum entstanden und eine nicht zu vernachlässigende Rolle bei den muslimischen Eroberungen spielten, müssen wir noch einmal kurz zur Wahlverwandtschaft von Christentum und (spät-)antiker Philosophie zurückkehren. Christen und Juden waren zu dieser Zeit nicht die einzigen Monotheisten. Auch viele Anhänger der alten Kulte und Mythen neigten monotheistischen Überzeugungen zu. Für die Gebildeten stellten die Mythen der antiken Götter und die Vielzahl ihrer Kulte nichts als altehrwürdige Symbole dar, durch die sich das eine Göttliche manifestierte. Eine Nähe zu den Christen bestand auch im Bereich der Moralvorstellungen. Die unkontrollierte Hingabe an Emotionen wurde von allen großen philosophischen Richtungen der hellenistischen Antike abgelehnt. Insofern war auch die möglichst weitgehende Kontrolle der Sexualität für sie wichtiger Bestandteil eines guten Lebens. Die Sexualfeindlichkeit des frühen Christentums, deren Reste heute eine Vermittlung konservativer christlicher Haltungen in westlichen Industriegesellschaften erschwerten, war in der Spätantike kein Hindernis für die Gewinnung von Anhängern unter den Eliten.[17]
Eine restriktive Sexualmoral war aber nicht das einzige Kennzeichen des spätantiken Christentums. Die Christen propagierten und praktizierten darüber hinaus eine Solidarität mit den Schwachen der Gesellschaft, die den Mysterienkulten und der klassischen antiken Kultur relativ fremd war. Die Idee war aus der jüdischen prophetischen Tradition übernommen und sollte später auch zu den Wesensmerkmalen des Islam gehören.[18]
Um 300 n. Chr. präsentierten sich Juden- und Christentum in ihrer Selbstsicht also nicht als ahistorische, kultzentrierte Glaubenssysteme. Sie waren vielmehr Religionen mit einer historisch präzise zu verortenden Geschichte und bestimmten verbindlichen Lehren. Anders als Kulte sind Lehren potentiell universal. Das gilt aber gleichermaßen für ihren Wahrheitsanspruch. In der Betonung von Lehren liegt daher – genauso wie in einem exklusiven Monotheismus – auch der Samen der Intoleranz. Die diesbezüglichen Thesen von Jan Assmann sind vielfach diskutiert worden. Unabhängig davon, ob sie generell zutreffen, sind sie für die Epoche, die hier im Mittelpunkt steht, nicht ganz von der Hand zu weisen.[19]
Die unterschiedlichen Auffassungen der Christen in Lehrfragen wurden unter anderem deshalb so virulent, weil das Christentum nicht allein im Hinblick auf seine Ideenwelt fest in die Umwelt eingebettet war. Es hat darüber hinaus in sehr viel weitergehendem Maße als irgendeine andere Religion der mittelmeerischen Antike Strukturen geschaffen, innerhalb derer Konflikte über die Lehre ausgefochten wurden. In Ansätzen ist dies bereits vor der rechtlichen Anerkennung des Christentums unter Kaiser Konstantin (reg. 306–337) zu beobachten. Die Errichtung einer überregionalen Kirchenorganisation war aber hauptsächlich ein Produkt der Zeit ab dem 4. Jahrhundert. In der Folge ging der Sieg einer Partei in Fragen der Lehre stets mit ihrer Kontrolle über die Kirche als Apparat einher.[20]
Das Christentum, das Anfang des 4. Jahrhunderts im Römischen Reich zunächst anerkannt wurde, entwickelte sich sehr schnell zu einer offiziell privilegierten Religion. Gleichzeitig betrachtete es der Kaiser nun als seine Aufgabe, Konflikte innerhalb der einzelnen Ortskirchen oder zwischen ihnen zu lösen. Je mehr im Laufe der nächsten Jahrzehnte das Christentum zu einer für alle verbindlichen, mit römischer Identität untrennbar verbundenen Staatsreligion wurde, desto mehr wurde die Definition von Glaubensinhalten auch für die Stabilität des Staates entscheidend. Die Kaiser, die zunächst die Rolle eines Schiedsrichters spielten, sahen es immer mehr als ihre Aufgabe an, selbst Lösungen für Fragen der kirchlichen Disziplin und des Dogmas zu formulieren.
Zunächst einmal waren dafür jedoch die Geistlichen zuständig. Die Ortskirchen wurden der staatlichen Verwaltung des 4. Jahrhunderts gemäß in Provinzen eingeteilt (unser Wort Diözese stammt aus der spätrömischen Verwaltungssprache). Der Metropolit (Erzbischof) sollte jeweils in seiner Kirchenprovinz die Aufgabe eines Aufsehers wahrnehmen. Über den Metropoliten standen die Patriarchen mit Sitzen in Rom, Konstantinopel, Alexandria, Antiochia und Jerusalem, wobei die Patriarchen der ersten vier Sitze häufig in Konkurrenz zueinander standen. Konflikte über Ehrenvorrang, administrative Befugnisse und dogmatische Fragen waren dabei in vielfältiger Weise miteinander verwoben. Letztlich galt für die Kirche wie für die weltliche Verwaltung, dass das entscheidende Kriterium für Position und Einfluss die jeweilige Nähe zur politischen Macht war.[21] Aus dieser Nähe zur Macht erklärt sich, dass in der Spätantike der Patriarch von Konstantinopel, der nur über eine schwache religiöse Legitimation verfügte,[22] zur eigentlich zentralen Gestalt in der Kirche aufstieg. So fanden im Umfeld von Konstantinopel die großen Konzilien statt, und keine der wichtigen Entscheidungen in Kirchenfragen wurde ohne den Bischof der Hauptstadt getroffen. Auf diese Weise waren die Patriarchen von Konstantinopel freilich auch in weit größerem Maße von wechselnden politischen Interessenlagen abhängig. Die vielfach am Rande des politischen Tagesgeschehens stehenden Päpste der Zeit konnten in dogmatischen Fragen eine im Vergleich einheitlichere Haltung vertreten. In dem Moment, in dem, wie nach Justinians Rückeroberung Italiens, die Päpste unter den direkten Zugriff der Kaiser gerieten, erwiesen sie sich bei entsprechendem Druck als genauso wankelmütig wie ihre bischöflichen Amtsbrüder in der Hauptstadt.[23]
Mit der Angleichung an und teilweisen Integration in staatliche Strukturen war aus den Kirchen die Kirche geworden. Der Prozess der Verwandlung einer Föderation der poleis in einen Einheitsstaat, der oben kurz skizziert wurde, hatte seine Parallele in der Kirche gefunden. Im religiösen Bereich wurden Uniformisierung und Bürokratisierung dadurch erschwert, dass hier neben materiellen Interessen Glaubensüberzeugungen eine Rolle spielten. Aufgrund des oben beschriebenen Wandels im Bereich des Religiösen waren diese Überzeugungen von zentraler Bedeutung für das Seelenheil jedes Einzelnen und wurden dementsprechend ernst genommen.
Innerchristliche Lehrstreitigkeiten
Die Christen waren zu Beginn des 4. Jahrhunderts weit überwiegend der Ansicht, dass man es bei Jesus nicht allein mit einem von Gott zum Messias berufenen Menschen zu tun habe. Christus war über das bloße Menschsein hinausgehoben. Diese Überzeugung hatten sogar die sogenannten Arianer, deren Glaube an die Unterordnung des Sohnes unter den Vater auf dem Konzil von Nicäa im Jahr 325 verurteilt worden war. Nach einigem Hin und Her war am Ende des 4. Jahrhunderts die Lehre der Arianer im Osten des Reiches tatsächlich marginalisiert. In den auf weströmischem Terrain entstandenen Germanenreichen der Völkerwanderungszeit dagegen spielte sie noch eine wichtige Rolle und wurde ein zentrales Identitätsmerkmal der germanischen Gruppen innerhalb der Eliten. In den römisch gebliebenen Gebieten bedeutete die Marginalisierung der Arianer nicht das Ende des Zwists. Sogar nachdem geklärt war, dass Christus, wie es im Nicänischen Glaubensbekenntnis hieß, «wesenseinig mit dem Vater» und vor aller Zeit «gezeugt und nicht geschaffen» sei, ging im Osten des Römischen Reiches der Streit um die Natur Christi weiter. Theologen aus dem Patriarchat von Antiochia war daran gelegen, die Majestät Gottes über dem Umstand seiner Inkarnation nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Einer von ihnen war Nestorius, der 428 zum Patriarchen von Konstantinopel berufen wurde. Mit seinem Namen ist diese kirchliche Richtung bis heute in der Literatur verbunden, auch wenn andere Theologen wie Theodor von Mopsuestia (gest. 428/429) für die Anhänger eine sehr viel größere Rolle spielten. Unter diesen Antiochensern vertrat man in der Folge die Ansicht, in Christus seien die menschliche und die göttliche Natur klar zu trennen. Alle menschliche Schwachheit sei allein der menschlichen Natur Christi zuzuschreiben und habe die göttliche Natur in ihm nicht berührt. Nicht Gott, sondern der Mensch Jesus sei deshalb von Maria geboren worden, und am Kreuz habe auch nicht die Gottheit, sondern Jesu Menschennatur gelitten. Diese Ansichten riefen die alexandrinische Kirche auf den Plan, die schon im Streit um den Arianismus die Göttlichkeit Christi mit besonderem Nachdruck vertreten hatte. Natürlich ging es dabei um den allein seligmachenden Glauben. Es ging aber gleichzeitig darum, die Stellung der Kirche Alexandrias in der Gesamtkirche zu stärken. Die Alexandriner waren der Meinung, dass sich in Christus göttliche und menschliche Natur gemischt hätten und nicht mehr zu unterscheiden seien. Gott sei von Maria geboren worden, und Gott selbst habe am Kreuz gelitten. Nur so, dachten sie, könne erklärt werden, dass durch Christi Opfertod die Sünden der Menschen gesühnt seien. Die Debatte um die Natur Christi wurde auf einem theologisch-philosophischen Niveau geführt, das viele Zeitgenossen, gerade im Westen der Mittelmeerwelt, überforderte. Es standen aber, wie wir sahen, nicht metaphysische Quisquilien, sondern zentrale Fragen der Würde der Gottheit und des menschlichen Heilserwerbs auf dem Spiel. In der heftig geführten Debatte bemühten sich die Kaiser um Ausgleich, und ein solcher schien auf dem Konzil von Chalcedon im Jahr 451 auch gefunden. Die Konzilsväter einigten sich auf einen Formelkompromiss: In Christus gab es demnach zwei Naturen, unvermischt und ungetrennt in einer Hypostase (Erscheinungsform; damit werden die drei Personen der Trinität bezeichnet). Die Hoffnung, dass damit alles geklärt sei, trog. Die Alexandriner, die später aufgrund ihrer Lehre von der einen Natur Christi Monophysiten[24] genannt wurden, bestanden auf der Verurteilung auch solcher Theologen der antiochenischen Schule, die aus der Sicht der moderaten Gegner des Nestorianismus durchaus noch auf dem Boden des rechten Glaubens standen. Zu einer solchen Verurteilung war man vor allem in Rom nicht bereit, und auch in Konstantinopel und in Syrien hatten derartige Maximalpositionen viele Gegner.
Die Kaiser manövrierten in schwierigem Fahrwasser, wollten sie die Einheit des Reiches und der Kirche nicht durch Unterstützung der einen oder anderen Seite gefährden. Ihre Suche nach Lösungen fand bald darin Ausdruck, dass man Anstrengungen unternahm, die Diskussion der Frage schlicht zu verbieten, bald darin, dass man sich bemühte, die Bischöfe unter Ausübung von zum Teil sogar physischem Druck zu Kompromissformeln zu zwingen. Justinian machte sich zeitweilig das Engagement seiner Gattin Theodora zunutze, die die Alexandriner unterstützte, während der Kaiser eher der chalcedonensischen Linie zuneigte. Die Chalcedonenser waren in Konstantinopel immer stark. Dass sie sich im Reich durchsetzen würden, war aber vor der Mitte des 7. Jahrhunderts keinesfalls ausgemachte Sache. Die Nestorianer waren seit dem Konzil von Ephesos, das sie 431 verurteilt hatte, in einer marginalisierten Position. Sie sahen die Zukunft ihrer Kirche nicht im Römischen Reich, sondern im sassanidischen Iran.[25]
Auch die Monophysiten missionierten jenseits der Reichsgrenzen und bekehrten insbesondere die Abessinier zu ihrem Glauben. Dies geschah mit der offenen Unterstützung der römischen Behörden und mancher Kreise bei Hofe. Zudem konnten monophysitische Theologen, Mönche und Bischöfe weiter in Konstantinopel wirken. Erstaunlicherweise waren sie aber vor allem im zu Antiochia gehörenden syrischen Raum aktiv. Dass sie in Ägypten, dem Hinterland Alexandrias, viele Anhänger hatten, überrascht weniger. In dem Moment aber, als sich in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts abzeichnete, dass man im Zentrum des Reiches zu einer die Radikalen unter den Monophysiten befriedigenden Lösung nicht bereit sein würde, kam es zur endgültigen Spaltung. Die Kaiser hatten im Laufe der Zeit entscheidenden Einfluss auf die Ernennung von Bischöfen gewonnen. Als nun in Syrien nur noch Anhänger des Konzils von Chalcedon zu Bischöfen erhoben wurden, organisierten sich die Monophysiten in einer Gegenkirche, die, da die städtischen Bischofssitze in der Hand der kaisertreuen Feinde waren, naturgemäß das flache Land als Zentrum hatte. Hier war das Griechische nicht so verbreitet wie in den Städten. Es ist deshalb nachvollziehbar, dass die neu entstehende Kirche das Syrische, den in der Region unter der Landbevölkerung verbreiteten Dialekt des Aramäischen, zur Kirchensprache machte. Man kann in diesem sprachlichen Wandel ein Phänomen des in vormodernen Agrargesellschaften weit verbreiteten Gegensatzes von Stadt und Land sehen. Womöglich wurde der Rückgang des Griechischen durch die sozioökonomischen Veränderungen in den Städten ab dem Ende des 6. Jahrhunderts verstärkt.[26] Ein ethnischer Gegensatz von Griechen und Syrern kam hier jedenfalls nicht zum Ausdruck. In der syrischen Kirche wurde das Erbe der hellenistischen Philosophie stets hochgehalten, und selbst die Ilias fand noch Mitte des 8. Jahrhunderts das Interesse eines syrischsprachigen Übersetzers.[27]
Eher wirkten die unterschiedlichen religiösen Auffassungen und das Gefühl der Monophysiten, der eigene wahre Glaube werde von «den Römern», den Mächtigen, unterdrückt, identitätsstiftend. Große Teile der Monophysiten waren im Fall militärischer Niederlagen der Meinung, die Kaiser erführen nun eine wohlverdiente Strafe, mit der der Allerhöchste sie wieder auf den rechten Weg zurückzuführen suche.[28]
Ähnliches lässt sich für Ägypten sagen. Hier war die kaiserliche Politik in der Frage der Besetzung von Bischofsstühlen lange sehr viel kompromissbereiter gewesen als in Syrien. Letzten Endes kam es aber auch dort schließlich zur Spaltung und zur Entstehung einer nicht mehr in Gemeinschaft mit Konstantinopel stehenden Hierarchie. Auch die ägyptische Kirche entdeckte das flache Land als Rückzugs- und Missionsraum und benutzte bald das Koptische, eine Spätform des Altägyptischen, als zusätzliche Kirchensprache. Die Positionen waren genauso verhärtet wie im syrischen Raum; zudem war die Zahl der Christen, die sich weiter der Reichskirche verbunden sahen, noch geringer.[29] Aber auch hier galt, wie wir noch sehen werden, dass die Kritik an der Reichskirche und kaiserlichen Religionspolitik nicht notwendig hieß, nicht mehr loyal zum Reich zu stehen. Man wollte es bessern, nicht verlassen.
Als die Sassaniden in Iran die Macht übernahmen, waren christliche Gemeinden bereits ein gängiges Phänomen im iranischen Herrschaftsraum, vor allem in der Region des heutigen Irak.[30] Durch die Deportation von Bewohnern des römischen Syrien im Verlauf der Feldzüge Schāpūrs I. (reg. 240/42–270) nahm die Zahl der Christen dann noch zu. Verfolgungen wie im Römischen Reich waren sie zunächst kaum ausgesetzt. Es scheint, als hätte es im 3. Jahrhundert Bestrebungen zur Schaffung einer einheitlichen zoroastrischen Staatsreligion gegeben. Die zeitgenössischen Inschriften des zoroastrischen Priesters Kartīr legen davon Zeugnis ab. Offenkundig kam es aber dennoch nicht zu einer nennenswerten Christenverfolgung in Iran. Kartīr ging es wohl eher um die Zurückdrängung des Manichäismus,[31] der im 3. Jahrhundert bei Hofe zeitweilig sehr einflussreich war, als um den Kampf gegen die Christen. Dies änderte sich, nachdem das Christentum im 4. Jahrhundert im Römischen Reich eine privilegierte Stellung erhalten hatte. Fortan mussten seine Anhänger als fünfte Kolonne des auswärtigen Feindes erscheinen. Es kam zu Repressionen. Die Verehrung der Opfer als Märtyrer hatte entscheidenden Anteil an der Entwicklung einer eigenen christlichen Identität im Sassanidenreich. Von genauso großer Bedeutung aber war, dass die Mehrheit der Christen unter sassanidischer Herrschaft im Streit um den Nestorianismus mit der römischen Reichskirche brach. Die naheliegendste Erklärung für diese Hinwendung vieler Christen in Iran zur mit dem Namen des Nestorius verbundenen Lehre dürfte politischer Natur sein. Die Zugehörigkeit zu einer theologischen Schule, die im Römischen Reich keine Rolle mehr spielte, ermöglichte es, sich ohne große Probleme gegen den Vorwurf der Feindspionage zu verwahren. Der Verfolgungsdruck im Sassanidenreich ließ ab der Mitte des 5. Jahrhunderts denn auch deutlich nach, und es begann eine intensive Missionsarbeit im zentralasiatischen Raum, die dort bis in die Mongolenzeit blühende christliche Gemeinschaften hervorbrachte. Die Zeichen schienen auf Beruhigung zu stehen. Die Kirche passte ihre Struktur der weltlichen an und wurde nicht müde, ihre Treue zu den Königen zu betonen. Bis in höchste Positionen bei Hofe konnten Christen aufsteigen, die nicht zuletzt unter den Angehörigen der Elite missionierten. Gerade das machte sie dann aber für die Vertreter des Zoroastrismus zu einer lästigen Konkurrenz. Zudem waren manche Christen im Sassanidenreich bestrebt, die Verbindungen zur römischen Reichskirche nicht ganz abreißen zu lassen. Sicherheit, dass die Christen nicht doch Agenten der Feinde waren, konnte es für die sassanidischen Herrscher so nicht geben. Religiöses Bekenntnis und politische Loyalität waren in der Spätantike nicht wirklich zu trennen. Deshalb fanden Verfolgungsmaßnahmen in Krisenzeiten immer wieder auch Fürsprecher unter den zoroastrischen Priestern.[32]
Zoroastrismus und Manichäismus
Über den Zoroastrismus,[33] die dominante Religion im Sassanidenreich, sind wir weit schlechter informiert als über das Christentum. Nicht nur ist der Gesamtumfang der Quellen deutlich geringer; viele zoroastrische Texte sind zudem schlecht zu datieren. Allen Arten der Spekulation sind folglich Tür und Tor geöffnet. Das ist besonders bedauerlich, weil der Zoroastrismus und mehr noch seine iranischen Vorläuferreligionen im ersten Jahrtausend vor Christus großen Einfluss auf die sogenannten abrahamitischen Religionen ausgeübt haben. Ein enger Kontakt hat vor allem am Ende des babylonischen Exils bestanden und ist danach nie mehr abgerissen. Wir können annehmen, dass iranisches religiöses Denken die Vorstellungen von Himmel und Hölle sowie vom Teufel als einem Widersacher Gottes entscheidend geprägt hat.
Im Zoroastrismus der Sassanidenzeit gab es verschiedene theologische Schulen, die miteinander im Streit lagen. Die Grundüberzeugung, dass die Welt das Werk eines guten Gottes namens Ahura Mazda sei, der im Kampf mit Ahriman, dem Gott des Bösen, liege, wurde zeitweilig überlagert von der Idee, dass über beiden als höchster Gott die Zeit stehe. Zudem fanden andere göttliche Wesenheiten Verehrung, ohne dass wir genau sagen könnten, in welchem Verhältnis sie jeweils zu Ahura Mazda gesehen wurden. Wichtig für unseren Kontext ist, dass die zoroastrische Priesterschaft große Anstrengungen unternahm, eine einheitliche Organisation von Kult und Lehre zu schaffen. Es wurden Schriften verfasst, die die religiösen Ideen systematisieren sollten, und überall im Reich suchte man Feuerheiligtümer anzulegen. Iranertum und das Bekenntnis zum Zoroastrismus sollten idealerweise immer zusammenfallen. Außerhalb Irans versuchten Zoroastrier nur im östlichen Teil Armeniens, der vom Sassanidenreich abhängig war, die dortige Oberschicht zu bekehren. Diese Ausnahme mag damit zusammenhängen, dass die armenischen Adligen stark von iranischer Kultur geprägt waren und in ihrer Lebensweise dem iranischen Adel nahestanden.[34]
Eine Bekehrung von Nichtiranern wurde ansonsten nicht angestrebt. Der Verzicht auf Mission bedeutete für die zoroastrischen Priester aber nicht, eine Gleichberechtigung aller Religionen im Reich gutzuheißen. Eine derartige Vorstellung wäre in der Zeit auch gänzlich ungewöhnlich gewesen. Minderheiten sollten auf dem ihnen gebührenden Platz verharren. Die im Vergleich mit Judentum und Islam noch strengeren Reinheitsgebote des Zoroastrismus stärkten die Identität und das Elitebewusstsein der Anhänger der «Guten Religion».
Lange Zeit ist die Forschung davon ausgegangen, dass es im Sassanidenreich ähnlich wie bei den Römern eine Staatskirche gegeben habe, und hat auch die Verfolgungen der Christen in diesem Kontext gesehen. Inzwischen geht man eher davon aus, dass die Idee der Einheit von Thron und Feueraltar unter den Sassaniden ein von priesterlichen Interessengruppen vertretenes Konzept war. Auch wenn sie sich der Religion Ahura Mazdas zugehörig fühlten, betrieben die Könige eine flexible Religionspolitik, die durchaus von anderen Einflüssen und politischen Interessenlagen geprägt war, zuweilen sogar von ihren häufig christlichen Gemahlinnen.[35] Man kann zwar nicht von einer sassanidischen Staatskirche im engen Sinne sprechen, aber bereits im 3. Jahrhundert gelang es offenbar, eine zentrale Hierarchie zu schaffen und damit den Zoroastrismus organisatorisch zu konsolidieren.[36] Die schon erwähnte Inschrift des Priesters Kartīr in Naqsch-i Rustam legt davon beredtes Zeugnis ab. Bis zum Ende des Reiches blieb der Zoroastrismus die Religion, deren Bilderwelt die sassanidische staatliche Propaganda bestimmte. Ahura Mazda erscheint auf zahlreichen Felsreliefs als der Schutzherr der siegreichen Könige. Symbole anderer Religionen fehlen in diesen Meisterwerken herrscherlicher Selbstdarstellung dagegen völlig. Die Identifikation des größten Teils des sassanidischen Militäradels mit der «Guten Religion» dürfte außer Frage stehen.
Vom Manichäismus als von den zoroastrischen Priestern kritisch beäugter Konkurrenz war bereits die Rede gewesen.[37] Diese im 3. Jahrhundert entstandene Religion beanspruchte für sich, die Vollendung aller vorherigen Bekenntnisse zu sein. Ihr aus dem Zweistromland stammender Stifter Mani sah sich selbst, wie später Mohammed, als das Siegel des Prophetentums. Der Manichäismus war stark von gnostischen dualistischen Vorstellungen geprägt. Anders als im zoroastrischen Dualismus wurde die geschaffene Welt jedoch als Werk des bösen Prinzips angesehen. Ausgesprochen gut organisiert, betrieb die manichäische Kirche eine systematische Mission, deren Erfolg aber nicht allein auf der Hingabe ihrer religiösen Eliten beruhte. Die Manichäer verstanden es, die Angehörigen der anderen Religionen jeweils in ihrer «Sprache» anzusprechen, indem sie je nach Klientel die Bezüge ihrer Religion zum Christentum, zum Buddhismus etc. betonten. Dieser Erfolg, vielleicht auch die so gänzlich andere Sicht auf die Welt, waren dafür verantwortlich, dass der Manichäismus den zoroastrischen Priestern gefährlich erschien. Auch im Römischen Reich begegnete man seinen Werbern bereits vor der Christianisierung des Staates mit Misstrauen. Diese Marginalisierung, ja fast Dämonisierung der Manichäer setzte sich in frühislamischer Zeit fort, wo der Manichäismus die gesellschaftsgefährdende Irrlehre par excellence darstellte. Nur die mit dem Namen des Mazdak (s. unten) verbundenen Überzeugungen galten als ebenso problematisch.
Von Priestern zu Schriftgelehrten: Das Judentum
Es ist hier angebracht, noch einmal auf das Judentum zurückzukommen. Wir hatten oben bereits gesehen, dass der radikale, gewaltbereite Versuch der Reinerhaltung jüdischer Identität sich in den Aufständen des ersten und frühen zweiten Jahrhunderts als Sackgasse erwiesen hatte. Der Tempel war zerstört und den Juden das Betreten des als heidnische Stadt wiederaufgebauten Jerusalem verboten.[38] Es gab zwei Wege, mit dieser Situation umzugehen. Viele Juden, vor allem Angehörige der Elite, setzten auch nach der Katastrophe weiter auf den Weg des kulturellen Austauschs mit der nichtjüdischen Umgebung. In der Diaspora nahmen etliche aktiv am Leben ihrer Städte teil oder traten in die römische Verwaltung ein. Noch im späten 4. Jahrhundert studierte der Sohn eines führenden jüdischen Religionsgelehrten Rhetorik bei Libanios (gest. nach 393), einem Heiden und dem zu seiner Zeit wichtigsten Lehrer in dieser Kunst. Der Rabbiner und der Rhetor standen in freundschaftlichem Austausch.[39]
Andere, gerade im Milieu der Religionsgelehrten, plädierten für den Rückzug auf einen jüdischen Binnenraum, in dem das Kommunikationsmedium nicht Griechisch, sondern Aramäisch und Hebräisch war. Die Zerstörung des Tempels hatte eine bereits zuvor eingeleitete Entwicklung beschleunigt, von der schon die Rede war: Nicht mehr die Priester hatten nunmehr die Definitionsmacht über die Religion, sondern die Rabbiner (d.h. Meister) genannten Schriftgelehrten. Durch ihre Anbindung an ein Gesetz, das man immer weiter ausleuchtete, wurde aus einer Religion des Opferkults eine Religion der Heiligung alltäglicher Lebensvollzüge. Neben die geschriebene Thora, die hebräische Bibel, trat die mündliche Überlieferung der Schriftgelehrten, die im palästinensischen und babylonischen Talmud kodifiziert wurde. Nach der Christianisierung des Römischen Reiches nahm die Bedeutung des intellektuellen Austauschs mit der Umwelt für die Juden ab. Sie sahen sich unverhohlenem christlichem Antijudaismus gegenüber. Vor dessen schlimmsten Auswirkungen wurden sie allerdings durch das weltliche römische Recht geschützt. Dieser Schutzraum des Rechts wurde auch von solchen Kaisern geachtet, die ansonsten als entschiedene und nicht immer tolerante Christen galten. Theodosius der Große (reg. 379–394), ein unnachgiebiger Feind der altrömischen Religion, begann um der Rechte der Juden willen einen Konflikt mit dem streitlustigen Bischof Ambrosius von Mailand. Anders als es der Bischof für richtig hielt, bestrafte der Kaiser die rechtswidrige Zerstörung einer Synagoge durch Christen.[40] Schutz hieß jedoch nicht Gleichberechtigung. Im 5. und vor allem 6. Jahrhundert wurde die Diskriminierung der Juden zusehends Teil des weltlichen Gesetzes. Das Judentum blieb zwar legal, seine Anhänger aber sahen sich immer mehr an den Rand gedrängt.