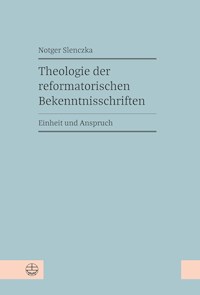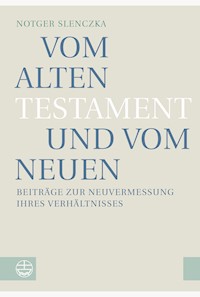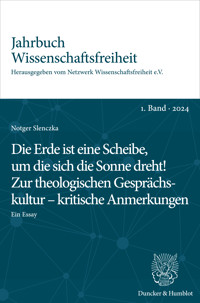
Die Erde ist eine Scheibe, um die sich die Sonne dreht! Zur theologischen Gesprächskultur – kritische Anmerkungen. E-Book
Notger Slenczka
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Duncker & Humblot
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die Erde ist eine Scheibe, um die sich die Sonne dreht! Zur theologischen Gesprächskultur – kritische Anmerkungen. Ein Essay In diesem Aufsatz geht es um die wahrheitsförderliche Funktion des Irrtums. Der Ausgangspunkt ist die 2015 ausgebrochene Debatte um die Kanonizität des Alten Testaments. Hier wurde geäußert, dass Die Infragestellung dieser Kanonizität so wenig einer Diskussion würdig sei wie die Frage, ob die Erde eine Scheibe sei; diese Behauptung verband sich mit (unzutreffenden) Vorwürfen des Antisemitismus. Diese wissenschaftliche Gesprächsverweigerung nimmt der Autor dieses Textes zum Anlass, an den Ursprung des wissenschaftlichen Ethos: es geht aus von der Möglichkeit des Irrtums auch der eigenen Position. Des Wahrheitsbesitzes ist man nie gewiss, sondern die streitbare wissenschaftliche Debatte ist der Weg, auf dem allein sich die Wahrheit durchsetzen kann. Vf. verfolgt diesen Gedanken von Platon und Aristoteles über die Aufnahme dieses Gedankens in der scholastischen und nachreformatorischen Theologie bis hin zu Schleiermachers Feststellung, dass die theologische Sondermeinung bis hin zur Häresie unverzichtbar sei für das Verständnis des Glaubens. Vf. zeigt dann im Schlussabschnitt, dass auch die Überzeugung, dass die Erde eine Scheibe sei, um die sich die Gestirne drehen, nicht einfach ein Irrtum ist – das zeigt sich daran, dass wir alle nach wie vor Kopernikus und Galilei vom Sonnenaufgang sprechen. Das ist der Ursprung einer Einsicht: dass es Bedingungen der leibgebundenen Existenz und des angeborenen Irrtums gibt, die sich nicht einfach mit der wissenschaftlichen Aufklärung beseitigen lassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
[195]
Jahrbuch Wissenschaftsfreiheit, 1 (2024): 195 – 223https://doi.org/10.3790/jwf.2024.1431701
Die Erde ist eine Scheibe, um die sich die Sonne dreht! Zur theologischen Gesprächskultur – kritische Anmerkungen
Ein Essay1
Von Notger Slenczka*
„… nous voyons que ceux qui suivent Copernic ne laissent pas de dire que le soleil se lève et se couche.“
Gottfried Wilhelm Leibniz, Discours de métaphysique, § 27
Der Titel dieses Beitrags hat folgenden Hintergrund: ich habe meine eigenen Erfahrungen mit dem Thema einer „theologischen Gesprächskultur“ gemacht, als ein 2013 geschriebener Aufsatz, in dem ich die Kanonizität des Alten Testaments für die Kirche in Frage stellte, im Jahr 2015 zum Gegenstand einer in Teilen sehr unsachlichen, bis in die Tageszeitungen hinein geführten Auseinandersetzung wurde.2 Die Stationen dieser Auseinandersetzung im Jahr 2015 habe ich auf meiner Homepage dokumentiert.
Auf einen Aspekt dieser Erfahrungen spielt der Obertitel an: mein Fakultätskollege Christoph Markschies, inzwischen Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, hatte es damals abgelehnt, meine Thesen zum Alten Testament überhaupt zu diskutieren. Das ist, so muss man zunächst festhalten, sein gutes Recht – niemand muss alles diskutieren. Allerdings muss man dann wirklich den Mund halten. Er hingegen hatte meine Position zum Alten Testament immer wieder verzerrt referiert3 und in den [196] Zusammenhang mit Thesen von „Nazi-Theologen“4 gestellt; er ist dabei inzwischen (2019) so weit gegangen, den Vorwurf des Antisemitismus zu erheben.5 Gegen – wenn nötig auch scharfe – Kritik an meiner Position ist nicht das Geringste einzuwenden. Wissenschaftlich illegitim und unredlich ist es aber, die Begründung für die genannte Einschätzung und gegen die Position zu verweigern, aber die Diskussion auf ein politisches Feld zu spielen und die Gegenposition zu verunglimpfen.
Das genau war der Grund dafür, dass ich den Kollegen Markschies zu einer öffentlichen Disputation über die Kanonizität des Alten Testaments aufgefordert hatte. Diese Aufforderung hat er eben abgelehnt mit einer Sottise, die er über Facebook – aber nicht nur dort – verbreitet hat: „Über solche Thesen diskutiert man so wenig wie über die These, dass die Erde doch eine flache Scheibe ist – solche Thesen weist man ebenso klar wie knapp zurück.“6
Die Ablehnung einer Disputation mit dieser Begründung will wohl sagen, dass mein Vorschlag zur Kanonizität des Alten Testaments gestrig ist – bestenfalls. Das mag durchaus sein;7 bei einer entsprechenden Begründung8[197] wäre ich gern bereit, zuzugeben, dass ich mich hinsichtlich des Alten Testaments in Gestrigkeiten verrannt habe. Dass ich irrtumsfähig bin, habe ich gerade in den Auseinandersetzungen um meinen Text zum Alten Testament immer betont! Eine solche Begründung hat der Kollege aber nie geboten.
Die zitierte Begründung für die Ablehnung einer Disputation setzt aber zweitens voraus, dass auch die Behauptung, die Erde sei eine Scheibe und, so füge ich hinzu: die Behauptung, dass sich um diese flache Erde die Planeten und der Kreis der Fixsterne drehen – dass diese Behauptungen so antiquiert sind wie nach Meinung des Kollegen meine Thesen zum Alten Testament. Meine Thesen dahingestellt: diese beiden kosmologischen Thesen muss ich in Schutz nehmen. Denn die sind nicht einfach falsch. Das werde ich im letzten Teil meines Referats begründen (VIII.).9
Dem vorausgehend aber einige Bemerkungen zur Debattenkultur (I.–VII.). Dass sie kritisch sind, wie der Untertitel sagt, liegt nicht an mir, sondern an den Teilen der gegenwärtigen Debattenkultur, die sich von meinen Anmerkungen zu Recht gemeint fühlen werden. Denn unsere gegenwärtige wissenschaftlich-theologische Gesprächskultur muss sich messen lassen an dem, womit ich einsetze: mit der Debattenkultur zu der Zeit, als die Erde für manche noch als Scheibe galt. Ich habe diesen Weg des Rückgangs zu den Ursprüngen unserer wissenschaftlichen Gesprächskultur gewählt und damit diesem Weg den Vorzug gegeben vor einem Rekurs auf rezente Wissenschafts- oder Diskurstheorien, denn, so denke ich: ein Essay zu diesem Thema soll, wie die alten Rhetoriker sagen, nicht nur ‚movere – bewegen‘, sondern auch ‚delectare – erfreuen‘, und dies – das delectare – erreicht man doch zuverlässiger mit einer referierenden Bezugnahme auf die Alten, die sich demjenigen, der Ohren hat zu hören, in ihrer Gegenwartsrelevanz sofort erschließen.
Wir werden dabei übrigens sehen: Vertreter der These, dass die Erde eine Scheibe ist, sind nicht ganz leicht zu finden – dies zu wissen ist eine Frage [198] der Kenntnisnahme der Forschungsgeschichte10; und damit bin ich beim ersten Thema.
I. Aristoteles: Wissenschaft und Forschungsgeschichte
Es sollte eigentlich bekannt sein, dass die Behauptung, die Erde sei eine Kugel, uralt ist. Bereits Aristoteles trägt sie als eine eingeführte These vor.11 Im Zweiten Buch von ‚περὶ οὐρανοῦ (peri ouranou) – lat.: De caelo – dt.: Über den Himmel‘12 diskutiert Aristoteles diese Frage, und er hält die Gegenthese – die Erde ist eine Fläche – zwar für falsch, aber für diskussionswürdig;13 auch Kopernikus macht sich übrigens noch die Mühe einer Widerlegung.14 Immerhin! Des Aristoteles eigene Argumentation geht aus von einer Reihe von Voraussetzungen, die ich im Folgenden skizziere.15
1.
Erstens setzt Aristoteles die These von der Vollkommenheit der Kreisgestalt voraus: daher sind die Himmelssphären kugelförmig, und an ihnen sind die ewigen und unveränderlichen Gestirne befestigt, die ebenfalls Kugeln sind.16[199] Vorausgesetzt ist dann vor allem die Lehre vom natürlichen Ort der vier Elemente, nach denen die Elemente vom Typus „Erde“ sich nach unten bewegen:17 Die These von der Sphärengestalt der Erde und von der Zentralstellung der Erde im Kosmos löst nämlich ein Problem: beides gilt als die einzige Möglichkeit, zu erklären, dass die Erde, im Unterschied zu einzelnen Portionen von Erdmaterial, nicht immer tiefer fällt: Das ist dann einsichtig, wenn die Erde im Zentrum des ganzen Weltalls liegt, zu dem jedes Seiende, das ein Gewicht hat, als zu seinem natürlichen Ort strebt. Dieses Zentrum ist punktförmig, und der Mittelpunkt der Erdmasse muss, wenn die Erde ruhen soll, mit dem Mittelpunkt des Zentrums identisch sein: um diesen Punkt herum sammelt sich aus allen Richtungen das Element der Erde – eben als Kugel.18