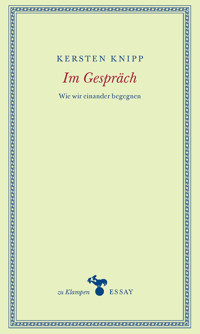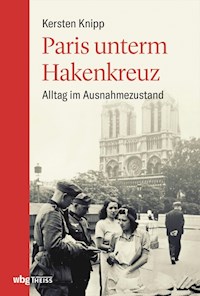16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Reclam Taschenbuch
- Sprache: Deutsch
Die Kunst des Miteinanders Was heute als Höflichkeit oder gute Manieren gilt, geht auf die Salons um 1700 zurück. Denn dort plauderte und flirtete nicht nur der Adel, sondern bald auch das Bürgertum. Und so entstanden viele Umgangsformen und Konventionen, die uns heute selbstverständlich erscheinen. Was ist Höflichkeit? Wie begegnen sich Mann und Frau? Was sagt man, wenn man einander nichts zu sagen hat? Und wie lässt sich ein Mensch am besten beeinflussen? »Amüsant, lehrreich, interessant, mit Beispielen aus verschiedenen Ländern reich gespickt und aufschlussreich … Ein vielseitiges Buch über ein sicher zu wenig beachtetes Phänomen.« Westfälische Nachrichten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Kersten Knipp
Die Erfindung der Eleganz
Europa im 17. Jahrhundert und die Kunst des geselligen Lebens
Reclam
2022, 2024 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH
Coverabbildung: Benjamin Eugène Fichel (1826–1895). © Painters / Alamy Stock Foto
Made in Germany 2024
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962297-2
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011491-9
www.reclam.de
Inhalt
Einleitung: Europa, Erbe, Eleganz
»Wunderbar und besonders«: Madame de Rambouillet und ihr Salon
Der König, die Macht und die Sprache: Rhetorik und Politik im Absolutismus
Erhabene und niedere Register: Die Gründung der Académie française
Italienischer Frühling: Baldassare Castiglione erkundet die Lässigkeit
»Wir alle sind Flickwerk«:Montaigne und die Entdeckung der Subjektivität
Kein richtiges Leben im falschen: Der Hofstaat und die Macht der Etikette
Geheime Gedanken: Die Frauen, die Bildung und die Emanzipation
Nah und fern: Das Verhältnis der Geschlechter
Virtuosität der Geselligkeit: Der galant homme und die Kunst, zu gefallen
Dunkler Optimismus: Baltasar Gracián und der Glaube an das Mögliche
Im Auge des Betrachters: Die Entdeckung der Mode
In den Wäldern: Jean-Jacques Rousseau sucht das wahre Selbst
Auf der Bühne: Diderot und der Wille zur Flexibilität
Arbeit am Fortschritt: Die Französische Revolution und der neue Mensch
Konvention und Bruch: Die Restauration und das 19. Jahrhundert
Schlusswort: Eleganz als Ethik
Anmerkungen
Literaturhinweise
Quellen
Forschungsliteratur
Personenregister
Einleitung: Europa, Erbe, Eleganz
»Kein vollständiges System, aber Bruchstücke, vielleicht nicht zu verwerfende Materialien, Stoff zu weiterem Nachdenken.«
Adolph Freiherr Knigge, Über den Umgang mit Menschen
Es gehört zu den faszinierendsten Erfahrungen städtischen Lebens: das kunstvolle Flanieren auf Bürgersteigen und in Fußgängerzonen, jene beinahe artistische Gewandtheit, mit der Passanten einander ausweichen, indem sie ihr Umfeld weitläufig sondieren, Engpässe frühzeitig bemerken und sich minimal zur Seite drehen, einen Schritt nach links oder rechts tun, um eine kleine Kollision zu vermeiden. Man bewegt sich aufmerksam in der Öffentlichkeit, im Bewusstsein, dort nicht allein, sondern Teil eines größeren Ganzen zu sein. Dazu gehört, sich entsprechend zu verhalten, also Rücksicht aufeinander zu nehmen, einander anzuschauen, wortlose Absprachen für ein, zwei Sekunden zu treffen und so einander erfolgreich auszuweichen. Das kann per Blickkontakt geschehen oder auch ohne, in jedem Fall ist Kommunikation im Spiel, die Bereitschaft und Fähigkeit zur Verständigung. Nichts ist aber schöner als dieser kurze Blick, die stumm signalisierte Übereinkunft, die der Schrittfolge oft vorausgeht, der Beschleunigung, Verlangsamung oder dem kleinen Bogen, und die den kontaktlosen Gang durch die Menge überhaupt erst möglich macht. Dieser kleine Augen-Blick, dieser verschwindend kurze Moment, ist mehr als nur ein Akt der Koordination. Er ist Programm, Bekenntnis und Erbe, in ihm spiegeln sich die Spielregeln der Zivilisation. Es handelt sich um Grundsätze des Miteinanders, Reflex gewordenes Wissen um die Regeln angemessenen Verhaltens in Gesellschaft.
Zugleich ist dieser Blick ein Vergnügen. Nicht selten sendet er bei der Koordination ein weiteres Signal, nämlich das der Lust an urbanen Umgangsformen, der Freude an wortlos ausgetauschter Information, am reibungslosen Ablauf der Verständigung, am Sekundenbruchteile währenden Moment, über den sich Austausch und gegenseitiges Einverständnis strecken. Es liegt etwas Sportliches in dieser Begegnung, etwas Artistisches, das Teil der modernen Lebensform ist samt ihrer Neigung zu minimalen Gesten, von denen nicht wenig abhängt – in diesem Fall die wie von Zauberhand arrangierten Bewegungsabläufe der großen Menge, ihre fließend-glatten Wogen in den Straßen der Stadt, geboren aus dem Geist der Notwendigkeit – und aus der Lust an der Eleganz. Denn elegant ist es, dieses Einander-Ausweichen, die beinahe tänzerische Art des unfallfreien Fortkommens ohne jegliche Zusammenstöße, ohne jede Rempelei. Die Voraussetzungen dieses geschmeidigen Fortkommens sind keineswegs banal, und das Wissen darum spiegelt sich in dem kurzen Lächeln, das den koordinierenden Blick bisweilen begleitet. Das freundliche Nicken, der kurze Gruß vermittels kurz hochgezogener Augenbrauen enthält die Freude über das geteilte Repertoire, das gemeinsame Wissen um Normen und deren anhand minimaler Körperwendungen souverän demonstrierte Beherrschung gerade jetzt, in diesem Moment inmitten des urbanen Getümmels.
So zumindest verhielt es sich viele Jahre, nein, Jahrzehnte. Die urbane Gesellschaft entwarf ihre Spielregeln, die allermeisten verinnerlichten sie so sehr, dass sie die Spontanität von Reflexen hatten: Es handelte sich um antrainierte, anerzogene Verhaltensweisen, die so selbstverständlich und sicher umgesetzt wurden, dass sie weniger wie bewusst vollzogene Akte als wie beinahe natürliche Verhaltensweisen wirkten. Inzwischen sind diese Reflexe nicht mehr ganz so spontan und verständlich, zumindest nicht mehr so verbreitet wie früher. Es scheint, als ginge die Erinnerung an die urbanen Spielregeln verloren, als verflüchtige sich die Einsicht in deren Sinn. Jedenfalls geht es ein wenig holprig zu in den Straßen der Stadt, die Körper weichen einander nicht mehr so geschmeidig aus, so als schmelze die Wendigkeit dahin. Blicke treffen sich immer noch, aber weniger verlässlich und weniger häufig. Entsprechend steif bewegen sich die Körper, treiben aufeinander zu und kollidieren dann auch. Arm und Schulter erleben, wenn nicht einen festen Zusammenprall, so doch deutlich spürbare Berührungen.
Es scheint, als mische sich eine gewisse Weltvergessenheit in die urbane Intelligenz, als schwinde die Aufmerksamkeit für die Dinge im nächsten Umfeld. Die Blicke sind nicht selten dem Boden zugewandt, fern und unbestimmt, dem Umfeld entzogen, ein Spiegel weltvergessener Subjektivität. Oder die Gehenden sind ins Gespräch vertieft, während sich ihre Dreier- oder Viererkonstellation über den größten Teil des Gehwegs erstreckt, und sie weichen auch dann nicht aus, wenn es erkennbar eng wird. Ausweichen scheint immer Sache der anderen zu sein. Nicht, dass es böse gemeint ist. Dazu wirkt der leichte Zusammenprall allzu oft wie ein Stoß gegen ein träumend abwesendes Bewusstsein, eine tiefe – allzu tiefe – Subjektivität, die der Gegenwart auf geheimnisvolle Weise enthoben ist. Das leichte Aufschrecken oder auch die dem Aufprall oft nachgereichte Entschuldigung lassen keinen Zweifel daran: Es ist nicht böse gemeint. Und doch ist das der Gesellschaft entzogene Bewusstsein auf dem Gehweg ein Phänomen, das sich anderswo fortsetzt: im lauten Handygeplapper im Zugabteil, souverän die Mitreisenden ignorierend; im musikalischen Erlebnis an der Ladenkasse, gespeist vom digitalen Kopfhörer, das auch im Moment der Bezahlung durch Worte und Gestik kaum unterbrochen wird; in den erstaunlichen Positionen der nach dem Gebrauch zurückgelassenen E-Scooter, die quer auf dem Gehweg, in weitem Abstand zur Hausmauer daliegen wie von Fünfjährigen hingeworfen, so dass sie alle anderen zu Ausweichmanövern nötigen.
Es ist merkwürdig: Auf der einen Seite hat die Gesellschaft ihre Sensibilität enorm entwickelt und ihr Bewusstsein dafür geschärft, wie andere Menschen denken und empfinden – gerade in einer zusammenwachsenden Welt ist das eine unverzichtbare kulturelle Leistung. Immer mehr Menschen versuchen, den anderen zu verstehen, zu begreifen, was in ihm vorgeht, wie er empfindet und wie er die Welt deutet, insbesondere in Zeiten von Flucht und Migration. Kulturelle Unterschiede können Gesellschaften stark belasten, und in Zeiten, in denen Vorstellungen über das, was gut und richtig, schlecht und falsch ist, immer weiter auseinandergehen, kommt es sehr darauf an, die Motive des oder der jeweils anderen zur Kenntnis zu nehmen und sie nachzuvollziehen. So ist gerade in den multikulturellen Gesellschaften des Westens ein neuer kommunikativer Standard entstanden, der allen Beteiligten enorm viel abverlangt. Wenn immer weniger selbstverständlich wird, wenn Verhaltensweisen sich ändern und Lebensweisen teils deutlich auseinanderklaffen – dann kommt es umso mehr darauf an, einander zu verstehen oder es zumindest zu versuchen.
Voneinander verschieden sind Menschen nicht nur durch ihre Herkunft, ihre Sprachen, ihre Konfessionen und Gewohnheiten. Sie unterscheiden sich zudem durch das Geschlecht, und zwar recht genau im Verhältnis 50 zu 50. Rund die Hälfte der Menschen sind Frauen, die andere Hälfte Männer, einige verstehen sich weder als das eine noch das andere. Vor allem aber sind diese beiden Hälften gleichberechtigt, und das einzugestehen hat die westliche Gesellschaft als ganze nicht wenig Mühe gekostet: Der im vorletzten Jahrhundert begonnene Kampf um Gleichberechtigung ist immer noch nicht endgültig ausgefochten. Und obwohl wir uns immer mehr bemühen, möglichst alle Menschen in unsere Gesellschaft zu integrieren, gehen wir im Alltag oft rüde und wenig achtsam miteinander um.
Umso mehr kommt es auf Verständigung an, auf Aufmerksamkeit und den Willen, einander zu verstehen. Wer ist der Mensch mir gegenüber, was empfindet er, wie gehe ich am besten auf ihn ein? Und umgekehrt: Wie wird er auf mich zugehen? Gefragt ist eine Annäherung, eine Verständigung, die im Zweifel viel mehr bewirkt, als dass wir nur halbwegs erträglich, vielleicht sogar gut miteinander auskommen. Die Höflichkeit, die in Momenten der Begegnung so entscheidend ist, entstammt einem ganz anderen Register als die sonst üblichen Alltagszwänge. 1885 schrieb der französische Philosoph Henri Bergson (1859–1941): »Wie die Anmut trägt sie [die Höflichkeit] die Idee einer grenzenlosen Geschmeidigkeit; wie die Anmut setzt sie zwischen den Seelen eine flinke, bewegliche Sympathie in Bewegung; wie die Anmut schließlich enthebt sie uns aus einer Welt, in der das Wort an die Handlung und die Handlung an den Nutzen gebunden ist, in eine andere, ideale Welt, in der Worte und Bewegungen sich von der Frage nach ihrem Nutzen befreit haben und kein anderes Ziel haben als zu gefallen.«1
In der Höflichkeit zeigt sich der Mensch ganz anders als in jenen Momenten, in denen er selbstvergessen durch den Alltag trottet. Der höfliche Mensch ist ein Mensch voller Eleganz, ein Mensch auf der Höhe seiner Möglichkeiten, ästhetisch, aber auch und vor allem hinsichtlich seiner Intelligenz. »Können wir nicht sagen, dass diese Höflichkeit in ihren tausenden unterschiedlichen Aspekten, die gewisse Qualitäten des Herzens und viele Qualitäten des Geistes voraussetzt, der seinerseits in der völligen Freiheit der Intelligenz besteht – dass diese Höflichkeit also eine ideale ist und dass der strengste Kritiker Unrecht hätte, wollte er mehr oder Besseres verlangen?«
Bergson schrieb seine Zeilen als junger Mann in einer Zeit, in der die Spielregeln der Höflichkeit ihren festen Rahmen verloren oder, positiver formuliert: das enge Korsett früherer Zeiten gesprengt hatten. Höflichkeit stand zu Bergsons Zeit bereits im Plural, sie ließ sich auf viele Weisen zur Geltung bringen. Zugleich war Höflichkeit aber immer sehr viel mehr. Bergson schrieb seine Zeilen vor dem Erbe einer Kultur der Eleganz, die – von heute aus gesehen – vor 400 bis 500 Jahren ihren Anfang nahm und gleich zu Beginn einen ihrer Höhepunkte erreichte. Es ist kein Zufall, dass eines der Zentren dieser Kultur Frankreich – genauer: Paris – war. Wie nirgends sonst konzentrierten sich dort politische Macht und kulturelle Energien, zumal der Adel sich einem bürgerlichen Konkurrenzdruck ausgesetzt sah, der nicht mit Waffen, sondern ökonomisch und vor allem kulturell ausgefochten wurde.
Heute würde man das mit dem Begriff soft power beschreiben: Entscheidend war die Attraktivität des Auftritts, die langfristig viel stärker wirkt als der bloße Einsatz von Gewalt. Vernunftgründe mögen dafür sprechen, sich den Waffen zu unterwerfen. Das Herz aber lässt sich so nicht binden. Es sucht die Nähe dessen, was es fasziniert und bewundert. Und so wurden in Paris – natürlich auch in anderen Hauptstädten, aber ganz besonders in der französischen – Traktate, Romane, Ratgeber verfasst, deren Autorinnen und Autoren die Verhaltensweisen ihrer Zeit sehr aufmerksam studierten. Meist waren sie mit ihnen wenig einverstanden, weshalb sie ihnen andere Modelle entgegensetzten. Allerdings entwickelten sie nicht nur Modelle, sondern auch und vor allem Begründungen. Die Autorinnen und Autoren gaben ihren Leserinnen und Lesern Empfehlungen zum angemessenen Auftritt in der Öffentlichkeit – die zu ihrer Zeit relevante Öffentlichkeit gründete überwiegend auf Königs- und Fürstenhöfen –, doch sie erklärten auch, warum sie diese und jene Formen für angemessen hielten. So machten sie ihre Leserinnen und Leser teils mit einem umfassenden Formenrepertoire bekannt, mehr aber noch regten sie sie dazu an, über den Sinn dieses Repertoires nachzudenken. Aus welchen tieferen Gründen entscheiden wir uns für einen Auftritt dieser oder jener Art? Damit setzten sie nicht nur dem Lauf der Zeit unterworfene und damit schnell hinfällige Ratschläge zum guten Benehmen in die Welt, sondern vor allem eines: das Nachdenken über die Motive, darüber, warum gewisse Verhaltensweisen angemessen sind und andere nicht. Es sind die von ihnen aufgeworfenen tieferen Überlegungen und Argumente, die die europäische Kultur, oder genauer, ihren mit Problemen des Stils befassten Teil, bis heute geprägt haben. Und genau das ist der Kern aller Erörterungen zur Eleganz: die Frage nach dem Warum. Mit ihren Antworten haben die Autorinnen und Autoren die soziale Sensibilität ihres Publikums und damit, quer über die Generationen, ihr gesellschaftliches Formbewusstsein in bislang unbekanntem Maß erhöht. Denn ergründet man die Eleganz des gesellschaftlichen Auftritts, untersucht man zuletzt ihre Motive – auch und vor allem ihre vorgeblichen Motive, hinter denen zu Recht andere, weniger lautere vermutet wurden.
Nirgends zeigt sich diese Kritik am pompösen Auftritt schonungsloser und bissiger als in den Schriften der französischen Moralisten, eines François de La Rochefoucauld (1613–1680) oder Jean de La Bruyère (1645–1696). Die beiden Autoren sind zusammen mit dem spanischen Jesuiten Baltasar Gracián (1601–1658) die wohl scharfsichtigsten Beobachter ihrer Zeit. Unentwegt attackieren sie die Finten und Prahlereien ihrer Zeitgenossen, lassen die Luft aus den großen Worten heraus oder zupfen an pompösen Gewändern, um den Blick auf die erbärmlichen Gestalten darunter zu lenken. Sie entblößen das Elend hinter dem Glanz. Dies tun sie nicht aus Boshaftigkeit (meistens zumindest), sondern aus einem geradezu aufklärerischen Impetus heraus: Sie lehren ihre Zeitgenossen, genau hinzuschauen, sich nicht mit der ersten oder zweiten Erklärung zufriedenzugeben, sondern – vielleicht – erst mit der dritten, vierten oder fünften. Denn die Menschen, die sie schildern, sind berechnende Wesen, sie denken um die Ecke und lassen sich allerhand einfallen, um andere zu täuschen und zu blenden. Eleganz, lernt man bei ihnen, ist keineswegs unschuldig. Nicht immer, aber doch sehr oft ist sie ein Instrument der Täuschung, inszeniert um des eigenen Vorteils willen. Man lasse sich also nicht blenden von all dem Pomp, man denke vielmehr nach und prüfe: Warum verhält sich dieser oder jener, wie er oder sie es tut, was sind die eigentlichen Motive, wo liegen seine oder ihre Interessen?
Diese Kunst des skeptischen Denkens hat ihre Anfänge ganz wesentlich bei einem Autor genommen: Michel de Montaigne (1533–1592). Der ehemalige Bürgermeister von Bordeaux schrieb von ungefähr 1570 an Essay um Essay. Darin wandte er sich den unterschiedlichsten Themen zu, die doch durch eines verbunden waren: die Skepsis ihres Autors sich selbst gegenüber. Nahezu auf jeder Seite setzt er sich mit seiner Stimmung, seinen Launen, Empfindungen, Regungen auseinander, fragt sich nach deren Gründen und deren Einfluss auf jene Person, die er ist: Michel de Montaigne. Aber wer ist Montaigne? Lässt er sich anhand fest umrissener Charakteristiken definieren? Oder ist er nicht vielmehr die Summe, ein Art Behältnis seiner stets sich verändernden Anwandlungen? Letzteres dürfte eher der Fall sein, nimmt Montaigne an – und trägt so auf wesentliche Weise zur modernen Selbstreflektion bei, dem neuzeitlichen Misstrauen gegenüber sich selbst, der Ergründung der verborgenen Kräfte und Motive, mit denen die Europäer – und nicht nur sie – bis heute befasst sind. Zugleich setzt er damit einen der Grundsteine der französischen Literatur, ihrer leichtfüßigen Eleganz und der spielerischen Beiläufigkeit, mit der sie noch die subtilsten Fragen aufgreift.
Der Skeptizismus, den er zu entwickeln half, ist präsent auch in all den Essays und Traktaten, die im folgenden 17. Jahrhundert über die Kunst des Auftritts am Hof wie auch in den bürgerlichen Salons der Zeit geschrieben werden sollten. Diese Werke wurden zu großen Teilen von Frauen – etwa Marie de Rabutin-Chantal alias Madame de Sévigné (1626–1696), Madeleine de Scudéry (1607–1701), Madeleine de Souvré (1598–1678) – verfasst und von Catherine de Vivonne, Marquise de Rambouillet (1588–1665), in ihrem chambre bleue, einem der frühesten Pariser Salons, in soziale Wirklichkeit verwandelt. Jene Texte stießen eine Kultur der Einfühlung, des Feinsinns und des leichten Gesprächs an, deren Anspruch an psychologischem Feinsinn und Takt der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis heute Standards setzt. Was denkt und empfindet der oder die andere, und wie gehe ich darauf angemessen ein? Aber auch: Wo sind womöglich die Grenzen des Gesprächs, was ist einer Unterhaltung in größerem Kreis angemessen und was nicht? Sind die Grenzen des Sagbaren thematisch definiert oder durch den Stil, die Art und Weise der Artikulation? Jedenfalls sollte man stets wissen, was man sagt, und ebenso, warum. Hält man sich dies vor Augen, zeigt sich die Abgründigkeit jeder, auch der entspanntesten Unterhaltung: Sie hat eine äußere und eine innere, eine sichtbare und eine stille Komponente, denn jedem einzelnen Wort geht ein komplexer Gedanke voraus, eine blitzschnell vollzogene Abwägung der Frage, was die folgenden Äußerungen bewirken oder zumindest bewirken könnten. So verstanden ist die Unterhaltung eine Form, die ihren taktischen Charakter verbirgt. Natürlich, jede und jeder weiß um die taktischen Aspekte des Gesprächs, aber klar ist auch, dass es richtig ist, sie zu verbergen. Denn nur durch das Überspielen jeglichen untergründigen Kalküls behält das Gespräch seine Leichtigkeit, die seinen eigentümlichen Reiz ausmacht.
Indem sich die Besucherinnen und Besucher der Pariser Salons dieses Umstandes bewusst sind, reihen sie sich ein in eine Tradition, die der italienische Autor und Diplomat Baldassare Castiglione (1478–1529) knapp hundert Jahre zuvor in seinem Libro del Cortegiano (1528, Der Hofmann) erörtert hatte: die Kunst der Lässigkeit, der scheinbar mühelosen Darbietung hochkomplexer Fähigkeiten, etwa der, ein Instrument zu spielen, einen Degen zu führen (und sei es nur zur sportlichen Demonstration) oder auch einen angemessenen gesellschaftlichen Auftritt hinzulegen. Um ihre ganze Faszination zu entfalten, sollten derlei Fertigkeiten nebenbei, wie selbstverständlich, ausgeübt werden. Sprezzatura nennt Castiglione diese Art der Darbietung, die eben dadurch, dass sie so beiläufig vollzogen wird, ihren demonstrativen Charakter verliert. Sprezzatura bedeutet wörtlich ›Preislosigkeit‹, im Sinne von Mühelosigkeit, Souveränität, die sich als solche nicht ausstellt: Das ist jene Lässigkeit, die heute im Begriff der Coolness aufscheint – und die bereits den Salongesprächen des 17. Jahrhunderts ihre entspannte Eleganz verlieh. Der Begriff und überhaupt das Libro del Cortegiano sind wie die Schriften des Spaniers Baltasar Gracián auch Dokumente jener grenzüberschreitenden, in zahlreichen Übersetzungen gesamteuropäisch gewordenen Kunst der diskreten Wachsamkeit, die aller Eleganz zugrunde liegt. Zudem trug die sprezzatura ganz wesentlich zum modernen Verhältnis der Geschlechter bei, wie es heute als selbstverständlich gilt. Die oft unsichtbar verlaufene Emanzipation der Frauen, die Bildungsprogramme, die sie seit Tagen der Christine de Pizan (1364–1429) verlangten und sich selbst auferlegten, die Meisterschaft, zu der sie es gerade hinsichtlich der Sprache brachten: All dies versetzte sie in die Lage, mit ihren Überlegungen zum eleganten Auftritt und der galanten Unterhaltung beider Geschlechter zu Lehrmeisterinnen der Männer zu werden.
Immer wieder zeigt sich allerdings: Eleganz ist eine anspruchsvolle und vor allem wandelbare Kunst. Nirgends wird das wohl deutlicher als in den frühen Diskussionen über Mode, in denen Begriffe wie Anmut, Schönheit und Ausstrahlung fallen – die sich aber auch mit deren Gefahren befassen, allen voran dem Risiko, sich zum Affen des Zeitgeistes zu machen. Mode verändert sich, eben das macht sie aus. Und weil sie sich so schnell verändert, auch im 16., 17. Jahrhundert schon, kommt es umso mehr auf den souveränen Umgang mit ihren Angeboten an. Was trägt man und warum? Die Fragen, die sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Gesprächsrunde hinsichtlich der Themen und Artikulationsweisen stellen, gelten ebenso für die Kleidung. Wer was aus welchen Gründen trägt, ist eine Tag für Tag neu gestellte Frage, die sich einfachen Antworten verweigert: Es gilt, die Lage selbst einzuschätzen, jeden einzelnen Moment.
Natürlich kann der elegante Auftritt eine Taktik sein. Mit ihr lassen sich Menschen beeinflussen, deutlicher: manipulieren, dienstbar machen. Die Kritik der Moralisten an den Sitten am Versailler Königshof hat offenbart, dass unter dem galanten Anschein Bösartigkeit, Zynismus oder Frivolität lauern können, eine Infamie und ein Zynismus, die es in sich haben. Wohlgemerkt: Es kann so sein, muss aber nicht. Und doch wurde die Kritik am galanten Auftritt lauter, vor allem schärfer. Niemand formulierte sie so pointiert und konzis wie der Genfer Philosoph Jean-Jacques Rousseau (1712–1778). Das Leben in der feinen Gesellschaft ist für ihn ein Quell nicht abreißender Entfremdung, einer verbogenen Lebensweise, die alle korrumpiert, die in ihr leben. Sie schneidet sie von ihren natürlichen Empfindungen, ihrer Identität, ihrer Authentizität ab und damit von dem, was Rousseau sich als die Fülle des Lebens dachte. All die Verbeugungen, die frivolen Machtspiele, die bei aller Formvollendung süffisant vollzogene Demonstration der tatsächlichen, während der feinen Abendgesellschaften immer nur zum Schein aufgehobenen Herrschaftsverhältnisse: In den Augen Rousseaus nahm dies unerträgliche Formen an, so ausgreifend und dominant, dass darunter nichts Menschliches mehr entstehen könne. Dass – teils ritualisierte – Formen auch Bindungen ermöglichen, Freundschaften und Beziehungen stärken können, dass das zunächst formale Einvernehmen Grundlage alles Weiteren sein kann, diesen Gedanken mochte er nicht zulassen. Da er sich zudem mit mehreren seiner ehemaligen Freunde zerstritten hatte, sein Roman Émile ou de l’éducation (Emile oder über die Erziehung) verboten und gegen ihn selbst ein Haftbefehl erlassen worden war, wählte er die Emigration – die er freilich in seinen Büchern ebenso inszenierte. So gab er unfreiwillig zu bedenken, dass die Idee von der unmittelbaren, unverfälschten Existenz eine Chimäre ist. Indem er sein Leben in Les Confessions (DieBekenntnisse) und Les rêveries du promeneur solitaire (Die Träumereien des einsamen Spaziergängers)vor seinen Lesern ausbreitete, wurde Rousseau zu einem der ersten Medienabhängigen der Neuzeit – einer jener Figuren, die sich nur über Bücher auszudrücken vermögen, während ihnen ein spontaner Ausdruck weitgehend versagt bleibt. Ohne das vermittelnde, inszenierte Wort konnte er, der Propagandist der Authentizität, nicht leben. Es war an seinem Freund Denis Diderot (1713–1784), in seiner Schrift über das Paradox des Schauspielers darauf die richtige Antwort zu geben. Sie lautet: Leben ist in erster Linie die Kunst der Verstellung, zumindest der Anpassung an den Moment. Es muss ja nicht in böser Absicht geschehen.
Diderots Skepsis hinsichtlich der Frage, ob Emotionen als angemessene Grundlage des öffentlichen Auftritts dienen können, war der vorerst letzte Versuch einer Ehrenrettung des Formalen. Zu sehr waren die feinen Riten seiner Zeit mit dem Königshof verbunden, als dass sie kurz vor 1789, dem Jahr der Französischen Revolution, nicht auch Abscheu erregt hätten: Dass sich die happy few der feudalen Gesellschaft an raffinierten Riten erfreuten, während das Gros der Bevölkerung gerade so durchkam, schien vielen ein obszöner, unhaltbarer Zustand, der dringend abgeschafft gehörte. Tatsächlich rechneten die französischen Revolutionäre auch mit der Formensprache des Ancien Régime ab; an die Stelle des Pomps der alten Zeiten sollte etwas radikal anderes treten: die neue Gesellschaft, der neue Mensch.
So radikal die Umarbeitung der alten Riten, ihr Ersatz durch neue Formeln des Miteinanders ausfielen, an einer Erkenntnis kamen die Revolutionäre nicht vorbei: Eine Gesellschaft – jede Gesellschaft – ist auf ein Formenrepertoire unabdingbar angewiesen, und zwar auch auf Regeln für die verspielten, leichten Momente des Lebens. Wie positioniert man sich, welchem Teil der Gesellschaft rechnet man sich zu, welchen Auftritt hält man für angemessen? All diese Fragen sind auch in postrevolutionären Gesellschaften von Belang und benötigen entsprechend neue Antworten. Die allerdings fallen in der entstehenden Massengesellschaft des 19. Jahrhunderts ausgesprochen vielfältig aus. Sie unterscheiden sich anhand sozialer, politischer und ökonomischer Kategorien, die freilich nicht starr, sondern flexibel und fließend sind. Doch alle drücken das Bedürfnis auch nach einer eleganten Formensprache aus, nach Riten der Höflichkeit und Verständigung, die das Leben leichter machen, auf der Straße ebenso wie in kleinerer Runde am Abend.
Die neuen Regeln mögen weniger offensichtlich und ausladend sein, stattdessen entsprechen sie in ihrer diskreten Art dem pragmatischen Selbstverständnis einer effizienzgetrimmten Gesellschaft bei ihrer Bewältigung urbaner Anonymität. Türen werden nicht mehr in großer Geste offengehalten, um der nachfolgenden Person den Durchgang zu erleichtern; eher werden sie kurz angestoßen oder wie zufällig einen Moment länger als nötig angetippt, bevor sie wieder zurückschwingen. Beim Einstieg in den Zug anderen den Vortritt zu lassen ist ein ebenfalls unauffällig gehaltener Akt, signalisiert mit einer kleinen Bewegung des Arms oder einem kurzen Nicken des Kopfs, nicht mehr hingegen durch weitläufiges Schwenken eines Arms. Was hingegen bleibt, ist das Bewusstsein für die Form, der Wille, den Moment angenehm zu gestalten und gelingen zu lassen. Das Bewusstsein des zu formenden Augenblicks und der Anspruch auf schnelle und zugleich angemessene Reaktion verbinden sich mit der Kunst, aus mehreren Optionen die passende zu wählen: All dies geht auf die Erfindung, zumindest aber auf die immer detailliertere Ausarbeitung der Eleganz im 16. und 17. Jahrhundert zurück, jenes sich damals radikal entwickelnde Bewusstsein für die Kunst, in einer Gesellschaft zu leben – und zwar angenehm. Und selbst wenn diese Kunst hie und da ins Stottern gerät (vielleicht auch nur, um sich neu zu erfinden): Der Anspruch auf einen angemessenen, und das heißt freundlichen, höflichen und eleganten Auftritt ist weiterhin gegeben. Er ist ein Erbe früherer Jahrhunderte, das wir nicht ausschlagen können.
»Wunderbar und besonders«: Madame de Rambouillet und ihr Salon
»Man sieht, dass alle Leidenschaften der Vernunft unterworfen sind.«
Mademoiselle de Scudéry, Conversations
Wenn die Zeitläufte schwer erträglich sind, ist es nötig, Gegenwelten zu errichten. Es braucht Orte, die anders sind als das bislang Bekannte, an denen ein anderer Geist, eine andere, bessere Atmosphäre herrscht. Solche Orte können ihre Gäste verwandeln, deren Möglichkeiten erweitern, vielleicht sogar Seiten an ihnen aufscheinen lassen, die sie bislang selbst nicht kannten. Diese Orte vollbringen, was eigentlich der Utopie vorbehalten ist: Sie verwandeln den Menschen. Wer diese Räume betritt, wird sie zwar nicht wie verwandelt wieder verlassen, aber doch mit neuen, starken Eindrücken, die geeignet sind, sein künftiges Verhalten grundlegend zu verändern.
Die Salons, die im frühen 17. Jahrhundert in Paris entstanden, wurden zwar nicht im Geist der Utopie gegründet, durchaus aber auf dem Fundament dezidierter Menschenbilder. Die Frauen, die diese Salons leiteten – es waren fast ausnahmslos Frauen –, verfolgten ihre Anliegen, indem sie unter der Hand Impulse freisetzten, die die französische Gesellschaft und Kultur bis ins Tiefste prägten. Sie setzten Standards und Verhaltensmuster, die unter veränderten Voraussetzungen und in vielfach gebrochener Form bis heute die Umgangsformen bestimmen oder zumindest eine Ahnung davon geben, wie sie aussehen könnten.
Vorangetrieben wurde diese kleine Revolution der Sitten mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln. Die Salonbetreiberinnen schufen Räume des Austauschs, der Unterhaltung und des Dialogs, Orte, an denen sich ein damals neuer Ton entfaltete, eine neue Art, über die Welt zu sprechen: über Grundlegendes und Banales, über die Vergangenheit und die Gegenwart, die schweren und die leichten Themen, das Alltägliche und das Außergewöhnliche. All das geschah in ernster, vor allem aber in unterhaltender Sprache.
Wer spricht und den Austausch sucht, bevorzugt eine angenehme Atmosphäre. Ein anregendes, belebendes Umfeld, in dem die Gedanken leichter in Schwung kommen als anderswo. Denn auch Ideen entstehen bisweilen ja über Empfindungen, inspirieren sich an den Impulsen eines anregenden Milieus. »Der Himmel ist hier immer heiter«, schreibt Madame de Rambouillet, die Gründerin des ersten bedeutenden Salons, des berühmten chambre bleue (›blaues Zimmer‹), im Juni 1644 an einen Freund. »Die Wolken vernebeln weder die Sicht noch den Verstand.«2 Die Wolken, von denen die Marquise spricht, ziehen nicht an der Fensterfront ihres Salons vorbei. Sie sind an dessen Decke gemalt, sind Teil der Innenausstattung, einer Welt, die sich selbst genügt. Und darauf kommt es der Gastgeberin an: einen Raum von eigenem Recht zu schaffen, einen stabilen Gegenentwurf zur Welt außerhalb seiner Mauern, der eine auf andere Weise nicht zu erreichende Unabhängigkeit garantiert: »Ich bin genauso wenig wie meine Loge der Veränderung unterworfen.«
Natürlich verändert sich die Welt, Madame de Rambouillet wusste es aus eigener Erfahrung nur zu gut. Geboren 1588 in Rom als Tochter des französischen Marquis Jean de Vivonne (1530–1599), seines Zeichens Botschafter in Italien und Spanien, und der aus altem italienischem Adel stammenden Giulia Savelli, wird Catherine de Vivonne, wie ihr Taufname lautete, im Alter von nur elf Jahren mit dem zwölf Jahre älteren Charles d’Angennes (1577–1652), dem späteren Marquis de Rambouillet, verheiratet – eine enorme Belastung für das Mädchen, das sich auch als Erwachsene in der Ehe nie völlig wohlfühlt. Umso hingebungsvoller widmet sie sich dem Gespräch, zu zweit oder auch in größerer Runde. Dafür lässt sie bei den 1618 begonnenen Umbauarbeiten ihres direkt am Louvre gelegenen, von den Eltern geerbten Pariser Stadthauses eigens einen Raum inklusive einer Reihe von mehreren eindrucksvollen Vorzimmern errichten, und zwar nach eigenen Plänen. »Von ihr lernte man, die Treppen an die Seiten der Räume zu setzen, um auf diese Weise eine große Reihe von Zimmern zu haben«, erinnert sich einer ihrer Vertrauten, der Schriftsteller Gédéon Tallemant des Réaux (1619–1692). Auch die Idee, Fenster und Türen bis unter die Decke reichen zu lassen, führt er auf sie zurück. Das war übertrieben – hohe Fenster und Türen gab es bereits in anderen Gebäuden –, doch war diese Bauweise zu jener Zeit alles andere als selbstverständlich. »Und das ist so wahr, dass die Mutter des Königs, als sie den Palais de Luxembourg bauen ließ, den Architekten befahl, sich das Hôtel de Rambouillet anzuschauen, ein Umstand, der für sie nicht ohne Nutzen war.«3
Madame de Rambouillet, genannt Arthénice, ein von dem Dichter François de Malherbe (1555–1628) ersonnenes Anagramm ihres Vornamens, entwirft einen Raum ganz nach ihren Vorstellungen, mit einer Kreativität, die Standards setzt. Der Salon sei »der berühmteste des Königreichs«, beschreibt über hundert Jahre nach dessen Bau der Historiker Henri Sauval die Wirkungskraft und Attraktivität des von der Marquise entworfenen Baus.4 Besonderen Wert legt die Gastgeberin auf inspirierende Atmosphäre. Die verdankt sich nicht nur den großzügigen Dimensionen des Saals, sondern ganz wesentlich auch dessen außergewöhnlichen Farbgebung. »Sie ist die Erste, die auf den Gedanken kam, einen Raum in einer anderen Farbe als Rot oder Hellbraun streichen zu lassen«, notiert Tallemant des Réaux. »Und das hat ihrem Saal die Bezeichnung Blaues Zimmer verschafft.«5
Blau die Wandbehänge, blau der Bezug der Sessel und Sofas, blau die Vorhänge an den Fenstern – ein Raum fast wie im Himmel, weit über der Erde, fast in den Wolken: ein kühnes Bekenntnis zur Schwerelosigkeit, zum Gedankenflug, dem Gespräch im entgrenzten Raum. Schon die Idee steht für eine Kühnheit, die auch, so das Ansinnen, die Besucherinnen und Besucher beflügelt.
Wolken, Licht und Luft: Madame de Rambouillet bittet ihre Gäste in ihr blaues Reich, der Tritt über die Schwelle führt in ein Areal animierter Leichtigkeit, so jedenfalls empfinden es die Gäste. An den Wänden hängen ein Gemälde von Venus und Adonis, ein Stillleben mit Blumen, dazu ein Bild Marias mit dem Jesuskind. Auf den Möbeln stehen Porzellanfiguren, kleine Bronzestatuen, Schüsseln aus Eichenholz, Blumentöpfe – ein dicht bestücktes Arsenal von Kunstwerken, Möbeln und Zierrat unterschiedlichster Art.6 Als »Palast der Heldinnen« beschreibt ein Besucher den Salon, als »auserwählten Hof« ein anderer, während ein weiterer von »einer großen gereinigten Welt« spricht und noch jemand in dem Raum einen »Tempel der Musen, der Ehre und der Tugend« sieht.7 »Alles ist wunderbar und vor allem besonders bei ihr«, resümiert Madame de Sévigné, den Salon ihrer Freundin vor Augen. In dem von 1649 an erscheinenden Romanzyklus Artamène ou le Grand Cyrus wird der Salon so beschrieben: »Die Lampen unterscheiden sich von denen an anderen Orten, ihre Zimmer sind voll zahlloser Raritäten, die die Stilsicherheit derjenigen erkennen lassen, die sie ausgewählt hat. Die Luft ist stets parfümiert, mehrere wunderbare Körbe voller Blumen erschaffen einen nicht endenden Frühling in ihrem Raum, und der Ort, an dem man sie normalerweise antrifft, ist so angenehm und so von ihrer Vorstellungskraft geprägt, dass man sich vorkommt wie in einem Zauberreich.«8
Schaut, gibt die Hausherrin ihren Gästen zu verstehen, das ist mein Angebot, ein Raum, wie ihn noch kaum jemand gesehen hat. Tretet ein, betrachtet das Außergewöhnliche und lasst euch anregen. Denkt und sprecht, wie ihr es anderswo im Leben nicht tut. Im Alltag haltet ihr euch zurück und passt euch an – aber hier seid ihr frei, hier gelten andere Normen als draußen vor der Tür. Von Anfang an entwirft die Marquise ihren Raum als Reich der unbegrenzten Möglichkeiten, als Raum, in dem das Undenkbare wirklich werden soll.
Doch bald werfen die Wolken einen Schatten auf das Gemüt der Marquise, sie verdunkeln den lichten Ort, den sie geschaffen hat. Vielleicht ist das eine Folge der frühen Ehe, womöglich auch ihrer schwachen Konstitution und jener Krankheit, mit der sie sich seit ihrem vierten Lebensjahrzehnt auseinandersetzen musste: einer Lichtallergie. »Madame de Rambouillet mochte ungefähr 35 Jahre alt sein, als sie bemerkte, dass das Kaminfeuer ihr auf merkwürdige Weise das Blut erwärmte und ein Schwächegefühl hervorrief«, berichtet der Schriftsteller Tallemant des Réaux in seinen Historiettes. »Einige Jahre später bereitete ihr das Sonnenlicht dasselbe Unbehagen.«9 Angesichts der ständigen Unpässlichkeiten entschließt sie sich, an den Gesellschaftsabenden ausgestreckt auf einer Liege in der Mitte des Raums teilzunehmen – in der Anmutung nicht einer Bettlägerigen, sondern der entspannten Herrscherin, der Direktorin und Intendantin, der Regisseurin des Gesamtkunstwerks, das sie entfaltete.
Draußen und drinnen, der Alltag und das Außergewöhnliche: Der Salon bezieht seine Wirkung aus den Gegensätzen, die er konstruiert. Eben noch mögen sich die Gäste in die Politik eingespannt gesehen haben, mögen ihren Dienst am Hof getan, sich den Mühen der Verwaltung unterzogen, ihren Anteil an der Funktionsfähigkeit der königlichen Behörden und damit des Landes im Ganzen geleistet haben. Nun aber lassen sie all dies hinter sich und betreten durch die Schwelle zum Salon eine Wirklichkeit von ganz anderer Art. »Wenn man im Hôtel de Rambouillet war, ließ man die Politik und die Intrigen an der Pforte zurück; nachdem man am Hof zugegen war, lösten sich dessen Gepflogenheiten im Hôtel de Rambouillet auf und wichen dem dort üblichen Ton. Je aufgewühlter und korrumpierter die Situation am Hof war, desto vornehmer und großartiger war die Gesellschaft der Rambouillet.«10
Das Zitat, wenngleich nicht der Feder eines Zeitzeugen, sondern eines späteren Historikers entsprungen, gibt eine Vorstellung von der künstlerischen Kraft, die Madame de Rambouillet in ihren Salon steckte. Alles darin verweist auf den Glauben seiner Schöpferin, dass der Königshof von Paris zwar vieles, aber längst nicht alles sei. Der Mensch ist frei, lautet die unterschwellige und zugleich unübersehbare Botschaft dieses Raums; nichts zwingt ihn, auf alle Tage derselbe zu sein. Er kann sich verwandeln, hat das Zeug, ein anderer zu werden, sich zu emanzipieren und das, was ihn sonst umgibt, hinter sich zu lassen, jedenfalls für ein paar Stunden. Vielleicht aber auch länger. Jedenfalls ist nichts, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint, zumindest ist es nicht gezwungenermaßen so, denn alles ist veränderbar.
Wenn die Gastgeberin bekennt, sie sei glücklich, Veränderungen nicht unterworfen zu sein, so meint sie doch nur die ihr von außen aufgezwungenen. Jene aber, die sie selbst herbeiführen kann, sind ihr willkommen. Das Glück, vielleicht auch die Bestimmung des Menschen ist, seine Umgebung verändern zu können. Wenn die Hausherrin vor ihrem Salon eine Allee von Pflanzen anlegen lässt, dann mit dem Ziel, »die einzige Person in Paris zu sein, die vom Fenster ihres Wohnsitzes aus eine Wiese blühen sieht«11. Extravaganz? Gewiss. Aber doch auch mehr: der Entschluss nämlich, die Wirklichkeit zu gestalten, sie dem eigenen Willen gemäß zu formen. Die Allee ist ihr mit den Mitteln der Landschaftsarchitektur bekundeter Anspruch, in die Welt einzugreifen und sie mit ihren eigenen Anschauungen in Übereinkunft zu bringen, wenn nicht gar, sie ihnen zu unterwerfen.
In diesem Arrangement blüht eine raffinierte Sinnlichkeit, die direkt auf die Besucherinnen und Besucher überspringt. Und wie könnte es anders sein?! Denn auch das Gespräch ist ja ein sinnliches Erlebnis ersten Ranges. Am Gespräch sind alle Wahrnehmungsorgane beteiligt, die Augen fixieren das Gegenüber, springen aber auch in den Hintergrund, wandern nach links und rechts, nach oben und nach unten. Was sie aufnehmen, findet seinen direkten Weg in die Sprache, die wiederum Eindruck auf den Gesprächspartner macht. So ist der ganze Mensch in das Gespräch eingebunden: Mimik, Gestik, Körperspannung, alles fließt ein in die Konversation. Und alles richtet sich zugleich an der Umgebung aus. Der gestimmte Raum wird selbstverstärkend.
Klar ist aber auch, dass bei aller Offenheit der Sinne ein bestimmtes Reglement zu beachten ist. Der Salon appelliert an die vornehmen Seiten der Gäste, fordert sie aber auch ein. Die Tonhöhe ist, bei aller Freiheit im Einzelnen, im Ganzen strikt vorgegeben, der Kanon der Artikulation exakt umrissen. »Die Umgänglichkeit besteht aus mehreren Dingen«, lässt Eustache de Refuge (1564–1617) 1616 die Leser seines Traité de la cour, ou instruction des courtisans (›Abhandlung über den Hof, oder Anleitung für Höflinge‹) wissen. »Vor allem aber in diesen Fähigkeiten: andere angemessen zu empfangen, die Personen zu begrüßen, ihnen ihre Ehre zukommen zu lassen, sie zu respektieren, auf sie zuzugehen, sie durch Zeichen und wohlwollende Signale anzusprechen, sie unserer Höflichkeit und unseres Wohlwollens zu versichern; ihnen mit Gesten und freundlichem Umgang ein Gefühl von Sicherheit und Vertrauen zu vermitteln, so dass sie mit uns ins Gespräch kommen.«12
Dieser Geist fördert eine nicht nur emotional, sondern auch intellektuell gedeihliche Atmosphäre. Die Gastgeberin liebt das Gespräch an sich. Ganz gleich, worum es geht, was zählt, ist der Fluss der Rede, der Austausch der Gedanken, das Hin und Her der Worte. Man müsse zwei Arten des Gesprächs unterscheiden, schreibt später, 1738, Nicolas-Charles-Joseph Trublet (1697–1770), genannt Abbé Trublet, Autor und Mitglied der Académie française. Die eine sei die konzentrierte Erörterung eines Themas, die Abschweifungen nicht erlaube. »Die andere ist jene, in der man nacheinander von verschiedenen Themen spricht, nach Maßgabe des Zufalls. Das ist die stärker verbreitete und diejenige, die dem französischen Geist am meisten entspricht.«13
So ist die Sprache für Madame de Rambouillet und ihre Gäste wenn nicht Garantin der Freiheit, so doch eine Möglichkeit ungezwungener Erkundung. Der Krieg hat die alte Ordnung ins Wanken gebracht, nichts ist mehr sicher, und darum lässt sich alles erörtern. »Alles ist strittig, alles auf der Welt ist problematisch, das weiß ich«, schreibt einer der Vertrauten der Madame de Rambouillet, der Schriftsteller Jean-Louis Guez de Balzac(1597–1645), in seinen 1657 erschienenen Entretiens (›Unterhaltungen‹). »Alles wird angezweifelt und allem widersprochen. Es gibt nichts, das nicht zwei Gesichter und mehrere Bedeutungen hätte; nichts, das so lobenswert wäre, dass es nicht in einigen seiner Teile zu entschuldigen wäre; nichts, das so stark wäre, dass sich nicht eine Schwäche finden ließe, und das nicht mit scheinbar ebenso guten Gründen angegriffen werden könnte wie die, mit denen es sich verteidigen lässt.«14
Alles steht zur Debatte. Das ist belastend, aber es gibt Möglichkeiten, dem Ungewissen beizukommen – indem man es nämlich zulässt, darauf verzichtet, zu allem eine dezidierte Meinung zu haben. Guez de Balzac weiß es wohl: Meinungen tendieren dazu, sich zu verhärten. Wer eine hat, ganz gleich wozu, trennt sich im Zweifel nur schwer von ihr. Meinungen gehen mit ihrem Träger, ihrer Trägerin eine oft allzu innige Bindung ein, sie zu korrigieren, zumal in einem größeren Kreis, ist keine leichte Übung. Allzu schnell kollidiert die Korrektur mit dem Stolz, weshalb es ratsam scheint, zu Meinungen ein distanziertes Verhältnis zu haben. »Ich zweifele lieber, als dass ich einen festen Standpunkt einnehme«, schreibt Guez de Balzac.15 Sein Freund und Kollege, der Dichter Jean Chapelain (1595–1674), ist über das Misstrauen zu einem ganz eigenen Schluss gekommen: Man beharre auf nichts! Und man hüte sich, den Dingen bis ins Kleinste nachzugehen, Argument um Argument nachzuschieben, nur um Recht zu behalten. »Ich gestehe Ihnen«, schreibt Chapelain 1639 an Guez de Balzac »dass die Entscheidung, eine Sache nur im Allgemeinen zu behandeln, ohne zum Besonderen hinabzusteigen – ein Umstand, der nur abstoßend ist –, mir als einer der besten Kunstgriffe der Beredsamkeit scheint.«16
Eben darum soll es im Salon gehen: eine Auszeit von der Politik zu nehmen, Atem zu schöpfen und sich von der Welt, zumindest der politischen Welt, ein paar Momente lang abzuwenden. Die Politik findet draußen statt – drinnen trifft man sich zum freien Spiel. Das Spiel ist Tanz, Theater, Konzert, Lesung und Spaziergang, aber vor allem ist es Konversation, Unterhaltung, die Lust am zwanglosen Gespräch. Und der Verzicht auf die Meinung ist der Preis, der für dieses Vergnügen, vielleicht sogar diese Notwendigkeit, zu zahlen ist.
Guez de Balzac, geboren 1597, Latinist und Schriftsteller, machte sich 1624 einem größeren Publikum durch seine Lettres, ›Briefe‹, bekannt, weniger wegen ihres oft beliebigen Inhalts als wegen ihres Stils: Leicht, verspielt und auf raffinierte Weise beiläufig, bestechen sie durch eine bis dahin kaum gekannte Eleganz. Nicht zur Freude aller: Seine Kritikerinnen und Kritiker werfen ihm vor, er übernehme allzu viele Einfälle von den antiken lateinischen Autoren, die ihn seit einem zweijährigen Aufenthalt in Rom Anfang der 1620er Jahre faszinieren. Anderen missfällt der für ihren Geschmack geradezu frivole Ton seiner Briefe. 1634 wird Guez de Balzac in die im selben Jahr gegründete Académie française berufen, an deren Sitzungen er jedoch kaum teilnimmt. Stattdessen zieht er sich in das Haus seiner Familie bei Angoulême zurück, von wo aus er als Vorreiter des neuen schriftlichen und mündlichen Stils in vier unter dem Sammelbegriff Cycle du Romain zusammengefassten Essays Madame de Rambouillet seine Vorstellungen eines angemessenen Gesprächs und eines neuen gesellschaftlichen Umgangs darlegt. »Ein Tag im Hôtel de Rambouillet ist mehr wert als mehrere Jahrhunderte anderswo«, notiert er. »Wenn man darum die Bedeutung und den Rang der Dinge richtig misst, enthalten die Veranstaltungen dieses Landes [gemeint ist der Salon] mehr Stoff als Jahrzehnte in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen.«17
Im Salon der Madame de Rambouillet sind die Präferenzen klar: Gastgeberin und Gäste bevorzugen den unterhaltenden, spielerischen Stil. Wie das Haus der Catherine de Vivonne sollen auch die darin geführten Gespräche eine Art Kunstwerk eigenen Ranges sein, das keinen anderen Vorgaben als denen des gemeinsamen Interesses und der Lust am Wort folgt. Wichtig ist dabei nicht das Thema – es lässt sich über sehr vieles reden –, sondern die Art, in der es aufgegriffen wird: locker, spielerisch, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, auch ohne jeden akademischen Ernst. Diese Ungezwungenheit wirft aber ganz neue Fragen auf – etwa die, in welche Richtungen sich ein Gedanke drehen, auf welche Weise weiterspinnen und sich neue Deutungen abgewinnen lässt. Die Gedanken sind frei, und die Themen sind es – einige dezente Spielregeln vorausgesetzt – ebenfalls. Kreisen die Themen, stürzen die Hierarchien: Alles – fast alles – lässt sich erörtern, kein Ding ist es nicht wert, näher untersucht zu werden, den Anstoß zu einer potentiell unendlichen Reihe von Beobachtungen und Reflektionen zu geben. »Die Kleinigkeit, die Wissenschaft, die Einbildungen, das Nichts – alles ist gut«, schreibt Jean de La Fontaine (1621–1695), der Dichter der berühmten, von 1668 an geschriebenen Fables (›Fabeln‹). Gesprächsstoff findet sich überall, im Kleinen wie im Großen, im Erhabenen wie im Nichtigen. Es gibt keinen Grund, vor den großen Themen zurückzuscheuen, und keinen, die kleinen geringzuschätzen. Alles kann zur Spielmasse werden, von allem lässt sich etwas lernen, Faszination kann im Kleinen und Großen gleichermaßen liegen.
Der große Künstler dieser Wortspiele ist ein Dichter: Vincent Voiture (1598–1648) »gab sich alle Mühe, seine Herkunft gegenüber jenen zu verschleiern, die nicht von ihr wussten«, berichtet Gédéon Tallemant des Réaux in seinen Historiettes, seinen Erinnerungen.18 Äußerlich eher unauffällig, kann sich der bürgerliche Emporkömmling in der höfischen Umgebung auf seine größte Begabung, sein Gespür für soziale Dynamiken wie auch sein Sprachtalent, verlassen. »Voiture war klein, aber gut gebaut, er kleidete sich gut. Er hatte einen naiven, um nicht zu sagen einfältigen Gesichtsausdruck, und man hätte meinen können, er mache sich über die anderen lustig, wenn er mit ihnen sprach. […] Er war einer der kokettesten Zeitgenossen.« Menschen lieben Neuigkeiten, und Voiture liefert sie. Stets informiert über die Neuigkeiten des Tages, weiß er sich mit ihnen in Szene zu setzen. »Er bemühte sich, die Gesellschaft im Hôtel de Rambouillet zu unterhalten. Immer hatte er Dinge gesehen, die die anderen nicht gesehen hatten. So dass, kaum dass er eingetroffen war, sich alle um ihn versammelten, um ihm zuzuhören.«
Der Stoff ist das eine. Das andere ist die Art, in der Voiture ihn präsentiert. Was die Zuhörer fasziniert, so deutet Tallemant des Réaux an, ist vor allem Voitures Erzählkunst – die Geschmeidigkeit der Darbietung, die rasche Entwicklung der Gedanken, kurzum: die Ästhetik seiner Sprache. Reaktionsschnell und begabt mit einem feinen Sinn für die Regungen seiner Zuhörerinnen und Zuhörer, ist er sich der Wirkung seiner Improvisationskunst bewusst. »Er gab vor, seine Rede aus dem Stehgreif zu halten. Das mag er oftmals tatsächlich auch getan haben, aber ebenso oft hatte er die Dinge bereits zu Hause vorbereitet. Dennoch war er ein anmutiger Geist, und man schuldet ihm Dank dafür, dass er den anderen zeigte, wie man die Dinge auf galante Weise sagt.«
Voiture ist ein stilbildender Künstler – und damit auch einer, der ganz wesentlich das ästhetische Selbstverständnis der um Arthénice versammelten Gruppe begründet. Er führt sie weg vom hochtrabenden Stil der Gelehrtenprosa, der schwerfälligen Diktion der Institutionen, die die sprachliche und damit auch soziale Norm setzen. Jene Norm ist dringend ergänzungsbedürftig, wenn Sprache auch die feineren, subtilen Regungen angemessen einfangen und zum Ausdruck bringen soll. Denn die offizielle Sprache geht allzu oft am Wesentlichen vorbei, ihr teils pompöser, teils strenger Stil wird den Empfindungen des urbanen Lebens nicht gerecht. Ihm fehlt der spielerische und zugleich subjektive Charakter des Dialogs, der sich im Blauen Salon entwickelt, als Kunst einer Avantgarde, die einer neuen Qualität des städtischen Lebens zuarbeitet, oder besser: sich ihr in zwanglosem Spiel nähert. Voiture ist der große Zeremonienmeister dieses Spiels, er setzt die entscheidenden Impulse, die die Gruppe aufnimmt und in leichtem Gespräch weiterspinnt. Sie lässt sich inspirieren, sie improvisiert und vergnügt sich damit, ihre Empfindungen und Einfälle auf neue Weise auszudrücken. Erlaubt ist, was gefällt. »Er [Voiture] hat auf immer den Anspruch, zur schönsten und galantesten Gesellschaft gehört zu haben, die jemals existierte, und von der er viel empfangen und der er vieles gegeben hat. Er hat den Anspruch, auf alle Zeiten die subtilsten Dinge ermöglicht zu haben. Er ist auf alle Zeiten unvergleichlich. Aber man werfe uns nicht vor, ihn auf alle Zeiten zu imitieren.«19
Die Gruppe wird ihm nicht dauerhaft nacheifern. Sie kann es auch nicht, denn der Wille zum Stil entwickelt eine ganz eigene Dynamik. Wenn es darauf ankommt, die Dinge auf neue Weise zu sagen und eine den eigenen Anliegen angemessene Sprache zu finden, kann es auf Dauer nicht genügen, immer in den gleichen Mustern zu sprechen, sich mit Imitationen und geronnenen Ausdrucksweisen zu begnügen. Jene, die sich mit dieser Art des Sprechens aus zweiter Hand begnügen, werden schon bald zum Spott ihrer Zeitgenossen. 1644 veröffentlicht der Schriftsteller und Historiker Charles Sorel (1602–1674) seine Loix de la Galanterie (›Gesetze der Galanterie‹), einen im Geist der Satire gehaltenen Ratgeber für alle, die in der feinen Pariser Gesellschaft etwas werden wollen. Der gehobene Auftritt ist voraussetzungsreich, erfahren die Leserinnen und Leser, denn er erfordert unter anderem Geld – durchaus beträchtliche Summen –, eine damit verbundene Veranlagung zum pompösen Auftritt sowie feines Gespür für den Geist der Zeit – und damit auch den der Sprache. »Sie werden immer mit den ausgesuchtesten Begriffen sprechen, die gerade am Hof gebräuchlich sind«, weist Sorel seine Leserinnen und Leser augenzwinkernd an. »Dabei werden Sie diejenigen meiden, die allzu pedantisch oder altbacken sind, solche also, die Sie niemals nutzen werden, es sei denn, um zu spotten. Ebenso gilt es durchweg einen komischen oder satirischen Stil zu pflegen.« Weiter gelte es die jeweils jüngsten Sprachmoden zu beachten: »Wenn es Wörter gibt, die erst vor kurzem erfunden worden sind und die die Leute von Welt gerne benutzen, muss man mit ihnen umgehen wie mit der neuesten Bekleidungsmode – also auf kühne Weise und so bunt wie eben möglich.«20
Mit spitzer Feder umreißt Sorel das unumgängliche Problem