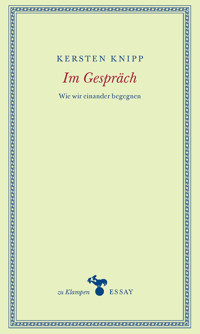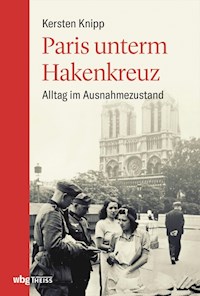11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Brasilien boomt. Lange als Land der Zukunft beschworen, muss man mit Blick auf heutige Verhältnisse sagen: Die Zukunft ist jetzt! »Das ewige Versprechen« wirft einen lebhaften Blick auf die schillernde und faszinierende Vielfalt der brasilianischen Kultur, von den Anfängen bis in die Gegenwart. Ob in Musik, Malerei, Mode oder Architektur – Brasilien war immer schon stilprägend. Kersten Knipp geht der vitalen Geschichte dieser Kultur nach, deren Ausdrucks- und Strahlkraft gewaltiger ist denn je. Was also ist Brasilien, und wer sind die Brasilianer? Wie wurde Brasilien zu einem solchen Erfolgsmodell? Welche Verheißungen und Ideale halten bis heute ein so vielgestaltiges Land zusammen? Anekdotenreich, in großen und kleinen Geschichten erzählt Kersten Knipp von einem Land, das sein ´ewiges Versprechen` einzulösen begonnen hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Brasilien boomt. Lange als Land der Zukunft beschworen, muss man mit Blick auf heutige Verhältnisse sagen: Die Zukunft ist jetzt! Kersten Knipp geht der aufregenden Geschichte der brasilianischen Kultur nach, deren Ausdrucks- und Strahlkraft gewaltiger ist denn je. Wer also sind die Brasilianer, und was ist Brasilien? Wie wurde es zu dem, was es heute ist? Welche Verheißungen und Ideale halten ein so vielgestaltiges, überbordendes Land zusammen? Anekdotenreich, in großen und kleinen Geschichten erzählt Kersten Knipp von einem Land, das begonnen hat, sein »ewiges Versprechen« einzulösen.
Kersten Knipp
Das ewige Versprechen
Eine Kulturgeschichte Brasiliens
Für H., die Zukunft als Versprechen
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2013
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage
der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4448
© Suhrkamp Verlag Berlin 2013
Suhrkamp Taschenbuch Verlag
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das
der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der
Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen,
auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form
(durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren)
ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert
oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet,
vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird,
ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir
übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: hißmann heilmann, hamburg
Umschlagfoto: Marcos Bonisson
Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Versprechen auf Brasilianisch
1 Begegnung am StrandDie Alte trifft die Neue Welt
2 Jenseits von PortugalDie Kolonie entdeckt sich selbst
3 Die geraubte HeimatBrasilien und seine Sklaven
4 Von Farbe und FreiheitDie Abschaffung der Sklaverei
5 Der Ruf vom IparangaBrasilien wird unabhängig
6 Süßer als die HonigbieneDie Romantik und die Indianer
7 Tropen und TempoBrasilien auf dem Sprung in die Moderne
8 Krieg im HinterlandDer Aufstand von Canudos
9 Moderne ZeitenSão Paulo, 1922
10Lob der MenschenfresserBrasilien auf der Suche nach sich selbst
11 Rhythm is it!Eine kleine Geschichte des Samba
12 Utopie im NiemandslandBrasília und der Traum der Avantgarde
13 Die Schöne am StrandDie Bossa Nova
14 Generäle und GuerillerosDie Militärs an der Macht
15 »Die Erbschaft unseres Elends«Die Literatur der Moderne
16 Raff dich aufDie Gegenwart
Bibliographie
Anmerkungen
Einleitung:Versprechen auf Brasilianisch
Da war Farbe und Bewegung,das erregte Auge wurde nicht müde zu schauen,und wohin es blickte, war es beglückt.
Stefan Zweig, Brasilien: ein Land der Zukunft
Ein Akt gegen die Schwerkraft, eine Bewegung, die eigentlich scheitern müsste. Kaum denkbar, dass der Schwung groß genug ist, den Springenden nicht tatsächlich durch die Luft trägt und nicht mittendrin fallen lässt wie einen schweren Sack. Aber die Energie ist da, und sie kommt aus dem Stand. Sie muss aus dem Stand kommen, etwas anderes lässt die Physik nicht zu. Mit einem Ruck hebt der Springende vom Boden ab, schleudert die Füße Richtung Himmel, denen dann Beine, Oberkörper und schließlich der Kopf folgen. Den ganzen Körper reißt es nach oben, wie gezogen von ungeheurer Energie. In wildem Schwung dreht er sich einmal um sich selbst, lässt die Erde hinter sich, zeigt, was sich mit Kraft alles erreichen lässt. Ein paar Augenblicke feiert der Wille Triumphe, um sich dann doch wieder der Schwerkraft zu beugen. Nicht demütig allerdings, sondern im stolzen Bewusstsein, das Mögliche erreicht zu haben.
Das Titelbild dieses Buches zeigt eine Szene am Strand. Ein Mensch voller Lebensfreude, der er auf grandiose Art Ausdruck verleiht. Ein Sprung am Wasser, vor den glitzernden Wellen des Atlantiks. Der junge Mann springt allein, für sich selbst, ohne Unterstützung durch eine Gruppe, wie es eigentlich die Regel ist. Denn normalerweise sind solche Sprünge Bestandteil der Capoeira, des brasilianischen Tanzkampfes, dessen Wurzeln in die Zeit der Sklaverei zurückreichen. Damals dienten die schnellen, kräftigen Bewegungen den Schwarzen dazu, sich Respekt zu verschaffen – untereinander, aber auch gegenüber der weißen Oberschicht, die massiv in der Sklavenwirtschaft engagiert war.
Und so hat die Capoeira neben aller Eleganz und Artistik auch etwas Bedrohliches. Die blitzschnellen Drehungen, Sprünge, die wirbelnden Arme und Beine, die ungeheure Kraft, die die Capoeira voraussetzt, mögen heute vor allem Kunst oder Spektakel sein – ihr Ursprung verweist auf andere Zwecke. Und wenn sich der Tanz heute so großer Beliebtheit erfreut, verweist dies neben der Freude an Schönheit und Körperbeherrschung auch auf die spezifischen Umstände, unter denen er entstanden ist. Das ewige Versprechen: Für die Portugiesen, die Brasilien im Jahr 1500 zum ersten Mal betraten, war das vor allem eines auf Reichtum. Pero Vaz de Caminha, der Chronist in Diensten auf den Schiffen von Pedro Alvarez Cabral, der die portugiesische Flotte jenes Jahres leitete, mochte sich noch so freundlich über die brasilianischen Indianer äußern – dass es letztlich um Gold und andere Schätze ging, daran ließ er keinen Zweifel. Die Kolonisierung Brasiliens war ein imperiales Projekt, von Anfang an auf Ausbeutung angelegt. Brasilien, das war eine Wette auf die Zukunft, darauf, dass sich in dem riesigen Land unter dem Tropenhimmel gewaltige Reichtümer ansammeln lassen würden. Schon der Name »Brasilien« deutet das an: Er geht auf das Brasilholz zurück, das man in Europa zum Färben brauchte und darum en masse aus der Neuen in die Alte Welt brachte.
Landschaft und Geschichte stehen darum in einem skurrilen Missverhältnis. Es gibt wohl nur wenige Länder, deren Natur ähnlich reich und schön ist. Die spektakuläre Kulisse von Rio de Janeiro, die schäumenden Wasserfälle von Iguaçu, die weißen Strände von Ceará oder die Weiten des Amazonas: Sie alle machen Brasilien zu einem wunderbaren, betörend anmutigen, furchteinflößend erhabenen Land. Und doch hat dieses Land unendlich gelitten – wie alle Länder, die unter die Herrschaft der Portugiesen und Spanier fielen. Die allermeisten derer, die auf den Spuren von Christoph Kolumbus und Pedro Vaz de Caminha den frisch entdeckten Kontinent betraten, lockte die Aussicht auf Reichtum. Gold, Silber, Edelhölzer, Zucker, Kakao und Kautschuk: Mit vielem ließ sich in Brasilien Geld machen, und wer immer die Mittel und den Mut hatte, der versuchte sein Glück – vorausgesetzt, er kam aus Europa, also aus den Ländern derer, die es als ihr selbstverständliches Recht ansehen, sich an dem Kontinent zu bereichern. Allen anderen, zuerst den Indianern und dann den verschleppten Afrikanern, war eine ganz andere Rolle zugedacht, nämlich durch ihrer Hände Arbeit den Reichtum zu fördern und ihren Herren dann zu überlassen. Und sputeten sie sich nicht, bekamen sie deren Unmut in drakonischen Strafen zu spüren.
Umso erstaunlicher scheint es, dass Brasilien eine solch reiche und wunderbare Kultur hervorgebracht hat. Seine Musik, allem voran der Samba, ist einzigartig. Ausgelassene Rhythmen, die zum Tanzen auffordern, sanft dahingleitende Melodien, in deren Schwung man sich wiegen möchte. Und doch ist gerade der Samba in einem schwierigen, ja feindlichen Umfeld entstanden. Er ist die Musik der Favelas, der schwarzen Vorstädte, genauer gesagt: der Elendsquartiere rund um die großen Metropolen. Der Samba berichtet von einem Leben unter Druck, von Menschen, die um ihre Existenz ringen müssen, mal in großen, meistens aber kleinen Kämpfen, der täglichen Sorge ums Brot, für das sie erst mal das nötige Kleingeld auftreiben müssen. Mag sein, dass im Samba auch etwas von der saudade der Portugiesen mitschwingt, dem diffusen Eindruck, im Leben nicht am rechten Platz zu sein, es vielleicht sogar zu verpassen. Im Fado, der portugiesischen Nationalmusik, hat die saudade zu ihrer schönsten Form gefunden. Ein Hauch von Fado schwingt auch im Samba mit – aber der knöpft sich andere Themen vor. In eleganter und zugleich direkter Sprache greift er die Missstände seiner Zeit auf, spricht von Gewalt, Rassismus, Bestechung. Und natürlich von den kargen Umständen, in denen so viele Brasilianer leben. Für sie ist das ewige Versprechen ein ganz anderes: eines darauf, das schwierige Leben gegen ein zumindest etwas Leichteres einzutauschen.
Dieses Versprechen hat sich in den letzten Jahren für zahllose Brasilianer erfüllt. Dank umfangreicher Sozialprogramme haben Millionen die Armut hinter sich lassen können. Wirtschaftlich hat Brasilien einen atemberaubenden Aufschwung genommen. Die Mittelklasse wächst, und mit ihr die Kaufkraft. Ebenso wächst mit ihr die Bildung. Brasilianische Techniker und Ökonomen zählen inzwischen zur Weltspitze, außenpolitisch fährt Brasilien einen sehr selbstbewussten Kurs, organisiert vor allem im Süden der Welt ein Lager, das den alten, etablierten Mächten Paroli bieten soll – mindestens. Eigentlich aber ist geplant, die globale Polit-Architektur grundlegend zu verändern, den aufsteigenden Mächten, zu deren Spitze Brasilien sich zählt, ein entsprechendes Gewicht zukommen zu lassen.
Eine wunderbare Erfolgsstory also. Und doch hat sie die Übel des Landes nicht beseitigen können, ja manche sogar verschärft. Stefan Zweig, der auf der Flucht vor den Nazis nach Brasilien kam und dort knapp zwei Jahre lebte, bevor er in Petrópolis im Bundesstaat Rio de Janeiro aus Verzweiflung über die Selbstzerfleischung Europas freiwillig aus dem Leben schied, hat ein beeindruckendes Buch über Brasilien geschrieben. In ihm kommt er immer wieder auch auf den freundlichen und friedlichen Charakter der Brasilianer zu sprechen. Recht hat er, zumindest auf der einen Seite. Die Brasilianer, die meisten jedenfalls, sind sehr umgängliche Menschen – offen, humorvoll, von mehr als nur formaler Höflichkeit. Unterhaltungen können sich über Stunden hinziehen, vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen, die leichten Themen genauso aufgreifen wie die schweren, die kleinen wie die großen. Und wer die brasilianische Variante des Portugiesischen mag, die lang gedehnten Vokale, das auf einen satten Zischlaut auslautende »t« oder »d«, dazu die charmante, latent archaische Syntax der Alltagssprache – für den ist Brasilien ein Paradies aus Worten, wechselseitiger Wertschätzung und warmen Willkommen. So hat auch Stefan Zweig die Brasilianer erlebt. Es gebe dort den wuchtigen, massigen, »starkknochigen« Typus des Nordens nicht, notierte er. »Ebenso fehlt im Seelischen – und man empfindet es als Wohltat, dies vertausendfacht zu sehen innerhalb einer Nation – jede Brutalität, Heftigkeit, Vehemenz und Lautheit, alles Grobe, Auftrumpfende und Anmaßende.«
Zweigs Buch erschien im Jahr 1941. Es ist das Buch eines Menschen, der vor der Barbarei in der Heimat floh, darum vielleicht einen besonders freundlichen Blick auf das Land wirft, das ihm Schutz gewährt. Brasilien hatte damals – und hat bis heute – einen einzigen Krieg geführt, nämlich von 1865 bis 1870 gegen Paraguay. Zweig war beeindruckt und angetan von dieser politischen Friedenskultur – so sehr offenbar, dass er darüber die weniger friedlichen Seiten des Landes übersah. Wenn nämlich die brasilianische Literatur so faszinierend ist, dann darum, weil sie fast durchgehend von Menschen in schwierigen Situationen handelt. Die frühen Chronisten, allen voran die portugiesischen Ordensleute, berichten vom Leid der Indianer, einige – allerdings weniger – dann auch von dem der Schwarzen. Im 19. Jahrhundert häufen sich die Berichte, und wenn sie sich ins Kämpferische wenden, vehement die Abschaffung der Sklaverei fordern, scheint aus ihren Seiten mit das Großartigste, was in der brasilianischen Literatur je verfasst worden ist. Aber die Schriften ließen keinen Zweifel: Brasilien war ein Land, in dem Brutalität an der Tagesordnung war. Und auch das, was die Autoren des 20. Jahrhunderts vor Zweigs Brasilienaufenthalt schrieben, ist eindeutig. Der Staat ließ schlimme Willkür und Ungerechtigkeit zu, unterschied gelegentlich sogar selbst zwischen Bürgern erster und zweiter Klasse – so etwa bei der gewaltsamen Vertreibung der zahllosen Tagelöhner und ihrer Familien, die Anfang des 20. Jahrhunderts aus dem Zentrum Rio de Janeiros weichen mussten, weil dieses umfassend modernisiert werden sollte. Fast alle landeten sie in den Notquartieren am Rande der Stadt – den Keimzellen der Favelas, in denen sich bis heute sämtliche Übel einer modernen Massengesellschaft verdichten. Wie es zugeht in den Favelas und wie sie zu dem wurden, was sie sind: auch das kann man in der brasilianischen Literatur lesen.
Und doch konnte Zweig nicht wissen, was wir heute wissen. Denn erst Jahrzehnte später drang die Gewalt in den Alltag ein, machte den Brasilianern auf drastische Weise zu schaffen. Kriminalität und Brutalität – auch die Lust an Brutalität – bilden das letzte und jüngste Kapitel der brasilianischen Gewaltgeschichte. An ihm lässt sich ablesen, welche Verwerfungen ein Land durchlebt, wenn es sich in Windeseile, im Zeitraum von zwei, bestenfalls drei Generationen, aus der Vor- in die Spätmoderne katapultiert, in ein, zwei Jahrzehnten von einer ländlichen in eine städtische Gesellschaft verwandelt, in seiner Mitte Metropolen heranwachsen, deren es kaum mehr Herr wird. Eine überstürzte Modernisierung, ein in Windeseile aufgezogener Kapitalismus, der Menschen, die über Jahrhunderte in gemächlichen Rhythmen gelebt hatten, fast über Nacht allerhöchstes Tempo und allergrößte Anstrengung abverlangt, ihnen die im Gegenzug zu erwartenden Sicherheiten aber verweigert – eine solche Gesellschaft sieht sich fast zwangsläufig größten Problemen gegenüber.
Umso größer ist die Leistung der Kultur. Die brasilianische Gegenwartskultur ist, ob sie will oder nicht, engagierte Kultur. Literaten, Musiker, Künstler: Alle setzen sich auf ihre Weise mit der Unwirtlichkeit der Städte – einer Unwirtlichkeit, die zunehmend auch die ländlichen Gegenden erfasst und prägt – auseinander. Sie beschreiben sie, wissen aber auch, dass sie es beim Beschreiben allein nicht belassen können. Nun kommt es darauf an, sie zu verändern. Und weil das so ist und weil die Künstler, Autoren und Musiker ihre Sache ernst nehmen, ist die brasilianische Gegenwartskultur von berstender Kreativität und Energie. Die Architekten Luis Costa und Oscar Niemeyer versuchten vor über 50 Jahren durch den Bau einer neuen Hauptstadt, Brasília, das ganze Land zu verändern, ihm eine neue politische und gesellschaftliche Kultur zu vermitteln. Kurze Zeit später versuchten die Intellektuellen und Künstler das Militär aus den Angeln zu heben, das sich 1964 an die Macht geputscht hatte. Sie scheiterten zwar an der selbstgestellten Aufgabe, verwandelten aber dafür sich selbst und das Land in ungeahntem Maß. Und die heutige Generation von Künstlern versucht die Kultur der Gewalt zu verändern, die Brasilien seit den 70er, 80er Jahren überzogen hat.
Und nach wie vor arbeiten sie daran, das größte Projekt voranzutreiben, das Brasilien sich überhaupt gesetzt hat: den neuen Homo brasiliensis, den »brasilianischen Menschen« zu schaffen. Mag sein, dass dieser Mensch niemals zur Welt kommen wird, jedenfalls nicht als exakt definierter, direkt zu definierender Typ. Vermutlich handelt es sich um einen eher theoretischen, besser vielleicht noch fiktiven Typus – der aber auf das Selbstverständnis des Landes ganz erheblichen Einfluss nahm, nimmt und nehmen wird. Indianer, Portugiesen und Afrikaner sind die Grundväter (und –mütter) des modernen Brasiliens. Ihnen traten später, im 19. Jahrhundert, Japaner, Libanesen, Syrer, Palästinenser, Deutsche, Italiener, Iren, Briten und viele andere zur Seite. Sie alle bildeten jenen großen Schmelztiegel, der Tag für Tag die unterschiedlichsten Mischungen hervorbringt. Brancos, pretos, pardos, mulatos, cafuzos, caboclos, mamelucos, cabras und viele mehr: Das brasilianische Portugiesisch hat eine ganze Klaviatur für die verschiedenen Ethnien und die aus ihnen hervorgegangenen Mischungen entwickelt. Alle sind sie Bürger eines Landes, alle Mitglieder einer einzigen Nation. Sie teilen sich Stadt und Land, leben Seite an Seite – wenn auch nicht immer harmonisch, und nicht durchweg ohne Grenzzäune, sichtbare und mehr noch unsichtbare. Dass diese vielen Gruppen einander näherkommen, mehr und mehr zusammenfinden, vielleicht, in ferner Zukunft, doch ein Homo brasiliensis aus ihnen entsteht. Auch das ist eines der großen Versprechen, das Brasilien für seine Bürger bereithält. Eingelöst hat das Land es freilich noch nicht. Aber es liefert Anstöße, wie das Miteinander gelingen könnte. Und darum, da hat Stefan Zweig recht, ist Brasilien ein Land der Zukunft. Ein Land, das weiterhin lockt, eine Zukunft in Aussicht stellt, die aber eben noch nicht restlos eingelöst ist. Es bleibt, vorerst, das Versprechen. Wie sehr die Brasilianer auf dieses Versprechen setzen, hat sich im Sommer 2013 gezeigt, als sie zu Hunderttausenden auf die Straße gingen und für ihre Zukunft protestierten: Für ein Ende der Korruption, ein Ende der Gewalt, bessere Lebensbedingungen, die Würde des Einzelnen. Es waren machtvolle Demonstrationen, die zeigten, wie entschlossen die Brasilianer das vor einem halben Jahrtausend gegebene Versprechen einfordern. Für sie ist und bleibt Brasilien ein Land der Zukunft, eines, das entscheidende Entwicklungen noch vor sich hat. Diese Entwicklungen werden in einer zusammenwachsenden Welt globale Auswirkungen haben, wirtschaftliche, politische und kulturelle Effekte weit über die Landesgrenzen hinaus. Was in Brasilien passiert, kann in Europa niemanden kalt lassen. Auch darum sollten wir uns für das Land und seine Kultur interessieren, ganz unabhängig von der Schönheit, die dieser Kultur wie selbstverständlich entspringt.
1Begegnung am StrandDie Alte trifft die Neue Welt
So ich wahrhaftig nur vom Raube lebte,Freibeuternd, oder weil man mich verbannt,Aus welchem Grunde, meinst du, etwa strebte,Ich nach Revieren, abseits, unbekannt?
Luis de Camões, Os Lusiades
Noch sahen sie das Land nicht, aber erste Anzeichen deuteten seine Nähe bereits an: Seit einiger Zeit trug die Strömung ihnen Gräser entgegen, und am Morgen des folgenden Tages zogen Vögel über das Schiff. Schließlich, am Abend des 22. April 1500, ist es soweit: In der Ferne zeichnen sich die Umrisse der Küste ab. Zunächst ein Berg: »sehr hoch und von runder Form«. In seiner Nachbarschaft weitere, nicht ganz so mächtige Erhebungen; schließlich flaches Land mit hochgewachsenen Bäumen. »Den großen Berg nannte der Kapitän ›Osterberg‹, und die Umgebung ›Land des wahren Kreuzes‹«.1 Doch bevor die Seeleute das unbekannte Land in Augenschein nehmen, müssen sie sich gedulden: Die Nacht ist hereingebrochen. Sechs Meilen vor der Küste gehen die Schiffe in der Bucht von Cabrália, nahe der Stadt Porto Seguro (»Sicherer Hafen«) im heutigen Bundesstaat Bahia, vor Anker.
Pero Vaz de Caminha, Schiffsschreiber an Bord der Expeditionsflotte unter Leitung von Pedro Álvares Cabral, erfüllte seine Chronistenpflichten penibel und mit Sorgfalt. Der nüchterne Stil seiner Aufzeichnungen lässt vermuten, dass er sich in jenen Momenten nicht darüber im Klaren war, dass er ein Dokument von welthistorischer Bedeutung verfasste. Die wenigen Zeilen, in denen er die Ereignisse der letzten Seemeilen festhielt, markieren ein Datum, das auf die Geschicke gleich dreier Kontinente – Lateinamerikas, Afrikas und Europas – allergrößten Einfluss nehmen sollte. In seiner Chronik schildert Caminha nicht weniger als die Geburtsstunde einer neuen Nation. Die Ankunft der Portugiesen an den Osterfeiertagen jenes Jahres 1500 eröffnete weit mehr als ein neues Jahrhundert. Sie setzte den Startschuss zu einer neuen Epoche, markierte den Eintritt eines Landes in die Weltgeschichte – zumindest jenen Teil der Weltgeschichte, den die Europäer schrieben.
Dass die Portugiesen so weit im südwestlichen Atlantik auf Land stoßen würden, war damals keineswegs ausgemacht. Sicher, Kolumbus war ein paar Jahre zuvor, 1492, einige hundert Seemeilen weiter nördlich von Álvares Cabral, auf verschiedene Inseln, die heutigen Bahamas, gestoßen. Aber dass sich hinter ihnen ein ganzer Kontinent verbarg, ahnten zu jener Zeit weder er noch andere europäische Seefahrer. Auch Álvares Cabral hatte, als er am 9. März 1500 in See stach, von möglichen Landmassen jenseits der neu entdeckten Insel keine genaue Vorstellung. Ohnehin folgte er eigentlich einem ganz anderen Auftrag: Drei Jahre zuvor, im Juli 1497, hatte ein ebenfalls portugiesischer Seefahrer, Vasco de Gama, als erster Europäer den Seeweg nach Indien erkundet. Zurück in der Heimat, erläuterte er König Manuel I. die hohen Gewinnmöglichkeiten, die der Gewürzimport aus Asien versprach. Der König war so angetan von den Aussichten, dass er umgehend eine Flotte mit 13 Schiffen Richtung Indien schickte. Deren Leiter, Álvarez Cabral, erteilte er noch einen weiteren Auftrag: nämlich zu überprüfen, ob Portugal weiter westlich im Atlantik womöglich territoriale Ansprüche reklamieren konnte. Denn seit Kolumbus von seiner Entdeckungsfahrt zurückgekehrt war, war zwischen Spanien und Portugal eine heftige Rivalität um die Vorherrschaft im Atlantik und die dort möglicherweise noch zu entdeckenden Gebiete entbrannt. Im Jahr 1494 wurden sich die beiden Seemächte im Vertrag von Tordesillas dann einig: Alle Gebiete jenseits einer 370 Seemeilen westlich der Kapverdischen Inseln gezogenen Demarkationslinie sollten an Spanien fallen; alle Länder östlich dieser Linie sollte Portugal erhalten. So ging das Gebiet des heutigen Brasiliens an Portugal, noch bevor das Königreich von dessen Existenz überhaupt sichere Kenntnis hatte.
Es war also eine auch für den damaligen Wissensstand brisante Entdeckung, über die Pero Vaz de Caminha König Manuel in seinem Brief informierte. In ihm erfuhr der portugiesische Herrscher auch, dass er von nun an neue Untertanen haben würde. Denn kaum machten sich die Seefahrer an Bord mehrerer Beiboote am Morgen des 23. April 1500 in Richtung Küste auf, erblicken sie dort, am Ufer eines Flusses, eine kleine Menschengruppe. Cabral ordnet an, Anker zu werfen. Eine kleine Vorhut lässt er weiterrudern, derweil die Menge am Strand wächst: »Erst zwei, dann drei, so dass sich, als das Boot die Flussmündung erreicht, dort 18 bis 20 Mann befanden.« Einer von Álvares Cabrals Offizieren nimmt Kontakt mit den Fremden auf. Diese reagieren freundlich, zumindest nicht feindlich. Vorerst allerdings bleibt der Kontakt verhalten: Man mustert einander, dann ziehen die Portugiesen sich wieder zurück. Am nächsten Morgen gibt der Kapitän das Signal zur Weiterfahrt. Ziel der Flotte sind die nördlicher gelegenen Gebiete. In einer Bucht lässt er die Schiffe vor Anker gehen. Auch hier zeigen sich Menschen am Ufer. Dieses Mal verständigen sich Portugiesen und Indianer ausführlicher. Der Kapitän lädt zwei junge Männer auf sein Schiff ein, wo sie mit allen Ehren empfangen werden – freilich nicht ohne bei den Gastgebern einige Verwunderung auszulösen: »Ihr Hautfarbe ist braun, etwas rötlich«, notiert de Caminha. »Sie gehen nackt, ohne irgendeine Bekleidung. Es ist ihnen gleichgültig, ihre Scham zu verhüllen oder zu zeigen; sie tun dies mit der gleichen Unschuld, mit der sie ihr Gesicht verhüllen.«2 Auch sonst wirken die Gäste recht befremdlich: Beide haben durchbohrte Unterlippen, in denen »echte weiße Knochen« stecken; der Kopf ist bis auf ein Haarbüschel auf der Scheitelhöhe geschoren; einer der Indios trägt eine »Art Perücke« aus gelben Vogelfedern. Als sie zu Álvares Cabral und den anderen Kommandanten geführt werden, machen sie »keine Ehrerbietungen«; auch sprechen sie nicht. »Einer warf jedoch den Blick auf die Kette des Kapitäns, und begann mit der Hand zum Land zu weisen und dann zur Kette, als wollte er sagen, dass es dort Gold gäbe. Er blickte auch zu einem silbernen Leuchter und zeigte gleichermaßen zum Land und zum Leuchter, als ob es auch dort Silber gäbe.« Ebenso interessieren sich die beiden Männer für die Perlen eines Rosenkranzes. Einer der beiden legt sie sich um den Hals. »Dann nahm er sie ab, wickelte sie um den Arm und zeigte zum Land und wieder auf die Perlen und zur Kette des Kapitäns, als wollte er sagen, sie würden Gold dafür geben.« Dann aber scheint es, er wolle sie doch nur zum Geschenk haben, was die Portugiesen aber ablehnen. »Dann legten sie sich mit dem Rücken auf den Teppich, um zu schlafen, ohne ihre Scham zu bedecken, die nicht beschnitten war. Die Schamhaare waren sorgfältig ausrasiert. Der Kapitän befahl, ihnen die Sitzkissen unter die Köpfe zu legen; und der mit der Perücke bemühte sich, diese nicht zu zerbrechen. Und dann legte man eine Decke über sie; und sie willigten ein, blieben dort und schliefen.«3
Tropische Anmut
Freundliche Menschen von paradiesischer Unschuld: Dieser Eindruck bestätigt sich auch in den folgenden Tagen und Wochen. Wo immer sie den Portugiesen begegnen, zeigen die Eingeborenen sich entgegenkommend und umgänglich, ohne jegliche Vorbehalte. Auch dem Gottesdienst, den der Kapitän auf dem neu entdeckten Land halten lässt, können sie offenbar etwas abgewinnen. Die Portugiesen stimmen Gesänge und Gebete an, »und ungefähr 50 bis 60 der Fremden waren dabei, mit den Knien auf dem Boden hockend wie wir. Und als das Evangelium gelesen wurde, erhoben wir uns und richteten die Hände in die Höhe. Sie erhoben sich mit uns und richteten ebenfalls die Hände bis zum Schluss in die Höhe. Wie wir setzten auch sie sich danach wieder hin. Und als wir Gott lobten und uns wieder hinknieten, knieten auch sie sich. Wie wir taten auch sie das mit erhobenen Händen, wenngleich auf eine derart sorglose Weise, dass es, versichere ich Ihrer Hoheit, nicht sonderlich ehrerbietig aussah.«4
Doch darüber lässt sich hinwegsehen – auch darum, weil der Anblick des fremden Landes so milde stimmte: Hübsch ist es anzuschauen, dieses von leichten Lüften durchwehte Land voller hochgewachsener Bäume und Palmen: »sehr flach und sehr schön.« Freilich, viel mehr kann man noch nicht sagen: »Bislang konnten wir nicht in Erfahrung bringen, ob es hier Gold, Silber, noch sonst etwas aus Metall oder Eisen gibt.« Doch das eigentliche Anliegen sei ohnehin ein anderes, schreibt der Chronist seinem König: »Die wichtigste Frucht, die man aus dieser Erde ziehen kann, scheint mir die Rettung dieser Menschen zu sein. Und dies muss der bedeutendste Samen sein, den Eure Majestät in diese Erde setzt.«
Es ist ein anmutiger Brief, den Vaz de Caminha an seinen König schickt. Wohlwollend sind die Worte, in denen er die Eingeborenen beschreibt, groß ist seine Bewunderung für die Schönheiten des Landes. Natürlich, dies ist ein typisches Kennzeichen des sogenannten ufanismo, des durchaus tendenziösen Eifers, mit denen Chronisten ihre Berichte ausschmücken, stets darauf bedacht, den Empfänger für ihre Sache einzunehmen. Und gerade in dieser Sache, weiß der Verfasser, geht es um etwas Großes. Eben darum hat Álvares Cabral auch beschlossen, zwei zur Besatzung gehörende Sträflinge in dem neu entdeckten Land zurückzulassen – ein Entschluss, dem sie sich paradoxerweise durch Flucht entziehen, in eben jenes Land, in dem der Kapitän sie ohnehin hatte absetzen wollen. Die beiden Ausgesetzten, so sah der Kapitän es vor, hätten schon einmal die Sprache der Eingeborenen lernen und sich mit ihren Sitten vertraut machen sollen, was die künftigen Kontakte zu den Indianern erleichtert hätte. Daraus wurde nichts: Die Spur der beiden Unglücklichen verlor sich in den Weiten des brasilianischen Küstengebiets auf immer.
Lockruf des Goldes
Ihr Schicksal deutet allerdings an, was sich auch in de Caminhas Brief erkennen lässt: Die Portugiesen haben noch einiges vor in dem neu entdeckten Land. Deutlich geben die Aufzeichnungen dem König zu verstehen, dass er sich um seine neuen Untertanen nicht allzu viele Gedanken machen muss: So freundlich und friedfertig wie sie sind, werden sie sich seiner Herrschaft offenbar ohne Umstände unterwerfen. Nein, solche Burschen braucht man nicht zu fürchten. Das ist umso erfreulicher, als eines scheinbar klar ist: Sie sind im Besitz von Gold.
In Caminhas Brief finden sich bereits alle Grundmotive, die die europäischen Vorstöße in die Neue Welt in den kommenden Jahrhunderten begleiten werden. Vor allem stellt sich die Frage nach dem Charakter, der moralischen Veranlagung und vor allem dem theologischen Status der Indianer: Sind es gute Wilde oder schlechte Wilde? Handelt es sich bei ihnen um Christen, zumindest potentielle Christen? Welche Religion haben sie, und steht diese mit den monotheistischen Religionen irgendwie in Zusammenhang? Es gibt Autoren, die das durchaus annehmen. Womöglich handelt es sich bei den Eingeborenen um »Präadamiten«, glauben die einen – Menschen also, die bereits vor der Erschaffung Adams den Erdball bevölkert hatten. Vielleicht zählen sie auch zu den »verlorenen Stämmen« Israels, sind also Nachkommen der Juden, mutmaßen andere. Dritte sind sicher, dass die Eingeborenen bereits Bekanntschaft mit dem Apostel Ostindiens gemacht hatten, von dem eine altchristliche Überlieferung berichtet.5 Wie also steht es in theologischer Sicht um die Eingeborenen? Je nachdem, zu welchen Antworten man kommt, entscheidet sich, welches die angemessene Haltung ihnen gegenüber ist. Diese Frage ist umso bedeutsamer, weil man ja nicht nur gekommen ist, um die frohe Botschaft in die Neue Welt zu tragen, sondern durchaus auch, um das Land und dessen Reichtümer in Besitz zu nehmen.
Kaum ist darum die erste christliche Messe auf brasilianischem Boden gefeiert, machen sich die Entdecker das Land auf ihre Weise untertan. 1502 erteilt der portugiesische König einer Gruppe Kaufleute die Monopolrechte zur Bewirtschaftung der neuen Kolonie. Dies ist der Beginn eines gewaltigen Unternehmens, in dessen Verlauf zunächst Abenteurer, Geistliche, Schiffbrüchige, verarmte Adelige und Seeleute in die Neue Welt kommen. Mit ihnen reisen aber auch zahlreiche degregados, verurteilte Straftäter, über die Gerichte das nach der Todesstrafe härteste Urteil verhängt haben: die Verbannung. Schritt für Schritt folgen andere Bevölkerungsgruppen, vor allem Bauern und Fischer aus den wirtschaftlichen darbenden Regionen des nördlichen Portugals. Für die brasilianischen Eingeborenen – auf dem Gebiet des heutigen Brasiliens lebten wissenschaftlichen Schätzungen zufolge um 1500 rund 4,7 Millionen Indianer6 – bedeutete dies den Anfang vom Ende ihrer bisherigen Lebensformen. Zugleich tragen die Europäer Krankheiten ins Land, gegen die die Indianer kein Immunsystem entwickelt haben. 1554 wütet eine ersten Masern- und Pockenepidemie durch die Kolonie, weitere Krankheitswellen folgen und kosten zahllose Eingeborene das Leben. Von den 40000 Indianern etwa, die Mitte des 16. Jahrhunderts die von den Jesuiten organisierten Missions- und Schutzgebieten bevölkerten, sollen am Ende des Jahrhunderts gerade 3500 überlebt haben.7
Tod im Kochtopf
Von dieser Wirklichkeit ist Pero Vaz de Caminha in seiner Chronik noch weit entfernt. Er schildert das neue Land als anmutigen locus amoenus, als Ort unschuldig-unbeschwerten Lebens. Damit greift er biblische, antike und mittelalterliche Motive idealer physischer und moralischer Landschaften auf, die sich umstandslos auch auf die Neue Welt übertragen lassen. Der Seefahrer Amerigo Vespucci etwa fühlt sich während seiner Reise im Jahr 1502 angesichts der ihn umgebenden Natur unmittelbar an den Garten Eden erinnert: »Manchmal war ich von den feinen Düften der Kräuter und Pflanzen sowie dem Geschmack der Früchte und Wurzeln so verzaubert, dass ich glaubte, ich befände mich im Irdischen Paradies.« Und die Menschen, die dort leben, beschreibt er als dieser Gnade durchaus würdig: »Sie kennen keine Stoffe, weder aus Wolle oder Flachs noch aus Baumwolle, weil sie einfach nichts brauchen. Sie haben auch kein privates Eigentum, denn alles gehört der Gemeinschaft. Sie leben miteinander ohne König oder Herrscher. Jeder Mann ist sein eigener Herr und besitzt so viele Weiber, wie er will. Sie haben keine Tempel und keine Gesetze, sie verehren nicht einmal Götzen. ... Sie leben ganz nach den Gesetzen der Natur. ... Sie treiben keinen Handel untereinander, und sie führen Krieg ohne Ordnung und ohne Kunst.«8 Vespuccis Schilderungen inspirierten einige Jahre später Thomas Morus zu seiner berühmten Utopia, in der er das Bild einer idealen Gesellschaft entwirft – irgendwo auf einer fernen Insel, weit weg von der Gesellschaft, in der er, Morus, selber lebte. Seine Begeisterung für dieses ferne soziale Gebilde ließ er sich auch nicht dadurch nehmen, dass Vespucci in seinem Bericht auch von der – gelegentlichen – Brutalität der Eingeborenen berichtet und von einer schaudererregenden weiteren Angewohnheit: nämlich ihresgleichen zu verspeisen. Dergleichen stört zunächst noch niemanden, das neue Land war das, als was man es sehen wollte: ein neuer Garten Eden. »Wenn es auf Erden ein Paradies gäbe, würde ich sagen, dass es sich heute in Brasilien befindet«, notiert im Jahr 1560 der Jesuit Rui Pereira.9
Von ganz anderen Eindrücken berichtete hingegen der deutsche Söldner Hans Staden (1525-1576). Auf einer 1550 im Dienste der spanischen Krone angetretenen Reise in die Neue Welt erlitt seine Flotte kurz vor der brasilianischen Südküste Schiffbruch. Staden kann sich retten und knüpft Kontakt zu den Portugiesen, denen er bereits während einer ersten Fahrt einige Jahre zuvor gedient hat. Er übernimmt das Kommando über eine kleine Festung auf der Insel Santo Amaro, rund 150 Kilomter im Norden von Rio de Janeiro. Dort führen die Portugiesen einen Kleinkrieg gegen die Tupínambá-Indianer, von denen Staden eines Tages verschleppt wird. Neun Monate halten sie ihn gefangen. In dieser Zeit drohen die Indianer wiederholt, ihn zu verspeisen. Doch Staden gelingt es, sich einen Ruf als Heiler und Wundertäter aufzubauen. Dieser bewahrt ihn davor, ein frühes Ende in den Kochtöpfen der Tupínambá zu finden. Wie ernst diese es jedoch meinen, begreift er, als im Laufe der kommenden Monate mehrere gefangene Portugiesen erschlagen und verspeist werden. Staden nutzt seine Gefangenschaft dazu, das Leben der Tupínambá in allen seinen Einzelheiten zu studieren. Seine Eindrücke veröffentlicht er 1557 in einem Buch, dessen bloßer Titel bereits eine große Leserschaft garantiert: Warhaftige Historia und beschreibung eyner Landtschafft der Wilden, Nacketen, Grimmigen Menschfresser-Leuthen in der Newenwelt America gelegen. Darin beschreibt er sehr detailliert auch die Praxis der Menschenfresserei. »Das tun sie nicht, um ihren Hunger zu stillen, sondern aus Feindseligkeit und großem Hass, und wenn sie im Kriege gegeneinander scharmützeln, rufen sie einander hasserfüllt zu: Über dich komme alles Unglück, du bist mein Essen, ich will dir noch heute deinen Kopf zerschlagen. Den Tod meiner Freunde an dir zu rächen, bin ich hier. Dein Fleisch soll noch heute, ehe die Sonne untergeht, mein Braten sein. Das alles tun sie aus großer Feindschaft.«10 Wie man sich die Schlachterei konkret vorstellen kann, auch das erfahren Stadens Leser in düsterer Anschaulichkeit. Und wo ihre Phantasie versagt, da helfen ihr die dem Band beigegebenen Holzschnitte auf die Sprünge. Diese Bilder waren von solch außerordentlicher Wirkung, dass sie auch lose gedruckt wurden, als Ikonen des Schreckens losgelöst vom Buch die Runde machten.
Nicht weniger drastisch als Hans Staden berichtete auch der Franzose Jean de Léry (1536-1613) von seinem Aufenthalt in Brasilien. Er begleitete eine Gruppe von Hugenotten und verbrachte zur selben Zeit wie Staden drei Jahre in der Bucht von Rio de Janeiro, wo die Franzosen eine Kolonie, »France Antarctique«, gegründet hatten. Dort hatte er ebenfalls engere Kontakte zu den Tupínambá. Lérys Beschreibung der menschenfresserischen Gewohnheiten des Stammes stimmen mit denen Hans Stadens überein. Allerdings versuchte der Franzose seinen Lesern den Abscheu über die blutigen Sitten zu nehmen, indem er sie mit kaum weniger blutigen Gewohnheiten in der Heimat verglich. »In erster Linie möge man an das, was unsere Wucherer tun, denken. Sie saugen Blut und Mark, verspeisen demnach zahllose Witwen, Waisen und sonstige arme Menschen bei lebendigem Leibe. Menschlicher würden sie handeln, wenn sie ihren Opfern sofort, anstatt sie dahinsiechen zu lassen, die Kehle durchschnitten. Sie sind demnach grausamer als die Wilden, von denen ich gesprochen habe.« Doch nicht nur auf metaphorischer Ebene erweisen sich die Europäer bei Léry als mindestens ebenso grausam wie die Tupínambá. Auch in der Alten Welt, erklärte er seinen Lesern, gebe es Beispiele für enthemmten Kannibalismus. Ein Opfer solcher Grausamkeiten sei in Auxerre etwa »ein gewisser Cœur de Foy«, ein Hugenotte, geworden. Nachdem seine Feinde ihn getötet hätten, rissen sie ihm das Herz aus, brieten es »und stillten ihre Wut, indem sie diese Teile verschlangen wie die Schlächterhunde. Heute noch leben Tausende von Menschen, die diese Taten bestätigen können.«11
Gute Wilde, schlechte Wilde
Der kleine Stich gegen die Feinde seiner französischen Glaubensbrüder ändert nichts daran: Lérys Buch ist ein frühes Dokument europäischer Selbstrelativierung, ein erster Versuch, die Eingeborenen im Rahmen ihrer eigenen Logik und nicht nach den Maßstäben der Alten Welt zu verstehen. Die Europäer, gibt er zu verstehen, sind gut beraten, sich moralisch nicht aufs hohe Ross zu setzen. Dass sie ohnehin Gefahr laufen, von ihren eigenen Vorstellungen zum Narren gehalten zu werden, deutete ihnen in feiner Ironie auch Lérys Landsmann, der Franziskaner André Thevet (1516-1590), an. In seinem Reisebericht Les Singularités de la France antarctique (1557) setzte er sich auch mit den Schilderungen jener Autoren auseinander, die die Neue Welt bereits vor ihm beschrieben hatten. Ihnen warf er vor, es mit der Wirklichkeit nicht allzu genau genommen zu haben: »Viele glauben unwissentlich, dass die Körper dieser Menschen, die wir ›Wilde‹ nennen, wie die der Bären, Hirsche und Löwen mit Haar bedeckt sind, da sie fast wie Tiere in Wäldern und auf Feldern leben. Und auf genau diese Art stellen die Fremden sie auch auf ihren Leinwänden dar. In anderen Worten, wer immer einen Wilden beschreiben will, muss ihn mit dichtem Haar von den Zehenspitzen bis zum Kopf ausstatten – eine ebenso unverzichtbare Eigenschaft wie die schwarze Farbe des Raben.«12
Staden, Léry und Thevet, aber auch viele andere befeuerten mit ihren Berichten die Diskussion, die in Europa über den Umgang mit den amerikanischen Ureinwohnern entbrannt war. In ihr prallten die unterschiedlichsten Thesen und Schlussfolgerungen aufeinander: Angenommen, die Indianer wären »Wilde« – handelte es sich dann um »gute« oder »schlechte« Wilde? Vielleicht war das aber auch unerheblich, wie der Franziskaner Juan Quevedo vermutete: Einem Gedanken Aristoteles' folgend, waren die Indianer für ihn »Sklaven von Geburt«. Wenn die Indianer aber »homunculi«, minderwertige Menschen, waren, wandten andere ein: Sollten sie dann nicht umso mehr den besonderen Schutz der Europäer genießen? Aber auch eine moralische Erziehung könnten sie gut gebrauchen, erläuterte der portugiesische Chronist Pêro de Magalhães Gândavo. Das erkenne man schon an der Sprache: Die Tupí-Indianer, berichtete er, kennten »kein F, kein L und kein R – – eine schreckliche Sache, denn so kennen die Indianer weder Fé (»Glauben«), Lei (»Gesetz«) noch Rei (»König«), und auf diese Weise leben sie planlos vor sich hin; außerdem können sie weder zählen, noch Gewichte oder Maße berechnen.«13 Der linguistisch geleitete Versuch einer moralischen Diagnose mochte nicht ganz ernst gemeint sein; doch selbst im Scherz offenbart sich das Überlegenheitsgefühl der Europäer. Zumindest einige der Indianer Südamerikas müsse man zur untersten Kategorie der Barbaren zählen und als »wilde Menschen« betrachten, ergänzte der spanische Jesuit José de Acosta. »Wilden Tieren gleich, haben sie kaum menschliche Gefühle.« Gerade darum aber, fuhr er fort, müsse man sie lehren, »richtige Menschen zu werden und sie erziehen wie Kinder«. Dieser Einschätzung widersprach der spanische Dramatiker Garcilaso de la Vega, der, als Sohn eines Eroberers und einer Inkaprinzessin, besonders sensibel für das Thema war: Er sprach von dem »guten, weisen Wilden«, ein Motiv, das auch der französische Essayist Michel de Montaigne aufgriff und in ganz Europa bekanntmachte. Neutraler formulierte es Bartolomé de las Casas: »Sind sie nicht auch Menschen? Haben sie keine Vernunft, keine Seele? Ist es nicht eure Pflicht, sie zu lieben wie euch selbst?«14 Am entschiedensten vertrat aber der Dominikaner Bartolomé de las Casas die Rechte der Eingeborenen. In seiner 1527 begonnenen Historia de las Indias beschrieb er in schockierender Anschaulichkeit, wie enthemmt seine Landsleute in den Kolonien mit den Indianern umgingen. Bis heute zählt sein Buch zu den eindrücklichsten Dokumenten kolonialer Grausamkeiten.
Von Holz und Handel
Auf die portugiesischen Kolonisten machten derlei Diskussionen wenig Eindruck. Sie interessierte vor allem eines: zu Wohlstand und Reichtum zu kommen. Das erste Produkt, mit dem sich entsprechende Ambitionen verwirklichen ließen, war das Färbholz – jenes »Pau-brasil«, dem die Kolonie ihren Namen verdankte. Dieses Holz ernteten die Kolonisten mit Hilfe der Eingeborenen, die zunächst noch auf freiwilliger Basis arbeiteten: »Die Indianer stellten ihre Arbeitskraft beim Auffinden, Fällen, Transportieren und Verladen des Färbholzes zur Verfügung, die Europäer belohnten sie dafür mit Messern, Äxten, Kleidung, billigem Schmuck und allerlei Tand.«15 Als die Portugiesen dann auch Zucker anbauten, begannen sie die Arbeit straffer und in größerem Umfang zu organisieren. Die Indianer, die an eine solche Art des Einsatzes nicht gewohnt waren, verweigerten sich ihr zunächst. So gingen die Portugiesen dazu über, sie zur Arbeit zu zwingen. Gleichzeitig – ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts – engagierten sie auch immer mehr Menschenfänger, die in Afrika Jagd auf Männer und Frauen machten und nach Brasilien verschleppten. Mehr und mehr ersetzten die Afrikaner fortan die Indianer als Sklaven und Zwangsarbeiter. Starke Fürsprecher fanden die Indianer auch in den Jesuiten, die 1533 ihre erste Missionsstätte errichtetet hatten und seitdem kompromisslos für den Schutz ihrer Zöglinge eintraten – was die portugiesische Krone 200 Jahre später, 1759, veranlasste, den Orden des Landes zu verweisen.
Trotzdem: Ihre Unschuld hatte die Kolonie, wenn sie eine solche denn jemals besessen haben sollte, längst verloren. Kaum dass sie entdeckt worden war, hatte sich die Neue Welt, nach den Worten ihrer Entdecker eigentlich ja ein tropischer Garten Eden, in eine riesige Wirtschaftszone verwandelt. Schon 1552 führte der portugiesische Historiker João de Barros Klage über den Verlust der frühen Weihen einer Kolonie, die doch unter ganz anderen Vorzeichen begonnen hatte: ›Santa Cruz‹ (›Heiliges Kreuz‹) lautete der Name, den man dem Land in den ersten Jahren gegeben hatte. Das aus Bäumen gefertigte Kreuz stand für einige Jahre an diesem Ort. Doch wie der Teufel hat auch das Zeichen des Kreuzes seine Macht über uns verloren. So große Mengen des roten Holzes, bekannt als Brasilholz, kamen aus diesem Land, dass die Menschen diesen Namen aufgriffen und ›Santa Cruz‹ darüber verloren ging. Es scheint, als ob der Name eines Holzes zum Färben von Kleidern bedeutender wäre als der Name jenes Holzes, das all jenen Sakramenten seine Färbung gab, durch die wir gerettet werden und die aus Christi Blut auf sie tröpfelte.« Man sollte der Kolonie ihren alten Namen zurückgeben, fordert João de Barros. »Denn unter Strafe eben jenes Kreuzes, das uns an unserem letzten Tag gezeigt werden wird, könnten wir angeklagt werden, mehr dem Brasilholz als dem Kreuz dienstbar zu sein.«16
Doch de Barros' Aufschrei nützte nichts: »Brasilien« blieb »Brasilien«, und das hieß: eine Wirtschaftskolonie, deren neue Herren gelegentlich zwar auch an zu rettende Seelen, viel mehr und viel öfter aber an die Mehrung ihres eigenen Reichtums dachten. Die historische Zäsur, die jene Ostertage des Jahres 1500 setzten, überlebten nur wenige Indianer. Den kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen hatten sie genauso wenig entgegenzusetzen wie dem Druck der Versklavung und den Viren, die die Kolonisten aus Europa einschleppten. Noch drastischer als die Männer bekamen die Frauen die neuen Herrschaftsverhältnisse zu spüren. Da die meisten Portugiesen ohne weibliche Begleitung in die Neue Welt reisten, zogen sie zur Zeugung ihrer Nachkommen die Frauen der Eingeborenen heran – »Indianerprinzessinnen«, wie die Portugiesen sie gerne nannten. Diese Frauen wurden zu Stammmüttern der ersten Brasilianer, der Töchter und Söhne einer Nation, die aus einer jahrhundertelangen Mischung unterschiedlichster Ethnien hervorging. Was ihre indianischen Stammväter und mehr noch Stammmütter dazu sagten, ist nicht bekannt. Brasilien war die ersten zweihundert Jahre nach der Zeitenwende von 1500 ein rein europäisches Projekt. Die Europäer definierten die Identität dieser Neuen Welt, physisch wie kulturell. Brasilien und seine indianischen Bewohner waren das, was die Portugiesen aus ihnen machten.
2Jenseits von PortugalDie Kolonie entdeckt sich selbst
Die Söhne Lissabon werden am Hof geboren, in Indien erzogen und in Brasilien verdorben.
Nuno Marques Pereira,Compêndio narrativo do peregrino da América
Nein, dieses Land kann keine Insel sein. Dafür ist es zu groß. Seine gewaltigen Ausmaße lassen etwas anderes vermuten: Es muss sich um einen neuen, bislang unbekannten Kontinent handeln. »Terra firme«, so werden die Seefahrer von der iberischen Halbinsel die Region bezeichnen, auf die sie im äußersten Westen des Atlantiks gestoßen sind. »Terra firma« – heute sagt man dazu: »Kontinent«.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!