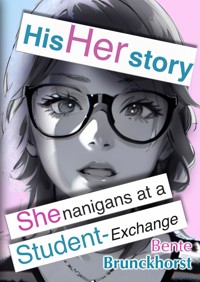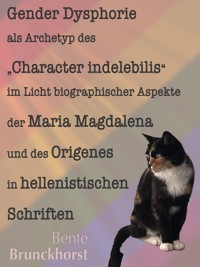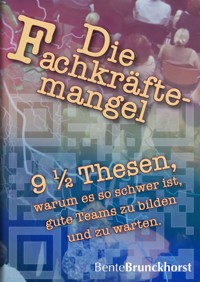
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Gehen Sie weiter! Dieses Büchlein enthält keine verwertbaren Fakten, sondern lediglich Meinung. Was glaubt die Autor*in bloß? Ach, Geisteswissenschaftler, na, dann ist alles klar! Auch noch in der Computer-Industrie gearbeitet? Bei den Einhörnern und so… Soll sie mal richtige Jobs ausprobieren, wo mit den Händen gearbeitet wird! Dann vergehen diese spinnerten Ideen schon… "KungFutius" sagt: Wenn starre Meinung Du hast, viel Lesen nichts nutzt. Im Reden Lösungen finden Du musst. In dem Sinne, wenn Sie in die Diskussion einsteigen wollen, ist das Büchlein bestimmt geeignet, ihre Komfortzone zu verlassen. - Und, wer weiß: Vielleicht eignet es sich sogar als kleines Geschenk?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
DIE FACHKRÄFTE-MANGEL
9 1/2 Thesen, warum es so schwer ist, gute Teams zu bilden und zu „warten“
Bente Brunckhorst
AD INTRODUCTIONEM
Eigentlich sollte der Untertitel heißen: Warum ist es so schwer, gute Fachkräfte zu finden?” Aber das trifft nicht das eigentliche Problem. Denn dieses sitzt sehr viel tiefer.
Weil die Fachkräfte nicht „gegendert“ sind? Also wie in den inzwischen üblichen Stellenangeboten: Fachkräfte:innen (m/w/d)? - Natürlich Quatsch. Wenn eine Person sich in einer Firma, im Team wirklich aufgehoben und ernstgenommen fühlt, dann gilt hier die direkte, passende Ansprache. Wenn diese Person in dieser direkten Ansprache ihrem Selbstbild entsprechend respektvoll behandelt wird, muss das Unternehmen nicht (m/w/d) hinter jedes Statement setzen. Dann lebt die Gruppe bereits Diversität. Die ja neben Gender-Aspekten wesentlich mehr Facetten aufweist. Das Wichtigste ist doch, dass alle im Team das gegenseitige Gefühl leben, eine Gruppe mit gemeinsamem Ziel zu bilden, die füreinander und nicht gegeneinander den Problemen gegenübersteht.
Andernfalls droht das vermeintlich Korrekte zur Farce zu werden. Es ist gemeinhin unerheblich, ob man eine dunkelhäutige Person mit dem N-Wort bezeichnet oder als „maximalpigmentierten Periäquatorialmensch“, sofern man ihr geballte Verachtung entgegenschleudert! Ihr eventuell gar mit Fäusten und Baseballschlägern gewaltsam zu Leibe rückt! - Andererseits wird man beim gemeinsamen Fondue-Abend vermutlich Wege finden, eventuell verletzend empfundenen Begriffen auf humorvolle Weise zu begegnen, denn das Wichtigste ist ja vorhanden: Gegenseitiger Respekt und Wertschätzung jenseits der vordergründig trennenden Aspekte und der Wunsch, miteinander zu reden.
Machen wir uns nichts vor, neben dem N-Wort haben wir noch J-Worte, das S-Wort, das I-Wort, das L- und das T-Wort, das Z-Wort nicht zu vergessen. B-Personen finden zudem meist, dass sie selbst in der Regenbogenfraktion untergehen und nicht genügend Beachtung finden. Und selbst die H-Pizza wird sowohl von italienischer, wie hawaiianischer Seite angemahnt!
Die Welt ist grundsätzlich aufgeregt. Erleben Sie mal Italiener bei der Frage, ob eine Sugo „Bologneser Art“ auf Spaghetti gehört und ob ein Polizist in Südtirol einen zunächst auf Deutsch oder auf Italienisch ansprechen sollte.
Ein ganzes Alphabet an gefühlt oder faktisch Unaussprechlichem tut sich neben solchen Do-Nots auf. Andererseits ändern sich unaussprechliche Dinge mit den Zeiten und Generationen. Und wir befinden uns zur Zeit der Drucklegung mitten in einem solchen Wechsel! Das, was noch Goethe aus unaussprechlich galt, wird heute im Schlussverkauf beworben: Die Hose, in allen möglichen Farben und Schnitten. Selbst Varianten, die nur kunstvoll um überwiegend Löcher designt wurden.
Dass Sprache das Bewusstsein prägt, wird massiv überbewertet. Es bedarf vielmehr bereits eines Willens, eines Bewusstseins zur beidseitigen und gemeinsamen Kommunikation. „Augenhöhe“ nennt sich das heute gern.
Die Fronten sind, was das „Gendern“ anbelangt, sogar (bewusst und orchestriert von finanzkräftigen „Meinungsmachern“) verhärtet worden. Ich werde in diesem Text deswegen gewollt und provokativ auf das „Gendern“ verzichten und an ihrer Stelle etwas anderes probieren. Ich werde gelegentlich stattdessen und vogelwild das generische Femininum einstreuen und es als Denksport den Leserinnen überlassen, ob nun explizit Frauen, oder die Gesamtheit möglicher gelebter Geschlechtsformen inklusiv gemeint ist. Das geschieht nicht, weil ich „Gendern“ für grundsätzlich problematisch halte. In Zeiten der Dominanz von Emojis ist die vielbeschworenen Reinheit der Sprache ohnehin vordergründig. Dem Genitiv eine zweite Chance zu geben, stünde der Gesellschaft besser an. Gefolgt vom reinen Konjunktiv, bar der Hilfsverben.
Gut, etwas Subversives ist ebenfalls mit in der Hinterhand. Aber positiv subversiv gemeint, denn die Diskussion ist hier bereits so verhärtet, dass sie nicht mehr zum Nachdenken anregt. Dabei ist gerade dieses notwendiger denn je, wenn man bedenkt, wie vehement aktuell (im Jahr 2025) der Kulturkampf um Geschlechtswahrnehmung in den Medien (nicht nur in unserem Land) ausgetragen wird.
Faszinierend, wenn sich Personen, deren Metier es ist, phantasievolle Geschichten zu erzählen, so wenig in andere Personen hineindenken können, dass sie sich in einem nicht zu gewinnenden „Kultur“-Kampf aufreiben. Diese TERF-Argumentation wird selbst bei genauerem Nachdenken fragwürdig, angesichts der Tatsache, dass man einerseits als Person nicht auf seine biologische Funktion reduziert werden möchte, andererseits seine Argumentation auf pure biologistische Fortpflanzungsargumente stützt. Diese Argumente fließen dann umgekehrt beim medizinisch notwendigen Fehlen/Entfernen dann doch wieder nicht in die Argumentation ein. Und zudem, wir haben dieses Phänomen in beiderlei Richtungen und über einen sehr langen beobachtbaren historisch-kulturellen Bereich!
Zu viel Theorie an dieser Stelle, nur soviel:
Vollends irreal wird die Argumentation, die eine dekadente Gegenwart beweint, angesichts der Tatsache, dass die indigenen Stämme Nordamerikas doch vor einem halben Jahrtausend schon sage und schreibe bereits fünf „Gender“ gezählt haben, trotz der Tatsache, dass sie ebenfalls wussten, dass zur realen Fortpflanzung primär zwei Geschlechter taugten. Und trotzdem waren bestimmte Positionen im Stamm bestimmten „Gendern“ vorbehalten, da diesen Personen besondere Fähigkeiten beigemessen wurden.
Zurück zu den unaussprechlichen Wörtern: Nehmen wir das leidige „N-Wort“. Die Geschichte hat uns, anders als Nord-Amerika, zum Glück vor einer Epoche der exzessiven, systematischen Sklaverei und der verrohenden Verwendung eines verunglimpfenden „N-Worts“ verschont.
Der Begriff „Mohr“ leitet sich hingegen absolut nicht in dieser wertenden Konnotation von den „Mauren“ ab, die sich in der südlichen Sahara-Gegend 1960 bei ihrer Staatsgründung selbst diesen Namen für ihr Staatsgebiet erkoren haben.
Warum man nun eine U-Bahn-Station krampfhaft umbenennen muss und dabei sogar antisemitische Personen ins Spiel bringt, obwohl das „J-Wort“ in unserer Geschichte eine viel größere Brisanz hat, ist vor allem eins: Aktionismus! Noch mehr Aktionismus ist es, wenn Schmierfinken aus der Haltestelle eine „Möhrenstraße“ machen. Dieser alternative Begriff der „Mohrrübe“ hat wohl seinen Namen woher?
Hüten wir uns vor dieser Art von Aktionismus! Vermeiden wir, allzu simple und voreilige Lösungen zu goutieren, die vor allem die betreffenden Personen nicht mit einbeziehen und über deren Köpfe hinweg Entscheidungen treffen! Auch das ist letztlich eine Form des Imperialismus, des Machismos und überaus paternalistisch; selbst wenn es von Frauen praktiziert wird.
Das alles könnte uns, auf unser Teams bezogen, als Beispiel für den Einstieg in der Diskussion dienen:
Etwas als Bereicherung statt Bedrohung wahrzunehmen, lenkt den Blick auf den potentiellen Nutzen, weg von einer möglichen Gefahr.
Wir wären in der Gesellschaft und in den Betrieben so viel weiter, wenn Profilierung nicht primär im Erkennen von potentiellen Gefahren, sondern im Aufzeigen von miteinander realisierbaren Lösungen stattfinden würde.
Das direkte Gespräch mit den Betroffenen suchen, statt schlicht Befindlichkeiten proaktiv zu vermuten, das stiftet Gemeinschaft. Denn ansonsten entsteht leicht eine Spirale, die jede Aktivität im Ansatz unmöglich macht. Wenn wir ehrlich sind, dann ist wirklich „wokes“ Handeln nicht möglich, weil Sie in ihrem Handeln immer irgendwelche Aspekte unserer 10.000 jährigen Menschheitsgeschichte unberücksichtigt lassen.
Zum Glück geht es aber nicht wirklich darum, sondern das bewusste Verletzen, das Herablassende im Dialog zu vermeiden und im konkreten Miteinander respektvoll umzugehen. Und wenn jemand zum Ausdruck bringt, dass er oder sie nicht behindert ist, sondern so gemacht wird, und dass der Begriff „Beeinträchtigung“ besser passt, dann ist das eben so. Andere sehen das vielleicht anders. Seien wir sensibel und handeln Sie situationsbedingt und persönlich und nicht pauschal über die Köpfe der Betroffenen hinweg.
Wenn Sie feststellen, dass ein Lagermitarbeiter eine Schreib-/Leseschwäche hat, benötigt er genau hier eine Hilfestellung und keine Rampe mit einem bestimmten Böschungswinkel. Bedenken Sie, die meisten Probleme, die uns in irgendeiner Form beeinträchtigen, entstehen im Laufe des Lebens, also bei Personen, die im Zweifelsfall längst innerhalb des Teams sind. Auf diese geänderten Bedarfe gilt es situationsbedingt und sensibel zu reagieren.
Sie sind also sehr oft bereits unsere Fachkräfte: Es geht somit nicht nur darum, sie zu finden, sondern insbesondere auch, sie zu halten. Zu halten? - Binsenweisheit, und trotzdem nicht ernstgenommen. Für den Fall, wenn es nach etlichen Jahren, in denen Personaler der Heerscharen an Bewerbungen nicht Herr werden konnten, noch immer nicht überall durchgedrungen ist: Wir befinden uns in einer Zeitenwende. Die „Human-Ressource“ beginnt knapp zu werden. Eine Vielzahl von Gründen zeichnet dafür verantwortlich.
Es geht an dieser Stelle aber ganz banal um den Aspekt, funktionierende Teams zu bilden, deren Mitglieder und provozierend auch „Mit-Vulven“ sich als operatives Ganzes verstehen und Aufgaben, Projekte und Ziele gemeinsam verfolgen. Teams, die sich gegenseitig den Rücken freihalten und Probleme nicht lediglich benennen, um sich selbst zu profilieren, sondern sich gegenseitig ergänzen und diese Probleme im Vorfeld im Zweifelsfall für ihr Team proaktiv beseitigen, bevor es eine eigene Dringlichkeit entwickelt. (“Herr Lehrer, im Keller brennt Licht!”)
TEAM also nicht als “Toll, ein anderer macht’s!”, sondern als gemeinsam verstandene Zielsetzung, in der dennoch jeder einen Teilbereich primär verantwortet, aber ebenfalls über den Tellerrand hinausblickt und Impulse setzt.
Deswegen: “Warum es so schwer ist, funktionale Teams zu bilden und zu warten?”
Moment mal: “Warten? Was soll das?”
Ja, denn Teams unterliegen einer Dynamik, die man im Auge behalten muss. Lebensumstände ändern sich. Manche werden krank, haben Schicksalsschläge, Unfälle, traumatische Erfahrungen, gründen oder verlieren Familien, ändern wichtige Parameter in ihren privaten Leben. Werden schlicht älter. Dieses im Auge zu behalten ist Aufgabe des Chefs.
Nur auf manchen fiktiven Sternenflottenraumschiffen gibt es eigens hierfür die Position des Moral-Offiziers. Im alltäglichen Leben des 21. Jahrhundert ist diese Aufgabe delegiert an den Teamleiter, der oft in Personalunion gleichzeitig Geschäftsführer ist.
Wäre trotzdem “pflegen” nicht der weniger spröde Ausdruck? Natürlich! Aber ist nicht „Pflege“ sofort assoziiert mit einer als geringer geachteten Tätigkeit? Der Pfleger ist nicht wirklich geachtet in unserer Gesellschaft. OK, man klatscht gelegentlich, dennoch ist sein Tätigkeitsprofil nicht „Chef-würdig“, wohingegen der Mechatronikerin, die eine desmodromische Ventilsteuerung eines sportlichen Motorrads wartet, eine gewisse Reputation und Kompetenz beigemessen wird. In kleinen Betrieben wäre sich auch die Chefin für diese Aufgaben nicht zu schade.
Sie merken, dass allein diese verquere Zuordnung der Geschlechterrollen schon auffällt? „Gendern“ Sie mal ehrenwerte Berufe wie den einer Hebamme und Sie erhalten einen Kunstbegriff mit „Assistenten-Konnotation”, der sich im wesentlichen spröde anfühlt.
Gut, Medizinern räumt man das Recht ein, in diesem speziellen Feld ebenfalls Kompetenz zu haben. Aber auch hier ohne den tiefen, historischen Mythos der weisen Frau, in den grundlegenden Dingen des Lebens bewandert, die Hebammen unterschwellig ihrem Gender zugesprochen wird.
Wir erinnern uns an die indigenen Medizinmänner. Ihr Wesensmerkmal war, dass sie sich von den anderen Stammesmitgliedern gerade auch in Gender-Aspekten elementar abhoben, nur so konnte diese spezielle Funktion vermittelt werden.