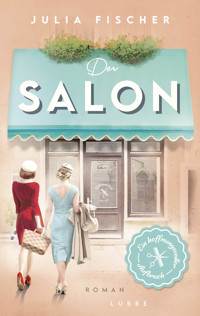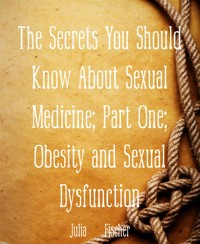6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein zauberhafter Sommer-Roman von der Autorin und Sprecherin Julia Fischer über große Gefühle, Italien, die große Liebe und große Oper. Sie kennt die Magie opulenter Stoffe und leuchtender Farben. Carlotta Calma, Damenschneiderin in Turin, hat sich ganz der subtilen Kunst verschrieben, Menschen durch Kleidung zu verändern, so wie ihre Mutter, Gewandmeisterin an der Turiner Oper. Carlotta entwirft Kleider für jede Lebenslage und stickt heimliche Botschaften unters Futter, die ihre Kundinnen auf eine Reise zu sich selbst schicken sollen. Denn für Carlotta ist eines klar: Es gibt keine hässlichen Frauen, jede Frau ist auf ihre Art schön und begehrenswert. Auch Carlotta hat sich seit ihrer Jugend verändert, ist vom hässlichen Entlein zu einer barocken Schönheit geworden. Ihr Jugendschwarm Daniele ist fasziniert von ihr, und sie glaubt sich am Ziel ihrer Träume. Doch ist der Schwarm von einst wirklich ihre große Liebe?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Julia Fischer
Die Fäden des Glücks
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein zauberhafter Sommer-Roman über große Gefühle, Italien, die große Liebe und große Oper.
Sie kennt die Magie opulenter Stoffe und leuchtender Farben. Carlotta Calma, Damenschneiderin in Turin, hat sich ganz der subtilen Kunst verschrieben, Menschen durch Kleidung zu verändern, so wie ihre Mutter, Gewandmeisterin an der Turiner Oper. Carlotta entwirft Kleider für jede Lebenslage und stickt heimliche Botschaften unters Futter, die ihre Kundinnen auf eine Reise zu sich selbst schicken sollen. Denn für Carlotta ist eines klar: Es gibt keine hässlichen Frauen, jede Frau ist auf ihre Art schön und begehrenswert.
Auch Carlotta hat sich seit ihrer Jugend verändert, ist vom hässlichen Entlein zu einer barocken Schönheit geworden. Ihr Jugendschwarm Daniele ist fasziniert von ihr, und sie glaubt sich am Ziel ihrer Träume. Doch ist der Schwarm von einst wirklich ihre große Liebe?
Inhaltsübersicht
Widmung
Zitat
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
Epilog
Zum Buch
Danksagung
Literaturliste
Links
Für die »Maßlosen«, die nicht in Schubladen passen, geschweige denn in Konfektion
»Einen Menschen zu lieben heißt, ihn so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat.«
Fjodor Michailowitsch Dostojewski
Prolog
Turin, Piemont, Mai 1997
Die Nacht war mit dem feinen Stoff verwoben, der Mond aus Kristallen gemacht, Hunderte Pailletten glänzten im kalten Licht der Deckenlampe wie blitzende Sterne. Carlotta zwang die schillernden Plättchen in Schlaufen und weinte, aber nur leise, denn ihre Mutter war schon auf dem alten Sofa eingeschlafen. Das prächtige Kleid bauschte sich auf ihrem Schoß – nachtblaue Marquisette, schwarze Gaze und Duchesse, Lage um Lage – und deckte sie zu. Eben noch hatte Mimi Calma einen Ärmel eingefasst, dann waren ihr die Augen zugefallen. Sie wurde schnell müde in letzter Zeit.
»Im neuen Schuljahr muss ich auf ein Internat, Lola«, hatte Daniele heute zu Carlotta gesagt. »Mein Vater war da früher auch.«
»Bist du wenigstens noch in den Sommerferien da?«, hatte sie ihn gefragt und sich an der Hoffnung festgehalten, damit sie nicht das Gleichgewicht verlor. Fünf Jahre waren sie jetzt zusammen auf der scuola primaria, fünf Jahre, und nun ging ihr einziger Freund einfach fort.
»Nein. Wir fliegen wieder nach Neuseeland, auf die Schaffarm.«
Carlotta saß bei ihrer Mutter, den Rocksaum in der Hand, und ihre Tränen liefen unaufhörlich. Sie tropften auf die funkelnden Glasperlen und versanken in dem edlen Stoff. Morgen war am Teatro Regio, der Turiner Oper, die erste Hauptprobe der Zauberflöte, und die Kostüme mussten fertig werden. Carlotta half gerne dabei. Sie war geschickt und liebte die Näharbeiten, die ihre Mutter manchmal auch mit nach Hause brachte. Doch heute war sie abgelenkt und dachte wieder und wieder an die Schule. In der dritten Klasse hatte sie sich dort in Danieles Mantel verliebt und ein bisschen auch in ihn. Der Mantel war schwarz und mit nachtblauer Seide gefüttert, nachtblau wie das Kleid, an dem sie gerade nähte. Sie hatte an der Garderobe ihr Gesicht darin vergraben und vom schützenden Fell der Schafe geträumt. Fast glaubte sie den Herzschlag der sanften Tiere zu spüren, vermischt mit dem Beben der Erde unter dem Stampfen einer Haka der Maori. Aber es waren nur die lauten Schritte ihrer Klassenkameraden, die den Flur entlangstürmten und sie überraschten. »Lola ist verlie-hiebt, Lola ist verlie-hiebt …«, riefen sie, und Daniele wandte sich ab, weil es ihm peinlich war. Aber als sie ihr dann auch noch das Pausenbrot wegnahmen, »damit die fette Lola-Qualle nicht platzt«, teilte er seines mit ihr und legte ihr den Mantel um, als es zu schneien begann. Carlotta strich mit den Fingerspitzen vorsichtig darüber und prägte sich das Gefühl für immer ein – die Geborgenheit und wollweiche Wärme der anschmiegsamen Zuflucht. Der Schnee fiel an diesem Tag auf Danieles dunkle Locken und schmolz, weil im richtigen Leben alles vergeht und nur die Illusionen überdauern. »Das ist ja wie in La Bohème«, sagte Carlotta zu ihm.
»Die Oper?«
»Ja. Meine Mutter ist Schneiderin am Teatro Regio, weißt du. Ich gehe jeden Tag nach der Schule rüber und mache dort meine Hausaufgaben. Da kann man überall spielen, und es gibt richtig gute Verstecke.«
»Hast du La Bohème gesehen?«, fragte Daniele interessiert. »Kennst du die Geschichte?«
»Klar.«
»Erzählst du sie mir?« Er schenkte Carlotta noch seinen Apfel und seinen schönsten Sternenblick.
»Also, die Hauptfigur heißt Mimi, so wie meine Mutter«, begann sie, »und Mimi ist die Nachbarin von Rodolfo, einem armen Schriftsteller. Sie klopft bei ihm, weil ihre Kerze ausgegangen ist und sie Feuer braucht.«
»Und dann?«
»Na, dann singen sie zusammen, weil ihnen kalt ist, weil’s draußen schneit, so wie jetzt. Aber auf der Bühne ist das kein richtiger Schnee, nur Schnipsel aus Seidenpapier.«
Daniele war begeistert. Zu Hause erzählte ihm niemand Geschichten, und er hatte auch keinen zum Spielen. Seine Mutter erlaubte ihm nicht, seine Freunde aus der Schule mitzubringen, denn sie waren kein passender Umgang. Schließlich war Danieles Vater ein bekannter Webereibesitzer. Die Lanificio Giordano produzierte mit die besten Stoffe der Welt. Dass Daniele auf eine öffentliche Schule ging, war der Wunsch seines Vaters gewesen, ein bescheidener Mann, der sich gerne unter seine Arbeiter mischte. »Mimi ist krank«, erzählte Carlotta weiter, »sehr krank. Sie hustet dauernd.«
»Muss sie sterben?« In der Oper ging es immer tragisch zu, das wusste Daniele, weil sein Vater auch oft Opern hörte.
»Du bist ja wie Peter Pan«, erwiderte Carlotta da und lachte. Sie saß auf dem Schulhof, vor dem sie sich sonst immer so fürchtete, und lachte! »Dem muss Wendy auch ständig Geschichten erzählen, so wie ihren Brüdern.«
»Ja, ich bin Peter«, stimmte Daniele ihr zu, denn dieses Theaterstück kannte er, »und du bist Wendy, mit der er ins Nimmerland fliegt, damit sie ihm und den verlorenen Jungs dort Geschichten erzählt.« Einmal um den Mond und weiter Richtung Nimmerland …
Am Ende des Winters fragte Carlotta Daniele, ob er sie nach der Schule einmal in die Oper begleiten wolle. »Ich weiß nicht, ob meine Mutter das erlaubt«, zögerte er.
»Aber Gino meint, er kennt deinen Vater, und er passt auf dich auf.«
»Wer ist Gino?«, wollte Daniele wissen.
»Er ist Schlosser und arbeitet in der Rüstmeisterei. Da machen sie Waffen und Feuerwerk.« Und den Flügel mit den Pfauenfedern, den die Königin der Nacht zu dem Kleid tragen würde, an dem Carlotta noch immer nähte. »Außerdem ist Gino so was wie mein Vater, mein Stiefvater. Er kümmert sich um meine Mutter, Rosina und mich.« Rosina war Carlottas kleine Schwester. Sie war erst eineinhalb. Ihre Mutter brachte sie tagsüber in die Kinderkrippe, damit sie arbeiten konnte, und Carlotta passte abends auf sie auf, wenn Mimi bis zum letzten Vorhang in der Oper bleiben musste. Dann sang sie für Rosina Lieder und verscheuchte schlechte Träume mit warmer Milch und Honig. »Ich glaube, Gino ist in meine Mutter verliebt«, verriet Carlotta ihrem Freund, »aber er traut sich’s nicht zu sagen.«
Daniele lächelte verlegen. »Und dein richtiger Vater?«, fragte er. »Wo ist der?«
Carlotta zuckte mit den Schultern. »Weiß ich nicht.« Sie tat so, als wäre es ihr egal, doch hin und wieder vermisste sie ihn. Es war nur eine unbestimmte Sehnsucht und der Wunsch, so zu sein wie die anderen.
Im kalten Licht des kleinen Zimmers fädelte Carlotta gerade den letzten Faden ein. Sie war fast fertig, die Glasperlen und Pailletten waren aufgebraucht, und Tränen hatte sie auch keine mehr. Daniele würde fortgehen. Sie würden nie wieder mit Gino in der Rüstmeisterei Peter Pan spielen – Gino war der allerbeste Kapitän Hook! –, nie wieder zwischen stumpfen Speeren, Lanzen und Piratensäbeln umherjagen, zusammen an der Drehbank stehen, sägen und hämmern. Einmal hatten sie mit Gino sogar eine Krone gemacht – für König Lear! Mit wem suchte sie denn jetzt Geheimverstecke, wer blies mit ihr Sternenstaub vom Schnürboden auf die Bühne hinunter oder verkleidete sich mit ihr im Fundus? Wer plante mit ihr Abenteuer? Und wer würde sie in der Schule beschützen?
Mit letzten flinken Stichen befestigte Carlotta das kleine Etikett mit dem Namen der Sängerin und dem Vermerk Zauberflöte im üppigen Mieder. »Du musst immer die Atmung berücksichtigen, Lotta-Schatz«, hatte ihre Mutter ihr bei der ersten Anprobe des prächtigen Kleides erklärt, »denn jeder Sänger atmet anders«, und die Königin der Nacht im Gewühl der Schneiderwerkstatt zwischen ratternden Nähmaschinen und glühenden Bügeleisen eine Arie anstimmen lassen, bis die Stoffzugabe aufgebraucht war. Ihre Stimme war eine Naturgewalt, rund, weich und hypnotisch, genau wie ihr Körper, dachte Carlotta, genau wie meiner. Doch auf den Brettern, die die Welt bedeuten, durften Frauen Raum einnehmen, und ihre Stimmen fanden Gehör. Hier spielten Hautfarben keine Rolle, denn die Sänger des Regio kamen aus der ganzen Welt, und wie alt jemand war, war auch ganz egal. Manchmal spielten sogar Frauen Männer, und pummelige Mädchen wurden irgendwann zum Star.
Carlotta suchte nach einem Kleiderbügel, schob einen Stuhl an die Wohnzimmertür und kletterte hinauf. Sie hängte das schwere Kleid ans Türblatt, damit es nicht knitterte, deckte ihre Mutter mit einer Wolldecke zu und betrachtete sie noch eine Weile. Sie war so schön. Sie trug ihr blondes Haar aufgesteckt und mit reichlich Schmuck darin, lilafarbenen Lidschatten und kräftigen mauvefarbenen Lippenstift. Ihre engen, spektakulären Röcke und Kostümjacken schneiderte Mimi selbst und kombinierte sie mit reichlich Accessoires und hohen Schuhen. »Alles ist erlaubt, solange es fantastisch ist«, hatte der Architekt der Turiner Oper einmal gesagt, und das war auch ihr Motto. Doch jetzt würden die Kleider ihrer Mutter bald wieder weiter werden, überlegte Carlotta. »Du wirst noch ein kleines Schwesterchen bekommen«, hatte sie am Abend erzählt, »im September, wenn Rosina zwei wird. »Ich möchte sie Susa nennen, was denkst du, Schätzchen?«
»Susa ist gut«, hatte Carlotta erwidert und geschluckt, weil sie dann bald zu viert alleine wären, ohne Vater.
»Freust du dich?«
Carlotta hatte nur genickt, denn das war kein Tag zum Freuen, nicht für sie. Daniele ging doch fort.
Sie löschte leise das Licht und schlich in ihr Zimmer unter der Dachschräge hinüber, wo Rosinas Bettchen neben ihrem stand. Die Kleine schlief und saugte an ihrem Schnuller. Carlotta legte sich zu ihr und verscheuchte die Schatten. Der schmale Mond vor ihrem Fenster schimmerte wie Strass am brokatgewirkten Himmel, die Sterne über Turin funkelten. In ihrem Traum fing Carlotta sie mit Nähgarn ein und säumte den Mond mit Silberpailletten.
Turin, Piemont, April 2016
1
Die weißen Riesen schoben sich am Ende der kalten klaren Nacht dicht an die Stadt heran, der Dunst löste sich auf. Der gewaltige Monte Viso mit seinem schneebedeckten Gipfel schien heute gleich hinter dem Corso G. Agnelli aufzusteigen, etwa auf Höhe des Eisstadions. Der Gran Paradiso, Monte Cervino und Monte Rosa balancierten auf den Kirchturmspitzen der Stadt. Carlotta stand auf dem Dach ihrer Wohnung, trank einen Cappuccino und träumte sich nach Frankreich hinüber. An der Küste entlang bis Gibraltar und das kleine Stück übers Meer kam man nach Marokko oder mit dem Po, der in Turin an den Hügeln mit den teuren Villen vorbeifloss, nach Osten ans Adriatische Meer. Auf seinem Weg durch die piemontesisch-lombardische Ebene speiste der Fluss weitläufige Reisfelder und wurde zur Heimat für Kiebitzschwärme und Reiher. Eine asiatische Impression unweit der Alpen und Myriaden gemeiner Stechmücken. Hier wuchsen Arborio, Carnaroli und Vialone – beste Sorten für ein duftendes Risotto, das Carlotta gerne mit frischem Spargel und knusprigem pancetta aß, mit Bärlauch und Safran oder als Indisches Curry. Als ihre kleine Schwester Susa vor neunzehn Jahren zur Welt gekommen war, hatte Carlotta kochen gelernt und ihre Liebe für ausgefallene Rezepte aus der ganzen Welt entdeckt. Sie hatte sich um den Haushalt gekümmert, ihre beiden Schwestern in den Kindergarten gebracht, wenn ihre Mutter noch schlief, und war dann selbst zur Schule gegangen. Sie hatte eingekauft, geputzt, die Kleinen wieder abgeholt und mit ihnen gespielt. Damals schlüpfte sie aus ihrem ungemütlichen Kokon und wurde zur Frau. Sie versöhnte sich mit ihrem fülligen Körper, erlebte ihn als anschmiegsam, Schutz spendend und stark. Heute glich ihre Figur einem harmonisch geschwungenen Violoncello, Carlottas liebstem Instrument im ganzen Orchester, und der Blick in den Spiegel quälte sie nicht mehr. Sie hatte den feinen klaren Teint ihrer Mutter geerbt, ihre kleine Stupsnase, die blauen Augen und das feste blonde Haar, das sie schulterlang trug. Und genau wie ihre Mutter lebte auch sie nun in einer Welt ohne Konfektionsgrößen und beißenden Spott, einer Welt, in der Menschen nicht auf eine Zahl im Etikett ihrer Kleidung oder ihrem Pass reduziert wurden und jede Schönheit ihr eigenes Maß besaß. Denn Carlotta hatte eine Schneiderei eröffnet und sie La Cenerentola genannt, nach der Oper vom Aschenputtel. Dort zauberte sie Kleider für Frauen wie sie, die nicht in Schubladen passten, oder jene, die noch auf der Suche waren – nach dem Außergewöhnlichen und nach sich selbst.
Gedankenverloren blickte Carlotta auf die hohen Berge, die Turin im weiten Halbrund umgaben, und spielte mit einem kleinen Fingerhut, den sie an einer Silberkette trug. Ein Flugzeug nahm Kurs auf die Balearen – einmal um den Mond und weiter Richtung Nimmerland … Carlotta war noch nie verreist.
An dem Tag, an dem sie Daniele das letzte Mal gesehen hatte, damals, am Ende der fünften Klasse, hatte es geregnet. Es war ein warmer Sommerregen gewesen, dachte sie gerade. Daniele hatte sie zur Oper hinüberbegleitet und sie dort gefragt, ob sie sich erinnere, wie Wendy Peter Pan einmal einen Kuss geben wollte und er ihr seine Hand entgegenstreckte, damit sie ihn da hineinlegen könnte.
»Weil er nicht gewusst hat, was ein Kuss ist«, hatte Carlotta erwidert. Natürlich erinnerte sie sich! »Wendy hat ihm dann ihren Fingerhut geschenkt, weil sie doch immer näht, und gesagt: »Das ist ein Kuss, Peter. «
»Gibst du mir auch deine Hand?«, hatte Daniele gefragt. Carlotta hatte sie ihm entgegengestreckt, und er hatte einen silbernen Fingerhut hineingelegt, sein Abschiedsgeschenk. »Das ist ein Kuss, Lola«, hatte er gesagt, »so wie in Peter Pan«, und ihr die Tränen vom Gesicht gewischt – eine Berührung zart wie Sternenstaub. Da wollte Carlotta mit ihm davonfliegen, zu den Piraten, Feen und Fingerhutküssen und weiter in jedes Märchenland, das sie in den letzten Jahren gemeinsam entdeckt hatten. »Ich komme nicht mehr mit rein«, hatte Daniele traurig geflüstert, sich zu ihr hinuntergebeugt und seine Lippen vorsichtig auf ihre gelegt. Ein flüchtiger Kuss, den der Regen gleich wieder fortwusch.
Während Carlotta noch in ihre Kaffeetasse träumte, fuhr ihre Schwester Rosina bereits mit dem Rad durch den Parco del Valentino zur Arbeit. In den ehemaligen Jagdgründen des Königshauses von Savoyen blühten die ersten Bäume und Sträucher, ein weißes und gelbes Wiegen mit rosa Sprenkeln im leichten Wind. Tulpen, Osterglocken und Veilchen, Springbrunnen und Skulpturen säumten ihren Weg. Rechter Hand, direkt am Fluss, stand das Borgo Medievale, die Nachbildung eines piemontesischen Dorfes aus dem ausgehenden Mittelalter. Mit seinen Zugbrücken und engen Gassen war es ein beliebtes Postkartenmotiv. Rosina trat in die Pedale. Sie freute sich dank des herrlichen Wetters schon jetzt auf eine Mittagspause im Freien. Jeder in der Stadt freute sich, alle saßen sie beim ersten Sonnenstrahl draußen vor den Cafés beim bicerin und später bei einem aperitivo, in Wintermänteln und Sommerstimmung. Freunde und Arbeitskollegen, Rentner und Schüler, jeder kannte irgendwen, der gerade unter den Arkaden spazierte oder einen der schönen zentralen Plätze überquerte. Sobald der Frühling kam, trafen sich die Menschen in der barocken Altstadt Turins, ohne verabredet zu sein.
Rosina war an diesem Tag die Erste in der Schneiderei, die ihre große Schwester vor zehn Jahren, an ihrem zwanzigsten Geburtstag, eröffnet hatte. Sie hatte erst kürzlich ihre Ausbildung bei Carlotta beendet, und Susa, das Küken, hatte vor einem Jahr damit begonnen. Die Kleine war ein quecksilbriges Geschöpf, unaufhörlich in Bewegung, flüchtig und unkonzentriert. Nie kam Susa pünktlich, immer dehnte sie ihre Pausen aus oder verschwand noch vor Feierabend, um sich mit wem auch immer wo auch immer zu treffen. Von den drei Schwestern war sie ihrer Mutter am ähnlichsten.
Mimi Calma war zur Gewandmeisterin befördert worden und verdrehte nach wie vor jedem Mann, der den Bühneneingang des Teatro Regio passierte, den Kopf. Sie pflegte ihre Affären und schwieg sich darüber aus. Und so kannten auch Rosina und Susa ihren Vater nicht. Eine schicksalhafte Begegnung beim Barbier von Sevilla oder Figaros Hochzeit lag nahe, bedachte man ihre Vornamen und die Inszenierungen, die in den fraglichen Jahren auf dem Spielplan gestanden hatten.
Rosina sperrte die Ladentür unter den Arkaden gegenüber dem Bahnhof Porta Nuova auf. Wenn die Calma-Schwestern von ihrer Näharbeit aufsahen, konnten sie dort die vielen Menschen beobachten, die einer Abfahrtszeit hinterherliefen, die Metro im Untergeschoss oder die Straßenbahn vor der Tür nahmen, und auch jene, die Einkäufe im lichtdurchfluteten, glasüberdachten Hauptgebäude machten. Denn Porta Nuova war eine architektonische Augenweide aus dem vorletzten Jahrhundert, ein Ort zum Verweilen und Ausgangspunkt fahrplanmäßiger Abenteuer.
Der Verkaufsraum musste gesaugt werden. Rosina holte den Staubsauger aus Carlottas Büro hinter der Werkstatt. Dann heizte sie die schweren Bügeleisen an, stellte frisches Wasser in einer Schüssel mit einem breiten Pinsel bereit, das zum Aufdämpfen benötigt wurde, und reinigte und ölte anschließend ihre alte Nähmaschine. Ein Blick auf Susas Arbeitsplatz sagte ihr, dass sie dort gleich weitermachen konnte.
Die Ladenglocke schlug an, Rosina hatte das Schild Aperto noch nicht ins Fenster gedreht.
»Ist Susa schon da?«, rief Carlotta aus dem Verkaufsraum zu ihr herüber. »Sie ist mit mir zusammen aus dem Haus.«
Die drei Schwestern wohnten gemeinsam im Stadtviertel San Salvario – vier Zimmer, eine Wohnküche und ein überquellendes, ständig besetztes Bad. Mit seinen riesigen Pflanzkübeln auf Mauervorsprüngen und Balkonen und einem Laubwald mit Wasserinseln im Innenhof erinnerte das Grüne Haus an Entwürfe von Friedensreich Hundertwasser, nur ohne Spiralen und Farben. Auf dem Dach gab es einen Gemeinschaftsgarten, in dem die Mieter Kräuter, Blumen und Gemüse anbauten. 25 Verde wuchs direkt neben dem ersten alten FIAT-Werk aus dem Boden und barg eine bunte Schar multikultureller Bewohner. Carlotta und Rosina lebten dort schon länger zusammen, Susa war erst vor einem Jahr bei ihrer Mutter aus- und bei den Schwestern eingezogen. Kurz hatte Mimi sich daraufhin einsam gefühlt und das vertraute Durcheinander und Susas Wildheit vermisst. Sie hatte wehmütig an die Zeit zurückgedacht, in der noch alle drei Mädchen bei ihr gewohnt und sie im engen Wohnzimmer unter dem Dach die Kostüme der laufenden Produktionen ausgebessert hatten. Doch seit ihrer Beförderung war Mimi für die Näharbeiten gar nicht mehr zuständig. Sie tauschte sich jetzt mit den Kostümbildnern und Regisseuren aus, interpretierte Entwürfe, wählte Stoffe aus und fertigte Schnittmuster an. Ihr oblag die Realisierung aller Kostüme der neuen Inszenierungen, soweit es die Damen betraf. Sie delegierte, organisierte und – was sie am wenigsten mochte – erstellte Zeitpläne und Etats. Sie besuchte Museen, studierte historische Kostüme und alte Fertigungstechniken, besprach sich mit den Schustern im Haus, den Hutmachern und der Rüstmeisterei. Dass ihre Mädchen nun groß, die Wohnung leer und sie alleine war, verwand sie im Sturm leidenschaftlicher Umarmungen wechselnder Liebhaber.
»Susa ist noch nicht hier«, gab Rosina Carlotta zur Antwort. »Ich kümmere mich gerade um ihre Nähmaschine. Sie arbeitet mit einer stumpfen Nadel und wundert sich, dass sie ständig alles wieder auftrennen muss.« Carlotta nahm sich vor, Susa künftig alle drei Maschinen warten zu lassen, nach Feierabend, bis sie endlich lernte, wie wichtig der sorgfältige Umgang mit den teuren Materialien war. »Ist sie mit dem Rad gefahren?«, fragte Rosina nach.
»Ja, und ich habe die Metro genommen«, erklärte Carlotta. Sie fuhr nur drei Stationen von der Haltestelle Dante bis zum Bahnhof, knapp sechs Minuten. Einmal war sie abgelenkt gewesen und erst im Paradies aufgeschreckt, am vorletzten Halt gleichen Namens – eine Fahrt, die nur in Turin gelang. Sie hatte damals in ihrem Reisetagebuch gelesen, in das sie all die Länder und Städte eintrug, die sie einmal besuchen wollte. Gourmetreisen durch die Welt – die Inkaküche in Peru entdecken, Sushi-Spezialitäten in Japan oder eine Cupcake-Tour durch New York. Sie war mit einem Karton kleiner Kuchen auf dem Schoß in der ruckelnden U-Bahn gedanklich ins Greenwich Village eingetaucht und schlemmte dabei lustvoll, als sie eine Dame hinter vorgehaltener Hand sagen hörte: »So eine hübsche junge Frau, wenn sie nur auf ihre Figur achten würde!« Ein Satz, den Carlotta gut kannte. Sie quittierte ihn gerne mit einem besonders großen Bissen in eine provokante Leckerei und dem Strahlen des unbeschwerten Genießers. »Wohin verschwindet Susa in letzter Zeit nur immer?«, fragte sie ihre Schwester. »Fällt dir das auch auf?« Carlotta erwartete nicht wirklich eine Antwort und kontrollierte stattdessen die Regale hinter dem Verkaufstisch, in denen sich die Meterware edler Stoffe bis unter die Decke stapelte – ein guter Teil ihrer Ersparnisse von Rosé bis Pink über Karmin zu Burgunder, von Purpur über Blau zu Kobalttürkis und sämtliche Erdfarben, schottischer Tweed, englischer Glencheck in bester Kammgarnqualität, luftige Seide-Woll-Gemische und wertvoller Kaschmir von asiatischen Ziegen. Aus ihrem dichten Unterfell zauberten die besten Webereien Norditaliens Tuche, leicht wie frisch gefallener Schnee – als hätten sie die fernen Winter selbst verwoben. Aber Carlotta konnte ihren Kundinnen auch Musterbündel zeigen, Stoffe für Röcke und Blazer, Hosen, Kleider und edle Abendgarderobe. In ihrer Auslage standen zwei Schneiderpuppen, die Carlottas neueste Kreationen zeigten und sich vor den internationalen Labels CHANEL, Prada oder Dior, die das teure Pflaster der Via Roma in der Altstadt säumten, nicht zu verstecken brauchten. Noch dominierten die warmen Stoffe im Fenster, aber Susa würde heute sicher umdekorieren, nichts liebte sie mehr, vorausgesetzt, dass sie noch auftauchte.
2
Gerade als Carlotta das Schild in der Ladentür umdrehte und die kleine Damenschneiderei damit offiziell geöffnet war, kam auch schon die erste Kundin herein – Signora Petroloni, eine mausgraue Dame Mitte fünfzig in völliger Unscheinbarkeit. Seit ihr Mann sie vor Jahren verlassen hatte, seit ihr Sohn aus dem Haus war und der Hund gestorben, hatte sie sich keine neuen Kleider mehr gegönnt. Für wen auch, nur für sich? Wer sah sie denn schon? Sie war darüber regelrecht unsichtbar geworden und wusste nicht, ob sie es so gewollt oder das Leben sie einfach ausgeblendet hatte. Eine ganze Weile war es ihr nicht einmal aufgefallen. Wie lange hatte sie nicht mehr in den Flurspiegel gesehen, bevor sie das Haus verließ? Signora Petroloni besaß jetzt einen Wellensittich – das einzig Bunte in ihrem Leben –, der öfter in den Spiegel sah als sie. Doch vor einigen Wochen hatte sie diese Schneiderei am Bahnhof entdeckt. La Cenerentola hatte auf dem schönen Ladenschild gestanden, und genauso hatte sie sich auch gefühlt – wie Aschenputtel vor der Verwandlung. In der Auslage sah sie zwei Schneiderpuppen, keine Gespenster mit Edelcouture auf den Rippen, nein, es waren die Silhouetten richtiger Frauen, und sie trugen zeitlose Kleider aus herrlichen Stoffen. Ein wacholdergrünes Tweedkostüm, bei dessen Anblick Signora Petroloni Bilder schottischer Inseln vor sich sah, weiches Gras, Schafe und klappernde Webstühle. Die britische Monarchin auf den Ländereien ihrer Sommerresidenz Balmoral Castle bei einem Spaziergang mit ihren Corgis. Und ein Hosenanzug, fließend, aus Flanell, mit weitem Bein und einem Wickelsakko, eisblau, schlicht und wirklich elegant. In der Spiegelung der Scheibe entdeckte die Signora sich dann selbst, kontur- und figurlos, eine Frau, die sich vergessen hatte, und so war sie beherzt durch die Tür getreten, ins Ungewisse.
Carlotta hatte ihr an diesem Tag zu einem klassischen Bleistiftrock mit taillierter Kostümjacke geraten und – entgegen Signora Petrolonis sonstiger Gewohnheit – einen maigrünen leichten Wollstoff der Lanificio Giordano dafür ausgewählt, der den Körper auch an warmen Tagen fast schwerelos umspielte.
»Ist es fertig?«, fragte die Signora Carlotta jetzt aufgeregt und versuchte, hinüber in die angrenzende Werkstatt zu sehen, wo Rosina eben noch den Rock aufdämpfte. Sie hatte das Seidenfutter erst am Vorabend kurz vor Ladenschluss einstaffiert und eine delfterblaue Paspelierung auf der Innenseite der Jacke aufgenäht.
»Ich denke schon«, erwiderte Carlotta. »Sind Sie bereit für die letzte Anprobe?« Signora Petroloni verschwand mit dem noch warmen Ensemble in der Umkleidekabine des Ladens und zog ihre verbeulte beige Bundfaltenhose, die in der Taille nicht mehr zuging, sowie den grauen Pullover aus. Ihren schlecht sitzenden Baumwoll-BH, der ein trauriges Dekolleté präsentierte, trug sie heute ausnahmsweise nicht. Sie hatte sich gestern einen neuen gekauft. Die Verkäuferin hatte ihn ihr persönlich auf den Leib gezurrt und dann mit einem beherzten Griff und einer routinierten Entschuldigung in die Körbchen gegriffen, um ihren Busen darin zurechtzurücken. Signora Petroloni war rot geworden, weil sie schon sehr lange niemand mehr berührt hatte, und schon gar nicht an dieser Stelle. Und dann strahlte die Verkäuferin sie an und meinte: »Das ist doch mal eine schöne Oberweite! Wenn Sie die richtig stützen und verpacken, ziehen Sie alle Blicke auf sich.« Da hatte sie noch zwei andere Modelle ausgesucht, eines in Schwarz und ein cremefarbenes mit schwarzer Spitze und die passenden Slips natürlich auch. »Sie kommen zurecht?«, fragte Carlotta vor der Umkleide, und Signora Petroloni bejahte es. Ihr erstes maßgeschneidertes Kostüm! Nicht die schlecht sitzende Konfektion, die so schnell aus dem Leim ging. Oder war doch eher sie es, die das tat? Ach, es war müßig, darüber nachzudenken. Und das Kostüm war grün! Maigrün hatte Signorina Calma gesagt und dass die Farbe die ihrer Augen unterstrich.
»Muss eine Bluse drunter?«, fragte sie aus der Kabine heraus, die nur durch einen schweren Vorhang abgetrennt war.
Carlotta antwortete: »Nicht unbedingt. An einem Tag wie heute werden Sie die Kostümjacke sowieso nicht ablegen wollen.« Und dann: »Sind Sie so weit?«
Der Vorhang wurde zur Seite geschoben, und eine ungläubige Signora Petroloni stand vor Carlotta. Das Kostüm saß wie angegossen. Der Rock endete genau auf Kniehöhe – das streckte, da Signora Petroloni nicht allzu groß war –, umspielte ihre runden Hüften und zeigte Taille. Ja, die Signora hatte eine, sie war nur über die Jahre und unter den weiten T-Shirts und Pullovern aus ihrer Wahrnehmung verschwunden, zusammen mit ihrem undankbaren Ehemann und ihrer Lebensfreude.
»Ist es nicht zu auffällig?«, fragte sie verunsichert. »Glauben Sie, ich kann so was wirklich tragen?«
Genau in dem Moment kam Susa in den Laden gestürmt. Ihre braunen Rehaugen funkelten glücklich, und sie fuhr sich durchs kurze blonde Haar. Ein Pixie-Schnitt, mit dem sie die Schwestern erst letzte Woche überrascht hatte – frech, sportlich und ungemein hübsch, genau wie Susa eben.
»Was meinst du, Susa«, band Carlotta ihre kleine Schwester gleich mit ein, denn sie konnte sie jetzt sowieso nicht fragen, wo sie so lange gewesen war, »kann Signora Petroloni die Farbe tragen?«
»Machst du Witze?!« Susa kam auf die Signora zu. »Sie sehen zehn Jahre jünger aus.« Und weil Susa es ernst meinte und Signora Petroloni schon beim ersten scheuen Blick in den Spiegel der Umkleide kaum glauben konnte, dass das wirklich sie war, die sie da sah, erlaubte sie sich, sich ein bisschen schön zu fühlen, heimlich.
»Möchten Sie noch etwas geändert haben?«, fragte Carlotta, die jetzt, ihr Maßband um den Hals gelegt, vor ihrer Kundin kniete und den Sprung der kurzen Kellerfalte überprüfte, die mehr Beinfreiheit gewährte. Diesmal hatte sie hier ihre Widmung eingestickt, versteckt unter dem Seidenfutter. Manchmal bot sich auch ein Revers an, ein Saum oder Bund. Selten war es mehr als ein Wort, oft in der Befehlsform verfasst, und es wirkte im Verborgenen: »Lebe!«, »Liebe!«, »Verzeih!« Jede Kundin bekam ihre eigene Widmung, und nie wiederholten sich Carlottas verborgene Wünsche.
»Nein«, flüsterte Signora Petroloni andächtig, »nichts.« Sie blickte in den großen Spiegel neben der Werkstatttür und drehte sich in alle Richtungen. Da stand schon fast wieder die Frau vor ihr, die sie einmal gewesen war – bevor ihr Mann gegangen und sie sich so wertlos gefühlt hatte. Er hatte ihre Selbstachtung mitgenommen und den guten Perserteppich, aber den vermisste sie viel weniger. Wenn sie seither auf der Straße ging, starrte sie meist auf den Boden, und sah sie doch einmal hoch, erkannte sie, dass dort viele, die sich nicht mehr aus sich heraustrauten, ihr Heil suchten – in den Ritzen zwischen den Pflastersteinen, auf dem Grund einer Tasse im Café, auf der Rückenlehne vor sich im Bus. In Aufzügen starrte man auf einen diskreten Fleck an der Wand gegenüber, um niemanden länger als zwei Sekunden ansehen zu müssen. Und dann gab es ja auch noch die Smartphones, die ganze Leben verschluckten und Scheinwelten schufen – Freundschaften ohne Kontakte, Reisen ohne Fortbewegung, Information ohne Erfahrung. Zusammengenommen ergaben diese unbeseelten Orte einen eigenen Kosmos, in dem man moderat verschwinden konnte.
»Darf ich etwas ausprobieren?«, fragte Susa Carlottas Kundin, und die nickte. Und schon zog sie die maigrüne Signora Petroloni mit dem fahlen Teint und den aschblonden, etwas unentschieden frisierten Haaren in die Werkstatt und setzte sie an ihren Platz. Rosina blickte von der Arbeit auf und lächelte ihr zu. »Wir nehmen nur ein bisschen Rouge und Wimperntusche«, erklärte Susa, »und Sie brauchen unbedingt einen passenden Lippenstift. Welche Farbe tragen Sie denn normalerweise?«
Ja, welche, überlegte die Signora. War Bitter ein Farbton?
»Ich habe mich schon so lange nicht mehr geschminkt, Liebes«, sagte sie zärtlich und betrachtete Susas Werk in deren Puderdose.
»Jetzt fehlen nur noch hohe Schuhe und ein Friseurbesuch«, entgegnete diese, ehe Signora Petroloni etwas erwidern konnte. »Ich würde sagen, etwas kürzer und blonde Strähnchen, das macht es lebendiger. Gehen Sie in die Via San Massimo, dort arbeitet ein Friseur, der aussieht wie Jake Gyllenhaal.«
»Und der schneidet auch Frauen?«
»Nein, nur Männer. Aber während Sie bedient werden, können Sie den Anblick genießen, und das spart Ihnen die Gala und COSMOPOLITAN für Wochen!«
»Susa!«, mahnte Carlotta ihre kleine Schwester, die die Anprobe mit Signora Petroloni gerade in eine Pyjamaparty für Schulmädchen verwandelte.
»Aber wenn’s doch stimmt«, gab sie unbeirrt zurück. »Das solltest du auch mal probieren, es macht gute Laune.«
»An der es dir ja nie mangelt!« Carlotta sah sie streng an. »Du fängst heute bitte mit dem Zuschnitt an, den wir gestern erarbeitet haben. Ich will von dir ein Probemodell aus Nesselstoff sehen.« Susa nickte ergeben. Alles, nur nichts mehr auftrennen müssen, das Auftrennen hatte sie nun wirklich satt. Ständig musste sie unter den wachsamen Augen ihrer großen Schwester ihre Arbeit verwerfen und von vorne beginnen.
Carlotta begleitete Signora Petroloni in den Verkaufsraum zurück und fragte sie, ob sie das Kostüm gleich anlassen wolle. »Es ist genau das richtige Wetter dafür.«
Die Signora sah zum Bahnhof hinüber. Die Sonne schien, und die Leute trugen ihre Mäntel bereits offen. Warum also nicht? Sie wollte ja sowieso noch Schuhe zum Kostüm aussuchen, und vielleicht – aber wirklich nur vielleicht – bemühte sie sich auch um einen Termin in der Via San Massimo. Jake Gyllenhaal … du meine Güte! Er hatte den Prinzen von Persien gespielt und war für Brokeback Mountain für den Oscar nominiert worden. Stahlblaue Augen und ein Lächeln … also ein Lächeln …
Als Signora Petroloni die Schneiderei an diesem Tag verließ, trug sie ihre alten Sachen nur noch in einer Tüte und beschloss, einen gemütlichen Spaziergang zur Galleria San Federico und weiter durch die Via Roma zur Piazza Castello zu machen. Sie wollte sich treiben lassen, einfach mal so in den Tag hinein, und Hirsestangen für ihren Rocco besorgen. Jetzt blickte sie auf und die Straße hinunter. Ein Passant sah in ihre Richtung und lächelte, ein Mann ihres Alters, der ihr bekannt vorkam, mit Trenchcoat und Hut. Sie drehte sich um, um zu sehen, wen er wohl im Auge hatte, doch hinter ihr stand niemand. Da erkannte Signora Petroloni – kurz vor ihrem sechsundfünfzigsten Geburtstag und damit keinesfalls zu spät! –, dass sie zwischen den Ritzen der Pflastersteine nichts finden würde. Das Glück sank nicht auf den Boden, es verbarg sich nicht auf dem Grund allein geleerter Kaffeetassen, nein, das Glück schwebte auf Augenhöhe und begegnete dem, der aufsah.
3
Vincenzo Giordano, Inhaber einer der besten Webereien des Landes, erreichte die Galleria San Federico, in der seine Büroräume lagen, genau um zehn. Sein Butler, den er schon von seinem Vater übernommen hatte, hatte ihn über den Ponte Vittorio Emanuele I in die Turiner Altstadt gebracht, vor der historischen Passage abgesetzt und war dann wieder zurück zur Casa Giordano auf den Hügeln über der Stadt gefahren. Eine tägliche Routine. Als Vincenzo aus der Limousine ausstieg, bemerkte er, dass die Sonne schien. Der graue Flanell, für den er sich heute Morgen entschieden hatte, der mit den Nadelstreifen, war aus weichem Kammgarn gefertigt und fast zu warm. Dafür passte er zu seinen dunklen Haaren und dem gepflegten Vollbart, in dem sich erstes Grau zeigte. Vincenzo war erst neunundvierzig, doch bei den Männern seiner Familie war das üblich. Es verlieh ihnen eine distinguierte Note, wie er fand.
Er hätte auf die Wettervorhersage seines Butlers hören sollen. »Zwölf Grad und steigend, leichter Südwestwind, Signor Vincenzo«, hatte Pasquale beim Frühstück verkündet und ihm etwas verschnupft den frisch aufgebügelten CORRIERE DELLA SERA überreicht. Eine antiquierte Marotte, von der er nicht abließ – das Bügeln der Zeitung, um Signor Vincenzo die Druckerschwärze an den Fingern zu ersparen, nicht der Wetterbericht. Der war hilfreich, wenngleich ausufernd. »Die Weidenpollen fliegen«, war Pasquale fortgefahren und hatte sich ein Niesen verkniffen, was seine tiefen Falten noch verstärkte. »Unsäglich, dieses Aufblühen! Das Barometer kündigt einen sonnigen Tag an.«
»Tut es das?«, hatte Vincenzo gefragt, der wie immer sehr leger im Morgenrock am langen Esstisch im Speisezimmer saß und sich um eine Konversation mit seinem betagten Angestellten bemühte. Pasquale verriet sein Alter nicht, aber er ging auf die siebzig zu. Er war höchstens zehn Jahre jünger als Vincenzos verstorbener Vater. Höchstens!
»Jawohl, das tut es«, hatte Pasquale bestätigt und Tee nachgeschenkt.
Der Frühling also, dachte Vincenzo, ein gnädig wiederkehrender Neubeginn. Vielleicht hatte er ja deshalb heute Morgen zum grauen Nadelstreifen gegriffen, dem letzten Anzug, den sein Schneider vor zehn Jahren für ihn angefertigt hatte, im Winter 2006, als die Olympischen Spiele in Turin ausgetragen worden waren und die Stadt sich neu erfand. Die Metro war gebaut und das aufgegebene und zu einem Hotel, Büro- und Einkaufszentrum umgebaute FIAT-Werk zum Pressezentrum erkoren worden. Lingotto, der Barren, mit der legendären Teststrecke auf dem Dach. Diese Bilder gingen um die Welt. Ja, genau das war der graue Nadelstreifen für Vincenzo, eine Reminiszenz an den erneuten Aufbruch seiner Stadt, an ihr wiedererwachtes Selbstbewusstsein und seine Befreiung. Denn in diesem Winter hatte er sich von Beatrice scheiden lassen. Er erinnerte sich noch deutlich an das Gefühl von Selbstbestimmung, Erleichterung und leisem Bedauern. Er verband es mit dem grauen Flanell, einem Zeitzeugen, so wie alle seine Anzüge, die Mäntel und Hüte. Selbst Vincenzos Krawatten erzählten Geschichten. In seinen Schränken konnte er lesen wie andere in ihren Tagebüchern. Er hatte über die Jahre nur wenig aussortiert, aber in letzter Zeit auch kaum mehr etwas hinzugefügt. Seinem Leben war nichts mehr hinzuzufügen, nicht hier.
Eine ältere Dame in einem auffallend gut gearbeiteten maigrünen Kostüm, Pumps und passender Handtasche, die Vincenzo an jemanden erinnerte – nein, er kam nicht drauf –, ging an ihm vorbei und betrat die Galerie. Er erkannte den Stoff sofort, Nummer 2/13096, die Kollektion vom Frühling 2013. Vincenzo kannte alle Stoffe seiner Weberei. Er nickte ihr im Vorbeigehen freundlich zu, und Signora Petroloni strahlte. In den neuen Schuhen fühlte sie sich aufrechter, sie bewegte sich bewusster, ihre Hüften tanzten ein wenig. Das genoss sie so sehr, dass sie heute gar nicht mehr nach Hause wollte. Außerdem hatte sie für elf Uhr einen Friseurtermin bekommen. Signor Giordano war nun schon der zweite Mann, der sie heute angesehen hatte, und im Spiegel dieser Beachtung fiel etwas von ihr ab. Der Mehltau, unter dem Rosen verschwanden, nach deren Duft sich keiner mehr sehnte. Sie wusste nicht genau, woran es lag, am maigrünen Kostüm, das Zauberkräfte zu haben schien, oder an der beschwingten Frühlingsstimmung? Aber etwas passierte an diesem Tag mit ihr, etwas veränderte sich, und vielleicht war es ihr Leben.
Vincenzo verharrte. Die kurze Begegnung hatte ihn aus seinen Gedanken gerissen, aber schon tauchte er wieder ein in die beredte Welt des grauen Flanells. Stoffe waren wie Bilder, wie die Poesie der Farben eines Gustav Klimt oder Friedensreich Hundertwasser. Eine Passion, die Vincenzo von seiner Mutter geerbt hatte, die die Malerei liebte, besonders Stillleben mit Rosen. »Du und deine Kunst«, hatte Beatrice früher oft geklagt und ihr langes braunes Haar in den Nacken geworfen, »ständig diese langweiligen Ausstellungen und dann die Oper … Können wir nicht mal ausgehen wie andere junge Leute, in einen Nachtclub oder eine Bar? Ich komme mir vor, als wäre ich schon hundert!« Ihre Augen, dunkel wie schwarze Vulkanerde, hatten vor Wut und Enttäuschung geglüht, doch selbst da war sie noch schön gewesen. Unnahbar und schön.
Atemberaubende weibliche Kurven und eine Taille, die ein Mann mit starken Händen fast umschließen kann. Sie steht über den Schautisch gebeugt, tief dekolletiert, in einem engen, zu kurzen Kleid. Das harte Licht fällt schräg von oben auf die breite Stoffbahn, die langsam unter ihrem konzentrierten Blick über die Arbeitsfläche gleitet. Beatrice stutzt, sie zieht die Lupe zu sich heran und schaltet eine weitere Lampe ein. Sie greift nach den feinen Nadeln, die die Abteilungsleiterin jeden Morgen ausgibt und abends abgezählt zurückverlangt, damit keine in einem Stück Stoff verbleibt, und näht einen Fadenbruch aus. Dazu beugt sie sich noch tiefer hinab. Das Licht zeichnet Schatten auf ihr schönes Gesicht und den üppigen Busen, ihr runder Po wölbt sich aufreizend, der Rock rutscht höher. Sie ist gerade mal siebzehn und träumt von einem besseren Leben, auf das sie drüben in der Chefetage schon einen Blick geworfen hat. Sie weiß, dass sie heraussticht, und ist doch nur eine von vielen. Eine von achtzig Frauen, die bei Giordano die Stoffe kontrollieren, die aus der Weberei herüberkommen oder von der Veredelung zurück. Beatrice entdeckt ein Webnest, das sie nicht ausbessern kann, und setzt ein Fehlerzeichen. Den Webfehler ihres Lebens verbirgt sie.
Die Giordanos führten ihren Betrieb in Valle Masso, einem kleinen Ort zwischen Mailand und Turin, jetzt schon in fünfter Generation, und wie Ermenegildo Zegna, Loro Piana oder REDA gehörten auch sie zu den Großen. Sie alle verdankten ihren Wohlstand dem klaren weichen Wasser, das aus den nahen Bergen kam und ihre Wollmühlen und Webereien speiste; Wasser, mit dem die frische, scharf riechende Schafwolle gewaschen wurde, um das Wollwachs abzuscheiden; Wasser, das zum Färben unabdingbar war und mehr noch für die Veredelung der fertigen Stoffe, die frisch vom Webstuhl erst einmal wie garstige, spröde Lumpen daherkamen. Hundert Arbeitsschritte waren es vom Fließ über das gesponnene Garn bis hin zum geschmeidig schimmernden Tuch.
Vincenzo, der in der Weberei seiner Familie seine Ausbildung gemacht und im nahen Turin Betriebswirtschaft studiert hatte, hätte überall aushelfen können. Er hatte unter der Regie seines Vaters den Rohstoffeinkauf abgewickelt und schon früh Verhandlungen mit internationalen Einkäufern geführt, denn er war von Anfang an dazu bestimmt gewesen, die Geschäftsführung zu übernehmen. Doch anders als sein Vater und dessen Vater vor ihm hätte er lieber in der Designabteilung gearbeitet und neue Muster und Stoffqualitäten entwickelt.
Es war an einem Frühlingstag wie heute gewesen, als Vincenzo Beatrice kennenlernte. Er war damals erst neunzehn und ein Frauenschwarm. Vincenzo war gerade auf dem Weg in die Werkshallen, als sie mit ihrem Rad an ihm vorbeifuhr, in Eile, denn ihre Schicht in der Reparaturabteilung hatte bereits begonnen. Sie sprang ab, drückte ihm ihr Fahrrad in die Hand und rief ihm im Laufen zu, er solle es doch für sie abstellen, als wäre er der Hausmeister oder irgendein Packer und nicht der Sohn des Chefs. Sie lachte, lief, ihr kurzes Kleid schwang im Rhythmus ihrer schnellen Schritte, und ihr schweres Parfum blieb im Hof zurück. Ein dunkler provokanter Duft, der Abenteuer versprach, die sie noch gar nicht kennen konnte.
Vincenzo betrat die Galleria San Federico und erfreute sich am prachtvollen Art déco, den feinen Läden und dem historischen Kino im Erdgeschoss. LUX stand in Leuchtschrift über den zweiflügligen Eingangstüren des Lichtspielhauses. Die hohe gewölbte Glaskonstruktion der Decke, der schwarz-weiße Marmor, Schmiedeeisen, all das erinnerte ihn an die Villa seiner Eltern oberhalb der Weberei, die er mit elf Jahren hatte verlassen müssen. Die Villa und seine Mutter und all die Träume, die sie mit ihm gemeinsam geträumt hatte.
Die Büros der Lanificio lagen im dritten Stock, dort, wo früher die Zeitung LA STAMPA ihren Sitz gehabt hatte, die noch heute der Familie der legendären FIAT-Gründer Agnelli gehörte. Ihr letzter großer Herrscher, der »Avvocato« Gianni Agnelli, starb vor dreizehn Jahren und mit ihm über hundert Jahre währende erfolgreiche Automobilgeschichte. Die Amerikaner schluckten damals die Fabbrica Italiana Automobili Torino, kurz FIAT, und den Nationalstolz gleich mit. Schwache Erben läuteten eben den Untergang ein, dachte Vincenzo betrübt und blickte zum Feinkostladen hinüber, wo er die Dame im grünen Kostüm wiederentdeckte. Sie stand vor der Auslage und verkörperte den Frühling mit femininer Eleganz. Dagegen würden die Männer nun bald wieder mit unkultivierten T-Shirts das Stadtbild prägen und baumwollenen Schals statt Krawatten. Der Turiner Frühling schlug sich in schlampigen Bermudas nieder und unsäglichen Socken in Sandalen. Die einstige Modehauptstadt Italiens war in der Masse betrachtet kein textiles Eldorado, lediglich alte Männer kleideten sich hier mit Würde, Geschäftsleute und schwule Pärchen. Und natürlich die Verkäuferinnen und Verkäufer der extravaganten Couture, die der gelangweilten Kundschaft zeigten, wie man sich mit einer kleinen Unsumme neu erfinden konnte.
Vincenzo ging am Pförtner vorbei, grüßte und schlüpfte schon im Treppenhaus aus seinem Mantel. Ohne Zweifel, es wurde Frühling in Turin.
4
Ein Gesamtkunstwerk in zartem Rosé: Das eng anliegende Kleid mit blassem Rosenmuster hatte Flügelärmel, einen goldfarbenen Schalkragen und Gürtel, und es gewährte tiefe Einblicke. Mimi Calma trug eine Korsage darunter, um Haltung zu bewahren. In ihrem aufgesteckten blonden Haar – die wenigen grauen vertuschte sie erfolgreich – saß eine riesige Blüte, ein Fascinator mit Strasssteinen. Ihr Make-up nahm die Farben wieder auf und gipfelte in leuchtend rosa Lippenstift und falschen Wimpern. Für Mimi hätte sich jederzeit der Vorhang heben und der Blick eines Mannes auf sie fallen können. Publikum, sie brauchte es so sehr, ohne existierte sie nur halb, der Applaus war ihr Leben. Vom ersten Morgenlicht bis zum Verlöschen der herabgebrannten Kerzen war er die Quelle ihrer Kreativität und Lebensfreude – der Applaus und ihre Kinder. Derzeit zollte ihn ihr ein Bass der La Traviata, dem sie auf der Probebühne begegnet war, als sie die Violetta zur Anprobe abgeholt hatte. Drei Monate hatte die Schneiderei des Regio an deren Kleid für den ersten Akt gearbeitet. Der Rock war aus einer so irrwitzigen Menge Seidensatin und Musselin gefertigt, dass jede Bewegung der Sopranistin fantastische Formen erschuf, flüchtige Skulpturen, die die Fantasie beflügelten und gleich wieder verschwanden. Wenn sie stillstand und die gewaltige Saumweite um ihre Beine drapierte, sah es so aus, als wüchse sie förmlich aus dem opulenten Kleid heraus und verschmölze mit seinen changierenden Farben. Der blutrote Rock ging fließend in ein puderfarbenes Mieder über, das dem zarten Hautton nachempfunden war. Heute gab Mimi letzte Anweisungen und kümmerte sich dann um die Fertigstellung der Kostüme für den Chor. Diese La Traviata ließ ihr Herz höherschlagen, denn sie war keine jener zeitgenössischen Interpretationen in Straßenkleidern, die Mimi lediglich für einen verschenkten Auftritt hielt. Nichts konnte sie mehr verdrießen als falsch verstandener Purismus. Und sie liebte das Abstrakte, Kostüme, die an keine Zeit gebunden waren, die die Rollen in Farbe und Form ausdrückten. Eine Hülle für den Klang und die großen Gefühle, die an der Oper immer etwas monumentaler waren als anderswo und sich über Oktaven erstreckten.
»Gehst du in die Kantine, Mimi?«, fragte Gino sie. Der langjährige Bühnenschlosser stand in der Tür der Damenschneiderei und ließ das vertraute Gewühl auf sich wirken – die großen Tische mit Stoffen, auf die mit Schneiderkreide Linien wie Landkarten aufgemalt waren; unzählige Schnittvorlagen, die auf Drahtbügeln an Garderobenständern hingen, ein raschelnder Wald aus Papier; Nähgarne, die auf Garnrollenhaltern die Wände schmückten, und Schneiderpuppen in den schmalen Durchgängen zwischen den Bügelstationen und Arbeitsplätzen der Näherinnen an der langen Fensterfront. Die Damenschneiderei befand sich im zweiten Stock der Gebäudezeile zur Piazza Castello, dem einzigen Teil der Oper, der nach dem Brand von 1936 erhalten geblieben war. Mimi und ihre Damen hatten eine wunderbare Aussicht auf die Rückseite des Palazzo Madama in schönstem Historismus, während die Herren in einem Nachbarhaus gegenüber dem Künstlereingang untergebracht worden waren. Man munkelte, dass es bei der Vergabe der Räume nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. Eine gewisse Dame habe sich im wahrsten Sinne des Wortes »nach oben geschlafen«, doch Mimis Kolleginnen ließen ihren kollektiven Aufstieg allesamt unkommentiert.
Mimi sah Gino an, und ihre schweren Wimpern klimperten. Sie flirtete mit ihm nur aus Gewohnheit, denn Gino war lediglich ein Freund. Ein Freund fürs Leben, mit Höhen und Tiefen, doch Letztere kostete sie nie unnötig aus. Schmerz war für sie nur ein gefräßiges Tier, das einging, sobald man es nicht mehr fütterte, Leugnen ein probates Mittel zur Verdrängung. Die Wahrheit schien Mimi stets überbewertet, sie komplizierte die Dinge doch nur.
»Ich muss den Nachlass meines Bruders regeln«, sagt Gino und setzt sich mit fassungslosem Blick zu Mimi an den Bühnenrand über dem Orchestergraben. Der Zuschauerraum wölbt sich vor ihm wie ein riesiger roter Walfischbauch mit weißen Rippen, den Seitenwänden der Logen. Seit er vom Tod seines Bruders weiß, fühlt Gino sich wie Jona, den der maritime Riese verschluckt hat, abgeschnitten von der Welt.
Bèp hat vor Jahren die Buntweberei der Familie übernommen, die Cotonificio Occelli nahe dem Ortsausgang von Valle Masso. Sie produziert einfache Baumwollstoffe, Tischwäsche und Futterstoffe für Regenzeug. Ein heruntergekommener Betrieb mit uralten Webstühlen. Gino hat damals ein anderes Leben gerufen, die Musik und die Liebe, die unerwidert bleibt.
»Wie ist das nur passiert?«, fragt Mimi ihn jetzt.
»Es war ein Unfall«, erwidert Gino. »Bèp ist oben in den Bergen von der Straße abgekommen und war sofort tot, mit vierzig Jahren. Wie kann so was sein?«
»Erbst du die Weberei?«, will Mimi wissen, und Gino schüttelt den Kopf. Er schweigt. Und zittert. »Soll ich dich zur Beerdigung begleiten?«, wagt sie einen weiteren Versuch, mit ihm zu reden.
Und er antwortet: »Denkst du nicht, dass du ihm das schuldig bist?!« Er ist so wütend. »Dass du ihr das schuldig bist, Mimi?« Er spuckt ihren Namen ins Parkett. Sie erschrickt, hat ihn noch nie so erlebt. Da weiß sie, dass Bèp es ihm erzählt hat. »Du musst es Carlotta sagen«, fordert er.
»Warum?«, fragt sie ängstlich und nagt nervös an einem lackierten Fingernagel.
»Weil sie nächstes Jahr, wenn sie volljährig wird, den Betrieb von ihm erbt«, erklärt er und steht auf. »Sie wird nicht viel Freude daran haben.«
Mimi denkt an ihr großes Mädchen. Carlotta kümmert sich um Rosina und Susa, als wären es ihre eigenen Kinder. Verdammt, flucht sie, wer braucht schon die Wahrheit? Sie macht nichts besser.
»Nein, ich habe heute Mittag einen Termin«, antwortete Mimi Gino und betrachtete ihn im Türrahmen der Schneiderei. Sie kannte ihn nun schon ihr halbes Leben lang. Er war ans Regio gekommen, als sie gerade dort ausgelernt hatte. Sein Haar war heute noch genauso dunkel wie damals, aber seine Augen hatten sich verändert. Sie waren grün wie die Landschaft im Südwesten des Piemont, zwischen den Weinbergen und Kirschplantagen, und sprühten vor Lebensfreude. Die hatte Gino erst hier entdeckt, in Turin, bei ihr und den Mädchen.
Viele der Kolleginnen schwärmten für ihn, denn Gino konnte schwere Maschinen reparieren, Partituren lesen, und er sprach manchmal noch die Sprache seiner Väter. Das piemontèisa war dem Italienischen und Französischen ähnlich, vermischt mit englischen Wörtern, Arabisch und dem alten Maya. »Wollen wir am Abend einen aperitivo zusammen nehmen?«, bot Mimi ihm an. Er sah schon wieder so enttäuscht aus.
»Da kann ich nicht, heute ist Dienstag.« Gino nickte den Damen an ihren Nähmaschinen zu und ging bedrückt zurück an die Arbeit.
»Sie brechen ihm das Herz, Signora Calma«, stellte eine der Schneiderinnen fest und seufzte. Das hab ich doch längst, dachte Mimi und spürte ein unbekanntes Gefühl in sich aufsteigen. War das etwa Bedauern? Um Himmels willen, sie war Anfang fünfzig, da blieb ihr doch keine Zeit mehr, um etwas zu bedauern! Solche Gedanken gruben sich flugs in die Gesichtszüge ein und machten unschöne Falten, die der beste Maskenbildner nicht vertuschen konnte.
Mimi sah auf die Uhr, sie musste los. Sie war mit ihrem neuen Liebhaber zum Essen verabredet. Wahrscheinlich musste sie die Unterhaltung wieder alleine bestreiten. Der Mann sah wirklich gut aus, aber er war verdammt schweigsam, was daran lag, dass er Este war. Sie stöckelte über die Piazza Castello, auf der die ersten Skater des Jahres ihre Sprünge übten. Eine Dame in einem maigrünen Kostüm saß auf einer Bank in der Sonne und sah ihnen zu. Mimi gefiel ihre Frisur, ein frischer moderner Schnitt, kinnlang. Die dauergewellten und artig auf Wickler gedrehten Einheitsfrisuren vieler Frauen ab fünfzig fand sie grauenhaft.
Signora Petroloni strich sich eine Strähne aus dem Gesicht und schmunzelte. Sie hatte alibihalber in den Frauenzeitschriften geblättert, die die Friseurin ihr hingelegt hatte, und den jungen Mann, von dem die kleine Signorina Calma erzählt hatte, bewundert. Er war ohne Zweifel ein Blickfang. Sie hatte ihre Augen kaum abwenden können, als käme sie gerade frisch aus einem Mädcheninternat. Jetzt fühlte sie sich runderneuert, innerlich wie äußerlich. Sie sah in die Tüte mit ihren alten Sachen, gab sich einen Ruck, stand auf und steckte sie beherzt in den nächsten Mülleimer. In diese Enge wollte sie nicht mehr zurück. In Kleidung, die Problemzonen erst zum Problem machte, weil sie an den Schenkeln kniff und anklagend über dem Busen schlapperte. In die Unscheinbarkeit, die sie wie unter einem Tarnumhang hatte verschwinden lassen. Vor aller Augen!
Mimi überlegte, die Dame anzusprechen, sie zu fragen, wo sie das Kostüm hatte arbeiten lassen, aber sie musste weiter. Am Palazzo Carignano wurde sie noch einmal langsamer, weil sie einen äußerst attraktiven Herrn in grauen Nadelstreifen registrierte, der vor dem Del Cambio, dem besten Restaurant der Stadt, stand und klingelte. Sie hätte zu gerne seinen Blick eingefangen, einen kurzen Moment im Scheinwerferlicht seiner Bewunderung verbracht, doch er beachtete sie nicht. »Giordano, zwölf Uhr dreißig« sagte er in die messingpolierte Sprechanlage, und der Türsummer erklang. Das waren die wirklich großen Auftritte, dachte Mimi da bei sich und setzte ihren Weg fort. Die würde sie immer nur aus dem Stehparkett miterleben.
5
Als der Tag, an dem der Frühling nach Turin gekommen war, zu Ende ging, traf sich die Stadt zum aperitivo. Heute saßen die meisten Turiner draußen, eng an eng, unter den langen Arkaden oder auf den gepflegten Plätzen – der weiten Piazza Vittorio Veneto, direkt am Po, umgeben von gepflegten Adelspalästen; der Piazza Castello, an der sich die Sehenswürdigkeiten nur so drängelten, allen voran die Oper und der Königspalast; oder im »Wohnzimmer der Stadt«, der Piazza San Carlo. In ihrer Mitte thronte das Reiterstandbild des Herzogs Emanuele Filiberto von Savoyen, der im 16. Jahrhundert die Hauptstadt seines Herzogtums von Chambéry nach Turin verlegt, Italienisch als Amtssprache durchgesetzt und das Grabtuch Jesu in den Turiner Dom überführt hatte. Ein guter Grund, der cavallo di bronzo, wie die meisten Filibertos imposante Statue nannten, mit einem trockenen Cinzano oder Martini kurz zuzuprosten, denn der Wermut hatte in dieser Stadt Tradition. Ein feinsinniger Turiner Weinhändler hatte ihn vor über zweihundert Jahren für die zarten Gaumen feiner Damen kreiert.
Vincenzo Giordano und sein Freund Gino Occelli trafen sich immer am ersten Dienstag im Monat im Caffè Mulassano, ein winziges Jugendstiljuwel mit rosafarbenem Marmortresen und einer ungewöhnlichen Kassettendecke, eine Einheit mit der aufwendigen dunklen Ladenfassade. Hier kamen in ständigem Wechsel den ganzen Tag über Menschen herein, bestellten einen Espresso, plauderten kurz und gingen dann wieder.
Gino, den sein Freund noch immer bei seinem Taufnamen Giòrs nannte, war mit Vincenzo in Valle Masso in die scuola primaria gegangen. In ihrer Freizeit hatten die Jungen auf dem Hauptplatz mit den Kindern der Spinner, Färber und anderen Weber des Ortes Fußball gespielt oder waren gemeinsam mit Ginos älterem Bruder Bèp durch die kleine Buntweberei ihres Vaters gestromert. Die Cotonificio Occelli stand in Hanglage, direkt an der Strona di Masso, und war ursprünglich mit Wasserkraft betrieben worden. Bei hohem Wasserstand drehte sich das alte Treibrad noch immer und ächzte bedrohlich, doch längst lief seine Kraft ins Leere. Die stillgelegte Antriebswelle im Keller verstaubte. Schon damals, in den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts, gab es in der Cotonificio baufällige Bereiche. Die feuchten Räume auf der Ostseite etwa, in denen zwei Jacquardwebstühle überdauerten. Ihr Holz hatte sich verzogen, die Weblitzen Rost angesetzt. Ein demontierter Warenbaum stützte einen angefaulten Türstock, denn das Dach in diesem Teil des Hauses war undicht. Und auch der schmale Balkon vor dem Vorraum zum Websaal, der zehn Meter über dem Fluss schwebte, war marode. Er hätte jederzeit abstürzen können.
»Du darfst da nicht drauf, Bèp!«, sagt Gino und hat plötzlich Angst. Sein Bruder ist heimlich hinausgegangen und lehnt sich über das kaputte Geländer. Er tut so, als würde er sich in den Fluss stürzen, und ruft aus Spaß um Hilfe. Er weiß, dass der Vater ihn nicht hört. Die brüllend lauten Revolverwebstühle im Saal nebenan schießen mit zweihundertfünfzig Stundenkilometern ihre Schiffchen durch die Kette, und dazwischen schlägt der Webkamm an und lässt Hunderte von Litzen scheppern, als würde es Nägel regnen. Zwanzig elektrobetriebene Maschinen in einem nach Öl stinkenden, von Faserstaub vernebelten Saal. Wenn der alte Occelli dort einen der Jungen entdeckt, gibt es gleich eine kräftige Ohrfeige, weil es tödlich enden kann, wenn eines der hölzernen Schiffchen mit den metallenen Spitzen übers Webfach hinausschießt. Jede Weberei hat ihre Einschusslöcher in den Wänden. Bèp turnt auf dem verbotenen Balkon. Der Beton ist bröckelig, abgefallener Putz liegt herum. Vincenzo und Gino stehen in der Tür und versuchen, von dort aus nach ihm zu greifen. Da löst sich das Geländer aus seiner Verankerung, der Boden bricht weg, und Bèp stürzt in die Tiefe. Er fällt vor den Augen der anderen, schreit und klammert sich im letzten Moment an die Abbruchkante. Der Fluss unter ihm tost, die Webstühle donnern in ohrenbetäubendem Rhythmus, Bèp schreit und weint. Vincenzo und Gino stehen wie angewurzelt da. Dann legt sich Vincenzo auf den Bauch, rutscht mutig hinaus, umfasst Bèps Handgelenke, und Gino verkeilt sich im Türrahmen und hält Vincenzos Füße fest. Der Lärm, die Todesangst, ihre Hilflosigkeit – Vincenzo bricht Bèp fast die Knochen, so fest hält er ihn. Und er ruft: »Du wirst nicht fallen, Bèp, hörst du! Ich zieh dich hoch!« Bèp starrt ihn an. Er glaubt den Aufprall schon zu spüren, gleich stürzt er ins Treibrad hinein. Doch da greift Gino auch noch nach ihm, und Vincenzo und er ziehen ihn gemeinsam hoch und ins schützende Zimmer zurück. Dort bleiben die Jungen liegen. Ihr Herzschlag und das Stampfen der Webstühle sind eins. Bèps Hände bluten, Vincenzos Hemd ist zerrissen, die Haut an seinen Unterarmen abgeschürft, die Hose völlig verdreckt.
Als Vincenzo an diesem Tag zu Hause reinschleicht, läuft er seinen Eltern in die Arme.
»Um Gottes willen, was ist passiert, Enzo?«, fragt seine Mutter besorgt und zieht ihn an sich. Er muss es erzählen. »Lass mich das erst mal versorgen«, sagt sie mit einem Blick auf das getrocknete Blut und küsst ihn vorsichtig. Ihre Lippen sind Schmetterlingsflügel, blass und kühl.
»Da wird gar nichts versorgt!«, donnert sein Vater Vittore. Er ist wütend und gibt sich selten die Mühe, seinen Zorn zu verbergen. Seine Windhunde ducken sich und klemmen ihre Ruten zwischen die Hinterläufe. Vittore zieht Vincenzo am Ohr in sein Zimmer und stößt ihn dort aufs Bett. »Kein Abendessen!«, sagt er mit bebender Stimme. »Und das nächste Mal, wenn du dir so eine Dummheit leistest, bekommst du von mir eine Tracht Prügel, die sich gewaschen hat!« Er wirft die Tür zu und sperrt sie ab. Dann streichelt Vittore seine Hunde, damit sie sich nicht ängstigen, und tätschelt ihnen liebevoll die schmalen Köpfe. Piccolo Levriero Italiano, Italienisches Windspiel – eine edle Rasse, und sie haben einen wirklich feinen Charakter.
»Enzo«, begrüßte Gino seinen Freund und zog den Stuhl am Tisch zurück, dass er sich setzen konnte. Das Mulassano war gut besucht. »Ich dachte, wir bleiben draußen und nutzen das schöne Wetter. Ist es dir recht?«
»Ich habe meinen Mantel dabei, kein Problem«, erwiderte Vincenzo, nahm Platz und orderte einen Negroni – Gin, roter Wermut und Campari auf Eis. Gino hatte bereits seinen üblichen Punt e Mes vor sich stehen, aber er wartete, bis der Kellner die tramezzini brachte und Vincenzos aperitivo, damit sie anstoßen konnten.
»Salute!«
»Salute, Giòrs«, sagte Vincenzo und trank einen Schluck. Sofort kroch ihm die Wärme des Alkohols in die Glieder, und der Arbeitstag fiel von ihm ab – die zähen Verhandlungen mit Dornier, bei denen er neue Luftdüsenwebmaschinen bestellt hatte, eine gewaltige Investition, die Sitzung mit den Produktionsleitern zum Arbeitsschutz, Probleme im Vertrieb und die Berichte seines Sohnes über die angestrebte Expansion der Firma. Daniele verlegte die Turiner Büros nach Mailand und plante, in den Couture-Markt einzusteigen, eine eigene Herrenlinie auf den Markt zu bringen, wie Zegna sie hatte oder Loro Piana, um konkurrenzfähig zu bleiben. Er dachte an die Gründung einer Tochtergesellschaft für das Geschäftsfeld Konfektion in Form einer GmbH, eine Absicherung für die Lanificio als Mutterunternehmen, falls der neue Geschäftsbereich in die roten Zahlen käme. Daniele war der Betriebswirt, den Vincenzos Vater sich immer für das Familienunternehmen gewünscht hatte, er führte die Linie erfolgreicher Unternehmer fort. Und deshalb würde Vincenzo ihm auch im Herbst die Geschäftsleitung übergeben, an Danieles dreißigstem Geburtstag, das war beschlossen. Vincenzo wollte danach das Land verlassen, den Kontinent und nicht zurückblicken. Er wollte auf die Schaffarm der Giordanos auf der Südinsel Neuseelands auswandern und das Landleben genießen. Noch einmal von vorne anfangen und das Leben, das sein Vater ihm aufgezwungen hatte, zurücklassen.
»Harter Tag?«, fragte Gino. Er knöpfte seine Windjacke zu und schlug den Kragen hoch.