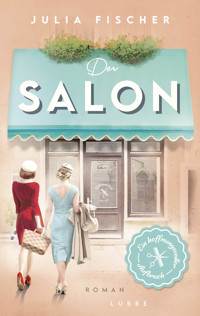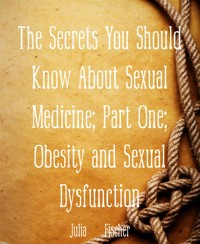Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Audio Media Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Sommer-Roman mit hohem Wohlfühlfaktor – zum Schmecken, Riechen und genüsslichen Lesen, und ein Liebes-Roman nicht nur für Florenz-Liebhaber! Von der bekannten Sprecherin und Schauspielerin Julia Fischer. Ein Liebesroman, der die Leserin direkt ins Herz von Florenz führt. Sie ist mehr als nur eine Apotheke: Die ehrwürdige Officina Profumo di Santa Maria Novella, inmitten der lebendigen Gassen und Plätze von Florenz, ist für ihre verführerischen Düfte berühmt. Hier liegt das Aroma von Kräutern, Potpourris und edlen Seifen in der Luft. Ein himmlischer Ort, an dem die junge Münchner Apothekers-Tochter Johanna auf den Spuren eines legendären Dufts zwei ungleichen Brüdern begegnet. Doch während Luca zaghaft um sie wirbt, hat sie ihr Herz längst an den stürmischen Sandro verloren - der einer anderen versprochen ist. Der Duft von Florenz und eine große Liebe - eine unwiderstehliche Mischung!
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Julia Fischer
Die Galerie der Düfte
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein Sommer-Roman mit hohem Wohlfühlfaktor – zum Schmecken, Riechen und genüsslichen Lesen, und ein Liebes-Roman nicht für Florenz-Liebhaber!
Sie ist mehr als nur eine Apotheke: Die ehrwürdige Farmacia di Santa Maria Novella, inmitten der lebendigen Gassen und Plätze von Florenz, ist für ihre verführerischen Düfte berühmt. Hier liegt das Aroma von Kräutern, Potpourris und edlen Seifen in der Luft. Ein himmlischer Ort, an dem die junge Münchner Apothekers-Tochter Johanna auf den Spuren eines legendären Dufts zwei ungleichen Brüdern begegnet. Doch während Luca zaghaft um sie wirbt, hat sie ihr Herz längst an den stürmischen Sandro verloren – der einer anderen versprochen ist.
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Florenz, Frühling 1985
München, Frühling 2011
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Florenz, Sommer 2011
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
München, Spätsommer 2011
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
München, Frühling 2012
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
München, Frühling 2013
31. Kapitel
32. Kapitel
Florenz, Frühling 2015
33. Kapitel
34. Kapitel
München, am selben Tag
35. Kapitel
Mailand, am selben Tag
36. Kapitel
Florenz, am Tag darauf
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
München, Frühling 2016
Zum Buch
Danksagung
Literaturliste und Links
Für meinen Mann, ohne den es diese Zeilen nicht gäbe,
seine Liebe und Unterstützung, die Geduld und Fürsorge
»Ein Parfum ist eine in Düften erzählte Geschichte, manchmal eine Poesie der Erinnerung.«
Jean-Claude Ellena, Chefparfumeur Hermès
Prolog
Florenz, Frühling 1985
Kühle – die Art, die der Frühling am Morgen noch etwas andauern ließ, die wie ein Versprechen auf einen der ersten heißen Tage auf der Haut lag, sich mit Vorfreude mischte, um nackte Füße in zu leichten Schuhen streifte und die impulsive Wahl verzieh. Der Auftakt für Ballerina-Tage, für Tage in luftigen Kleidern, zarten Röcken und Blusen, endlich, Ende Mai. Es war eine sanfte Kühle ohne winterliche Reißzähne, durchwoben vom matten Licht des anbrechenden Tages, und sie machte Anna glücklich. Die junge Frau stand auf der Piazzale Michelangelo und sah auf die Stadt, deren Häusermeer jenseits des Arnos nur als Schattenriss unter ihr lag. Die Spitzen der Bergkette im Osten von Florenz flammten rot auf. Ein schmaler Streifen, der die wenigen Wolken vor dem weißen Himmel für Augenblicke rosa färbte und die Häuser ins Orange tauchte. Das Licht reiste ohne Zeit, die Fassaden zwischen Sand und Ocker glühten von einem Moment zum anderen. Aus der Ferne betrachtet verschwand ihr schleichender Verfall hinter dem goldenen Leuchten – Sandstein, gekalkte Ziegel und rote Dächer. Und wenn Anna sich auf dem menschenleeren Platz hoch über Florenz nach Osten wandte, dann verflüssigte sich das warme Licht der Sonne im Arno und schickte ihn als goldenen Strom gemächlich weiter Richtung Meer. Keine weite Reise, nur über Montelupo Fiorentino, an Empoli vorbei und weiter Richtung Pisa. Doch der Fluss kostete sie aus, diese Strecke. Er schlängelte und wand sich durch die toskanische Hügellandschaft, passierte Olivenhaine, Zypressenalleen und Mohn durchsetzte Wiesen – rauschendes Rot. Er nahm nie den kürzesten Weg.
Annas Blick versank an diesem Morgen in seinem glitzernden Wasser, bis eine Lichtbrechung in einem Fenster der Domkuppel aufblinkte und ihre Aufmerksamkeit wieder auf das Häusermeer lenkte, il Duomo nahm ein warmes Bad. Jetzt war sie in der Stadt der Blumen, der Wiege der Renaissance, deren Geist sie seit Wochen nachspürte, wirklich angekommen. Anna beendete bald ihr Studium der Gartenbauarchitektur und war mit Vorbereitungen zu ihrer Diplomarbeit beschäftigt – »Italienische Gärten des 16. Jahrhunderts«. In Florenz fühlte sie sich ähnlich befreit wie die Architekten, deren Pläne sie hier studierte. Jene, die wie Brunelleschi, der kühne Konstrukteur der Kuppel der Santa Maria del Fiore, keine Grenzen mehr akzeptiert hatten, eigene und bauliche. In einer Zeit, in der die Naturwissenschaften, die aufblühende Kunst und wiederentdeckte Philosophie der Antike die Enge und Angst zwischen kirchlichem Dogma und weltlicher Macht endlich aufgebrochen hatten, war der Goldschmied zum Baumeister aufgestiegen. Das Individuum rückte in den Mittelpunkt der Betrachtung, und die Erde verschwand aus dem Zentrum des Universums. Galileo Galilei, der »Ketzer«, ließ sie fortan um die Sonne kreisen. Er lag gleich dort unten in Santa Croce, dem »Pantheon von Florenz«, begraben, und mit ihm Machiavelli, Michelangelo und Rossini. Es hieß, der heilige Franziskus habe den Grundstein der Kirche gelegt – doch der Bau begann erst sechzig Jahre nach seinem Tod. Aber wen kümmerten schon Jahrzehnte angesichts der versammelten Jahrhunderte, der großen Geschichte, der Gelehrten und Künstler der Stadt, die dank der Medici und ihrem weltoffenen Geist zum Inbegriff des Aufbruchs geworden war. Ein Aufbruch, wie er auch Anna bevorstand, nur vertagte sie ihn noch ein wenig.
Anna betrachtete die schlafende Stadt unter sich, den fernen Palazzo Vecchio – das heutige Rathaus –, von dem sie jeden Stein aus ihren Architekturführern kannte, und spürte, dass ihr Leben jetzt an einem Wendepunkt stand. Denn wie Michelangelo oder da Vinci, deren unvollendete Werke dort unten überdauerten, kannte auch sie das Gefühl, sein Herz bereits an ein neues Projekt zu hängen, während das alte noch alle Aufmerksamkeit zu binden versuchte. Die Begeisterung eilte auch ihr immer ein Stück voraus und riss ihr Herz mit. In dieser Stadt schlug es schneller.
Der Ponte Vecchio griff unweit des Rathauses über den Arno. Die kleinen Juwelierläden, die sich zu beiden Seiten an die Brücke klammerten, auf ihr stapelten, eng und dreistöckig, waren noch geschlossen, die Stadt unter Anna stand still. Sie überlegte, ob das der Zustand war, in dem auch sie sich gerade befand. Blieb sie einfach nur für einen Moment stehen, um dann genauso weiterzumachen wie zuvor? War ihr Aufenthalt in Florenz nur eine kurze, unbedeutende Zäsur? Oder würde sie etwas mit nach Hause nehmen, das ihr Leben veränderte, etwas von dem, was Florenz ihr erzählte? Versuche es! Gestalte dein Schicksal! Genieße den Tag.
Zu dieser frühen Stunde fuhren noch keine Autos in den Straßen, keine Busse, hier oben auf dem weitläufigen Platz war Anna allein. Doch schon in wenigen Stunden würden Touristen aus aller Welt im Laufschritt den weltberühmten David bestaunen, ohne zu verweilen, ohne einzutauchen in den Schaffensprozess des Bildhauers, die Statue nur durch die Linse des Fotoapparats betrachtend, als Hintergrund für ein Lächeln im Album »Florenz-Pisa-Rom in drei Tagen«. In der Rückschau überlagerten sich die eiligen Bilder und verschwammen zu Italien, Hitze, Kunst und Pizza. Die Bronzekopie des Jünglings mit den gewöhnungsbedürftigen Proportionen, der ursprünglich für die Ansicht in großer Höhe, außen an der Domfassade, konzipiert worden war, erinnerte Anna heute an einen anderen Körper, wärmer als dieser, anschmiegsam, fordernd, und sie dachte an andere Hände, kräftige, zärtliche Hände, die einen Zeichenstift hielten – Giovanni. Er war Kunststudent oder Lebenskünstler, sie fragte ihn nicht. Es genügte ihr zu wissen, dass ihr Körper unter seinen Berührungen brannte, glühte wie Florenz in der Mittagssonne. Und es gab keinen Schatten in seinem Blick, der sie vor dieser Hitze gerettet hätte. Wenn er sie küsste, verging sie und erstand wieder neu, ein Phönix aus der Asche der eigenen Lust. Anna war ihm gleich zu Beginn ihres Urlaubs am Arnoufer begegnet, ein Skizzenbuch auf seinen Knien, das dunkle Haar halb lang und ungebändigt. Er malte die Boote auf dem Fluss und sah wieder und wieder zu ihr herüber, um sie fachkundig zu vermessen. Ihr schmales Gesicht mit der langen, geraden Nase, die veilchenblauen Augen – sein Kohlestift erlaubte ihm nicht, diese Farbe einzufangen –, ihr breiter, nicht zu voller Mund. Das ganze Ebenmaß ihrer Erscheinung war von ellenlangem, gewelltem dunkelblondem Haar umgeben, nach dem sich jeder Mann umdrehte. »Kann es sein, dass Botticelli Sie schon einmal gemalt hat, Signorina?«, hatte er sie gefragt, denn Anna sah Simonetta Vespucci, Sandro Botticellis Vorlage für seine Geburt der Venus, ungemein ähnlich. Der üppige Busen, die schlanke Taille, die sinnlichen Hüften.
»Für wie alt halten Sie mich?«, hatte sie entrüstet entgegnet.
»So alt wie die Welt, schöne Venus«, hatte er geantwortet und ihr Lakritzpastillen angeboten. Und während Anna noch nach einer schlagfertigen Antwort gesucht hatte, hatte er sie bereits genüsslich skizziert und später darunter »la mia Venere«, »meine Venus«, notiert. Darüber hatte sie Cornelius und ihre Eltern für einen Moment vergessen und das Gefühl, an den Erwartungen zu ersticken, die sie zu Hause bedrängten, ein Gefühl, das sie sonst nur in zu engen Räumen überfiel. In überfüllten Hörsälen litt sie, in ihrer Wohnung öffnete sie zu jeder Jahreszeit und über Stunden die Fenster und vermied es, in Restaurants zu gehen, außer im Sommer, wenn sie draußen sitzen konnte. Ja, sie musste sogar in ihrem alten Cabrio, einem Käfer, Baujahr 1965, die Seitenfenster herunterkurbeln, solange das Dach geschlossen blieb. Die Sitze des cremefarbenen Wagens waren mit rotem Kunstleder bezogen, die Stoßstangen verchromt. Es war eines der ersten Modelle mit Außenspiegel auf der Fahrerseite und schon fast historisch. Anna liebte das Geräusch des luftgekühlten Boxermotors. Das regelmäßige Schnurren und leichte Rasseln klang wie ein Versprechen, es gab ihr das Gefühl, unterwegs zu sein, ungebunden. So wie hier auf ihren ausgedehnten Spaziergängen durch den Giardino di Boboli, den Garten der Villa Bardini oder den des Palazzo Medici Riccardi, wenn sie alleine war und mehr Baum als Mensch, mehr Gras und Stein, Regen und Wind als Lebensgefährtin und zukünftige Ehefrau, Element statt Wesen. Hier fühlte sie sich leicht und unbelastet von Zwängen und zu frühen Versprechen, schließlich war sie erst vierundzwanzig.
Die ersten Händler kamen und öffneten ihre Verkaufsstände auf der Piazzale. Anna stieg in ihren Käfer und fuhr zurück in die Stadt. Sie wollte sich den Tag über treiben lassen und im Viertel Oltrarno zu Mittag essen und ein Glas Weißwein trinken, dort, wo Florenz noch ursprünglich war und die Preise moderat. Vielleicht würde sie die Siesta auf dem Balkon ihres kleinen Hotelzimmers verbringen und ihre Notizen und Skizzen sortieren. Oder sie würde sich durch die Accademia schieben lassen und dort den David im Original bestaunen, in Erwartung ihres Treffens mit Giovanni jeden steinernen Muskel des Giganten mit hungrigen Blicken nachfahren, genau wie sein Schöpfer vor fast fünfhundert Jahren, nachdem er ihn aus dem groben, verhauenen Block befreit hatte. Anna wollte den kräftigen Oberkörper der Statue mit dem gleichen Verlangen streifen wie einst Michelangelo, die starken Arme, die verheißungsvolle Lendenpartie – Stein, Fleisch und Tagtraum, versponnen zu einer kleinen erotischen Fantasie. Sie gönnte sich in diesen Tagen die sinnliche Wahrnehmung der Bilder und Skulpturen, legte ihre Kunstführer zur Seite und trank die Farben und Formen wie Wein. Sie ließ sich berauschen, berühren, ließ sich von der Kunst verführen und erlag ihr – willig.
»Lass uns zusammen essen, schöne Venus«, hatte Giovanni gestern gesagt. »Wir treffen uns um sieben an der Piazza Santa Maria Novella. Und später machen wir einen Spaziergang.« Der Auftakt ihrer ersten gemeinsamen Nacht, die sie nun schon seit Tagen hinauszögerten, um das Spiel der Blicke und folgenschweren Küsse weiter auszukosten. Denn dass es passieren würde, wussten sie beide. Und dass sie nicht länger warten wollten.
Anna hatte nur einmal zu Hause angerufen, gleich nachdem sie jenseits des Brenners, wo die Landschaft sich veränderte und die Berge Südtirols sie freigegeben hatten, in ein anderes Leben eingetaucht war. Eines, das seine Faszination aus der Vergänglichkeit schöpfte, das die ganz großen Gefühle erlaubte, weil es sie nicht bewahren musste. In dieser Stadt war sie »la Venere«, die pure Verführung, die reine Lust und Lebensfreude. Und sie war verliebt.
Giovanni saß gegenüber der Basilika, trug Jeans, Hemd und eine dunkelbraune Lederjacke und zeichnete die Rosen der Grünanlage – Rosa sericea, die Seidige. Anna hatte immer die lateinischen Bestimmungen der Pflanzen im Kopf, eine Berufskrankheit. Während sie auf ihn zuging, betrachtete sie seine konzentrierte Haltung und kostete seine Versunkenheit aus, die Hingabe, wenn er malte, aß oder – liebte? Ihr Herz schlug ihr schon wieder bis zum Hals, ihre Beine gehorchten ihr kaum, da sah er auf – dunkle Augen, rebellisch, herausfordernd und von einer Sehnsucht getrieben, die sie in seiner Nähe mitriss. Sie wusste nicht, wohin, sie wusste nur, dass sie ihr folgen würde. Dieses Lächeln auf seinem Gesicht und dann sein Körper, der sich langsam aufrichtete – sie speicherte jede seiner Bewegungen. Sein Zeichenblock fiel aufs Pflaster. Er ließ ihn liegen, stand auf, kam ihr entgegen, nahm sie in die Arme und küsste ihr Haar. Er zog das Tuch ab, mit dem sie es zusammengehalten hatte, und vergrub beide Hände in ihrer langen blonden Mähne. Seine Lippen näherten sich den ihren. Er zögerte, er zögerte immer, nur um sie zu quälen. Und dann küsste er sie, und diese Küsse schmeckten nach Lakritz. Anna hätte gerne auf das Abendessen verzichtet und ihn mit in ihr Hotelzimmer genommen, um endlich mit ihm alleine zu sein, dort oder in seiner Wohnung, wenn er denn eine hatte. Sie wusste nicht einmal das, nicht, wo er wohnte, nicht, was er den Tag über machte, wenn sie sich nicht sahen, nicht, wovon er lebte, und es war ihr auch egal. Sie hatten ja nur diese wenigen Wochen, und Fragen, auf die Anna Antworten brauchte, gab es zu Hause genug, Pläne und Erwartungen.
Sie aßen bei Kerzenschein in der beginnenden Dämmerung in einer Osteria in der Via delle Belle Donne. Die kleinen Tische waren dicht an der Straße eingedeckt, der Abend noch warm.
»Cosa hai fatto oggi?«, fragte er, was sie heute gemacht habe. Diese Sprache schmiegte sich an den Gaumen, sie war ein duftendes Soufflé aus Lauten, lockte mit jedem köstlich fremden Klang. Anna beherrschte sie gerade gut genug, um mit Hilfe ihres Wörterbuchs die alten Pläne der Landschaftsarchitekten zu übersetzen und auf ihrem Weg durch die Stadt nicht verlorenzugehen.
»Ich war ganz früh auf der Piazzale Michelangelo und habe der Sonne zugesehen, wie sie aufgeht«, versuchte sie ihm zu erklären, und sein Blick hielt sie fest, während sie sprach. Er wandte sich nicht einmal ab, als der Kellner die antipasti brachte und den Wein. »Und dann habe ich mir den David in der Accademia im Original angesehen. Und jede Menge Madonnen.«
»Und was denkst du, la mia Venere, ist er der schönste Mann der Welt?«
»Mir fehlt noch der Vergleich«, antwortete sie. »Aber ich denke schon, dass er ein Mädchen zum Träumen bringen kann. Oder einen Mann.«
»Und was bringt dich zum Träumen?«
»Du.«
Giovanni zog ein Päckchen in Geschenkpapier aus der Tasche und schob es ihr über den Tisch. Anna packte es vorsichtig aus. Ein Eau de Cologne, Acqua di S.M. Novella stand auf der Verpackung.
»Früher hieß es Acqua della Regina. Die Dominikanermönche des ehemaligen Konvents dort drüben am Platz hatten es für Caterina de’ Medici kreiert.« Er deutete in Richtung der Piazza Santa Maria Novella.
»Mönche, die Parfum herstellen?« Anna war überrascht.
»Nun, sie haben vor etwa achthundert Jahren eine Apotheke gegründet, Rosenwasser zur Desinfektion destilliert und Heilkräuter verarbeitet. Und dann kamen viele andere Produkte dazu, wie zum Beispiel die ersten Acqua, die später ein Italiener – Farini – nach Deutschland gebracht hat.«
»Du lügst doch!«, sagte Anna, gabelte die letzten Zucchini vom Teller und lachte. »Die stammen aus Köln. Das sagt doch schon der Name Eau de Cologne.«
»Ach, ich lüge also.« Giovanni griff nach ihrer Hand und roch an der Innenseite ihres Handgelenks – ein Hauch von Seife. Sein Atem streifte ihre Haut.
»Natürlich. Was versteht ein Kunstmaler schon von Parfum?«, provozierte Anna ihn weiter und wunderte sich über seine Reaktion, denn er zog seelenruhig seinen Skizzenblock aus der abgetragenen Umhängetasche, die er neben seinen Stuhl gestellt hatte, und schlug ihn auf. Anna sah Porträts, Kirchenfenster, Spiegelungen am Fluss und … Flakons. »Du zeichnest Flakons?« Sie war überrascht.
»Von irgendetwas muss ein armer Künstler doch leben«, erklärte er und führte ihr seine neuesten Entwürfe für die erwähnte Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella vor. »Heute ist das ein internationales Unternehmen, das sich auf Düfte, Naturkosmetik und einige andere Produkte spezialisiert hat. Magst du es denn?« Er wartete auf ihre Antwort.
»Bitte?«
»Das Acqua della Regina. Magst du es? Es ist der Duft einer Königin. Es ist dein Duft, Anna.« Sie öffnete die Umverpackung und schraubte den Verschluss ab. Zitrusnoten, Lavendel womöglich und Rosmarin, sie war keine Expertin. Giovanni nahm die schlichte Flasche, rückte seinen Stuhl näher an sie heran, schüttete sich etwas von der edlen Essenz in die Hände und strich Anna damit über den Hals. Er betupfte ihre Schläfen, ließ einen Tropfen in ihr Dekolleté fallen und betrachtete, wie er zwischen ihre vollen Brüste rann. Er beträufelte ihr Haar, beugte sich vor, küsste sie und fuhr dabei unter dem Tisch langsam mit seiner Hand unter ihr Kleid und zwischen ihre Beine. Ihr blieb schon wieder die Luft weg. »Il conto, per favore!«, hörte sie ihn sagen, obwohl sie gerade erst die Vorspeise gegessen hatten, und sein Blick durchdrang sie, minutenlang, eine ganze Ewigkeit, angefüllt mit wilden Herzschlägen und dem Duft einer vergangenen Epoche.
»Wohin jetzt?«, fragte Anna erwartungsvoll mit leicht brüchiger Stimme, und Giovanni deutete auf seinen Motorroller am Straßenrand, einer unter Hunderten. Sie wusste nicht, dass er eine Vespa fuhr, doch im Moment hätte sie nicht einmal mehr ihren eigenen Namen gewusst – nur mehr seinen.
Die kurze Fahrt über schmiegte sich Anna dann an ihn, spürte das schwere Leder seiner Jacke unter ihren Händen und genoss die Nähe. Sie überquerten den Arno auf der Ponte alla Carraia und fuhren ein Stück am Fluss entlang, bis Giovanni rechts in eine kleine Seitenstraße abbog, wenig später neben der langen Mauer des Giardino di Boboli anhielt, der längst geschlossen war, und dort ein unscheinbares Tor öffnete. Er hatte eine Picknickdecke unter dem Arm, die hinter dem Sitz der Vespa festgebunden gewesen war, und seine Umhängetasche dabei. Anna fürchtete, dass sie entdeckt werden könnten. »Ich bin nachts oft hier«, beruhigte Giovanni sie, und sie spürte einen Anflug von Eifersucht in sich aufsteigen. »Ich komme sonst immer alleine. Der Garten ist nur ohne die Massen schön.«
»Ist er das?«, fragte Anna nach. Sie war etwas enttäuscht gewesen, als sie ihn an ihrem ersten Tag in Florenz durchquert hatte – Hecken und Bäume, eine beeindruckende Zypressenallee und noch mehr Hecken, keine wirklich lauschigen Plätze, kaum Blumen. Der karge Garten, der sich mit steilen Anstiegen einen Hügel hinaufzog, lebte allein von seinen umwerfenden Ausblicken über die Stadt, der ihn umgebenden Architektur und den mannigfachen Kunstobjekten darin, dem Inselteich, den Brunnen und der berühmten Grotte von Buontalenti.
»Kennst du das Kaffeehaus?«, fragte Giovanni sie leise.
»Ich hab es nicht gefunden. Es steht im Plan, aber ich war zu müde, um noch weiterzugehen.«
»Das ist es.«
Anna sah vor sich in der anbrechenden Dunkelheit unterhalb des Weges, den sie gekommen waren, einen kleinen rechteckigen Bau, dreistöckig, mit einem gemauerten, verglasten Rondell auf einer Dachterrasse. Eine Art Pavillon, türkis getüncht mit himmelblauen Türen, die verschlossen waren. Sie gingen um das Gebäude herum. Die Vorderseite, die zum Palazzo Pitti und auf die Stadt hinunterschaute, war als Halbrund gebaut, mit umlaufenden schmalen Balkonen und schönen Fensterfronten und das abfallende Gelände zu Füßen des Kaffeehauses ein Obstgarten. Anna erkannte unzählige Apfelbäume, die die einzelnen Terrassen umstanden, bis unterhalb ein Brunnenplatz abschloss. Sie staunte noch über den romantischen Fleck, auf den sie hier gar nicht gehofft hatte, da sah sie Giovanni, wie er die Decke unter einem der Bäume ausbreitete und Papierlampions mit Teelichtern aus seiner Tasche zog, sie aufklappte und in die Äste hängte – rote, gelbe und orangefarbene Sonnen und blaue Monde. Anna setzte sich und wartete, bis er alle Kerzen angezündet hatte und zu ihr zurückkam. Sie atmete den Duft ihres neuen Parfums ein, den des Gartens und der Stille und den seiner Haut. Er hatte sie aus ihrem Kleid geschält und betrachtete sie nun in ihrer schlichten Wäsche, als würde er sie später aus dem Gedächtnis malen wollen. Sein Hemd lag neben ihr im Gras. »Er ist nicht der schönste Mann«, flüsterte sie, »David. Ich kann ihn nicht atmen so wie dich.« Da löste er ihren BH, streifte ihren Slip ab und küsste jeden Zentimeter ihres nackten Körpers. Sie spürte sein rauhes Kinn auf ihrem Bauch, auf der Innenseite ihrer Schenkel. Der Ruf einer Nachtigall erklang im Park, und Anna verschmolz mit dem Boden, der Erde, dem Gras, den Wurzeln der Bäume.
»Lass mich dich malen, bitte«, sagte Giovanni, und sie wusste, dass sie unmöglich noch länger auf ihn warten konnte. »Bleib genau so.« Er griff bereits nach seinem Zeichenblock und dem Kohlestift und murmelte mit einem Lächeln: »Meine schaumgeborene Venus …« Er korrigierte ihre Haltung, legte ihr langes Haar über ihre Schulter und plazierte ihre linke Hand oberhalb ihrer Brüste. Anna spürte den lauen Abendwind auf ihrer Haut, die im Mondlicht leuchtete wie hundert zarte Apfelblüten. Sie hörte das leichte Schaben der Kohle auf dem Papier, sah seine aufmerksamen Blicke über ihren Körper gleiten und ahnte, wie sein Stift ihre Freizügigkeit in dunkle harmonische Linien übersetzte. Und mit jedem Strich wuchs auch sein Verlangen, mit jedem Detail, das er erfasste, schwoll seine Begierde an. Sie war seine Venus, seine Eva, die allererste Frau unter den vielen, die er geliebt hatte. Sie war die ultimative Verführung im Garten Eden, allein sie anzusehen machte ihn glücklich.
Giovannis Zeichnung blieb unvollendet. Er legte sich zu ihr, und Anna half ihm, sich auszuziehen. Sie schloss die Augen, sperrte die Welt aus und ließ ihn ein. Ihre Erregung folgte dem Weg seiner tastenden Hände, seiner Küsse, sie verzweigte sich von den Wurzeln zum Stamm, bis Anna nur noch das zarte Zittern der Blätter im Wind war, das Fließen des Wassers über Brunnenkaskaden, das Leuchten der bunten Laternen und der alles verzehrende Brand. Erde und Luft, Wasser und Feuer und ein fünftes Element, das sie alle umfing und ihren gemeinsamen Rhythmus bestimmte. Anna baute sich aus diesen Bildern einen Garten – aus Giovannis Liebe und Zärtlichkeit, seiner Lust und seinem Verlangen, mit einem unscheinbaren Tor, das nur sie allein kannte, unter Apfelbäumen, im Mondschatten eines verlassenen italienischen Pavillons.
Ihre Diplomarbeit kam langsam voran. Anna verbrachte ihre Tage in den Gärten und Parks, kartographierte Lorbeerbäume, Steineichen und Kastanien, Pinien und Schirmkiefern, zeichnete Oleander, Hibiskus und wilden Wein, Granatapfel- und Feigenbäume, Myrte und wilde Zistrosen, von Laurus nobilis bis Cistaceae. Und Giovanni zeigte ihr Maltechniken, schenkte ihren Skizzen Licht und Schatten und den Pflanzen die Details. Anna erforschte die Einbindung der Gärten in die Landschaft, Freitreppen und Skulpturen, Teiche und Blütenmeere, Jahrhunderte, die ineinandergriffen, und lauschte dabei lange auf ihr Herz. Inmitten der freien Gestaltung der ersten Gärten, in denen kein Gemüse mehr gezogen, keine Heilpflanzen mehr angebaut wurden, Gärten, die Architekten nur um ihrer selbst willen und zur Freude ihrer Besitzer geschaffen hatten, bemerkte sie, dass die völlige Freiheit zweckbefreite Ordnung geschaffen hatte und klare Symmetrie. Wo das Chaos möglich gewesen wäre, der Zufall hätte Raum greifen können, hatten die Künstler der Renaissance sich für die Struktur entschieden, die Anna ein Gefühl der Sicherheit und Ruhe vermittelte.
An den Wochenenden frühstückte sie mit Giovanni in belebten Bars am Straßenrand irgendeines kleinen Ortes zwischen Florenz und Marina di Pisa. Dort, wo zwischen den Hütten der Fischer, die ihre großen Netze in die Flussmündung tauchten, der Arno ins Meer floss, aßen sie frischen Fisch und genossen die frühsommerlichen Sternennächte am Strand. Manchmal träumte Anna von dem Mann, den sie zurückgelassen hatte. Manchmal spürte sie, wie die Hoffnung auf ein neues Leben mit jeder drängenden Flut hereinkam und die Sehnsucht nach ihrem alten mit der einsetzenden Ebbe aufs Meer hinauszog. Die Gefühle wurden zu Treibgut, dessen Geschichte das Meer im Wechsel der Gezeiten langsam abwusch – angelandet, fortgerissen und irgendwann für immer zerstört.
»Ich fahre am Dienstag nach Hause«, sagte sie Ende Juni zu Giovanni, als ihre Ersparnisse knapp wurden und sie endlich wusste, wie ihr Leben aussehen sollte. Dabei war sie selbst überrascht, dass der Abstand, den sie von Cornelius gewonnen hatte, und die Freiheit, ihre Zukunftspläne noch einmal gründlich zu hinterfragen, sie letztlich doch in die alte Bindung zurückführten.
»Sei sicura?« – »Bist du dir sicher?«, fragte Giovanni sie, obwohl er wusste, dass es passieren würde, und hielt sie noch etwas fester im Arm als sonst. »Vielleicht können wir …«
»Nein«, unterbrach Anna ihn da, »wir können nicht. Ich habe doch ein Leben zu Hause und meine Familie.« Und einen Mann, der auf mich wartet und zu mir gehört, dachte sie. »Soll ich das alles einfach aufgeben? Ich glaube, wir beide sind nur für diese kurze Reise gemacht, in diesem Traum. Aber in Wahrheit …«
»Die Wahrheit kennst du doch gar nicht, Anna«, sagte Giovanni da traurig, »über mich, meine ich. Du hast nie gefragt. Aber vielleicht, wenn du wüsstest …«
»Bitte, tu das nicht. Bitte nicht. Mach mir das Herz nicht schwer. Lass uns in unserer Erinnerung bleiben, wer wir hier füreinander waren.«
»La Venere und ihr Maler vom Arnoufer«, sagte er und schwieg.
In dieser Nacht schlief Giovanni nicht mit ihr. Er hielt Anna nur im Arm und schmiegte sich an sie, bis die Sonne aufging. Und als sie sich am Ende ihres letzten gemeinsamen Abends vor ihrem Hotel trennten, fragte er sie, ob sie sich noch von ihm verabschieden werde, und sie versprach, am Morgen auf der Piazza Santa Maria Novella auf ihn zu warten, ehe sie abfuhr.
Sie kam um neun, er war schon da. Er saß auf einer Bank neben den Rosen, die er erst vor wenigen Wochen gezeichnet hatte. Anna glaubte beinahe, dass er die Nacht dort verbracht hatte, so zerstört sah er aus. Er war unrasiert, sein Haar noch wirrer als gewöhnlich, der dunkle Blick fast leer. Sie parkte im absoluten Halteverbot und setzte sich zu ihm.
»Jetzt also«, sagte er nur und küsste sie auf die Stirn.
»Ja, jetzt«, erwiderte sie.
»Ich liebe dich, Anna.«
»Und ich liebe uns. Und ich nehme uns auch mit, glaube mir. Unsere erste gemeinsame Nacht im Giardino di Boboli, ich werde keinen Moment vergessen. Keinen Kuss.«
Giovanni stand auf und griff hinter sich nach zwei kleinen, schmalen Apfelbäumen, die an der Bank lehnten. Ihre Wurzelballen waren mit Sackstoff umwickelt. »Du könntest sie im Fußraum vor dem Beifahrersitz transportieren«, sagte er zaghaft, »und sie zu Hause einpflanzen, wenn du möchtest. Du hast mir doch von deinem Garten erzählt.« Dem Garten ihrer Eltern, dem ehemaligen Kräutergarten im Hinterhof ihrer Apotheke. Anna war schon seit einer Weile damit beschäftigt, ihn neu anzulegen. Und es gab dort bereits alte Apfelbäume, die den Standort mochten. »Versprich mir, dass du über uns nachdenkst, Anna, bis sie im nächsten Jahr blühen, und mich anrufst, wenn du es dir anders überlegst. Ich habe dir hier einen Zettel mit einer Telefonnummer hingebunden.«
»Wenn ich es mir anders überlege?«, fragte sie.
»Ja, wenn du doch etwas über mein Leben wissen willst und den Mut hast, bei mir zu bleiben.«
Anna verstaute die Bäumchen umständlich in ihrem Wagen. Die ungewöhnliche Fracht reichte bis zum Dachhimmel.
»Jetzt also …«, sagte sie dann zu ihm.
»Ja, jetzt«, entgegnete er, küsste sie ein letztes Mal innig und blieb am Straßenrand stehen, bis der VW Käfer in Richtung Bahnhof und autostrada verschwand.
In ihren Gedanken pflanzte Anna bereits die beiden Bäume in den Garten ihrer Träume und mitten hinein in ihr neues Leben. Sie war etwas wehmütig, sie vermisste Giovannis dunkle Blicke, seine Stimme und Berührungen bereits, als die weite Landschaft der Poebene wieder in die enge Bergwelt und die Täler Südtirols überging. Doch sie wusste auch, dass dieser Abschied nur der Anfang war.
München, Frühling 2011
1
Die Hochgebirge der Pyrenäen, der Karpaten und des nördlichen Apennin manifestierten sich in Johanna Stern-Reiters lauschigem Hinterhof in München-Neuhausen, mitten in der Stadt. Eine Anmutung der Alpen lag in der Morgenluft, waldig, frisch, Holz und Nadeln immergrüner Zeitzeugen, die mehr Wetter über sich haben ergehen lassen als mancher Mensch in seinem Leben und noch mehr Entbehrungen. Johanna saß auf der Bank vor ihrem kleinen Laden, ihrer Sternwarte – Naturkosmetik und Seelenheil, und betrachtete die Frühlingsbeete. Sie lockten die Sinne und lähmten die Hast. Der blaue Persische Ehrenpreis war schon fast wieder verblüht, die letzten Duftveilchen, die sie noch nicht in Kokosfett gebettet hatte, um ihren violetten Zauber einzufangen, trollten sich noch zwischen Schlüsselblumen und Tulpen. Der Waldsauerklee verzweigte seine zarten weißen Blüten unter einer langen Buchenhecke, die Johannas Stadtgarten zur Westseite hin abschloss, während ihn eine mannshohe efeuüberwucherte Backsteinmauer vom Nachbargrundstück im Osten trennte. Dort gab es nur alte Garagen und Fliederbüsche. Rückwärtig grenzte das Grundstück an eine Wiesenfläche, auf der ein flacher Institutsbau stand, und zur Straße hin reihten sich die historischen Wohnhäuser eng an eng. Sie waren durch schmale Durchgänge voneinander getrennt. Es gab also gerade genug Sonne für Johannas Kräutergarten, die üppig gesetzten Blumen und niedrigen Buchshecken, die die Beete eingrenzten, für Stauden, Kletterpflanzen und einen Teich. Die Apfelbäume würden bald blühen, zwei Säulenäpfel, alte Goldrenetten und ein Ambrosia. Das Windspiel in seinen Zweigen hatte Ben ihr vor drei Jahren geschenkt. »Wenn es anschlägt, Jo, dann denke ich an dich.«
»Und wenn es stillsteht?«
»Dann bin ich bei dir.«
Ben hatte den Zylinder aus Holz selbst ausgehöhlt, mit Klangstäben im Inneren und einem Holzsegel an einer Schnur, das die schönen Töne anschlug. Das Spiel antwortete dem Flüstern des Windes mit hellem, schwingendem Vielklang, wie der Duft und der Nektar des Baumes dem Summen der Bienen. Johanna hatte es erst gestern aus seinem Winterlager geholt, doch schon heute machte sein Anblick sie traurig.
Sie zog ihre Strickjacke enger um sich. So kurz vor den Ostertagen war es noch kühl am Morgen, auch wenn das Sonnenlicht bereits über die Dächer kletterte und an den Fassaden entlang, Fenstersims um Fenstersims, in den Hof herunterstieg. Es würde gegen Mittag den ganzen Garten fluten, von der Grasnarbe bis zur Himmelskante. Johanna fühlte die Kraft des Frühlings, der mit dem Geruch der schneebefreiten Erde, dem Modern von Gras, Moos und Laub Ende März seinen Anfang genommen hatte. Sie schob eine Haarnadel in ihren geflochtenen Chignon zurück, der ihr langes rotes Haar im Nacken bändigte, und überprüfte die Temperatur der großen Kupferdestille, die neben ihr auf dem Tisch auf einer mobilen Kochplatte stand. Bei schönem Wetter destillierte sie ihre Hydrolate, die Duftwässer, am liebsten im Freien. Das Prasseln der Siedesteinchen im Kessel vermischte sich dann mit den Vogelstimmen im Hof, bis nach einer Weile gedämpften Brodelns der lautlose Aufstieg des heißen Dampfes begann. Er wallte durch den Korb mit Destilliergut hindurch und riss die leichten Moleküle der ätherischen Öle und aller flüchtigen, wasserlöslichen Bestandteile des Pflanzguts mit sich. Oben an der rotgoldenen Kuppel angekommen, schlüpfte er mit seiner Fracht durch ein dünnes Geistrohr und weiter durch eine Schlangenkühlung, in der das Destillat rasch abkühlte. Das war der Kreislauf der Natur. Das Verdunsten des Wassers aus Meeren, Seen und Flüssen, angeheizt durch ein gewaltiges Kraftwerk auf einer fernen Umlaufbahn und dem Inferno im Inneren der Erde, geboren aus geschmolzenem, schwerem Metall. Das Aufsteigen der Wassermoleküle, die Kondensation, der Regen. Johannas Destille war nach diesem großen Vorbild und einem frühen Entwurf Leonardo da Vincis gebaut, nur dass das Verdunsten in ihrem Kessel ein Verdampfen war und der Himmel ihr kupferner Dom. Die klare komprimierte Kraft der Latschenkiefernzweige, die sie heute verarbeitete, floss am Ende ihrer Transformation als schmales Rinnsal heraus. Duftende Pflanzenseelen, gefangen wie ein Dschinn in seiner Flasche. Zwei Liter Hydrolat würde Johanna heute erbeuten und ein paar Milliliter fast farblosen wertvollen Öls. Beide bargen sie das ureigene Wesen des trutzigen Nadelbaums, der in den Hochgebirgen auf kahlen Steilhängen ausharrte, der Lawinen überstand und trockene, felsige, nasse und kalte Standorte gleichermaßen duldete. Diese Genügsamkeit zog Johanna auf Flaschen und rührte sie später in Badezusätze und Massageöle. Sie wirkte in Raumsprays und sprudelte in Duftbrunnen, sie verströmte sich in Menschenseelen, die sie kaum wahrnahmen, und verband sich mit ihrem Empfinden. Sie und die Weite der Bergwelt, die jeden so frei atmen ließ, als stünde er gerade selbst auf einem der Gipfel und würde den Himmel berühren. Die Weite war ein erhabener Duft.
Johanna verdankte diese Zweige einem jungen Gärtner aus dem Botanischen Garten, der gerade mal neunzehn war. Sie hatte ihn vor zwei Jahren auf seltene Rosenblüten angesprochen und er sich schlagartig in ihr Feuerhaar und den scheuen veilchenblauen Blick verliebt. Seither träumte Niklas Farn von ihrem Porzellanteint und dem schmalen, ebenmäßigen Gesicht und zeichnete, wann immer sich Gräser im Wind wiegten, in Gedanken ihren schönen Hals nach und ihre schlanke Figur. Bei ihrer ersten Begegnung hatte Johanna ein lindgrünes Kleid getragen, dessen Taille auf der Hüfte saß, und einen passenden Hut mit kleiner Krempe, den ein breites, gerafftes Band umfing. Dazu eine lange Kette aus Perlen und emaillierten Blüten sowie Spangenpumps mit geschwungenem Absatz, die das Bild komplettierten – eine Erscheinung aus den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts. Niklas hätte sie am liebsten vom Fleck weg eingetopft! Er war damals noch in der Ausbildung gewesen und irritiert, hatte die Gartenschere an einer preisgekrönten Rose angesetzt und versehentlich ihre schönste Blüte gekappt. Das feuerrote Wunder mit dem Namen Liebesglut, eine Teehybride und für die alljährliche Rosenschau bestimmt, war ruiniert. Er hatte Johanna die Glut in der Farbe ihres Haares, das nach Neroli und Amalfizitronen duftete, wortlos überreicht und zweigte seither Harze und Hölzer, Wurzeln und Blüten, Blätter und Früchte für sie ab, wo er nur konnte und es nicht allzu sehr ins Auge stach. Die einundzwanzig Hektar städtischer Botanik, für die Niklas Farn mitverantwortlich war, präsentierten sich ihren Besuchern fortan aufgeräumter denn je, zugestutzt, umgegraben und stellenweise unerklärlich karg. Alles, wirklich alles, wonach es Johannas wallenden Kessel verlangte, war plötzlich irgendwo übrig geblieben. Wenn Niklas Johanna anrief, kam sie auf ihrem cremefarbenen Rad mit dem geflochtenen Rattankorb am Lenker in diesen altmodisch-femininen Kleidern, die ihr so gut standen, eine Hand am Lenker, die andere an der Hutkrempe, und die Zeit schraubte sich für ihn um ein Jahrhundert zurück. Er erzählte ihr dann von seiner Arbeit, ohne die Sätze zu beenden, denn Niklas war schüchtern, und sein Mut reichte nie bis zum Schluss. »Du musst ihn dir ansehen, er ist wirklich sehr …« – »Wirklich sehr schön, Niklas?« – »Ja, schön. Dieser Baum ist …, besonders im Mai.« Eine Eigenart, die der stille junge Mann nicht ablegen konnte. Manchmal tranken sie Tee im Café gegenüber dem Botanischen Institut, doch nie, nicht ein einziges Mal in den zwei Jahren, die Niklas Johanna nun kannte, hatte er sie um ein Rendezvous gebeten. Er hatte sie nur angeblickt, ihr die »Gartenabfälle« zugesteckt und von einer leidenschaftlichen Berührung zwischen Pflanzkübeln und Wildblumen geträumt. Das alles wusste Johanna Stern-Reiter nicht, sie ahnte es höchstens, übersah es und partizipierte. Niklas Farn war schließlich sechs Jahre jünger als sie, und sie fühlte sich auch immer noch gebunden an Ben. Ben, den Tischler mit der schönen tiefen Stimme, dem dunklen Haar und Augen wie schillernder Kohlenstaub, der für sie den Wind zum Klingen gebracht hatte. Ben, der nach drei gemeinsamen Jahren und einem Versprechen einfach gegangen war. Er liebte jetzt eine andere. Es war leicht für den, der fortging, doch an dem, der zurückblieb, nagte noch lange die Einsamkeit.
Johanna prüfte ihr Destillat und war zufrieden. Der April war ein guter Monat zur »Ernte« der Zweige. Ein Nachbar aus dem Vorderhaus, in dessen Erdgeschoss sich die Apotheke ihrer Eltern befand, hatte ihr erst letzten Monat seinen vertrockneten Weihnachtsbaum überreicht, und sie hatte kaum zu fragen gewagt, wo Ludwig Korn ihn so lange deponiert hatte. »Vielleicht destilliert sich ja der Duft von Weihnachten mit heraus, ha, ha«, hatte er lachend gesagt. »Dann ist dieses alchemistische Treiben, mit dem Sie uns sicher noch einmal alle in die Luft jagen werden, Fräulein Sternreiter, doch wenigstens noch von praktischem Nutzen!« Er war ein Spaßvogel, dieser Korn, bieder bis ins Mark, ein eingefleischter Junggeselle Mitte fünfzig, dessen Ordnungsliebe jeden Bogen überspannte. Ein Buchhändler, der in seinem Laden Schöngeistiges, philosophische Werke und Reiseführer hatte. Ein Humanist vom alten Schlag, der Dichter und Denker zitierte und verloren aussah, sobald er sich unbeobachtet glaubte.
»Vielen Dank, Herr Korn«, hatte Johanna höflich entgegnet, »aber den Duft von Weihnachten hab ich schon.« Es war eine Mischung aus Schokolade, Zimt und einem Hauch Weihrauch, den sie im Herbst in Seifen verarbeitet hatte, mit kandierten Orangenstücken und Flitter von Blattgold. »Trotzdem können Sie das verdorrte Bäumchen gerne hierlassen, es wird schon für irgendwas zu gebrauchen sein.«
»Die kleinste Pfütze spiegelt den Himmel, meine Liebe!«, mahnte Ludwig Korn zur Bescheidenheit und verbarg seine Erleichterung, sich den Weg zum Container für Gartenabfälle erspart zu haben. Johanna hatte daraufhin den ersten Destilliergang des Jahres auf offenem Feuer angesetzt und das Bäumchen zum Anschüren verwendet, eine knifflige Sache, denn es war schwer über der Gluthitze die Temperatur im Kessel zu regeln. Der Kornsche Weihnachtsbaum, der das letzte bisschen Duft längst ausgehaucht hatte, brannte wie Zunder. Er ging binnen Minuten in Rauch auf und roch wenngleich nicht nach dem Fest der Liebe, so doch nach einem gemütlichen Kaminabend im Kreis der Familie.
2
Die letzten Bestellungen vom Samstag waren in aller Frühe angeliefert worden. Der Fahrer vom pharmazeutischen Großhandel hatte einen Schlüssel zum Wohnhaus in der Blutenburgstraße. Das war so üblich, er war Herr über viele Türen der Stadt, er, den man übersah wie den Postboten oder den Gasableser. Sein grauer Kittel und die Routine von Kommen und Gehen radierten ihn und sein Allerweltsgesicht mit der Zeit aus der Wahrnehmung der Leute aus. Er stellte die grüne Plastikkiste mit den Medikamenten im Flur an die Hintertür der Stern-Apotheke und fuhr seine morgendliche Runde weiter. Er würde am späten Vormittag mit der nächsten Lieferung wiederkommen und am Nachmittag und abends kurz vor Geschäftsschluss noch einmal.
Cornelius Reiter, Johannas Vater, verließ gegen halb acht seine Wohnung im ersten Stock und stolperte zum wiederholten Mal draußen am Flur über einen Berg Spielzeug der Familie Beck – selbe Etage, drei Kinder und ständig diese aufdringlichen Küchengerüche! Er musste sich an deren überquellendem Schuhregal anhalten und stieß sich dabei am Knie. Leise fluchend raufte er sich das dichte graumelierte Haar, stapfte die Treppe hinunter und nahm leicht verstimmt die grüne Kiste mit den angelieferten Medikamenten mit in die Räume hinter dem Verkauf. Sie mussten noch vor Ladenöffnung in die digitale Warenwirtschaft aufgenommen und einsortiert werden, in alphabetischer Reihenfolge von Aarane bis Zymafluor.
Cornelius Reiter liebte die ersten Handgriffe am Morgen, wenn die Apotheke noch ihm alleine gehörte. Er sperrte die Tür zum Gang hinter dem Notdienstzimmer, der Rezeptur, in der Arzneien zubereitet wurden, und dem Büro auf, schaltete im Magazin das Licht ein und setzte die grüne Kiste dort auf dem Tisch neben dem ausladenden Schubladenschrank mit den tiefen Auszügen ab. In den Regalen ringsum lagen Verbandsmaterial, Windeln und Einlagen, und es stapelten sich die Vorratsbehälter mit Tees. Außerdem stand hier der große Kühlschrank für Impfstoffe, Insulin und sonstige kühl zu lagernde Medikamente. Ein offener Durchgang führte über drei kleine Stufen hinunter in den Verkauf direkt an den breiten massiven Ladentisch, feinster dunkler Nussbaum, an dem bequem drei Kollegen gleichzeitig bedienen konnten. Hier standen die gängigsten Artikel griffbereit, so dass man sich nur umzudrehen brauchte, um das Aspirin, die Hustenstiller oder hoch dosierte Vitamine zur Hand zu haben.
Reiter zog seinen weißen Kittel über und schaltete die Nachtbeleuchtung des Schaufensters aus, das seine Frau fast jeden Monat neu dekorierte. Vom März waren noch Antihistamine ausgestellt, der übliche Pollenflugkalender, eine Werbung für Nasenduschen sowie Haselnuss- und Erlenzweige, deren Anblick allein schon die Nebenhöhlen anschwellen ließ. Sehr liebevoll gestaltet, denn Anna Stern-Reiter hatte als studierte Landschaftsarchitektin einen Blick für Proportionen. Sie pflanzte mit Vorliebe Grünzeug in die Auslage und verschwendete an diesen Quadratmeter Präsentation klaglos ihr ganzes Talent. Reiter fuhr die Kassen und Computersysteme hoch und rollte den Zeitschriftenständer neben die Ladentür – die APOTHEKEN Umschau, medizini für die Kleinen, der SENIOREN Ratgeber und diverse Informationsblätter. Und dann setzte er sich wie jeden Tag für ein paar Minuten auf die schmale Bank neben der Eingangstür, die den Fußlahmen und Herzkranken vorbehalten war, und ließ seinen Blick durch den Raum schweifen. Die Einrichtung der Stern-Apotheke war nach wie vor aus einem Guss, eine historische Apotheke aus dem Jahr 1889 und seit jeher in Familienbesitz. Die deckenhohen dunklen Regale und Schränke wurden von kleinen gedrechselten Säulen und Simsen durchbrochen, die unzähligen Schubladen hatten weiße Emailschilder mit lateinischen Aufschriften über den Messinggriffen. In einem Schrank hinter Glastüren standen alte Albarelli, Deckelgläser, Mörser und eine antike Feinwaage, alles Schätze von Annas verstorbenem Urgroßvater Ferdinand Stern, der sich selbst noch als wahren Alchemisten verstanden hatte und das Rad der Zeit und pharmazeutischer Errungenschaften gerne um fünfhundert Jahre zurückgedreht hätte. Reiter blickte zur Decke und schmunzelte über die beiden Ösen im Stuck. Hier schwebte einst ein präpariertes Krokodil über der Ladentheke, als wäre es sein angestammter Lebensraum, ganz in der Tradition mittelalterlicher Apotheken, die noch Animalia feilboten – Arzneistoffe tierischer Herkunft wie Spanische Fliegen und Bibergeil oder Knochen und Zähne von Walross, Elefant und Tiger, in Tinkturen gepfuscht und Salben gemischt, je grässlicher im Geschmack, desto nachhaltiger in der Wirkung. Wahlweise erretteten sie sogar von Pest und Milzbrand. Auf diese Kuriositäten aus exotischen Ländern verwiesen Namen wie Löwen-, Mohren- oder Einhorn-Apotheke. Mancherorts lockte ein Pferdekopf mit gedrechseltem Narwalzahn auf der Stirn Kunden, ein Fabelwesen aus dem Packeis oder exotische Meeresbewohner, in Alkohol und Formalin zur Ewigkeit verdammt, so wie das Sternsche Krokodil, das Annas Vater vor Jahrzehnten abgenommen und durch ein Foto der Kuriosität in der Auslage ersetzt hatte. Die peinliche Trophäe, die zu allem Überfluss auch noch schielte, lagerte seitdem im Keller, oberstes Regal, eingewickelt in ein altes Leinentischtuch mit Flickspuren. Der Echsenpanzer war über die Jahre als Schattenriss diffundiert, nur die Nasenlöcher blieben ausgespart, die Zähne blitzten, und die Schwanzspitze stand über. Doch nach ein paar Jahren nahm das Apothekenpersonal das gar nicht mehr wahr. Selbst Reiters Putzfrau wuchtete sich nicht so weit nach oben, ihre Haushaltsleiter reichte gerade bis zu den Kartons zu retournierender Medikamente im vorletzten Fach.
Letzten Monat aber hatte Anna die Fenster der Lichtschächte geöffnet und die Stahltür zum Flaschenkeller verkeilt, die laut feuerpolizeilicher Verordnung immer geschlossen sein musste. Sie verfügte über eine Riegelkonstruktion, damit sie hinter jedem, der den Raum verließ, zufiel. Und hinter jedem, der ihn betrat, ebenfalls, was lästig war. Die gelagerten Alkohole, Spiritus und Terpentin, potenziert durch Johannas Schatz an ätherischen Ölen mit niedrigem Flammpunkt, bargen Explosionsgefahr. Ungleich gefährlicher schien Anna jedoch die einsetzende Schimmelbildung. Der Keller wurde in den letzten Jahren immer feuchter. Der Durchzug war unerlässlich, um die Bestände zu schützen. Und bei dieser Aktion hatte ein Windstoß das alte Krokodil, das in seiner Trockenmasse nicht allzu viel wog, aus dem Regal gehoben. Es lag nun mit gebrochenem Bein unter dem Tisch mit Kosmetikbeständen französischer Thermalquellen und müffelte. Reiter überlegte angestrengt, wie er das Ungetüm loswerden könnte. Das Naturhistorische Museum hatte bereits abgewunken und das Abfallwirtschaftsamt, verantwortlich für den Sondermüll, ebenfalls. Der Hausmüll verbat sich, besonders am Stück, zumal Tierpräparate bis ins letzte Jahrhundert hinein zur Konservierung in Arsen, Lindan und Cyanid eingelegt worden waren, um Parasiten, Schimmel und Säurefraß abzuhalten. Anna hatte eine heimliche Beisetzung im Hinterhof angeregt, die sie mit Buchensetzlingen kaschieren wollte. Die Verbindung eines approbierten Pharmazeuten und einer einfallsreichen Gärtnerin barg eben ohne Zweifel kriminelles Potenzial, dachte Reiter gerade amüsiert, den Blick noch immer zur Decke gerichtet. Doch das war nicht der Grund, warum sein Schwiegervater ihn damals mit Handkuss willkommen geheißen hatte. Vielmehr war er über den Fortbestand des Familienunternehmens erleichtert gewesen, nachdem seine Tochter beruflich so aus der Art geschlagen war, obwohl Anna nie als Landschaftsarchitektin gearbeitet hatte, denn schon bald nach Beendigung ihres Studiums war Johanna zur Welt gekommen. Anna kümmerte sich seither um die Administration der Stern-Apotheke, sie war die Herrin der Ablage und Meisterin pompöser Papierflut.
Fast hätte Reiter die Zeit vergessen. Er sah auf die Aufsatzuhr über dem Durchgang zum Magazin. Sie trieb ihn mit flinken Zeigern zur Eile an. Seine beiden Damen, Christa Werner und Ilse Neubeck, würden gleich die Ladentür aufsperren und die ersten Kunden hereinlassen. Die tägliche Routine nahm ihren Lauf.
3
Johanna wechselte die Auffangflasche unter der Kupferdestille und ging in ihren Laden, der in den ehemaligen Lagerräumen der Apotheke untergebracht war – ein weiß getünchter einstöckiger Flachbau im Hof, mit hellblauen Fensterrahmen, das Schild Sternwarte über der gleichfarbigen Tür und ein weiteres vorne am Durchgang zur Straße. Heute war Montag, da hatte sie geschlossen. Das Wochenende und den Montag nutzte Johanna für die Produktion ihres Sortiments. Feinste Seifen, die zum Anbeißen nach Schokolade oder Vanille dufteten und die sie in der Form winziger Schokoladentafeln goss – sie musste sie im Regal immer etwas weiter oben ausstellen, damit sie nicht flugs von Kindern verspeist wurden. Pastellfarbene Badekugeln, die in der Wanne sprudelten und Rosenduft aufsteigen ließen – jenen aus dem Botanischen Garten. Cremes und Masken auf der Basis von Bienenwachs und Kakaobutter, zum Testen in Schälchen angerichtet und mit frischen Früchten und Blüten garniert. Duschschaum, Haarshampoos und Spülungen mit geheimen Zutaten und überraschendem Duft, alle in der Rezeptur der elterlichen Apotheke angerührt. Naturparfums, in denen die wilden Herzen der Pflanzen schlugen, geboren aus Wasser und Licht, und romantische Dessous. Eine indische Änderungsschneiderin aus Johannas Straße fertigte sie nach Maß, Fantasien aus besticktem Tüll, Seide und Satin, die verzauberten. Nila Bhattathiri nähte außerdem auch Johannas Kleider, die Mode der zwanziger Jahre, die sie so gerne trug, aber nur selten in Kaufhäusern fand. Das Herzstück der Sternwarte waren jedoch die Hydrolate, wundersame Wasser sublimer Wirkung, die Johanna als Flüssige Umarmung, Liquide Achtsamkeit oder Balsamischer Mut anbot. Sie war davon überzeugt, dass sie die Gemütslage ihrer Kundinnen verändern konnten: Gelöste Heiterkeit aus Gänseblümchen, mit denen jeder Mensch Kindheitserinnerungen an Blumenkränze, Liebesorakel und nie enden wollende Sommer verband; Transparente Zeit vom Mammutbaum, dem Speicher von Epochen; ein aphrodisischer Vanilletraum oder das Hainbuchenfluidum Bloody Monday, das das Gefühl von Widerwillen und elender Erschöpfung am Anfang einer Woche, Sprühstoß für Sprühstoß, zerstäubte. Doch ein Hydrolat fehlte. Johanna suchte schon seit Jahren danach und hätte es zum wiederholten Mal selbst ganz dringend gebraucht. Eines, das Liebeskummer heilte und das Vermissen, über dem man die Bilder gemeinsamer Zeit nicht mehr ertrug. Eines, das wie Licht in die Verlassenheit floss, wie flüssiges Licht und das Herz genauso leicht machte. Dieser Duft musste sich aus irgendeiner Blüte gewinnen lassen, die ihr Geheimnis noch hütete, sich fassen lassen wie ein Diamant in warmes Gold, und wäre er auch noch so flüchtig. Ja, dieser eine Duft entzog sich, und doch fanden Johannas Kundinnen in ihrem Laden fürs Seelenheil ein erlesenes Sortiment und sich selbst in einem gemütlichen Wohnzimmer wieder, eingerichtet im schwedischen Landhausstil. An den weißen Regalen aus Birkenholz und der Verkaufstheke hatte Ben oft noch nach Feierabend gearbeitet, um Johanna zwischen Werkzeug und Schleifstaub zu küssen, um ihre Hände unter seinen über die glatten, abgerundeten Kanten und sorgfältig verleimten Bretter gleiten zu lassen, damit sie spürte, dass er das lebendige Material Span um Span gezähmt hatte. Ein Tisch mit Bistrostühlen und geblümten Kissen stand im Eck, an dem es für Johannas Kundinnen immer eine Tasse Tee gab, und bonbonfarbene Kommoden daneben. Zwei Fenster gingen zum Garten hinaus, und ein leise murmelnder Duftbrunnen erfrischte die Luft. Hier entspann sich das Gefühl, nach einem Schiffbruch endlich angelandet zu sein, glücklich gestrandet zwischen Tiegeln und Töpfen, Blüten-Potpourris und edlen Flakons.
»Entschuldigung, ich bräuchte nur schnell etwas von der Liquiden Achtsamkeit, bevor ich ins Büro muss.« Johanna sah eine attraktive Mittdreißigerin im Business-Look vor sich, die gerade mit einem kleinen Hund in den Laden gekommen war – schmales Kostüm, strenge Frisur und ein gehetzter Gesichtsausdruck. »Eine Freundin hat sie mir empfohlen«, ergänzte sie, und das Hundchen japste. »Benny, sitz!«, befahl die Kundin daraufhin, und der Hund gehorchte brav. Lustige braune Augen sahen zu Johanna auf.
»Die hab ich nicht«, entgegnete sie der Dame freundlich. »Schnelle Achtsamkeit, meine ich. Und eigentlich ist montags auch geschlossen, das ist mein Produktionstag.« Die Kundin war nicht erfreut. »Aber wenn Sie sich kurz setzen wollen, dann kann ich nachsehen, ob nebenan noch was im Lager steht. Bitte …« Johanna deutete auf das Tischchen mit den beiden Stühlen. »Oder Sie sehen sich etwas um.« Die Dame in Eile blickte auf ihre teure Uhr und seufzte. Je kostbarer der Zeitmesser, desto knapper ist die Zeit bemessen, dachte Johanna und nahm ihr Mammutbaumhydrolat aus dem Regal. Sie versprühte ein wenig im Laden, ehe sie im Nebenraum verschwand und die Tür hinter sich schloss. Sie überprüfte dort die Glasplatten mit cremigem Kokosfett, in dem sich seit drei Wochen die Duftveilchen verschwendeten. Sie lagerten in einem offenen Schränkchen mit Messingschienen. Das Verfahren nannte sich Enfleurage. Die Blüten, die fürs Destillieren zu zart waren, gaben ihren Duft an das Fett ab und wurden alle paar Tage gewechselt, bis es sich gesättigt hatte. Dann versetzte man die Masse mit Alkohol, verschloss sie luftdicht in einem Glas und überließ sie der Zeit. Die war für die meisten Produkte eine unerlässliche Zutat. Für Seifen, die nach dem Ausformen in luftigen Regalen reifen mussten wie guter Käse oder Parfums aus ätherischen Ölen, die sich erst demaskierten und ihre wahre Duftgeschichte erzählten, wenn sie geruht hatten und dekantiert worden waren wie edler Wein. Und dann die Hydrolate, sie waren kapriziös. Es dauerte Tage, bis sich auf ihrer Oberfläche das ätherische Öl gesammelt hatte und abgenommen werden konnte. Johanna verarbeitete es gesondert. Außerdem rochen die Wässer frisch mitunter nach Schwefel, der typische Blasengeruch, der sich aber bald legte. Hydrolate waren instabil, sie verdarben leicht, brauchten Pflege und manchmal sogar ein Tröpfchen Weingeist, um nicht auszuflocken oder zu verschlieren. Doch anders als ätherische Öle, deren Wirkstoffe viel konzentrierter waren, konnte man sie unbedenklich für sanfte Einreibungen verwenden, auf die die Haut nie allergisch reagierte. Oder man nahm sie als Arznei ein wie einst die ersten leichten Eaux de Cologne. Hydrolate begleiteten Prüfungen, umarmten ängstliche Seelen in Krankenhäusern und Hospizen, spendeten Kraft bei Geburten. Sie umfingen das Leben vom Anfang bis zum Ende.
Die Kundin ging durch den Laden, schraubte Tiegel auf und zu und lobte ihren kleinen Hund. Das Sedativ der Giganten tat seinen Dienst. Johanna sah unterdessen nach ihren getrockneten Kräutern, rührte Rinden der Zaubernuss in einem Eimer mit Quellwasser um und beschloss, dass sie nun lange genug gewartet hatte. Schnelle Achtsamkeit war nun mal ein Paradoxon, das sie unmöglich verkaufen konnte. Sie griff sich ein Fläschchen ihres Pfefferminz-Rosmarin-Hydrolats und kehrte zurück in den Verkaufsraum.
»Entschuldigung, es hat etwas gedauert«, flunkerte sie, als sie wieder durch die Tür trat. Die Kundin lächelte entspannt. Sie hatte ihr Haar aus dem Knoten gelöst. Ihr Hund saß auf dem Stuhl, den Johanna ihr angeboten hatte, und blickte sie erwartungsvoll an. »Wissen Sie, wie Sie das Hydrolat anwenden?«
»Einfach im Raum versprühen hat meine Freundin gesagt. Ich brauche es fürs Büro. Hilft es denn auch gegen Vergesslichkeit?«
»Nun, ich denke schon. Es schärft den konzentrierten Blick auf eine Sache«, spekulierte Johanna und überlegte, ob sie der Frau nicht doch besser ein Ginkgo-Präparat aus der elterlichen Apotheke empfehlen sollte.
»Meine Kollegin treibt mich mit ihrer Schusseligkeit nämlich noch in den Wahnsinn. Ich werde das deshalb heute mal versuchen«, erklärte die Kundin, »wenngleich ich skeptisch bin. Achtsamkeit aus der Flasche?« Und dabei stand die anfangs so Gehetzte doch schon ganz und gar im Bann der transparenten Zeit des über dreitausend Jahre alten Mammutbaums, dessen Vorfahren schon vor der Kreidezeit die Erde bedeckten. Johanna schmunzelte.
»Das macht vierzehn Euro fünfzig, bitte, und sehen Sie es als Experiment. Wenn Sie Ihre Kollegin nicht kurieren können, verwenden Sie das Hydrolat zur Fellpflege von Ihrem Benny. Die Pfefferminze kühlt im Sommer wunderbar, und der Rosmarin schützt vor Plagegeistern.«
4
Ihr Gesicht war noch immer wunderschön, schmal wie das ihrer Tochter und trotz der Fältchen ihrer fünfzig Jahre ebenmäßig. Ihre blonden Haare trug Anna Stern-Reiter seit einigen Jahren auf Kinnlänge und seit sich die ersten grauen einschlichen in einer Tönung, die das Blond ins Platin verschob. Trotzdem konnten Johanna und ihre Mutter ihre frappierende Ähnlichkeit nicht leugnen, Botticellis schaumgeborene Venus war nur ein paar Jahre älter und vielleicht ein klein wenig breiter um die Hüften geworden. Doch das verspielte sich bei ihr, die hinreißend üppige Oberweite verzieh ein paar Zentimeter um Bauch und Po. Anna legte etwas Rouge auf, tuschte ihre Wimpern und zauberte mit losem Puder kleinste Unregelmäßigkeiten aus ihrem Gesicht. Sie versprühte Un Jardin sur le Nil von Hermès – ein Duft nach Sand und Wasser, der ihre Frühlingstage erfüllte, ein impressionistischer Spaziergang durch die Garteninseln auf dem Nil bei Assuan, wie sein Schöpfer es einmal formuliert hatte – und schlüpfte in ein dünnes graues Wollkleid, eine lange weiße Strickjacke und Pumps. Seit sie verheiratet war, trug Anna oft hohe Schuhe, obwohl sie selbst darin nicht zu ihrem Mann hochreichte. Cornelius Reiter überragte sie immer.
Die pinkfarbenen Ranunkeln auf dem Balkon waren Säufer! Beim ersten Gießen sah Anna ihre Tochter im Hof neben ihrer Leonardo-Destille sitzen. Der vage Duft eines Nadelwalds wehte herauf, frisch, etwas harzig und zitrusschwanger. Pseudotsuga menziesii, die kanadische Douglasie, stellte Anna fest. Glänzend hellgrüne Nadeln mit feinen Silberstreifen an der Unterseite … Sie schloss die Augen und reiste in ihrer Vorstellung nach British Columbia. Sie stand am türkisfarbenen, kalten Emerald Lake, von wo aus sie die wilden Gipfel des President-Gebirgszugs betrachtete. Kanadische Indianer glitten in ihren Kanus lautlos übers Wasser, die Boote aus der Rinde der Küstentanne gebaut und die gleichmäßig geführten Paddel mit ihrem Harz präpariert. Das war schon verrückt, was Düfte so alles in einem auslösten! Bei Anna war es das Fernweh, und es war immer etwas zu groß für ihren kleinen Balkon.
»Guten Morgen, Schatz«, rief sie zu ihrer Tochter hinunter, die nach wie vor angeschlagen auf sie wirkte. Schon ihre Trennung von Patrick, ihrer ersten großen Liebe, hatte Johanna zutiefst verletzt. Er hatte sich nach dem gemeinsamen Abitur für ein Studium in Australien, in Perth, entschieden und wollte keine Fernbeziehung führen. Danach war sie für Jahre allein geblieben, bis sie Ben kennenlernte, den Bodenständigen, praktisch Veranlagten, der so offen schien und direkt. Er hatte Johannas Herz im Sturm erobert, und sie hatte wieder Vertrauen gefasst. Anna verstand noch immer nicht, was da Ende letzten Jahres passiert war, warum Ben jetzt eine andere liebte, aber vielleicht hatten Johanna und er sich einfach nur in unterschiedliche Richtungen entwickelt, sie waren doch noch so jung. So jung, genau wie sie damals, als sie vor ihren Gefühlen nach Florenz geflüchtet war. »Destillierst du den kanadischen Goldrausch, Jo?«, fragte Anna.