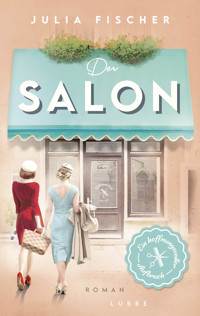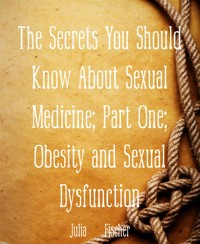9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Salon-Saga
- Sprache: Deutsch
1956. Die zwanzigjährige Leni aus dem ländlichen Hebertshausen träumt von einem Leben in der Großstadt - von eleganten Geschäften, Kinobesuchen und grenzenloser Freiheit. Als die junge Friseurin die Chance bekommt, sich bei dem vornehmen Münchner Salon Keller vorzustellen, scheint der Traum zum Greifen nah. Unterdessen hadert ihr Bruder Hans mit seinem Medizinstudium. Seine Leidenschaft gilt der Jazzmusik und einer Frau, die für ihn unerreichbar ist. Denn die schöne Charlotte ist bereits verheiratet - mit einem Mann, den sie nicht liebt. Während sie alle darauf hoffen, ihr Glück zu finden, müssen sie Entscheidungen fällen, die ihr Leben für immer verändern werden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 644
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
1956. Die junge Leni aus dem ländlichen Hebertshausen kann ihr Glück kaum fassen: Die Anstellung bei dem vornehmen Friseur Keller in München ist der erste Schritt zur Verwirklichung ihres großen Traums – ein eigener Salon in der Stadt. Unterdessen hadert ihr Bruder Hans mit seinem Medizinstudium. Seine Leidenschaft gilt der Jazzmusik – und Lenis Freundin Charlotte, die in einer unglücklichen Ehe gefangen ist. Während sie alle darauf hoffen, ihr Glück zu finden, stellt ein Schicksalsschlag ihre Zuversicht auf eine harte Probe …
Über die Autorin
Julia Fischer ist eine deutsche Schauspielerin, Sprecherin und Schriftstellerin. Die Mutter dreier Kinder und Tochter des Komödienstadel-Regisseurs Olf Fischer und der Schauspielerin Ursula Herion lebt mit ihrer Familie in München und hat schon als Kind auf Pumuckel-Schallplatten und im Kinderfunk mitgewirkt, später den Beruf der Schauspielerin ergriffen sowie verschiedene Magazine im Bayerischen Fernsehen moderiert. In den letzten Jahren kamen unzählige Hörbuchproduktionen hinzu (unter anderem als deutsche Stimme von Agatha Raisin). Außerdem hat Julia Fischer seit einigen Jahren das Schreiben für sich entdeckt und seit 2014 bereits vier eigene Romane veröffentlicht, für die sie zahlreiche begeisterte Feedbacks erhalten hat.
J U L I A F I S C H E R
W U N D E R
einer neuen
Z E I T
München-Saga
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Originalausgabe
Copyright © 2022/2024 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text-und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Ulrike Brandt-Schwarze, Bonn
Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von Motiven von © Mirrorpix/getty-images © Anastasiia Smiian/shutterstock
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-1014-5
luebbe.de
lesejury.de
Für Gunda und Franz,die sich für mich erinnert haben
Prolog
Juli 1951
In der Schlafkammer nebenan knarrten die Dielen. Draußen war es längst hell, die Vögel zwitscherten im Garten um das alte Haus, die Wiesen erwachten, und Lenis innere Uhr sagte ihr, dass es halb sechs war. Sie hörte, wie ihre Mutter Käthe nebenan mit dem Waschkrug hantierte und mit beiden Händen das kalte Wasser aus der großen Porzellanschüssel schöpfte. Dann war es wieder still. Leni wusste, dass ihre Mutter sich jetzt anzog – immer noch eines der alten Vorkriegskleider, die neben den verwaisten Sachen des Vaters im Schrank hingen. Und dass sie dann ihre dunklen Haare, in denen sich immer mehr weiße Strähnen zeigten, im Nacken zusammensteckte, ohne in den Spiegel zu sehen. Ehe ihre Mutter ihre Schlafkammer verließ, würde sie noch in eine Kittelschürze schlüpfen, um ihr Kleid bei der Hausarbeit zu schonen, und wie immer vergessen, sie auszuziehen, wenn sie um halb acht gemeinsam mit ihr das Haus verließ, um ihr Geschäft aufzusperren.
Der Frisörsalon Landmann war dienstags bis samstags von acht bis zwölf und von vierzehn bis neunzehn Uhr geöffnet, montags machte Lenis Mutter Hausbesuche. Es gab nur zwei Stühle, und die Ausstattung war spärlich, aber die Frauen hier im oberbayerischen Hebertshausen waren nicht anspruchsvoll – Waschen, Schneiden, Legen und hin und wieder Ohrlöcher stechen, sehr viel mehr wurde nicht nachgefragt. Und die Männer fuhren ohnehin lieber in das nahe Dachau zum Kölbl, weil sie sich von einem Herrenfriseur bedienen lassen wollten, der auch rasierte – die meisten zumindest. Leni und ihre Mutter hatten trotzdem alle Hände voll zu tun, denn auch die Flüchtlinge und Vertriebenen aus den Baracken an der Münchner Straße kamen zu ihnen. Die Familien aus dem Sudetenland, aus Schlesien und Ungarn, die seit Jahren in den zugigen Bretterverschlägen wohnten, in denen der Schwamm hauste. »Menschenunwürdig«, sagte Leni über die Provisorien, die der Zeit trotzten, aber ihre Mutter meinte, dass sich die Würde der Menschen seit dem Krieg anders definiere.
Jetzt hörte Leni, dass sie die Treppe hinunterstieg, Pantoffeln an den Füßen. Ich sollte auch aufstehen, dachte sie, und ihr zur Hand gehen. Aber die Tage waren auch so schon lang. Bis vor einem Jahr war Leni noch auf die »höhere Schul«, die Volksschule hier oben auf dem Weinberg, gegangen, in der die Kinder von der ersten bis zur achten Klasse in nur zwei Klassenzimmern unterrichtet wurden – Buben und Mädchen natürlich getrennt. Sie hatte sie im letzten Jahr abgeschlossen und machte seitdem bei ihrer Mutter eine Friseurlehre. Einmal die Woche fuhr sie mit dem Zug nach München in die Berufsschule in die Hirschbergstraße, an den anderen Tagen stand sie mit ihrer Mutter zusammen im Salon. Das Zupfen, Hecheln und Stumpfziehen von Rohhaaren, um daraus kleine Haarteile zu knüpfen, und den Umgang mit Montierbändern, Gaze und Haartüll – allesamt Arbeiten eines Perückenmachers, die Bestandteil der Ausbildung waren – musste sie abends zu Hause üben. Und noch bevor sie zu Bett ging, schrieb sie ihr Werkstattwochenbuch mit den Facharbeitsblättern.
Die Schule fiel Leni leicht, auch wenn jetzt noch anatomische und physiologische Grundlagen, Chemie und Mathematik dazukamen. Als Friseur musste sie schließlich die genaue Zusammensetzung der Haarfarben, Dauerwellwasser und Fixierlösungen kennen, Mischungsverhältnisse berechnen oder in der ebenfalls zur Ausbildung gehörenden Schönheitspflege Hautanalysen erstellen können, auch wenn sie vieles davon im Salon ihrer Mutter gar nicht brauchte. Sie hatten ja nicht einmal einen Heiß- oder Thermwell-Apparat! Leni würde deshalb zur Prüfungsvorbereitung ein paar Tage im Friseursalon Kölbl arbeiten dürfen, der moderner ausgestattet war. Sie selbst experimentierte schon länger mit der Herstellung von Kosmetikprodukten. Nach Rezepturen ihrer Großmutter, der Landmann-Oma, siedete sie Seifen, setzte Gesichtswasser an und mischte Cremes, doch ihre Mutter hatte kein Interesse daran, in ihrem Salon Kosmetikbehandlungen anzubieten: Gesichtsmassagen, Pflegepackungen oder Maniküren. »Geh, Leni, wer will denn des bei uns?«, sagte sie.
»Die Frauen aus den Baracken zum Beispiel, da sind einige nämlich viel moderner als wir hier. Mehr so wie die aus München.«
»Die jungen vielleicht, die Ang’strichenen, die mit unseren Burschen poussieren.«
»Na und? Die sind doch auch Kundschaft. Und des Schminken ist heutzutag ganz normal. Alle tragen doch jetzt Lippenstift.«
»Alle net und du schon gar net!«
Ihre Mutter war eine strenge Ausbilderin, aber Leni lag die Arbeit. Sie hatte schon als Kind stundenlang im Salon Puppen frisiert und den Mädchen die Haare geflochten. Hatte hinter der Verkaufstheke gesessen, jeden Handgriff ihrer Mutter verfolgt und mit schöner Schreibschrift die Termine in das Auftragsbuch eingetragen, das dort lag. Die Kundinnen kamen persönlich vorbei, um sie zu vereinbaren, denn es gab im Salon kein Telefon. Die wenigsten Hebertshausener hatten eines, und wenn, dann einen Doppelanschluss, wie der Metzger Herzog, dessen Apparat in seinem Gasthof stand, mit dem Rabl, der Fahrräder und Motorräder verkaufte und eine eigene Werkstatt hatte. Wer von den beiden zuerst den Hörer abhob, wenn es klingelte, nahm das Gespräch entgegen, und war es nicht für ihn, musste der Anrufer eben ein zweites Mal durchklingeln.
Leni schlüpfte unter ihrer Bettdecke hervor. Sie richtete sich ebenfalls für den Tag her, zog sich an und flocht ihre langen kupferroten Haare zu Zöpfen. Die ungewöhnliche Farbe hatte sie aus der mütterlichen Linie, von der Bürglein-Oma, die sie nicht mehr kennengelernt hatte.
Die Haustür fiel ins Schloss. Leni sah durchs Fenster, dass ihre Mutter die Handtücher von der Leine nahm, die Leni gestern noch aufgehängt hatte. Die Hebertshausener hatten ein gemeinsames Waschhaus hinter der Feuerwehr unterhalb vom Hansbauer. Dort wusch Leni nicht nur die Leibwäsche der Familie, sondern auch die Handtücher für den Salon. Jeden Montag kochte sie sie aus, stampfte und rieb sie, spülte sie mit klarem Wasser nach und wrang sie mühsam aus. Und dann hievte sie die schwere feuchte Wäsche auf einen Leiterwagen und zog ihn den Berg hoch. Frau Kopp, der ihre Mutter immer samstags die Haare machte, besaß eine eigene Waschküche und sogar eine Schleuder – Leni hatte diese einmal gesehen. Man musste sich draufsetzen, wenn sie eingeschaltet wurde, weil sie sonst wie ein Geißbock herumsprang.
Leni öffnete ihre Zimmertür und horchte in den Flur. Ihr Bruder schlief noch. Kein Wunder – seit er letzte Woche sein Abitur bestanden hatte, schlug er sich die Nächte im Club der Amerikaner um die Ohren. Im Hinterzimmer des Gasthofs am Walpertshofener Bahnhof, in dem eine Jukebox stand, die Jazz und Rock ’n’ Roll spielte. »Negermusik«, sagte ihre Mutter, wenn Hans den Rundfunkempfänger anstellte – »Good morning! This is AFN Munich …« – und dann versuchte, die Stücke auf seiner Trompete nachzuspielen.
»Die GIs haben die Decke im Hinterzimmer vom Domini mit Fallschirmseide abgehängt«, hatte Hans Leni begeistert erzählt, »das sieht aus wie ein Himmel, und da gibt’s Cola und Whisky.«
»Den darfst du noch gar net trinken, weil du noch net volljährig bist!«, hatte sie ihm geantwortet. »Und rein darfst du da auch net. Des is nur für die vom Militär.«
»Die Liesl, mit der ich in die Schule gegangen bin, ist auch oft da.«
Aber über die Liesl redeten die Leute in der Gemeinde, das wusste Leni, die Kundinnen im Salon ihrer Mutter nannten sie »Ami-Flitscherl«.
Leni ging hinunter in die Küche. Das war ihr liebster Moment: wenn sie das Frühstück herrichtete, der Tag noch unberührt war und voller Möglichkeiten. Während sie den Ofen anschürte und einen Topf mit Wasser aufsetzte, das Geschirr auf den Tisch stellte und das Butterfass und das Brot aus der Speisekammer holte, träumte sie davon, dass sie sich bald verlieben würde, in einen jungen Mann, der durch Zufall in den Salon käme und sich von ihr die Haare schneiden lassen würde. Einen, der nicht aus dem Ort stammte und den sie nicht schon ihr halbes Leben lang kannte. Und sie träumte, dass ihre Mutter den Salon vergrößern und modernisieren würde und plötzlich eine bekannte Schauspielerin in der Tür stünde – »Arbeitet hier das Fräulein Landmann? Sie ist mir empfohlen worden« – und,dass sie eines Tages einen eigenen Salon haben würde, den Salon Marlene, modern eingerichtet und mitten in München.
Leni mahlte den Ersatzkaffee – den guten Kathreiner – und wartete, bis das Wasser kochte. Ihre Mutter war noch immer im Garten, aber jetzt stand sie wie jeden Morgen am Gartentor und wartete auf ein Wunder.
*
Er wird einen Koffer in der Hand haben, so wie die anderen, die zurückgekommen sind, dachte Käthe und sah zur Kirche hinüber. Nicht den, mit dem er fortgegangen ist, aber auch einen aus Pappe, die Ecken mit Stahlblech verstärkt und mit einem Lederriemen zusammengehalten oder einer Schnur. Dabei wird gar nicht viel drin sein in seinem Koffer, ein Kamm vielleicht, ein Stück Seife und ein kleiner Spiegel, ihre Briefe, die sie ihm ins Feld geschickt hatte, ein Hemd und Wechselsocken, die Fotos der Kinder. Was besitzt einer schon, wenn er aus einem russischen Kriegsgefangenenlager entlassen wird? Gerade genug, dass sich der letzte Rest Leben daran festklammern kann.
Ihr Otto galt seit der Schlacht um die Krim als vermisst, aber Käthe war davon überzeugt, dass er noch lebte. Sie hatte im März 1944 seinen letzten Brief bekommen, der ihr schier das Herz gebrochen hatte, so entmutigt war ihr Mann gewesen. Aber wegen der Kinder – Hans war damals erst elf und Leni acht gewesen – hatte sie weitergemacht und sich die Zweifel am Sinn dieses Krieges nicht anmerken lassen. Sie hatten sich hier alle nichts anmerken lassen, um sich und die Ihren zu schützen.
Die Köpfe der Spalierrosen schaukelten im warmen Sommerwind, die Obstbäume trugen schwer an ihren Früchten. Bald würde es frische Äpfel, Birnen und Quitten geben, aus deren Kernen Käthe Haarfixierer kochte. In den Gemüsebeeten, die Ottos Mutter zwischen den Kriegen angelegt hatte, waren die Kohlköpfe und der Sellerie schon reif. Was nicht gleich gegessen wurde, machte Käthe ein. So waren sie immer gut versorgt und hatten auch die Zeit der Rationierungen überstanden, als gleich zwei Flüchtlingsfamilien aus Lokut bei ihnen einquartiert worden waren. Die Landmann-Oma, wie sie Ottos Mutter genannt hatten, hatte sogar Hühner und Hasen gehalten, um den Speiseplan hin und wieder mit etwas Fleisch aufzubessern, und Tabak angebaut. In der Zeit, in der eine Schachtel Zigaretten zwanzig Reichsmark gekostet hatte, war er als Tauschware begehrt gewesen.
Die Morgensonne fiel auf das kleine Gewächshaus, in dem Käthe ihren Salat vorzog, ehe sie ihn ins Freie setzte. Aber erst, wenn die Nachtfröste vorüber waren und das Wasser in ihrer Waschschüssel auf der Kommode in der Schlafkammer nicht mehr gefror. Sie bemerkte, dass eine Scheibe gesprungen war, die musste sie ersetzen, doch es gab so viel zu reparieren – das Dach, den Zaun –, dass sie kaum nachkam.
Käthe hielt weiter Ausschau. Otto würde von der Bahnhofstraße über die alte Friedhofstreppe, am Pfarrhaus und an Sankt Georg vorbei, heraufkommen, von wo aus man an klaren Tagen vom Watzmann bis zur Zugspitze die ganze Alpenkette sah. Und dann würde er stehen bleiben, den Koffer abstellen und winken. Und sie würde ihm entgegenlaufen, sich ärgern, dass sie schon wieder vergessen hatte, die Kittelschürze auszuziehen, und ihn umarmen. Genauso lange wie an dem Tag, an dem er fortgegangen war.
Jetzt lehnte sie sich an den Stamm der großen Kastanie, in die Otto das Baumhaus gebaut hatte. Sämtliche Kinder aus der Nachbarschaft hatten schon darin gespielt. Oft waren sie gleich nach dem Unterricht von der Schule herübergekommen, die nur einen Steinwurf weit entfernt lag.
Das Küchenfenster ging auf, und Käthe roch den Duft des Malzkaffees, den Leni gekocht hatte. »Guten Morgen, Mama!«, rief ihre Tochter.
»Morgen, Leni, hast gut g’schlafen?«
»Schon.«
Das zarte Kind rührte sie. Wie ein junges Fohlen sah sie aus mit ihren fünfzehn Jahren, dabei war sie genauso zäh wie sie selbst und arbeitete für zwei.
»Frühstück is fertig.«
Käthe versank kurz in Lenis blauen Augen, die immer so fröhlich leuchteten. Die hatte sie von ihrem Vater geerbt, genau wie ihr Bruder. Sie hatten die Farbe des Wassers in dem kleinen Tümpel der Amper hinter dem Wehr. Da, wo der Fluss nur mit halber Kraft weiterfloss, weil er in den Mühlbach umgeleitet wurde, der die Turbinen der Holzschleiferei antrieb, in der Otto früher gearbeitet hatte und sein Vater auch.
Sie war ihm das erste Mal auf der Wiesn begegnet, auf dem Münchner Oktoberfest, wo Käthe mit ihren Eltern hingegangen war. Damals hatte sie schon ihre Friseurlehre im Geschäft ihres Vaters in Freising absolviert und – weil es nicht danach ausgesehen hatte, dass sie je einen Mann finden würde – ihren Meister gemacht. So konnte sie wenigstens einmal das elterliche Geschäft übernehmen, wenn sie schon keine eigene Familie gründen würde. Als Otto und sie sich verliebt hatten, war Käthe schon siebenundzwanzig Jahre alt gewesen und das, was viele eine alte Jungfer nannten. Drei Jahre später war Hans zur Welt gekommen.
»Ich komm gleich, Leni, ich hab nur …«, erwiderte Käthe.
»Ich weiß, Mama.«
Käthe setzte sich an den Küchentisch und schenkte den Malzkaffee ein.
»Soll ich den Hans wecken?«, fragte Leni und schmierte sich Butter und selbst gemachte Marmelade auf ihr Brot. Seit die Lebensmittelkarten letztes Jahr abgeschafft worden waren, hatten sie alle wieder mehr auf dem Teller, und Käthe musste den Pfannkuchenteig nicht mehr mit Wasser strecken.
»Nein, lass ihn schlafen, er hat sich’s verdient«, sagte sie.
»Wir hätten’s uns auch verdient! Nur weil er sein Abitur g’schafft hat, darf er doch net auf der faulen Haut liegen.«
Hans war in den letzten acht Jahren an sechs Tagen die Woche mit dem Zug nach München gefahren und dort aufs Humanistische Gymnasium gegangen, weil es in Dachau erst seit diesem Jahr eine Oberschule gab. Im Krieg war der Unterricht oft ausgefallen, da hatten sie Trümmer weggeräumt, trotzdem war letzte Woche seine Abschlussfeier gewesen. Käthe hatte ihr Sonntagsgwand angezogen – ein Dirndl mit reinseidener Schürze –, und Leni hatte sie frisiert. »Jetzt siehst aus wie die Magda Schneider«, hatte sie zu ihr gesagt. Käthe hatte sich im Spiegel betrachtet, aber die Ähnlichkeit mit Romy Schneiders Mutter beim besten Willen nicht erkannt. Seit Otto fort war, nahm sie sich als Frau gar nicht mehr wahr, in ihrem Leben gab es nur noch die Arbeit und ihre Kinder. Leni würde in zwei Jahren ihre Gesellenprüfung ablegen und Hans im nächsten Sommer sein Medizinstudium beginnen. »Du wirst amal a Doktor, damit du vor niemandem buckeln musst, Hans«, hatte sein Vater früher oft zu ihm gesagt.
»Im Garten gibt’s jede Menge Arbeit, Mama«, stichelte Leni. »Und den Zaun hat der Hans auch noch net repariert.«
»Ich weiß, ich hab’s ihm schon zweimal g’sagt.« Käthe seufzte. »Räum zamm, Leni, wir müssen los.«
Sie nahmen die Abkürzung zum Ortskern hinunter, wo der Metzger Herzog und der Bäcker Schaller mit dem Kramerladen schon geöffnet hatten. Der Rabl war auf dem Weg zu seiner Werkstatt. Erst gestern hatte er Käthe erzählt, dass er plane, eine Tankstelle in Hebertshausen zu bauen. »Eine ganz moderne, damit ich den Sprit für die Motorradl nimmer aus’m Fassl pumpen muss.«
»Glaubst du, des rentiert sich, Schorsch?«, hatte sie ihn gefragt und an den Schmiedschorle gedacht, der schräg gegenüber vom Rabl noch immer die Pferde der umliegenden Bauern und Fuhrunternehmer beschlug.
»Freilich, Käthe, die Zulassungen wern immer mehr. Seit der Währungsreform geht’s bergauf.«
Ja, es ging bergauf, die Geschäfte in der Gemeinde florierten, und es kamen immer noch Flüchtlinge, die sich hier bei ihnen niederlassen wollten. Die Schule platzte aus allen Nähten, und Käthes Friseursalon konnte sich vor Terminen kaum retten. Kein Wunder, die Zeit der Kopftücher war vorüber, in der es für die Frauen außer Arbeit gar nichts gegeben hatte. Jetzt wollten sie sich wieder mit gepflegten Frisuren sehen lassen und in Kleidern, deren Schnitt nicht mehr am Stoff sparte. Wer nicht gerade in der Landwirtschaft arbeitete oder in der Fabrik, der schaute auf sich.
Dank Lenis Hilfe legte Käthe nun Monat für Monat ein paar Mark für Hans’ Anmeldegebühren an der Universität zurück, für seine Bücher und die Miete für ein Zimmer im Studentenwohnheim. Die meisten waren zwar noch nicht wiederaufgebaut, aber es würde sich schon etwas Passendes finden.
Käthe sperrte ihren Salon auf und prüfte mit einem routinierten Blick, ob Leni am Vorabend auch den Boden, die Spiegel und die Waschbecken gründlich gewischt hatte. Die Einrichtung stammte noch von ihrem Vorbesitzer, der im Winter 1939 gefallen war, und Käthe hatte seither kaum etwas verändert. Sie hatte lediglich das Schild über dem Schaufenster übermalt, auf dem nun Frisörsalon Landmann stand, die eingedeutschte Schreibweise, wie im Salon ihres Vaters, nicht die aus dem Französischen abgeleitete. Tradition und Bodenständigkeit, das war ihre Devise.
»Magst die Handtücher für mich einsortieren?«, fragte sie ihre Tochter.
»Gleich.«
Leni studierte die Termine für den Tag.
»Was schaust denn?«
»Wer heut als Erstes kommt.«
»Na, die Frau Brunner und die Frau Brandl, wie jeden Dienstag um acht.«
»Es hätt ja sein können, dass mal jemand anderer kommt.«
»Und wer soll des sein?«
»Vielleicht die Sonja Ziemann oder die Liselotte Pulver«, sagte Leni und grinste.
Warum nicht, dachte Käthe und musste selbst schmunzeln, manchmal passierten auch Wunder – dass ihr Otto wieder heimkam zum Beispiel oder dass Hans endlich den Zaun reparierte.
*
Als die Haustür ins Schloss gefallen war, hatte Hans sich noch einmal umgedreht und versucht, wieder einzuschlafen, aber die Nachbarin hatte ihre Teppiche im Garten ausgeklopft. Ein dumpfer Klang wie Granatwerfereinschläge, und nur zwei Häuser weiter war das häusliche Störfeuer erwidert worden. An Schlaf war also nicht mehr zu denken, doch das schlechte Gewissen, weil seine Mutter und seine kleine Schwester arbeiten gingen, während er noch im Bett lag, hätte ihm ohnehin keine Ruhe gelassen. Die beiden schufteten für die Pläne seines Vaters, dessen größter Wunsch es gewesen war, dass Hans einmal Medizin studierte, dabei würde er viel lieber auf die Musikhochschule gehen.
»Diese musische Begabung muss man fördern, Herr Landmann, die ist ein Geschenk«, hatte der Lehrer Laut zu seinem Vater gesagt, als Hans in der zweiten Klasse gewesen war, »und im Musikverein mangelt es uns an guten Blechbläsern.«
»Wenn’S meinen, Herr Lehrer, aber beim ersten Vierer ist’s vorbei mit der Trompeterei!«
Das Lernen war für Hans immer eine Qual gewesen. Er hatte am liebsten Völkerball und Fangen gespielt und mit seinem besten Freund, dem Wegener Rudi, im Baumhaus gesessen. Sie waren im Sommer an die Amper zum Baden gegangen und im Winter Schlitten gefahren und nie vor dem Betläuten heimgekommen. Bis Hans aufs Gymnasium gemusst hatte und er den Rudi nur noch an den Wochenenden und in den Ferien sehen konnte, weil er mit dem Lernen kaum nachkam. Diese Jahre waren schwer für ihn gewesen, und hätte er den Musikunterricht und seine Trompete nicht gehabt, wäre er vollends verzweifelt.
Hans setzte sich in seinem Bett auf und schaute zu seiner Kommode hinüber – da stand sie. »Ah, look at you, lad. You’re playing like Chet Baker«, hatte gestern ein Offizier im Club zu ihm gesagt, als er ein Stück gespielt hatte, das er von einer der Victory Discs kannte, die die GIs in ihrem Marschgepäck mitgebracht hatten: Freeway – extrem schnelle Tempi, scharf, laut und voller Lebensfreude. Jazz war Hans’ Lebenselixier, der floss ihm im Viervierteltakt durch die Adern und erzählte ihm Geschichten von Selbstbestimmung und Freiheit. Dem Aus- und Aufbruch. Allem, wonach er sich sehnte.
Du bist zu alt für solche Flausen!
Hans glaubte schon wieder, die Stimme seines Vaters zu hören. Sie begleitete ihn durchs Leben. Er stand auf und nahm seine Trompete in die Hand, strich zärtlich darüber und betrachtete sie. Das Mundrohr war aus Goldmessing, und die Ventile waren aus Edelstahl.
Verkauf sie, sagte die Stimme in ihm, die nur selten schwieg, und konzentrier dich auf dein Studium. Du brauchst jetzt einen Praktikumsplatz, sonst wird das mit der Zulassung nix.
Hans hätte sich längst danach umsehen sollen, und er hatte sich auch vorgenommen, zu Hause mit anzupacken. Der Zaun fiel ihm wieder ein, er hatte versprochen, ihn zu reparieren, aber dazu musste er erst Latten besorgen. Das Werkzeug seines Vaters stand im Schuppen, aber das Sägeblatt der Holzsäge war verrostet, und Nägel waren auch keine mehr da. Er würde nach Dachau müssen, um sie zu kaufen, und dafür brauchte er Geld. Er hatte seine letzte Mark für Zigaretten ausgegeben.
Der Frühstückstisch war noch für ihn gedeckt, als Hans in die Küche trat. Er trank den lauwarmen Malzkaffee, dann wickelte er seine Trompete in ein Tuch, legte sie in den selbst gebauten Holzkasten und schnallte ihn – die Stimme seines Vaters noch immer im Ohr – auf den Gepäckträger seines Fahrrads. Er würde sie in der Musikalienhandlung in Dachau verkaufen. Sich von den Träumen, die an ihr hingen und ihn ablenkten, trennen und den Zaun reparieren.
1
Juli 1956
Leni sah sich die Termine für den heutigen Dienstag an, während ihre Mutter frische Handtücher zurechtlegte. Frau Brunner und Frau Brandl erschienen um acht – so wie immer. Ein Tag war wie der andere, seit sie vor drei Jahren ihre Lehre abgeschlossen und die Gesellenprüfung bestanden hatte. Sie bediente die immer gleichen Kundinnen, die sich die immer gleichen Frisuren wünschten, und schnitt hin und wieder ein paar Handwerkern, die in ihrer Frühstückspause in den Salon kamen, oder Kindern nach der Schule die Haare. Dabei benutzte sie die ewig gleichen Produkte – »Bei uns bekommen die Kunden eine Seifenwäsche, Leni, und dann kommt die Essigspülung von der Landmann-Oma drauf« –, und es gab praktisch keine Beratung. Als sie noch auf der Berufsschule gewesen war, hatte Leni von den Lehrlingen aus anderen Friseurgeschäften gehört, dass den Damen dort die neuesten Schnitte und Frisuren aus Magazinen empfohlen wurden. Damals hatte sie noch stundenlang die verschiedenen Kopfformen in ihr Werkstattbuch gemalt und die passenden Ausgleichslinien, die runde Gesichter schmaler und schmale runder wirken ließen, eckige weicher oder lange kürzer. Die richtige Frisur schuf Ebenmäßigkeit und Harmonie, und Leni hatte einen guten Blick dafür entwickelt.
»Wir sollten renovieren, Mama«, hatte sie letztes Jahr zu ihrer Mutter gesagt, »das ganze alte Holz rausreißen, streichen und Linoleum verlegen.« Dann wäre wenigstens einmal ein Anfang gemacht, und der Salon sähe nicht mehr so altbacken aus.
»Bist narrisch! Wie soll ma denn des bezahlen?«
»Der Skrobanek tät’s uns günstig machen.«
»Aber dann müsst ma ja zusperren.«
»Höchstens eine Woch.«
»Nix da, Leni, solang der Hans studiert, brauch ma jeden Pfennig. Und unser G’schäft läuft doch. Ich wüsst nicht, wie wir noch mehr arbeiten könnten.«
Damit hatte ihre Mutter recht. Fünf Tage die Woche neun bis zehn Stunden am Tag im Salon stehen, gerade genug Zeit, um zwischendurch etwas zu essen, und dann kamen am Montag für Lenis Mutter auch noch die Hausbesuche dazu und für Leni die große Wäsche. Der Sonntag war ihr einziger freier Tag, da erledigten sie die liegen gebliebene Hausarbeit und kümmerten sich um den Garten. Gleich nach dem Kirchgang schlüpften Leni und ihre Mutter aus ihrem Sonntagsgwand und werkelten los, so wie die meisten Frauen, während ihre Männer am Stammtisch saßen. Noch mehr Arbeit würden sie nicht bewältigen können, aber darum ging es Leni auch nicht. Sie wollte den Friseursalon verschönern, um etwas Farbe in den grauen Alltag zu bringen und aus dem tristen Salon einen Ort zum Wohlfühlen zu machen, an dem sich die Kundinnen entspannen und ein wenig träumen konnten. So wie sie träumte, wenn sie in den Zeitschriften blätterte, die ihr Frau Reischl, die Wirtin vom Waldfrieden, schenkte, sobald sie sie ausgelesen hatte: die Neue Illustrierte oder die CONSTANZE, in denen junge Mädchen mit hohen Pferdeschwänzen und kurzen Ponys in Caprihosen abgebildet waren und Damen mit festlichen Steckfrisuren, in die allerlei Schmuck und Haarteile eingearbeitet worden waren – je größer der Anlass, desto höher die Frisur! Elegante, gepflegte Frauen, die wie Filmstars aussahen, wenn sie Suppenextrakt und Waschpulver anpriesen.
Seit ihre Mutter ihre Idee zu renovieren mit einem kurzen »Auf gar keinen Fall!« abgelehnt hatte, schnitt Leni die Werbeanzeigen aus und hängte sie im Salon auf. Am besten gefiel ihr die Anzeige für ein französisches Parfum – CHANEL N°5 –, auf der eine Frau, deren rabenschwarzes Haar in weichen Wellen über ihre Schultern fiel, im großen Abendkleid mit Pelzstola zu sehen war. Sie hielt einen Flakon in der Hand und küsste ihn wie die Königstochter aus dem Märchen den Frosch. Außerdem dekorierte Leni das kleine Schaufenster mit den Seifen, Cremes und Gesichtswassern, die sie immer noch selbst herstellte, wobei sie die Rezepturen ihrer Großmutter weiterentwickelt hatte.
»Und du glaubst wirklich, dass unsere Kundinnen so was kaufen?«, hatte ihre Mutter sie skeptisch gefragt. »Selber g’machte Kosmetik? Wo’s doch jetzt wieder so schöne Sachen in der Drogerie gibt.«
»Solang du ihnen die Haar mit Seife wäschst und die Pomaden und des Haarwasser selber machst, kann ich ihnen auch meine Kosmetik verkaufen«, entgegnete ihr Leni.
Ihre Freundin Ursel hatte eine Ausbildung zur Schaufensterdekorateurin im Kaufhaus Rübsamen in Dachau gemacht. Sie hatte eine Preistafel für sie entworfen und ihr kleine Podeste gebaut, auf denen Leni ihre Produkte präsentierte. Die Podeste waren wie die Rückwand des Schaufensters mit Stoff bespannt, den die Ursel bei Rübsamen abgezweigt hatte. Eine schöne Komposition in Rosa und Lindgrün, die einen betörenden Duft verströmte.
»Mei, des riecht immer so gut da herin«, sagte jetzt auch Frau Brandl, als sie in den Salon kam und ihren Einkaufskorb abstellte. »Darf ich den da stehen lassen, Frau Landmann? Ich war nämlich schon beim Herzog, bei dem is der Tafelspitz heut im Angebot.«
»Natürlich, Frau Brandl.« Lenis Mutter deutete auf einen der beiden Stühle. »Die Leni wäscht.«
Leni legte Frau Brandl einen Frisierumhang um, drehte ihren Stuhl zum Waschbecken um und kippte die Lehne nach hinten, was immerhin eine kleine Neuerung im Frisörsalon Landmann war, denn bis vor wenigen Jahren hatten sich die Kunden noch mit dem Gesicht nach vorn ins Waschbecken beugen müssen und den Seifenschaum in den Augen ertragen.
»Net so schwungvoll, Leni«, mahnte ihre Mutter.
»Des macht doch nix, Frau Landmann, des is wie auf der Wiesn in der Schiffschaukel. Mei, bin ich da früher mit meinem Mann gern drauf g’fahren.«
»Grüß Gott, Frau Landmann.« Frau Brunner erschien nun ebenfalls, ihre Promenadenmischung an der Leine. »Leni, Gusti.«
Leni grüßte höflich zurück, nur Frau Brandl hörte gerade nichts, weil das Wasser lief und Leni ihr die Haare einseifte.
»Is die Frauenmantelcreme schon fertig?«, fragte Frau Brunner. »Batzi, sitz!«
»Was für eine Frauenmantelcreme?«, wollte Lenis Mutter wissen.
»Die Leni hat mir versprochen, dass sie mir eine macht. Sie hat g’sagt, dass ihre Oma die auch benutzt hat.«
»Ja, des stimmt.«
»Und die hat doch mit ihre Achtzig noch ausg’schaut wie ich heut mit meine Sechzig!«, sagte Frau Brunner anerkennend.
Leni wickelte Frau Brandl ein Handtuch um den Kopf und klappte ihre Stuhllehne wieder hoch. Der feine Duft der Seifen aus der Auslage war mittlerweile dem stechenden Aroma der Essigspülung gewichen.
»Ja, die Theres!«, sagte Frau Brandl, als sie sie sah. »Warst schon beim Metzger? Der Tafelspitz is heut im Angebot.«
»Den mag mein Mann nicht. Aber ich geh nachher noch hin und frag nach ein paar Resten für meinen Batzi.«
»Ich hab die Creme dabei«, kam Leni auf Frau Brunners Frage zurück. »Schauen’S, da im Regal steht sie.«
»Darf ich?« Frau Brunner hob den Deckel des kleinen Einmachglases an und schnupperte. »Wunderbar!«, sagte sie.
»Ich geb ein bisserl Rosenöl mit dazu, weil der Frauenmantel eigentlich nach nichts riecht. Und die Tropfen, die sich in der Früh in den Blättern sammeln, verarbeite ich auch in der Creme.«
»Nein, so was!«
»Die Oma hat g’sagt, dass die Alchimisten früher versucht ham, Gold daraus zu machen, weil sie so schön funkeln«, erzählte Leni.
Frau Brunner trug die Creme auf ihren Handrücken auf und verrieb sie. »Vielleicht is sie deshalb so geschmeidig?«, überlegte sie.
»Nein, des macht des Lanolin, des Wollwachs«, erklärte Leni. »Ich bekomm’s von dem Schäfer, der seine Schafe auf den Wiesen hinter Deutenhofen stehen hat.«
»Himmelstau!«, sagte Frau Brandl unvermittelt.
»Bitte?«
»Meine Mutter hat den Frauenmantel Himmelstau genannt, wegen der Tropfen, die sich da drin sammeln. Jetzt weiß ich’s wieder.«
»Und meine hat Marienblümerl dazu gsagt«, meinte Frau Brunner, »nach der Heiligen Jungfrau«, und bekreuzigte sich.
Lenis Mutter bat Frau Brunner, Platz zu nehmen, und legte ihr nun auch einen Frisierumhang um. »So wie immer?«, fragte sie sie pro forma, und Frau Brunner nickte.
»Wollen Sie Ihren Mann nicht amal mit was Neuem überraschen, Frau Brunner?«, hakte Leni nach und sah dabei ihre Mutter herausfordernd an.
»Ich hab ihn am Samstag schon mit dem neuen Puddingpulver von Mondamin überrascht«, gab Frau Brunner zurück, »weißt, des ma nur so einrührt, und der Pudding liegt ihm heut noch im Magen.«
»Ja, des neumodische Sach, wo alles schnell gehen soll, des is nix«, stimmte Frau Brandl ihrer Bekannten zu, während Leni ihr Wasserwellen ins feuchte Haar legte. Sie verzichtete dabei auf das Fixativ, das ihre Mutter aus Quittenkernen kochte, weil es einen grauen Schleier im Haar hinterließ und die Trocknungszeit verlängerte.
»Mei, du bist a Künstlerin«, lobte Frau Brandl Leni und verfolgte im Spiegel, wie sie ihre Haare mit einer Hand abwechselnd von rechts nach links kämmte und die Wellenberge beim Richtungswechsel zwischen dem Zeige- und Mittelfinger der anderen festhielt. Die Spitzen drehte Leni in Sechserform auf und steckte sie mit Lockennadeln fest.
»Also ich kann die Wasserwellen nicht ohne Kämmchen legen«, stimmte ihre Mutter Frau Brandl zu.
»Aber die Kämme verziehen die Welle gern«, sagte Leni.
»Beim Kölbl nehmen’s für die kurzen Haar im Nacken Wickler«, wusste Frau Brandl.
»Mit denen wird die Frisur aber viel zu wulstig.«
»Vielleicht sollt ich auch lieber wieder Wasserwellen machen lassen«, überlegte Frau Brunner. »Des Ondulieren strapaziert die Haare ja schon sehr.«
»Die Mama macht des ganz schonend, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. So gut wie sie temperiert keine des Eisen«, sagte Leni, obwohl sie im Stillen kein Freund des Ondulierens war. Die Hitze schädigte das Haar, und es verlor mit der Zeit seinen natürlichen Glanz. Immer.
»Ja, des glaub ich gern. Und meinem Mann g’fallen halt die Locken besser«, sagte Frau Brunner.
»Ich könnt Ihnen die Haar amal papillotieren, des sieht dann ähnlich aus und ma braucht keine Brennscher«, schlug Leni vor und band Frau Brandl ein Haarnetz um, bevor sie die Trockenhaube holte.
»Magst mir noch die Abendzeitung geben, Leni? Die is in meinem Einkaufskorb«, bat Frau Brandl sie. »Sonst is es immer so langweilig unter der Haube.«
»Ja, davon kann die Heller Luise ein Lied singen«, bemerkte Frau Brunner, »die kommt schier um vor Langeweile, seit sie unter der Haube is!«, und die Damen lachten herzlich.
»Geht’s Haareschneiden?«, fragte ein Bub, der ohne Termin hereinkam. Der kurzen Lederhose, die er trug, sah Leni an, dass sie in der Familie schon länger durchgereicht und nicht geschont worden war, genau wie die abgewetzten Haferlschuhe.
»Hast du net Schul?«
»Na, wir teilen uns doch des Klassenzimmer mit die Zwergerl aus der ersten und zweiten Klass. Die san am Vormittag drin und wir am Nachmittag, weil die Oberstuf vom Lehrer Lieb des andere Zimmer braucht.«
Herrn Lehrer Lieb mussten jeden Tag zwei Buben in der Pause die Brotzeit holen: eine Schachtel Astor-Zigaretten und einen Riegel Blockschokolade. Daran erinnerte sich Leni noch gut.
»Dann setz dich da drüben hin«, sagte sie und deutete auf einen Stuhl neben der Tür. »Ich schieb dich kurz dazwischen.«
»Ganz die Mama«, lobte Frau Brunner Leni, »immer in Bewegung, des Mädel.«
Als Leni an diesem Abend gegen sieben den Boden im Salon fegte, war ihre Mutter bereits zu einer weiteren Kundin in den Baracken unterwegs, einer jungen Ungarin, die ihre kleinen Kinder nicht allein lassen konnte und gestern, am Montag, keine Zeit gehabt hatte. Leni wischte durch die Waschbecken und Regale und reinigte anschließend die Kämme und Bürsten in warmem Seifenwasser. Ihre Effilierschere klemmte, sie hatte es bemerkt, als sie dem Buben am Vormittag die Haare geschnitten hatte. Sie ölte das Schloss, legte sie zu den anderen Scheren und sah sich noch einmal um. Frau Brandl hatte vor Schreck ihre Zeitung vergessen, als sich Frau Brunners Hund über den Tafelspitz in ihrem Einkaufskorb hergemacht hatte. Leni nahm sie und begann, sie klein zu schneiden – das Zeitungspapier brauchte sie, um die rußgeschwärzte Brennschere zwischendurch abzuwischen –, als ihr Blick auf die Stellenanzeigen fiel. Der Salon Keller am Hofgarten, eine der besten Adressen in München, suchte eine Friseuse, wie die weiblichen Friseure neuerdings genannt wurden, da nun immer mehr Frauen diesen Beruf ausübten. Verlangt wurden eine abgeschlossene Ausbildung und Berufserfahrung. Leni setzte sich und las die Anzeige ein zweites Mal durch. Aber so sehr ihr der Gedanke auch gefiel, in einem Salon wie Keller zu arbeiten, in dem Stars und Ministerialangestellte bedient wurden, konnte sie doch ihre Mutter nicht mit ihrem Geschäft allein lassen. Oder doch?
Hans stand kurz vor seinem letzten Studienjahr. Er hatte nach einem sechsmonatigen Krankenpflegedienst vor vier Jahren die Aufnahmeprüfung an der Ludwig-Maximilians-Universität bestanden und seitdem kein Semester wiederholt, auch wenn er seine Prüfungen nur mit Mühe und manchmal erst im zweiten Anlauf schaffte. Bald würde er die finanzielle Unterstützung von zu Hause nicht mehr brauchen, überlegte Leni, und dann könnte sie ihren Meistervorbereitungskurs und die Prüfung machen und auf einen eigenen Salon sparen. Doch dazu musste sie zuvor bei einem renommierten Friseur Erfahrungen sammeln, der mit den neuesten Produkten und Techniken arbeitete. Einem, der mit der Zeit ging – so wie der Salon Keller.
Sie schnappte sich einen Lappen und putzte durch die Regale, die sie schon am Tag zuvor sauber gemacht hatte. Egal, sie musste irgendetwas tun, das half ihr beim Nachdenken. Wenn sie die Stelle bei Keller bekäme, trennten sie nur noch ein paar Jahre von ihrem eigenen Salon, in dem sie dann keinen Haarlack mehr verwenden würde, sondern das neue »flüssige Haarnetz«, das Taft zum Sprühen, und in dem ihre Kundinnen unter einer Steckfrisur keine Gretelfrisur verstanden, wie sie die Frauen hier auf dem Land trugen: die Haare zu Zöpfen geflochten und einmal um den Kopf gelegt. Auf dem Hochzeitsfoto ihrer Großmutter, das um die Jahrhundertwende aufgenommen worden war, hatte die Landmann-Oma ihr Haar auch schon so frisiert und ihre Mutter vor ihr ebenfalls.
Der Salon Keller am Hofgarten …
Leni betrachtete sich in dem breiten Spiegel über den Waschbecken, der am Rand schon blinde Flecken hatte, und versuchte, sich vorzustellen, wie sie dort arbeitete. Wie sie Schauspielerinnen, Mannequins und den Ehefrauen der Offiziere der US-Armee die Haare machte. In einem blütenweißen Kittel, auf dem ihr Name eingestickt sein würde – Marlene.
Gedankenverloren blätterte sie durch das Auftragsbuch mit den Terminen. Frau Brunner und Frau Brandl würden auch am nächsten Dienstag wieder um acht erscheinen. Und danach Frau Reischl und Frau Schaller um neun. Waschen, Schneiden, Legen und sich über die Angebote vom Metzger austauschen. Kochrezepte, Dorftratsch und zwischendurch Laufkundschaft. Ein Tag war wie der andere in der kleinen Gemeinde am Rande vom Dachauer Moos, während sich der Rest der Welt neu erfand.
2
Draußen vor dem Zugfenster zogen die Felder vorbei, der Mais stand jetzt Anfang Juli schon mannshoch, und die Wiesen blühten, aber Leni nahm die satte Landschaft kaum wahr. Sie hatte ihre Mutter angelogen, um nach München fahren zu können, und – schlimmer noch! – sie wollte sich dort heimlich um die Stelle im Salon Keller bewerben.
»Darf ich dem Hans morgen das Geld für die Miete bringen?«, hatte sie sie am Vorabend gefragt. »Bitte, Mama, ich hab schon so lang nimmer frei g’habt.«
In der Zeitungsanzeige stand, dass die Bewerber eine beglaubigte Abschrift Ihres Gesellenbriefes und ein Lichtbild schicken sollten. Aber Leni hatte nur das, auf dem sie ihre Firmkerze in der Hand hielt. Sie hatte deshalb beschlossen, persönlich vorzusprechen und Herrn Keller anzubieten, zur Probe zu arbeiten. Wenn er erst sah, wie fleißig sie war, gab er ihr vielleicht eine Chance.
»Und wie soll des gehen? Wir ham doch Kundschaft«, hatte ihre Mutter gesagt.
»Die Frau Weber hat für morgen früh abg’sagt, und die Frau Wimmer wird diesmal nur g’waschen und eingedreht. Bis du am Nachmittag nach Deutenhofen fährst, bin ich wieder da.«
»Ich weiß net, Leni …«
»Dann könnt ich auch nach neuen Frisierumhängen schauen. Vielleicht find ich farbige, in Rosa oder Türkis.«
»Ich hab die alten schon g’flickt«, hatte ihre Mutter knapp erwidert.
Das war so typisch! Egal, was Leni vorschlug, ihre Mutter blockte es ab. Dabei freuten sich die Kundinnen über kleine Neuerungen wie die Werbebilder im Salon und die Schaufensterdekoration. Und langsam wurden sie auch experimentierfreudiger.
»Mei, Leni, deine Haare glänzen immer so schön«, hatte eine der Damen kürzlich zu ihr gesagt, als sie am Mittwochnachmittag allein im Salon gewesen war, weil ihre Mutter da immer nach Deutenhofen ins Krankenhaus fuhr und den Patientinnen dort die Haare machte. »Wenn ich mir da meine anschau … Die sind irgendwie stumpf, findest du nicht?«
»Ich kann Ihnen eine Hennapackung draufmachen.«
»Henna? Sind’s dann net rot?«
»Nein, bei Ihnen käm ein schönes leuchtendes Kastanienbraun raus, wie bei der Sophia Loren.«
»Bei der Loren? Ja, was du net sagst!«
Leni hatte das Hennapulver, das sie gegen den Willen ihrer Mutter in Dachau besorgt hatte – »Braucht’s net!« –, mit heißem Wasser und Rotwein angerührt, damit der Farbton kräftiger wurde, und ihre Kundin war von dem Ergebnis so begeistert gewesen, dass sie ihr ein ordentliches Trinkgeld gegeben hatte.
Zum Glück hatte Leni einen Sitzplatz bekommen. Wenn die Arbeiter der Dachauer Papierfabrik, von MAN und Krauss-Maffei in der Früh den Zug am Walpertshofener Bahnhof nach München nahmen, standen viele bis Allach draußen auf den Plattformen zwischen den Holzwaggons, und drinnen drängten sie sich dicht an dicht.
Mit ihrem hellblauen Tellerrock, den Leni sich aus einem einfachen Baumwollstoff genäht hatte, der kurzärmeligen Bluse und schmalen Kappe, die ihr die Ursel wie die Spitzenhandschuhe geliehen hatte, stach sie aus der Menge heraus. Leni hatte ihre Sommersprossen unter feinem Puder versteckt und ihre Haare im Nacken zu einem Chignon zusammengedreht. Den hatte ein berühmter Pariser maître coiffeur erfunden, von dem Leni in der CONSTANZE gelesen hatte, dass er die Begum für ihre Hochzeit mit dem Aga Khan frisiert hatte.
»Fesch!«, hatte ihre Mutter beim Frühstück zu ihr gesagt, und Leni war kurz davor gewesen, ihr zu beichten, was sie vorhatte. Aber wenn sie die Stelle gar nicht bekam? Dann hätte sich ihre Mutter doch ganz umsonst gesorgt, wie sie die viele Arbeit in Zukunft ohne sie schaffen sollte.
»Nächster Halt Hauptbahnhof, Endstation, bitte alles aussteigen!«, rief der Schaffner durch den Waggon, und Lenis Aufregung war auf einmal größer als das schlechte Gewissen.
Sie liebte München! Zum ersten Mal war sie als kleines Mädchen mit Hans und den Eltern hier gewesen, auf der Auer Dult; dann an den Berufsschultagen, und vor zwei Jahren, an ihrem achtzehnten Geburtstag, hatte sie mit ihrer Mutter und ihrem Bruder einen Ausflug in den Tierpark Hellabrunn gemacht. Hans hatte der gewaltigen Elefantenkuh Stasi eine Semmel zugesteckt, die daraufhin ein Kunststück zeigte. Noch wochenlang hatte Leni den Kundinnen im Friseursalon davon erzählt, und von Mimi, dem Walross, das sich von ihr sogar hatte streicheln lassen. Einmal war sie mit der Ursel in München ins Kino gegangen, und hin und wieder begleitete sie ihre Mutter zum Einkaufen in die Stadt. Aber wenn ihre Mutter etwas zu erledigen hatte, das sie nicht auf den Montag legen konnte, an dem sie mit ihren Terminen flexibler war als an den anderen Tagen, sagte sie zu Leni: »Bleib du im G’schäft, sonst müss ma’s zusperren«, und Leni insistierte nicht. Lieber nutzte sie die Gelegenheit, um ihren Kundinnen Schönheitstipps zu geben, ohne dass ihre Mutter sie ermahnte – »Net so viel reden, Leni, arbeiten!« –, und ihnen ihre Kosmetik zu verkaufen. Der Inhaber der Maximilian-Apotheke in Dachau, wo sie ihr Ätznatron zur Seifenherstellung kaufte, hatte sie bereits darauf angesprochen und gefragt, ob sie nicht Interesse hätte, ihre Rezepturen mit ihm gemeinsam weiterzuentwickeln. Das würde vielleicht ihr Problem mit der geringen Haltbarkeit der Cremes lösen, denn sie könnte dort mit Hydrolaten und ätherischen Ölen arbeiten, die sie mangels Destillierkolben nicht selbst herstellen konnte, und bestimmt kannte Herr Albrecht, der Apotheker, sich auch mit anderen Konservierungsstoffen aus.
Als der Zug zum Stehen kam, stieg Leni aus und ging durch die weitläufige Schalterhalle. Die große Uhr erinnerte sie daran, dass die Zeit in dieser Stadt schneller verging als zu Hause. Draußen staute sich vor dem Kaufhaus HERTIE der Verkehr. Das Schrillen der weiß-blauen Straßenbahn mit den neuen Stromabnehmern, die sich jetzt nicht mehr in die Oberleitung einhakten, mischte sich mit dem lauten Hupen eines Lastwagens. Der Fahrer schimpfte, und Leni vergaß kurz zu atmen. »Obacht!« Ein Herr rempelte sie an und lief ohne Entschuldigung weiter. Vor ihr winkten zwei Damen nach einem Taxi. Sie trugen Bleistiftröcke und taillierte Kostümjacken, ihre Hüte waren farblich auf ihre Handtaschen und die spitzen Pumps abgestimmt. Leni schaute etwas betreten auf ihre Schnürschuhe und dachte an die ungeteerten Straßen in Hebertshausen, die staubig und voller Schlaglöcher waren.
»Kann ich Ihnen vielleicht helfen, Fräulein?«
Ein junger Mann sprach sie an, er war kaum älter als sie und hatte seine dunklen gelockten Haare mit reichlich Frisiercreme in Form gebracht.
»Nein, danke, ich komm schon zurecht.«
Seine Augen sind blau, nein, grau, dachte Leni, als spiegele sich in ihnen nicht der Himmel, sondern der Stein der Kriegsruinen.
»Wo müssen Sie denn hin?«, fragte er.
»In die Ludwigstraße.«
Er trug Hemd und Krawatte und einen dünnen Pullunder, seine Schuhe waren blank poliert. Über seiner Schulter hing ein Fotoapparat an einem langen Lederriemen. »Mit der drei«, sagte er.
»Bitte?«
»Die Straßenbahn, Sie müssen die Linie 3 nehmen.«
Mit der war Leni in entgegengesetzter Richtung immer zur Berufsschule gefahren. »Wissen Sie, wie viele Stationen es bis zum Hofgarten sind?«, fragte sie den jungen Mann, nur um sicherzugehen, dass sie nicht daran vorbeifuhr.
»Vier. Sie müssen am Odeonsplatz raus.«
»Danke«, sagte sie und spürte, dass ein Abenteuer begann. Hier in dieser Stadt fing es an, und vielleicht konnte sie ihre Mutter ja mit auf diese Reise nehmen, damit sie endlich wieder nach vorn schaute. »Lass los, Mama«, hatte Leni erst gestern am Gartentor zu ihr gesagt, »lass den Papa los, der kommt nimmer«, und ihre Mutter hatte ihr geantwortet: »Morgen vielleicht.«
Die Straßenbahn war so voll, dass Leni stehen musste. »Bitte in die Mitte durchgehen, Herrschaften!«, rief der Schaffner, und die Menschenmenge schob sich mit ihr weiter. Leni hielt sich nahe am Fenster an einer Schlaufe über ihrem Kopf fest, damit sie hinaussehen konnte und nichts verpasste. Die Straßenbahn fuhr am Justizpalast vorbei, in dem während des Krieges der Prozess gegen die Mitglieder der Weißen Rose stattgefunden hatte. Leni wusste es von Hans, da die meisten Mitglieder der Widerstandsgruppe Medizinstudenten gewesen waren. Sie hatten in denselben Hörsälen gesessen wie er heute, hatten dieselben Institute besucht und sogar ein paar derselben Dozenten gehabt. Leni legte den Kopf in den Nacken und sah an dem ehrfurchtgebietenden historischen Gebäude hoch, das seine dunkle Vergangenheit abgeschüttelt zu haben schien.
Überall wurde gebaut. Auch an der zweiten Haltestelle, am viel befahrenen Stachus, wo die Straßenbahn nun zum Maximiliansplatz und wenig später in die Brienner Straße abbog. Dort fuhr sie am ehemaligen Palastcafé vorbei, einst ein Prachtbau aus der Gründerzeit. Es hatte Platz für zweitausend Gäste gehabt und war ein Treffpunkt für Künstler und Literaten gewesen. Leni kannte das alte Gebäude nur von Bildern aus der Zeitung, ebenso wie den schlichten, neuen Luitpoldblock, der jetzt an seiner Stelle stand. Doch wirklich hier zu sein war ein anderes Gefühl, als eine Zeitung aufzuschlagen. Es war wie die heimliche Fahrt auf dem selbst gebauten Floß auf der Amper mit dem Katzlmeier Fritz und seinen Freunden oder der erste verstohlene Kuss auf dem Waldfest. Eine Mischung aus Angst und Euphorie.
»Nächster Halt Odeonsplatz!«
»Entschuldigung, darf ich?«, bat Leni einen Herrn, der den Ausstieg versperrte.
»Leit, lasst’s d’Leit naus!«, rief der Schaffner.
Jetzt lag die lange Ludwigstraße vor ihr, an deren Ende das notdürftig geflickte Siegestor aufragte. Leni bestaunte die frisch verputzte Theatinerkirche, die Feldherrenhalle, die einer italienischen Loggia nachempfunden war, und das Café Annast, das die meisten Münchner noch immer nach seinem Vorbesitzer Tambosi nannten. Die Tische wurden auch im dahinterliegenden Hofgarten eingedeckt, wo die Leute unter gestreiften Sonnenschirmen zwischen jungen Nachkriegsbäumen saßen und Kaffee und Cognac tranken. Bis hierher hatte die rastlose Choreografie der Stadt Leni in weniger als fünfzehn Minuten gebracht, aber jetzt hielt sie inne und entdeckte in der an das Café angrenzenden Ladenzeile den Salon Keller. Der Name stand in Gold auf dunkelblauen Markisen. In einer der Schaufensterscheiben spiegelte sich das ausgebombte Leuchtenberg-Palais.
Sie ist wund, diese Stadt, wie so viele Städte, dachte Leni. Ein Patient in der Genesungsphase, hätte Hans gesagt, aber Leni sah sie schon vor sich, wie sie aussehen würde, wenn sie geheilt war, weil sie im Heute schon ein Stück vom Morgen und all seinen Möglichkeiten entdeckte.
Auf dem Bürgersteig saß eine alte Frau, neben ihr lag ein verbeulter Strohhut mit vergilbtem Blumenschmuck. Ihre Strümpfe waren verrutscht und ihre Kleider schmutzig. Sie fütterte Tauben. Leni bückte sich, gab ihr zwanzig Pfennig und beschloss, später zu Fuß zum Bahnhof zurückzugehen, um das Geld für die Straßenbahn zu sparen. Die Alte sah sie an und lächelte. Aus ihrem verwitterten Gesicht strahlten Leni klare blaue Augen entgegen, und sie spürte ein kleines Kribbeln in ihrer Magengrube. Ein bisschen so wie letztes Jahr, als ihr der scheue, abgemagerte Kater zugelaufen war, den jemand ausgesetzt hatte. Er war weiß und hatte rote Flecken auf einer Seite vom Bauch und blaue Augen. Sie hatte ihn Frank genannt, das sprach sie Englisch aus, wie Frank Sinatra, dessen Lieder sie liebte – Love is here to stay. Die spielten sie mittwochs im Wunschkonzert, das Fred Rauch moderierte und das sie mit ihrer Mutter im Radio anhörte.
Dieses Gefühl trug Leni bis vor den Friseursalon. Durch den Glaseinsatz der Tür erkannte sie hohe Decken mit Stuck und eine Empfangstheke aus Mahagoni, auf der eine große silberglänzende Registrierkasse und ein Telefon standen. Die Regale dahinter waren aus demselben Holz gefertigt, und es gab eine kleine Sitzecke mit feinen Polstersesseln und einer Garderobe gleich hinter der Eingangstür.
Leni brauchte zwei Anläufe, dann trat sie ein und ging über glänzenden Marmor so zielstrebig wie möglich auf die Dame hinter der Theke zu.
»Grüß Gott, ich bin die Marlene Landmann, ich würd mich bei Ihnen gern um die Stelle als Friseuse bewerben, die Sie inseriert ham«, sagte sie entschlossen, obwohl sie sich gerade wie eine Hochstaplerin vorkam.
»Bei mir nicht«, entgegnete die Dame. »Wenn, dann bei Herrn Keller, aber der ist zu Tisch.«
»Oh, schon so früh?«
»Lassen Sie mir Ihre Unterlagen da, dann gebe ich sie ihm.«
»Ich hab g’hofft, ich könnt ihn persönlich sprechen. Darf ich warten?«
»Gleich hier.« Die Dame deutete auf die Sitzgruppe, auf deren Resopaltischchen die Elegante Welt und MADAME – die Zeitschrift der gepflegten Frau – lagen, mit der neuesten Mode aus London und Paris, und für die Herren Automagazine. Leni blätterte durch die Haute Couture und beobachtete aus den Augenwinkeln die Friseusen in ihren weißen Kitteln und deren Kundinnen unter roséfarbenen Frisierumhängen. Sie saßen auf höhenverstellbaren, mit rotem Kunstleder bezogenen Stühlen unter Trockenhauben, die an der Decke über ihnen befestigt waren und nur heruntergezogen werden mussten, lasen, rauchten oder tranken Sekt aus funkelnden Kristallgläsern. Leni zählte auf der Stirnseite des Salons vier Stühle, und möglicherweise standen weitere hinter der halben Wand, die den Damensalon von dem kleineren Bereich der Herren abtrennte. Ein riesiger Philodendron diente als zusätzlicher Sichtschutz.
Ein Mädchen wusch einer Kundin Färbemittel aus dem Haar und wirkte nervös. Ein junger Bursche fegte den Boden, ein anderer verteilte mit ernstem Gesicht zu viel Haarwasser auf dem Kopf eines Herrn. Der frische alkoholische Duft stieg Leni in die Nase, und sie dachte an das selbst angesetzte Haarwasser, das ihre Mutter in ihrem Salon benutzte – Birkenblätter in Obstessig.
Das Telefon klingelte, die Dame hinter der Theke hob den Hörer ab: »Ja, natürlich, Frau Biederstedt, der Chef färbt persönlich, ich trage es ein. Und schneiden und legen wie immer bei Frau Berger?« Hinter ihr im Regal stand das neue Taft mit der Aufschrift: Viel länger frisch frisiert.
Der Herr, der jetzt hereinkam, trug eine rotgeblümte Fliege zu einem braunen Nadelstreifenanzug, ein Hemd mit goldenen Manschettenknöpfen und ein schmales geschwungenes Bärtchen über der Oberlippe. Leni schätzte ihn auf Mitte vierzig, sein Haar war unnatürlich schwarz, und seine Bewegungen waren ausladend. An seiner linken Hand prangte ein Siegelring.
»Herr Keller, da ist ein Mädchen, das sich auf die Stelle bewerben möchte«, sagte die Dame am Empfang zu ihm und deutete auf Leni.
»Frau Mai wartet auf mich, Maria. Helga, auswaschen und durchkämmen!«, rief er dem Lehrmädchen zu. »Ich bin sofort da.«
»Frau Mai ist schon so weit«, sagte Helga, die bereits ein Handtuch um den Kopf der Kundin geschlungen hatte, und ihre Stimme zitterte.
Leni sprang auf. »Entschuldigung, Herr Keller, wenn ich stör, aber ich wollt mich gern persönlich vorstellen …«
»Gesellenbrief«, unterbrach sie Keller, und Leni gab ihm ihre Unterlagen. »Ausbildungsbetrieb Käthe Landmann, Friseurmeister, Hebertshausen«, las er vor. »Wo ist das?«
»In der Nähe von Dachau. Der Salon meiner Mutter.«
Keller sah Leni abfällig an. »Oh, my goodness! Sie kommt vom Land«, seufzte er. »Wo soll ich denn da anfangen? Der Dialekt, die schlichte Erscheinung und kein Blick für Gestaltung.« Er sah auf ihre staubigen Schuhe, und Leni schluckte. »Junge Dame, Sie sind hier im Salon Keller, der ersten Adresse der Stadt.«
»Ich weiß, Herr Keller, ich …«
»Und dann nur drei Jahre Berufserfahrung! Nein, ausgeschlossen, ich bedaure.« Keller ging zu seiner Kundin und ließ Leni einfach stehen. Sie überlegte, ob sie noch etwas sagen sollte. »Verzeihung, Herr Keller!«
»Was ist denn noch?« Er zog eine Augenbraue hoch.
»Die Farb bei der Frau Mai is zu früh ausg’waschen worden. Des Blond hat jetzt an Blaustich.«
»Bitte?« Er sah sein Lehrmädchen entsetzt an, und die nickte kaum merklich.
»Sie sollten die Haar noch amal mit zweiprozentigem Wasserstoffsuperoxyd bestreichen«, schlug Leni vor, »damit die Oxydation wieder anläuft. Pfüa Gott.«
Draußen kämpfte Leni mit den Tränen. Sie musste in die Haimhauserstraße, wo Hans zur Untermiete wohnte, und fragte, nachdem sie sich etwas beruhigt hatte, eine Passantin nach dem Weg.
»Zu Fuß brauchen Sie vielleicht zwanzig Minuten«, klärte die Dame sie auf, »aber mit der Trambahn keine fünf Minuten. Immer nur die Ludwigstraße hinunter und die Leopold entlang.«
Diesmal kaufte Leni ihre Fahrkarte bei einer Schaffnerin mit feschem Kurzhaarschnitt, die genau wie ihre männlichen Kollegen Uniform trug und den Galoppwechsler für das Kleingeld umgehängt hatte.
Die Straßenbahn fuhr an der Universität vorbei, an der Hans studierte. Viele seiner Vorlesungen fanden in den Instituten rund um das Sendlinger Tor statt, hatte er ihr erzählt, aber das hier musste das Hauptgebäude am Geschwister-Scholl-Platz sein. Auf beiden Seiten der Straße standen große Springbrunnen, neben denen sich Studenten verschiedenster Nationen niedergelassen hatten und die Sonne genossen. Leni sah zwei Inderinnen im Sari und junge Männer mit schulterlangen Haaren. So fühlt sich Freiheit an, dachte sie, der Schritt ins Ungewisse, wo etwas wartet, jenseits der ausgetretenen Pfade. Wie sehr sie ihren Bruder darum beneidete!
Die Schaffnerin tippte sie an, als sie an der Münchner Freiheit aussteigen musste, und Leni bedankte sich und wünschte ihr einen schönen Tag.
»Das wird er«, gab die junge Frau zurück, »nach Feierabend, wenn ich die Verkleidung los bin.«
An der gesuchten Adresse stand kein Haus. Leni sah nur eine bröckelnde Fassade. Sie versicherte sich, dass sie die richtige Hausnummer notiert hatte, überquerte dann einen Hof und fand den Namen von Hans’ Vermietern am Rückgebäude auf einem provisorischen Klingelschild. Die Tür zum Hausflur war nicht verschlossen. Sie ging hinein und klopfte im zweiten Stock. Ein alter Herr in Anzug und Krawatte öffnete ihr. »Ja, bitte?« Er trug ein seidenes Einstecktuch.
»Sind Sie der Herr Pohl?«
»Ja.«
»Mein Name is Leni Landmann, ich bin die Schwester vom Hans«, sagte sie, und ein Lächeln ging über sein Gesicht.
»Das Fräulein Landmann, wie schön, kommen Sie doch herein.«
»Is er da?«
»Das Zimmer hinten links, ich sage ihm Bescheid.«
»Danke.«
»Darf ich Ihnen vielleicht eine Tasse Tee anbieten? Meine Frau hat gerade etwas aufgebrüht, das entfernt an Earl Grey erinnert.«
»Des wär sehr nett. Ich bin seit heut früh unterwegs.«
»Dann setzen Sie sich doch zu uns ins Wohnzimmer, und ich hole Ihren Bruder. Hildchen, wir haben Besuch!«, rief er in die Küche.
Bald saßen sie alle zusammen um einen Tisch herum, der kaum genug Platz für die vier Tassen und die bauchige Teekanne bot. Ihr Deckel hatte einen Sprung, er wurde nur vom Tropfenfänger zusammengehalten. Leni sah sich um. Die wenigen Möbel der Pohls schienen zusammengetragen zu sein, die Vorhänge waren verschlissen, ein paar schöne Landschaftsbilder schmückten die Wände, und neben einem der hohen Fenster stand ein Flügel. Von der Decke blätterte der Putz.
»Du hättest doch nicht extra herkommen müssen«, sagte Hans, der müde aussah.
»Ich wollt sowieso was in München erledigen«, erwiderte Leni, und Frau Pohl schenkte den Tee ein. Sie hatte neben ihrem Mann auf dem Sofa Platz genommen und hielt seine Hand. Genau wie er war auch sie adrett gekleidet, ein wenig aus der Mode, aber farblich auf ihn abgestimmt. Ihr silbernes Haar schimmerte gepflegt.
»Und da hat die Mutter dich allein fahren lassen? Unter der Woche?«, fragte Hans.
»Ich hab ihr gesagt, dass ich mir anschauen will, wo du jetzt wohnst, und dir dein Geld bringe.« Wie gern hätte sie Hans von ihren Plänen und dem verunglückten Vorstellungsgespräch erzählt, aber dann hätte sie vor seinen Vermietern, die sie kaum kannte, zugeben müssen, dass sie ihre Mutter belogen hatte.
Von der Decke rieselte der Putz in Herrn Pohls Teetasse. Leni sah nach oben und entdeckte einen Wasserschaden, der die Aufhängung des Kristallleuchters dunkel umrahmte.
»Stellen wir uns vor, es wäre Zucker«, sagte Herr Pohl.
»Wird er halten, Theo, was meinst du?« Seine Frau blickte unschlüssig zum Leuchter hinauf.
»Unser Hans hier sagt, der Balken, an dem er hängt, ist tadellos. Für alles andere kann ich nicht sprechen, Hildchen, aber der Balken hält.« Die Pohls nickten sich aufmunternd zu.
»Wir lassen Sie beide jetzt mal allein«, meinte Herr Pohl wenig später und stand auf. »Bleiben Sie und plaudern Sie noch miteinander.«
»Danke, des is sehr nett, Herr Pohl«, sagte Leni.
»Aber rutschen Sie ein bisschen nach links, Fräulein Landmann, sonst kann ich nicht für Ihre Unversehrtheit garantieren.«
»Theo, du machst der jungen Dame Angst!«
»Nicht doch, Hildchen, das Fräulein hat starke Nerven, das sehe ich doch. Genau wie du.«
Ehe Herr Pohl die Türe hinter sich zuzog, sah Leni noch, wie er seine Frau im Flur küsste und sie ihm die Krawatte richtete.
»Übrigens, hier ist dein Geld, Hans«, sagte sie zu ihrem Bruder und gab ihm ein Kuvert. »Zweihundertvierzig Mark, mehr bekommen wir diesmal net zamm.«
»Sag der Mutter danke von mir.«
»Sag’s ihr am Wochenende selber.«
»Leni, ich kann nicht kommen, ich muss lernen. In vier Wochen fangen die Semesterferien an, wir haben Prüfungen.«
»Sind die sehr schwer?«
»Ja.«
»Bald hast du’s ja geschafft«, versuchte Leni ihren Bruder aufzumuntern, »und dann bist du ein richtiger Arzt.«
Hans nickte und schwieg. »Weißt du noch, Leni, früher im Baumhaus, da haben wir uns immer alles erzählt«, sagte er nach einer Weile und zündete sich eine Zigarette an.
»Gibt’s denn was, des du mir erzählen magst?«
»Nein …«, kam es zögernd. »Aber ich habe das Gefühl, dass dir etwas auf der Seele liegt. Du bist doch nicht nur meinetwegen nach München gekommen, oder?«
Leni schüttelte den Kopf.
»Und warum dann?«
»Ich hab mich im Salon Keller am Hofgarten für eine Stelle als Friseuse beworben.«
»Heimlich?«
»Ja, erst mal schon, falls es nicht klappt.« Und das tat es ja wohl eindeutig nicht!
Leni stand auf und ging durchs Zimmer. Sie sah sich die Fotos an, die auf dem Flügel in Silberrahmen standen – Herr und Frau Pohl auf einem Faschingsball, sie als Ägypterin verkleidet und er in einer römischen Toga. Das Bild musste an die dreißig Jahre alt sein. In einem Regal entdeckte sie Trophäen von Tanzwettbewerben aus den Zwanzigerjahren und stapelweise Notenhefte.
»Is er Musiker, der Herr Pohl?«, fragte sie und strich über den glänzenden Flügel.
»Ja, Pianist. Er hat vor dem Krieg in allen großen Konzerthäusern der Welt gespielt und war lange im Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz. Seine Frau hat dort getanzt, so haben sie sich kennengelernt.«
Herr Pohl klopfte. »Entschuldigung, störe ich?«
»Nein«, sagte Hans. »Meine Schwester hat gerade Ihren Flügel bestaunt. Würden Sie vielleicht etwas für sie spielen?«
»In Wahrheit spielt man immer nur für sich selbst«, antwortete der alte Herr erfreut über Hans’ Bitte und öffnete die Fenster.
Draußen war es wunderbar warm. Ein Bilderbuchtag, den viele Studenten im Englischen Garten und an der Isar anstatt in ihren Hörsälen verbrachten. Herr Pohl setzte sich an den Flügel, griff in die Tasten und spielte Summertime, während seine Frau in der Tür stehen blieb und ihn betrachtete. Die Klänge erfüllten den ganzen Raum und schwebten in den Hof hinaus.
»Welche Musik hören Sie, Fräulein Landmann?«, fragte er am Ende des Stücks.
»Leni liebt Sinatra«, antwortete Hans für sie.
»Ah …«
Hans’ Vermieter horchte in sich hinein, fand die gesuchte Melodie und ließ seine Hände wieder über die Tasten wandern. »April in Paris«, erklärte er, denn ohne die Orchestrierung und Sinatras Stimme war das Lied kaum zu erkennen. »Hildchen und ich sind über die Champs-Élysées spaziert, die Allee der elysischen Felder. Erinnerst du dich, mein Herz?«, fragte er seine Frau. Sie stand noch immer im Türrahmen, lächelte verträumt und nickte. »Das erste Grün an den Bäumen und du in deinem gelben Kleid …« Jeder Ton schien Leni eine Liebeserklärung zu sein, jeder Anschlag der Tasten barg für die beiden eine Erinnerung.
»Danke, Herr Pohl, das war wunderschön«, sagte sie, als der alte Mann den Deckel über den Tasten schloss.
»Vielleicht noch eine Tasse Tee?«, bot seine Frau an.
»Nein, danke, Frau Pohl, ich muss leider schon gehen, damit ich meinen Zug net verpass. Ich sperr um zwei unser G’schäft wieder auf, wenn die Mama die Leut im Krankenhaus frisiert.«
»Ich bringe dich zum Bahnhof«, sagte Hans.
Leni setzte sich im Damensitz auf den Gepäckträger seines alten Fahrrads und hielt sich an ihm fest. So wie früher, den Berg hinunter und nach Dachau zum Zauner in die Augsburger Straße, um eine neue Tafel für die Schule zu kaufen. Hans hatte seine immer wieder zerbrochen, wenn er und der Rudi im Winter auf ihren Schulranzen den verschneiten Hügel hinuntergesaust waren.
Auf dem Weg zum Marienplatz staunte Leni über die Kranlandschaft und wie sich in dieser Stadt in jede noch so kleine Baulücke ein provisorischer Laden drückte. Das ist wie in unseren Gemüsebeeten, dachte sie, da kommt auch in jeder Furche etwas hoch, das leben will