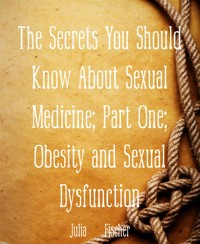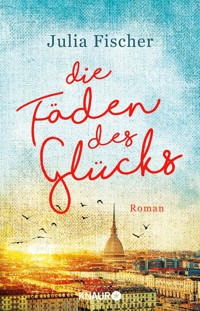Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Audio Media Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Edle Pralinen, ein Familiengeheimnis und eine bezaubernde Liebe: ein Roman für alle, die Italien und den Duft von Schokolade lieben Die Haselnussplantage ihrer Familie in den Hügeln von Alba ist Ellas ganze Welt. Sie ist erst fünf, als ihre Mutter stirbt und ihr nur ein altes, selbstverfasstes Pralinenrezeptbuch hinterlässt. Dieses Rezeptbuch enthält die Geschichte eines Lebens in Gramm und Millilitern - und den Anfang eines Traums. Als Ella ihr Zuhause verliert und in der historischen Altstadt eine Chocolaterie eröffnet, taucht ein Fremder bei ihr auf, der gegen ihren Willen eine leise Unruhe in ihr weckt. Ist dies aber der richtige Zeitpunkt, sich zu verlieben? Julia Fischers warmherziger Italien-Roman führt den Leser ins Piemont - und ins Herz einer dramatischen Familiengeschichte! Für die Leserinnen von Nina George und Nicolas Barreau
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Julia Fischer
Der Geschmack unseres Lebens
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein zauberhafter Italien-Roman, aus dessen Seiten der Duft nach Schokolade, edlen Weinen und den seltenen weißen Trüffeln des Piemont aufsteigt:
Die Pralinen-Rezepte ihrer früh verstorbenen Mutter und ihr Elternhaus auf der Haselnuss-Plantage in den Hügeln über Alba im wunderschönen Piemont, das ist Ellas ganze Welt. Ihre Mutter Francesca starb, als Ella fünf Jahre alt war, und ein streng gehütetes Geheimnis umgibt ihren Tod. Ein Geheimnis, das den Vater in stiller Trauer erstarren ließ und Ellas Bruder Danilo schon als Teenager von zu Hause forttrieb.
Umso hingebungsvoller bereitet Ella in ihrer Chocolaterie süße Köstlichkeiten nach den Rezepten ihrer Mutter zu, 32 Pralinen-Sorten hat sie im Sortiment, eine für jedes von Francescas Lebensjahren.
Bis Ellas Leben noch einmal kräftig durcheinandergewirbelt wird und sie entscheiden muss, wer sie wirklich sein möchte: Denn Danilo kehrt nach Alba zurück, um Ella zu erzählen, was er über den Tod ihrer Mutter weiß. Und die geliebte Haselnuss-Plantage fällt an die Bank. Ausgerechnet ein Fremder erdreistet sich, bei der Zwangsversteigerung das einzige Angebot abzugeben. Und ein Fremder betritt eines Morgens Ellas Chocolaterie, um ihr eine Zusammenarbeit vorzuschlagen: Er hat nämlich eben eine Haselnuss-Plantage erworben …
Inhaltsübersicht
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
Epilog
Zum Buch
Danksagung
Literaturliste
Für meinen Bruder und Dich, Max, mein Großer
»In starkem Grad besitzt einer nur, was ihm fehlt, da er’s suchen muss.
Im Suchen lebt er. Alle suchen etwas.«
Robert Walser, Schwäche kann eine Stärke sein
Prolog
La vita è una torta di compleanno. Una torta di compleanno«, sagte Francesca immer wieder – das Leben ist ein Geburtstagskuchen – und schlug mit schnellen routinierten Bewegungen aus dem Handgelenk den Eischnee schaumig. »Du nimmst dir ein Stück, Stück um Stück, Stück um Stück.« Die Küche des dreihundert Jahre alten Landsitzes in den Hügeln des Piemont am Stadtrand von Alba glich einem Schlachtfeld: teigbeschmierte Rührschüsseln, Konditorenmesser und schokoladenbenetzte Abkühlgitter stapelten sich auf den Arbeitsflächen, abgestoßene Kuchenformen, schwer und emailliert, Spritzbeutel, Pinsel und Backpapier. Die Knethaken der Küchenmaschine arbeiteten auf höchster Stufe, feiner Mehlstaub tanzte in der Luft, und Radio Cuneo Nord spielte in voller Lautstärke La Isla Bonita. Auf dem Herd kochte gerade mit lautem Zischen die Milch über. Francesca zog den Topf von der Kochplatte und wischte sich mit ihrer Küchenschürze den Schweiß von der Stirn. Der Spätsommer brachte keine Abkühlung, und der mächtige Ofen war schon seit Stunden angeheizt … oder waren es Tage? Die Zeit war eine relative Größe, nicht wie Milch in einem Messbecher oder Mehl auf einer wackligen Waagschale. Die Zeit dehnte sich aus und ergoss sich über jeden Topfrand, sie verdampfte, zerstob.
Francescas Gedanken sprangen umher wie die Reste der Milch auf dem glühenden Herd. Runde Kügelchen, die munter auf und ab hüpften, bis sie sich unschön einbrannten. Ein eiliger Blick in die selbst verfassten Rezepte, und die Zeitschaltuhr am Backofen rasselte schleppend. Die junge Frau zog das Blech mit dem Biskuitteig heraus und öffnete die Tür zum Garten, dem Stückchen verdorrter Wiese, an das die Plantage anschloss, die den ganzen Hügel bedeckte. Es war schwül, die Luft schien aufgeladen. Sie war wie sie und nahm den Ausbruch vorweg. Francesca sah die Schatten der Haselnussbäume, Reihe um Reihe auf elf Hektar Grund, und dachte an den Tag zurück, an dem sie mit zwei Koffern und dem Geruch des Meeres im Haar hier gestrandet war – schaumgeboren und an Land gespült. Jetzt hing das herbe Aroma der Nüsse in ihren Kleidern.
Senzafarina – ohne Mehl –, die torta di nocciole wurde nur mit Eiern und den Tonda Gentile del Piemonte gebacken, den besten Haselnüssen der Welt. Francesca gab Muscovado-Zucker dazu, der aus Mauritius kam und diese feine Karamellnote hatte. Fühlte sich an wie feuchter Sand. Sie überlegte, den Küchenboden damit zu bestreuen, einen Strand aus Südseezucker anzuhäufen und Ellas Geburtstag am Meer zu feiern. Aber sie hatte nur noch zwei kleine Säcke in der Vorratskammer. Es reichte gerade, um den langen Esstisch zu dekorieren. Sie verrührte Eigelbe und Zucker und gab die frisch gemahlenen, gerösteten Nüsse dazu. Perfekt!
Dein Leben ist ein Geburtstagskuchen, mein Kind, schrieb sie kurz darauf in ihr ledergebundenes Rezeptbuch, doch kaum einer würde es lesen können. Weil sie zu langsam waren, alle! Viel zu langsam in ihrem Denken und Fühlen und Tun, viel zu träge! Nicht wie sie, die sie auf Sternschnuppen reiten konnte, die Sonne im Bauch und ihr Glühen in den Gliedern.
Im Radio liefen jetzt Nachrichten, und Francesca sang ein altes Schlaflied: »Ninna nanna, coccolo della mamma« … War es schon Zeit, die Kinder ins Bett zu bringen? Sie mussten doch ausgeschlafen sein, sie wollten schließlich feiern: das Licht und das Leben!
Als Francesca Ellas großen Bruder Danilo vor sieben Jahren geboren hatte – ihr erstes Kind, das sie für immer an dieses Leben band –, da war die Dunkelheit über sie hereingebrochen. Monatelang. Angelina, die strenge Hebamme mit den festen Händen, hatte ihr damals mit dem Baby geholfen und Chiara, die mit den Erntehelfern aus Kalabrien gekommen war, so wie sie. Denn an der Stiefelspitze gab es keine Arbeit, und die ’Ndrangheta regierte das Land. Aber man sprach nicht über die Mafia, und das Verschwinden verschwieg man auch.
Francesca schob die Erinnerung beiseite, hob den Eischnee unter, füllte die luftige Kuchenmasse in eine Springform und stellte sie in den Ofen. Die ganze Küche war erfüllt vom Duft der Schokoladen und gerösteten Nüsse, dem Marzipan und Nugat und dem Aroma der feinen Marmeladen, die sie zwischen die Schichten der Biskuitteige strich. »Stück um Stück«, wiederholte sie ihr Mantra, um es nicht zu vergessen. Sie sollte es aufschreiben, in ihrem Buch, zu den Rezepten, es war wichtig.
Die Küchenuhr schlug zur vollen Stunde, ihr Pendel schubste die Zeit in steter Bewegung vor sich her. Tick-tack, ticktack, es war erst drei und doch schon dunkel. Francesca sah hinaus und wunderte sich. War es nicht eben noch Mittag gewesen? Als sie den Garten für Ellas Feier dekoriert und ihre Geschenke überall verteilt hatte? Die Tische unter die Haselnussbäume gestellt und Stühle hinausgetragen? Jetzt war es plötzlich Nacht geworden, und es donnerte weit entfernt, aber das Wetter würde vorbeiziehen. Oder nicht? Sie stellte sich vor, wie die Sonnenschirme davonflogen, kleine bunte Inseln im Wind, und musste lachen. Sie würden sich in die Luft schrauben wie Dorothys Farmhaus in Der Zauberer von Oz. Das Farmhaus in Kansas, das ein Tornado mitriss und bei seiner Landung im Land der Munchkins die böse Hexe des Ostens unter sich begrub. Das Märchen war zum Kriegsende mit den Amerikanern nach Italien gekommen. Francescas Mutter hatte ihr das Buch geschenkt und Francesca die Abenteuer der kleinen Dorothy auf ihrem Weg in die funkelnde Smaragdstadt wieder und wieder gelesen. Dem Mädchen mit den silbernen Schuhen, das Zeit und Raum überwand und am Ende seiner fantastischen Reise nach Hause zurückfand. Das Gefühl, in einer fremden Welt aufzuschlagen, kannte sie selbst, einer Welt, die jeder Realität entbehrte und sich doch echter anfühlte als die Wirklichkeit der anderen.
»Du nimmst dir ein Stück, Stück um Stück.« Francesca schrieb es auf die Tischplatte, malte kryptische Zeichen in den Mehlstaub, der das dunkle Holz überzog. Das war gut, so konnten ihre Gedanken nicht so schnell durch die feinen Ritzen der Dielen und Türspalte schlüpfen. Sie waren einfach zu beweglich, unstet und immer auf Reisen. Drehten sich, schraubten sich in himmelhohe Höhen und stürzten dann ab wie Dorothys Farmhaus.
Die Zeitschaltuhr rasselte schon wieder, die torta di nocciole musste aus dem Ofen. Ein Rezept aus der Familie ihres Mannes.
Als Philippe Donati im Morgengrauen nach Hause kam – er hatte die ganze Nacht über einen Streit mit seiner jungen Frau hinuntergespült –, war die Küche bereits aufgeräumt und bis ins kleinste Eck geputzt. Francesca saß am langen Esstisch, der jetzt mit einer dicken Schicht Zucker bestreut war, und es standen Pralinenschalen und Tortenplatten darauf: Drei verschiedene Schokoladenkuchen gab es, Biskuitrollen mit Heidelbeer-Mandel- und Preiselbeersahne, eine Mascarpone-Feigentorte, einen Panettone, die torta di nocciole und Berge von Waffeln. Ein Blick ins Schlaraffenland – la cuccagna. Sie hatte die Kuchen mit Schaumküssen und Gummibärchen garniert, bunten Schokolinsen und eingelegten Kirschen. Cocktailschirmchen schmückten die Anmutung eines Strandes. Philippe ging zum Radio und stellte es ab. Francesca konnte unmöglich die Kinder hören, wenn sie nach ihr riefen.
Sie sah ihn an und strahlte, betrachtete ihr Werk und sagte: »Stück um Stück, Philippe. Du verschlingst dein Leben Stück um Stück, verstehst du, weil es so gut schmeckt und du es auskosten willst, aber es verschlingt dich auch.« Sie wartete auf seine Zustimmung, aber sie kam nicht, denn er verstand sie kaum. Sie sprach viel zu schnell, und ihre Worte machten keinen Sinn. Etwas brachte ihr Blut zum Kochen, als würde Brandbeschleuniger durch ihre Adern fließen, und jeder zündende Einfall glich einer Explosion.
Draußen begann es zu regnen. Philippe sah im ersten Morgenlicht neue Kleider in den Haselnussbäumen – aufgesteckt wie bunte Fahnen –, Schuhe und Strümpfe. Francesca hatte sie zusammengebunden und über die Äste gehängt. »Hast du noch mehr Geschenke für Ella gekauft?«, fragte er mit unterdrückter Wut, die ihm die Luft abschnürte.
»Ja, ciccino, Bücher und ein Fahrrad und ein Puppenhaus mit einer richtigen Küche. Dort können wir zusammen backen, in Ellas eigenem kleinen Haus. Aber du musst es gut festmachen, es darf nicht davonfliegen, hörst du!«
»Was?«
»Das Haus, es darf nicht davonfliegen. Siehst du denn nicht, dass ein Sturm aufzieht?« Francesca strich sich eine dunkle Haarsträhne aus dem erhitzten Gesicht. Sie sah aufgelöst aus, ihre zarte Statur wirkte zerbrechlich. Philippe machte sich Sorgen, sie aß viel zu wenig und schlief kaum noch. Verzweifelt schlug er mit der flachen Hand auf den Tisch. Der Zucker rieselte auf den frisch gewischten Boden, die Cocktailschirmchen zitterten, und Francesca erschrak. Jetzt griff er nach ihren Armen, zog sie daran hoch und schüttelte sie. »Du bist verrückt, Francesca, hörst du? Verrückt!«, schrie er sie an. »Womit hast du das denn alles bezahlt? Kannst du mir das sagen?« Sie holte seine Kreditkarte aus ihrer Schürzentasche und zeigte sie ihm. »Wir haben Schulden, Francesca!«, rief er aufgewühlt.
»Aber wir ernten doch gerade«, erwiderte sie verständnislos und erzählte dann aufgeregt, wen sie alles zu Ellas Geburtstagsfeier eingeladen hatte. »Wir müssen feiern, Philippe«, sagte sie beschwörend, »bevor wieder ein Stück vom Kuchen fehlt. Mit den Kindern aus der Stadt, unseren Nachbarn, den Freunden …«
»Freunden?!« In welcher Welt lebte sie denn nur? »Wir haben keine Freunde«, warf er ihr vor, »und es werden auch keine anderen Kinder kommen. Niemand wird kommen!« Niemand. Weil sie hinter ihrem Rücken redeten und Francesca für genauso verrückt hielten, wie er es tat. Nur dass er sie liebte, heillos und ohne Hoffnung. Ella würde allein an ihrer Geburtstagstafel sitzen, nur mit ihrem Bruder und einem Dutzend Torten und Pralinen zwischen dem irrsinnigen Ausverkauf einer Kinderboutique und eines Spielzeugladens. Diese Übersprunghandlungen ruinierten ihn. Ihre spontanen Einkäufe und unvorhersehbaren Ausflüge, wenn sie mit den Kindern ins Auto stieg und ans Meer fuhr, immer wieder ans Meer. Beim ersten Mal hatte sie ihm noch einen Zettel auf dem Küchentisch hinterlassen: »Ich fahre nach Hause, alles wird gut.« Gott sei Dank war niemand verletzt worden, als sie völlig übermüdet von der Straße abgekommen und von den carabinieri aufgegriffen worden war. Philippe war vor Angst fast umgekommen. Und jetzt fühlte er sie wieder, diese Ohnmacht und das Entsetzen. Er wusste nicht, wie er es aufhalten konnte, wie er sie aufhalten konnte.
Die Bank hatte ihm geschrieben, er kam seinen Kreditverbindlichkeiten nicht mehr nach. Er würde Land verkaufen müssen, das er nicht entbehren konnte – noch mehr Land, das seine Familie über Generationen bestellt hatte, Krieg und Krankheiten zum Trotz.
Philippe ging in die Plantage hinaus, stieg auf die Tische und holte die nassen Kleider und Schuhe aus den Bäumen. Der Regen wurde stärker. Er warf Ellas Geschenke auf einen Haufen: ihr Rad, die vielen Päckchen in buntem Papier mit kunstvollen Schleifen, die Kleider und das Puppenhaus. Nass bis auf die Haut, trat er danach, bis eine aufgeweichte Sperrholzwand barst und Francesca aufschrie und weinte. Sie rannte ins Schlafzimmer hinauf und packte in Eile ihren Koffer. Dann lief sie, noch immer barfuß und in der Küchenschürze, zu ihrem Wagen hinter dem Haus. »Ich verlasse dich!«, schrie sie unter Tränen. »Diesmal verlasse ich dich wirklich, und die Kinder nehme ich mit!« Sie hatte ihnen doch noch kein Schlaflied vorgesungen …
Philippe kam ihr nach. Sie standen jetzt an der Auffahrt, und er versperrte ihr den Weg zurück ins Haus. »Dann geh doch! Glaubst du nicht, wir wären ohne dich besser dran?« Ihre Drohungen und leeren Versprechen konnte er schon nicht mehr zählen.
»Ich will nur noch die Kinder holen.«
»Keinen Schritt«, entgegnete er kühl, »die Kinder bleiben hier.«
Francesca schlug nach ihrem Mann, und er schlug unvermittelt zurück. Zum ersten Mal in all den Jahren und viel zu fest. Sie fiel zu Boden und sah ihn fassungslos an. An einem Fenster im ersten Stock bewegte sich ein Vorhang.
»Dino!«, rief Francesca hinauf, so laut sie konnte. »Dino!« Doch das Prasseln des Regens und der Wind verschluckten jeden Ton. Es donnerte und blitzte, die Welt schickte sich an, unterzugehen.
»Steig in den Wagen, sonst weiß ich nicht, was passiert«, sagte Philippe gefährlich ruhig und erkannte sich selbst nicht wieder. Alles um ihn brach zusammen. Da kroch sie wie ein verwundetes Tier zu ihrem Auto, setzte sich hinters Steuer und raste den Hügel hinunter.
Ella schlief noch, als ihre Mutter am Morgen ihres fünften Geburtstags ein grünes Leuchten am stürmischen Himmel entdeckte und beschloss, ihm bis in die Smaragdstadt zu folgen.
1
Der Fliesenspiegel an der Wand hinter der Ladentheke war schön geworden. Ella hatte ihn selbst angebracht, um sich das Geld für den Handwerker zu sparen. Die gleichen blau-roten Ornamente, die auch in der Küche ihres Elternhauses über der Spüle verlegt waren. Sie hatte die überzähligen Kacheln im alten Weinkeller gefunden. Den großen Herd hatte sie auch mitgenommen. Er stand jetzt in ihrer Backstube gleich neben der Pralinenküche im Souterrain des historischen Eckhauses, dessen dicke Wände im Sommer die Hitze abhielten. Casa medioevale las man auf der Steintafel an der Fassade – Haus aus dem Mittelalter – und Torre medioevale am Turm nebenan. Doch von den einstigen Geschlechtertürmen stolzer adeliger Familien, die Alba seinen Beinamen eingebracht hatten – die Stadt der hundert Türme –, war nur noch eine Handvoll übrig geblieben. Sie beherbergten jetzt Wohnungen und Läden.
Gestern erst war die lange Theke geliefert worden, Ella konnte also bald mit dem Backen und Pralinenmachen beginnen. Ihre Hände in feines Kakaopulver graben, dem leisen Rieseln des Zuckers lauschen und feine Teige mit Nussmehl bestäuben, bis sich ihre Gedanken beruhigten, ihre Sorgen in warme Schokoladenbäder tauchten und weichem Biskuitduft wichen. Ihre Chocolaterie sollte Anfang September öffnen, wenn die Albesi aus dem Urlaub zurückkehrten. Noch vor dem Ende der Schulferien und dem großen Touristenansturm zur Weinlese und der anschließenden Trüffelmesse.
Ein Mann mittleren Alters stand vor dem Geschäft und suchte nach der Hausnummer. Er sah das frisch gemalte Ladenschild über dem Schaufenster zur Via Cavour – La Cuccagna stand darauf, Schlaraffenland – und trat ein. »Signorina Donati? Ich hab Ihre Lieferung hier«, sagte er und deutete auf eine Sackkarre vor der Tür, die mit Kartons beladen war. Die Schokoladenlieferung: Maracaibo, Arriba, Bolivia und Criolait, Java und Edelweiß, von dunkel und bitter über mild und milchig bis hell und unconchiert. Nur ein kleiner Teil der Zutaten, die Ella brauchte, neben Kakaobutter, Nugat und Marzipan. Vieles musste sie frisch besorgen. Butter, Eier und Sahne etwa oder die Haselnüsse, die die Nussbauern der Region soeben geerntet hatten. Das Land rund um Alba war ein einziger Haselhain, Hügel um Hügel, Senke um Senke, so weit das Auge reichte. Wo kein Wein angebaut wurde, wuchsen die genügsamen Nüsse.
»Helfen Sie mir, die Kartons in den Keller zu tragen!«, erwiderte Ella, und ihre Bestimmtheit überraschte den Mann. Er betrachtete die zierliche kleine Person, ihr kastanienbraunes Haar, die lebendigen dunklen Augen, und seine Laune hob sich.
»Selbstverständlich«, sagte er und richtete den Kragen seines grauen Arbeitskittels, »und ich kann auch beim Auspacken zur Hand gehen, bellezza.« Ella schickte ihn zur Abkühlung alleine hinunter und wartete, bis er mit den leeren Verpackungen wieder heraufkam. »Das wird ein feiner Laden, denk ich«, versuchte der Mann sich erneut an einem Gespräch. Ella wischte gerade durch die Regale und polierte das Glas der neuen Theke. »Eine Konditorei?«
»Eine Chocolaterie. Und Kuchen«, gab sie knapp Auskunft und stellte fest, dass sie sich auf ihre neue Aufgabe freute. Die Selbstständigkeit war die richtige Entscheidung gewesen, auch wenn sie sich zuerst bei verschiedenen Bäckereien und Confiserien in der Gegend um eine Stelle beworben hatte. Doch ihre mangelnde Berufserfahrung hatte ihr immer wieder Absagen eingebracht, noch bevor sie sich persönlich hatte vorstellen können. Dabei machte sie sich in der Praxis so viel besser als auf dem Papier.
»Gleich gegenüber vom Bäcker?«, fragte der redselige Lieferant und blickte skeptisch in die Auslage der Panetteria Barbieri hinüber.
»Gleich gegenüber«, bestätigte Ella ungerührt. »Ich habe dort gelernt, und ihre Kuchen sind gerade mal Durchschnitt, Touristenware, nichts Besonderes. Die können mit meinen nicht mithalten.« Sie gab sich selbstbewusst, auch wenn ihr eine innere Stimme sagte, dass ihrer torta dinocciole noch eine entscheidende Zutat fehlte. Nur eine kleine Prise … tja, wovon? Gehackter Kakao- oder Kaffeebohnen, die den Röstgeschmack der Nüsse besser hervorhoben? Ein Schuss Haselnusslikör oder Malzzucker statt des Muscovado? Im Rezeptbuch ihrer Mutter stand nichts darüber, nur unleserliches Gekritzel, eingestreute Zitate und eine Passage aus dem Zauberer von Oz unter den Honigtrüffeln: »Die Sonne und der Wind hatten auch sie verändert. Sie hatten den Glanz aus ihren Augen genommen und nur ein nüchternes Grau zurückgelassen.« Ella hatte das Märchenbuch, aus dem ihre Mutter ihnen früher oft vorgelesen hatte, wie einen Schatz gehütet – genau wie das Puppenhaus mit der ausgebesserten Wand. Es stand jetzt in ihrer Auslage. Sie würde in jedem seiner sechs Zimmer eine andere Pralinensorte präsentieren und im Dachzimmer unter dem Giebel die torta di nocciole, die nicht so viel Platz brauchte wie die üppigen Torten oder der hohe Panettone.
»Sie sind ein mutiges Mädchen«, sagte der Mann, der noch immer in Ellas Laden herumstand. »Mutig und verdammt hübsch, wenn ich das sagen darf.«
»Sie dürfen mir Ihre Rechnung geben«, erwiderte Ella und seufzte. Schon wieder so einer, der sie niedlich fand! Ihr Vermieter war auch darauf hereingefallen, als sie mit einem unschuldigen Lächeln die Nebenkosten verhandelt und eine Mietpreisbindung herausgeschlagen hatte, weil sie jeden Cent umdrehen musste, seit sie den Kredit für die Ladeneinrichtung aufgenommen hatte.
»Scusi, Signorina«, entschuldigte sich der Lieferant und zog einen Zettel vom Klemmbrett. Ella nahm ihn entgegen, bedankte sich und griff nach ihrem Eimer.
Die Ladenglocke schlug erneut an, und ihre Kinder stürmten herein. »Fahren wir jetzt zu den Großeltern, mamma?«, fragte Lauro.
»Nonnina Francesca besuchen?«, ergänzte Lisa. »Und nonno Philippe?«
»Ihre zwei?«, fragte der Mann, der sich von Ella nicht losreißen konnte, und sie nickte. »Wie alt seid ihr denn?«
»Zehn«, erklärte Lauro etwas verlegen und sah zaghaft zu seiner Mutter hinüber. Ein scheuer Blick, den Ella von früher kannte, lichtblau und fragend, unbeantwortet.
»Und du, kleine Signorina?«, wollte der Lieferant von Lisa wissen.
»Ich bin auch zehn«, antwortete sie bestimmt, »wir sind doch Zwillinge!«
»Aber ihr seht euch gar nicht ähnlich. Und eure Mutter ist doch höchstens …«
»Zweiunddreißig und vergeben«, unterbrach ihn Ella und überlegte, künftig einen Ring anzustecken, um solchen Avancen zu entgehen. Das Flirten lag ihr nicht, nicht mal mit Männern, die sie attraktiv fand.
»Accidenti!«, rief der Mann erstaunt aus, verließ den Laden und lief mit seiner Sackkarre in Mahesh Bai hinein, der gerade in der schmalen Seitenstraße zwischen Ellas Geschäft und seinem Restaurant, dem Samsara, die Tische für das Mittagsgeschäft eindeckte. Albas Altstadt mit den schönen roten Backsteinfassaden war Fußgängerzone, nur der Lieferverkehr rollte am Morgen die gepflasterten Straßen entlang. Die Ladenbesitzer stellten ihre Waren deshalb vor den Geschäften aus, und die zahlreichen Restaurants, die mit piemontesischen Spezialitäten um Gäste warben, breiteten sich bis weit in die Nacht hinein lautstark und raumgreifend rund um ihre Lokale aus. Das Vincafe in der Via Vittorio Emanuele, der Hauptader der Stadt, die die Albesi nur Via Maestra, also Hauptstraße, nannten, baute seine Tische und Stühle sogar bis zur Chiesa di Santa Maria Maddalena hinunter.
Mahesh winkte Ella und den Zwillingen zu und lächelte verträumt. Er war der schönste Mann, den sie je gesehen hatte. Etwa in ihrem Alter, mit mauretanisch-indischen Wurzeln, eine männliche Version der Scheherazade aus Tausendundeiner Nacht. Er trug sein schwarzes Haar schulterlang und seine Hemden gerade so weit aufgeknöpft, dass die Sehnsucht, ihn zu berühren, selbst satte Herzen streifte wie ein heißer Wüstenwind. Seit Ella ihren Laden renovierte, gönnte sie sich Maheshs Anblick und genoss es, wenn er zwischen seinen Tischen hindurchtanzte, Tischtücher aufschlug und Gläser zurechtrückte, ehe er in seiner Küche verschwand. Und wenn sie nachts nicht schlafen konnte, weil es in der Wohnung über ihrem Laden viel zu heiß war, dann schlich sie zu ihm hinunter, saß mit ihm in seinem mäßig frequentierten Restaurant und probierte seine regionalen Köstlichkeiten mit arabisch-indischem Einschlag. Die alteingesessenen Albesi mieden Maheshs Lokal, das er erst vor zwei Jahren von einem einheimischen Wirt übernommen hatte – der Ausländer, der hinduistische Götter anbetete und einen deutschen Wagen fuhr! Matilda Barbieri, die Frau des Bäckers von gegenüber, unterstellte ihm sogar eine Affäre mit Ella und erzählte jedem, dass Mahesh in Wahrheit Drogengelder aus dem Opiumanbau seiner indischen Familie wusch. Sie hatte in einer Illustrierten einen Artikel über süchtige Papageien gelesen, die in Madhya Pradesh Schlafmohnfelder plünderten, und ihre Schlüsse gezogen.
»Fahren wir?«, fragte Lauro noch einmal und strich sich durchs weizenblonde Haar. Eine Geste, die Ella an ihren Bruder erinnerte. Danilo und sie hatten viel zu früh Verantwortung übernommen, den Vater auf der Plantage unterstützt und im Haushalt geholfen. Aber trotzdem war alles vor die Hunde gegangen, das Land, das Haus und ihr Vater auch. Ella hatte es nicht aufhalten können, mit keiner Anstrengung der Welt. Sie hatte bis zum Schluss gekämpft. Allein, denn ihr Bruder war mit achtzehn Jahren eingezogen worden und hatte sich zum Wehrdienst verpflichtet. Er kam zum 4º Reggimento Alpini Paracadutisti, dem Fallschirmjägerregiment, und zog in einen fremden Krieg. Manchmal hatte er Ella geschrieben, und sie hatte vor Kummer geweint.
»Habt ihr die Wohnungstür oben abgeschlossen?«, fragte sie ihre Kinder und räumte den Putzeimer mit lautem Scheppern weg. Es war erst Mittag, aber für heute hatte sie genug getan. Das war schließlich ihr Geburtstag, und den würde sie nicht mit Putzen verbringen.
»Klar«, erwiderte Lauro.
»Und wo sind die Schlüssel?«, fragte Ella.
»Die hab ich dir grade dahin gelegt.«
»Wohin?«
»Na, da!« Lauro deutete auf die Ladentheke, aber die war leer und glänzte vorbildlich. Ella blickte skeptisch. »Hab ich!«, beharrte Lauro, und sie versuchte, sich zu erinnern, wann sie sie weggenommen hatte. Als der Lieferant gegangen war vielleicht und sie kurz in einen orientalischen Traum eingetaucht war. Das war doch zum Aus-der-Haut-Fahren! Ständig entwickelten die Dinge ein Eigenleben, entzogen sich wie von Geisterhand – Geldbörsen, Schlüssel, Schmuck –, ja, ganze Lebensentwürfe kamen ihr abhanden. »Du wirst noch einmal deinen Kopf verlieren, mein Mädchen«, hatte ihr Vater oft zu ihr gesagt, dabei hatte sie um ihr Herz immer mehr Angst gehabt.
»Im Putzeimer«, rief Lisa, die schon angefangen hatte zu suchen, »du hast sie mit dem Wischlappen reingeworfen.«
Ella steckte die Schlüssel in ihre Handtasche. »Blumen?«, fragte sie in die kleine Runde.
»Müssen wir noch kaufen«, erwiderte Lisa. »Aber wir haben ein Bild für die Großeltern gemalt.« Sie kramte ein Blatt aus ihrer Tasche, faltete es auf und zeigte es ihrer Mutter. Ein Hügel mit Haselnussbäumen und ein rotes Haus mit grünen Fensterläden obendrauf.
»Das ist wunderschön«, sagte Ella betreten, und Lauro wischte sich mit einer trotzigen Bewegung eine Träne vom Gesicht.
2
Ella fuhr mit ihrem klapprigen alten Fiat Punto über den Corso Piera Cillario am gewaltigen Ferrero-Werk vorbei. Der Duft der pasta gianduja, des berühmten Nutella, das hier produziert wurde, zog auch heute wieder durch die lauten, geschäftigen Straßen der Stadt. Doch entlang der Schleife des Tanaro, nur Minuten vom Zentrum entfernt, wurde es stiller, und Ella erkannte die ersten Felder. Im Häusermeer der Altstadt, in der sie jetzt mit ihren Kindern wohnte, gab es kein Grün. Wenn die Sehnsucht nach ihrem Elternhaus sie überfiel, musste sie auf den Turm von Maheshs Restaurant steigen und nach der Plantage Ausschau halten. Die Farben des Spätsommers in sich aufnehmen, das Gelb und Ocker und satte dunkle Grün und die schöne Symmetrie, in der die Landschaft sich präsentierte: unzählige bewirtschaftete Hügel mit Haselnussbäumen und Sträuchern, die in Reih und Glied an ihnen hochkletterten, und geduckte Weinstöcke, die die Erhebungen wie ein Quilt überzogen, von Rosen begleitet. Und obenauf, stolz und thronend, die Häuser und Kirchen, Burgen und Schlösser. Hier wurzelt unsere Identität, dachte Ella oft, wenn sie das Land vom Turm aus überblickte, und fragte sich, wie einer je wieder Halt finden konnte, wenn seine Wurzeln ausgerissen wurden.
»Ich nehme die Blumen«, erklärte Lisa und griff nach dem kleinen Strauß, den sie soeben besorgt hatten.
»Dann nehm ich aber das Bild«, sagte Lauro zu seiner Schwester auf der Rückbank, faltete es zusammen und steckte es ein.
»Ihr werdet doch jetzt wohl nicht streiten?«, ging Ella dazwischen. »Nicht heute! Wir sind gleich da.«
»Entschuldigung«, kam es leise im Chor, und kurz darauf wurde getuschelt.
»Können wir?« Ella parkte den Wagen und ging mit ihren Kindern auf den säulengetragenen Eingang zu, den Schlüssel schon in der Hand. Die beiden liefen voraus: Lisa, das Ausrufezeichen im Satzgefüge ihres Lebens, die ihr so ähnlich sah, und Lauro, der Blondschopf, in dessen Gesicht Ella immer ihren Bruder entdeckte. Er fehlte ihr so sehr.
Der cimitero urbano wirkte wie eine kleine Stadt, in der jede Familie ihr eigenes Haus besaß. Bis auf die, die sich nahe dem Eingang Urnennischen mit einfachen Grabplatten teilten, eingelassen in lange Wände aus kühlem Marmor. Sieben oder acht Reihen übereinander und so hoch, dass die Angehörigen auf Leitern hinaufsteigen mussten, um ein Bild zu küssen, ein Gebet zu murmeln oder die Blumen auszutauschen, die fast immer aus Plastik waren und trotzdem verblassten.
Neben dem schlichten Mausoleum der Donatis wuchs ein Haselnussstrauch, der heute mit bunten Schleifen geschmückt war. Salvatore musste hier gewesen sein, ihr ehemaliger Nachbar. Und vor der Glastür, die den schmalen Treppenabgang zur Familiengruft versperrte, entdeckte Ella einen frischen Blumenstrauß.
»Von wem ist der, mamma?«, fragte Lauro.
Sie hob ihn auf. »Ich weiß es nicht, mein Kleiner.«
»Nehmen wir ihn mit runter?«
»Natürlich.« Ella versuchte, sich ihre Verwunderung nicht anmerken zu lassen, während sie aufsperrte und die Treppe hinunterstieg, die ums Eck lief und Abgeschiedenheit garantierte.
»Hallo, nonno«, sagte Lauro jetzt. »Wir haben dir ein Bild gemalt, deine Plantage und den Hügel und das rote Haus.« Er legte das Papier auf den schmalen Sims vor der Grabplatte seines Großvaters, auf der dessen Name stand: Donati Philippe; geboren 3. Oktober 1941; gestorben 13. Januar 2017. Fünfundsiebzig Jahre und ein Tod auf Raten.
Ellas Hochzeitskleid hing am Schrank ihres Zimmers und funkelte in der Sonne, die durch die Fenster fiel. Von hier aus überblickte sie die Ausläufer der Stadt und das bestellte Land, erkannte die Kirche von Diano d’Alba im Süden und die Stadt Bra im Westen. Der Monte Viso dominierte das Bergpanorama, ein Götterthron und Himmelsstürmer mit immer weißem Haupt. Es war einer der wenigen klaren Tage, an denen die Luft nicht trüb war und das Licht härter als sonst. Einer der wenigen Tage, an denen Ella glücklich war. In sechs Wochen würde sie heiraten. Nicolo hatte sein Master-Studium in Mailand abgeschlossen und bereits ein Auslandssemester an der San José State University in Kalifornien absolviert. Mit einem Visum für sich und seine zukünftige Ehefrau in der Tasche wollte er nun für drei Jahre im Silicon Valley arbeiten. Sein großer Wunsch, seit er Alba verlassen hatte und zum Studieren nach Mailand gegangen war. »Du wirst es lieben, Ella, dort ist alles so anders, und du kannst aufs College gehen, wenn du willst. Du wirst Zeit haben«, hatte er gesagt. Und Ella hatte sich gefragt, was sie gerne werden würde, wer sie sein wollte jenseits des Hügels und der kleinen Welt, die sie kannte. Jenseits der Verpflichtungen, dem ewigen Drehen des Mühlsteins, der den grauen Alltag zu Traumsand zerrieb, aus dem sie unermüdlich ihre heile Welt backte. Jeden Tag neu wie diese sattgelben Gugelhupfe aus der Vanillepuddingwerbung. Strahlende Kinderaugen und selige Mütter in gestärkten Küchenschürzen. Als junges Mädchen hatte sie davon geträumt, eine Chocolaterie in Turin zu eröffnen, die größte im ganzen Land! Jetzt befühlte sie den weißen Stoff ihres Hochzeitskleides, die Seide, die Spitzen und das breite lichtblaue Band, das die Taille umfing – eine Schleife aus Sehnsucht und zartem Satin –, und träumte wieder. Sie dachte an die Liebe, die Nicolo und sie verband, ihre erste gemeinsame Nacht vor zwei Jahren im Studentenwohnheim, wo sie ihn besucht hatte, und an ihre Trennung, als er in Kalifornien gewesen war. Doch anders als ihre Mutter war er zu ihr zurückgekommen. Und anders als ihr Bruder, der in irgendeiner gottverlassenen Bergregion Afghanistans stationiert war und ihr nur hin und wieder Postkarten schickte, auf denen nichts stand, das sie tröstete. Ihr großer Bruder, um den sie sich immer gekümmert hatte, obwohl er der Ältere war. Doch jetzt würde sie auch endlich fortgehen und ihren Vater und das Haus auf dem Hügel verlassen. Die Einsamkeit und den schleichenden Verfall. Ihre Heimat.
Als es an diesem Tag klingelte, öffnete Ella in ihrem Brautkleid die Tür und ließ Dottor Ruggiero herein, der bat, sie und ihren Vater sprechen zu dürfen. Philippe hatte sich in den letzten Wochen nicht gut gefühlt, aber das war nichts Neues, denn er trank zu viel und achtete nicht auf seine Gesundheit. Seit er vor zwei Jahren im ehemaligen Kelterhaus beim Einlagern der Nüsse gestürzt war, war sein rechtes Knie kaputt. Ella wollte ihn damals ins Krankenhaus fahren, aber er hatte sich gewehrt. Jetzt stützte er sich beim Gehen auf einen Stock und im Leben auf sie.
Philippe begrüßte den Hausarzt der Familie im Wohnzimmer, wo er in seinem Sessel neben dem Kamin saß. Die dunklen Deckenbalken ließen den Raum niedrig erscheinen, der Steinboden wirkte rustikal. Ella hatte sich Mühe gegeben, hier alles etwas gemütlicher zu gestalten. Sie hatte die Teppiche aus den leer stehenden Zimmern zusammengetragen, Vorhänge genäht und die alten Möbel ein Stück ums andere frisch lackiert. »Die Ergebnisse sind da«, sagte Dottor Ruggiero und setzte sich mit ernster Miene. Ellas Herz schlug schneller, die Angst kroch durch ihre Glieder. Sie sollte sich umziehen, aber nicht jetzt. »Es ist ein Karzinom im Darm, und es hat bereits in die Lymphknoten gestreut.«
»Was heißt das?«, fragte Ella, während ihr Vater die Nachricht ohne Regung über sich ergehen ließ, so als hätte er schon viel zu lange auf seinen Tod gewartet. Allein sein Blick wanderte zu seinem Hochzeitsfoto, auf dem er stolz und selbstbewusst neben Francesca stand und ihre blauen Augen heller strahlten als das Kleid, das sie trug. Francesca, sein Stern, sein Licht.
»Sie müssen sich operieren lassen, Philippe, und anschließend eine Chemotherapie machen. Das ist Ihre beste Option.«
Ella setzte sich zu ihrem Vater, der mechanisch mit seiner linken Hand über die Sessellehne rieb, die an dieser Stelle schon ganz verschlissen war, und sagte: »Wir schaffen das, hörst du, papà.«
»Wir, Ella?« Er blickte ins Leere. Dort wartete etwas auf ihn.
»Ja, wir! Ich gehe nicht weg. Ich bleibe hier bei dir, bis du wieder gesund bist. Er wird doch wieder gesund? Oder, Dottore?«, fragte sie ängstlich, und der Arzt zählte ihr jeden möglichen Verlauf auf: den bestmöglichen, den schlimmsten und alles dazwischen. Die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten, das Grauen und den Schmerz in Variationen. Ella sah auf ihr Kleid und hörte aufmerksam zu. Sie gab sich alle Mühe, nicht verzweifelt zu wirken, ging, als Dottor Ruggiero fort war, in ihr Zimmer hinauf und starrte dann lange in den großen Ankleidespiegel. Jetzt weinte sie und spürte, wie ihr das Atmen immer schwerer fiel. Die Wut gewann die Oberhand. Sie griff nach einer Vase, in die sie erst am Morgen frische Blumen gestellt hatte, und warf sie ihrem Spiegelbild entgegen. Das Glas zersprang. Bruchstücke einer geborstenen Zukunft, die Ella später in einem Karton verwahrte, in der Hoffnung, sie irgendwann wieder zusammensetzen zu können.
»Soll ich noch Wasser holen, damit wir der nonna auch die anderen Blumen hinstellen können?«, fragte Lisa ihre Mutter. Sie standen noch immer in der kleinen Familiengruft. »Die sind doch für sie, oder?«
»Ich nehme es an. Warum sollte sonst jemand ausgerechnet heute Blumen bringen?«, sagte Ella.
Als Lisa vom Brunnen zurück war, stellten sie die beiden Sträuße auf den kleinen Altar an der Stirnseite der Gruft, und Ella strich zärtlich über das gerahmte Foto ihrer Mutter. Bilder – nichts anderes war ihr von ihr geblieben, und das Rezeptbuch. Die gemeinsamen Erlebnisse waren nur Fragmente aus zweiter Hand, die ihr Vater auf dem Grund einer Flasche mit ihr geteilt hatte oder die aus Danilos Erzählungen stammten. Erinnerungen, die er später mitgenommen und sie damit dem Vergessen überlassen hatte.
»Schau mal, mamma«, meinte Lauro und deutete auf die Daten der Großmutter: Donati Francesca; ved. Bruno; geboren 11. Mai 1958; gestorben 17. August 1990; I tuoi cari. »Als die nonna den Unfall gehabt hat, da war sie genauso alt wie du heute. Zweiunddreißig.«
»Du hast recht«, erwiderte Ella überrascht, »das war mir gar nicht bewusst«, und verlor sich in seinem lichtblauen Blick, der seit dem Tod des Großvaters mehr und mehr an Farbe verlor. Passierte es etwa schon wieder?
3
Der Sandsturm legte sich langsam, und Salvatore Rinaldi erkannte unter der gewaltigen Wolke auf der Plantage gegenüber seinen neuen Nachbarn auf der Erntemaschine. Michele Mariani hatte den Wendetraktor der Donatis mit der klapprigen Kehrvorrichtung und dem Sammelkorb durch einen dreirädrigen Vollernter ersetzt, der auf dem schwierigen Gelände deutlich flexibler war. Dort, wo im letzten Herbst bei Starkregen der Hang mitsamt den Sträuchern abgerutscht war, hatten Helfer die Erde wieder hinaufgebaggert und neue Haselnüsse angepflanzt. Hätte man’s gleich gemacht, wären die Pflanzen noch zu retten gewesen, aber so hatten sie über Monate an der Grundstücksgrenze herumgelegen und waren verdorrt. Die Bäume auf Marianis Plantage waren zudem überaltert. Hier hätte der Bestand schon vor Jahren verjüngt werden müssen, aber es fehlte ja sogar am Rückschnitt. Die Ernte konnte nicht gut ausfallen, dachte Salvatore, und Mariani war spät dran. Die meisten Landwirte hatten ihre Haselnüsse bereits in den Trockensilos.
Die Gerüchteküche erzählte, dass der Neue jenseits der Straße noch Land dazugepachtet hatte. Einer der Neun vom Stadtpatz hatte es erwähnt, der ehemalige Bürgermeister Mancini oder Rizzo, dessen Tochter das Weingut führte. Gestern erst auf der Piazza Savona, wo sie sich jeden Abend einen der Stühle vom Café Savona aus dem Stapel nahmen, sie im Kreis zusammenstellten und ihre kleinen konspirativen Sitzungen abhielten. Nein, jetzt wusste Salvatore es wieder. Massimo Barbieri, der beleibte Bäcker, hatte es erzählt und dass Mariani seinen Betrieb auf Bioanbau umstellen wolle. Bio! Damit dürfte er die Lacher sämtlicher Haselnussbauern der Region auf seiner Seite haben. Aber was wusste er schon? Er baute lediglich etwas Spargel an, Tomaten, Zucchini und Paprika. Auf seinem kleinen Grund wuchs nicht viel, er finanzierte sein bescheidenes Leben mit seiner Trüffellizenz. Kannte die besten Plätze in den Wäldern der Bassa Langa, wie die Landschaft der Unteren Langhe auf Piemontesisch hieß, und hatte einen guten Hund. Den alten hatten sie ihm vor drei Jahren vergiftet, die Verbrecher! Irgendwelche Konkurrenten, die Giftköder auslegten und ohne Genehmigung nach Trüffeln suchten. Letztes Jahr hatten die Neun vom Stadtplatz so einem ehrlosen Kerl im Wald aufgelauert, ihn auf frischer Tat ertappt und seiner Frau daraufhin gesteckt, er verlasse sie nachts nicht zum Trüffelsuchen, sondern einer Geliebten wegen. Parisis hübsche Tochter Viola – Parisi gehörte ebenfalls zum Bund der Neun – hatte der Gattin des Übeltäters das vermeintliche Verhältnis sogar gestanden. Und damit war die Sache dann erledigt gewesen und der falsche trifolao auch. Wer sich in solchen Dingen auf die Polizei verließ, der war verlassen, das wussten die Neun und fackelten nicht lange!
Salvatore stellte die angeschlagene Schüssel, in der noch ein letzter Rest Risotto klebte, neben sich auf die Bank vor seinem bescheidenen Haus, trank den Arneis aus und streckte die alten Glieder. Hier im Schatten seiner Edelkastanie saß er mittags gern und überblickte die Nachbarschaft. Marianis Plantage, die kleinen Felder südöstlich und die Häuser, die an sein Grundstück grenzten. Hier war er geboren worden, und hier würde er sterben. Hier hatte er sich als junger Mann verliebt und für seine Freiheit gekämpft.
Der Krieg war in ihren Augen angekommen und grub sich in ihren schönen jungen Körper. Gianna war siebzehn, so wie er, und seit ein paar Monaten beim Widerstand. Eine Stafette, die gefälschte Dokumente, Lebensmittel und Geld vom geheimen Führungszentrum in Alba zu den bewaffneten Formationen in den Bergen schmuggelte und Nachrichten bis Turin. Die Aufzeichnungen der alten Frauen etwa, die hier vor ihren Häusern saßen und scheinbar teilnahmslos ins Nichts starrten, während sie notierten, wie viele Militärfahrzeuge der Deutschen Wehrmacht vorbeifuhren oder Truppen marschierten und welche Waffen sie dabeihatten. Manche vecchietta konnte weder lesen noch schreiben. Die führte dann Strichlisten. Großmütter, Mütter, Schwiegertöchter und Töchter schlossen sich der resistenza an, weil sie sich noch frei bewegen konnten, während die Männer deportiert wurden oder gezwungen, an der Seite der Deutschen gegen die Alliierten zu kämpfen. Seit die Wehrmacht weite Teile Oberitaliens besetzt hatte, waren Tausende Männer und Frauen in den Untergrund gegangen. So wie Maria Donati, Salvatores Nachbarin, die sich mit ihrem kleinen Sohn Philippe alleine durchschlug, denn ihr Mann war in Frankreich gefallen.
»Sie haben meine Mutter geholt«, flüsterte Gianna. Die Stille lag in diesen Nächten wie eine schwere Decke über dem Land. Keine Aufklärer am Himmel, keine Truppenbewegungen, nur hin und wieder ein paar verirrte Salven aus Maschinengewehren mit Leuchtspurmunition. Salvatore zog sie fester an sich und küsste sie aufs Haar. Es roch nach der Druckerschwärze der verbotenen Flugblätter. Seine Hand glitt zaghaft über ihre grobe Bluse und spürte den Stern der Garibaldi-Brigade, den sie versteckt an der Innenseite ihrer Brusttasche trug.
Sie würde morgen in die Berge gehen, ins Mairatal, das an Frankreich grenzte, zu ihrem Bruder und den Männern der Brigade. In Alba war sie nicht mehr sicher. »Und meinen Onkel und Sandra haben sie auch«, sprach sie leise weiter und zitterte. Die Nacht war warm und der Boden, auf dem sie lagen, auch. Nur ein leichter Wind streifte durch die Blätter der Kastanie. »Sie verhören sie, weil sie mich und meinen Bruder suchen.« Salvatore atmete flach vor Entsetzen, denn er kannte sie alle, ihre ganze Familie. Sandra, Giannas kleine Schwester, die erst fünfzehn war, und ihre Mutter, die wie Maria Donati Waffen und Sprengstoff in ihrem Einkaufskorb transportiert hatte, versteckt unter den letzten Kartoffeln, die es noch auf Lebensmittelkarte gab. Und Munition und Handgranaten in Glühbirnenkartons, vor deren Detonation die Frauen sich mehr fürchteten als vor den Besatzern. »Sie werden sie nach Turin bringen, zum SD. Ich weiß es von einem Spitzel bei den carabinieri.« Gianna weinte. Wie müde sie war – und er auch. Letzte Nacht hatten sie einige Strommasten sabotiert und die Brücke über den Tanaro ausspioniert, die sie sprengen wollten, ehe der Winter kam. Sie mussten den Versorgungsweg der Deutschen zerstören, um sie von den nachrückenden Verbänden im Norden abzuschneiden. Die Partisanen brauchten ihn nicht, sie mussten keine Panzer, schwere Lastwagen oder große Munitionsvorräte bewegen. Und sie kannten das Gelände, jeden Stein, jede Untiefe, wenn das Wasser stieg.
»Sie kommen wieder nach Hause«, versuchte Salvatore, Gianna zu trösten. »Du musst daran glauben.«
»Nein, sie landen in Mauthausen, so wie Tibaldi und seine Leute im Januar. Ich weiß es von Toni.« Toni Versino von der 41. Brigade. Ein Deckname, so wie sie Gianna jetzt Larva nannten – der Schatten, der Geist –, aber in ihren gefälschten Papieren stand Verena Santacroce, der Name einer Toten. »Ich muss weg, bevor sie mich finden.«
»Du solltest dich zu deinem Vater durchschlagen«, beschwor Salvatore sie. Der war letztes Jahr mit seinen Kameraden über den Pass aus Frankreich zurückgekommen, nachdem Mussolini vorübergehend abgesetzt worden war. Sie hatten ihn in Zivilkleidung gesteckt und zu Verwandten in den Süden geschickt. Zehntausende italienische Männer waren so dem Schicksal entgangen, für die Republik von Salò erneut zu den Waffen greifen zu müssen. Gianna und ihre Kameradinnen waren sogar in Kasernen gegangen, zwei Schichten Kleidung am Leib, und hatten sie den Soldaten überlassen, die von dort fliehen wollten. Getarnt als ziviles Küchenpersonal, waren sie dann an den Wachposten vorbeimarschiert und desertiert. »In Neapel sind die Amerikaner. Wenn du’s bis dahin schaffst, bist du in Sicherheit, Gianna«, sagte Salvatore, doch sie schüttelte nur den Kopf. »Bitte, Gianna, bitte, tu es für mich. Für deine Familie.« Salvatore wusste, dass er keinen Tag länger in der Angst um sie leben konnte. Sie lähmte sein Denken, jeden Schritt, den er tat, und lenkte jeden Schuss.
»Ich gehe in die Berge und kämpfe von dort aus für meine Familie, um den Krieg zu beenden. Das musst du doch verstehen, Toto.« Toto – so hatte sie ihn schon am ersten Schultag genannt und später, als er sie an ihrem fünfzehnten Geburtstag geküsst hatte, wieder. Und in der Nacht, in der sie sich zum ersten Mal geliebt hatten – mitten im Krieg. Seine Hände kannten ihren Körper besser als seinen eigenen. Ihre Beine, die durch die Botengänge kräftiger geworden waren, durch die steilen Anstiege im unwegsamen Gelände. Und ihre Hüften, die sie in zarten Röcken schwang, wenn die Miliz ihr zu nah kam – ein naives junges Mädchen auf dem Weg zur Arbeit. Ihr Rücken war biegsam von der Verstellung und ihr Blick verdunkelt vom Hass. Gewalt und Willkür hatten alle Zartheit getilgt. »Ich gehe morgen los«, fuhr sie fort, und seine Arme umschlossen sie. »Mein Bruder sagt, sie sind gut ausgerüstet, die Engländer werfen Waffen ab.«
»Haben die Deutschen nicht erst letzten Monat einiges erbeutet? Unsere Leute sind doch über die französische Grenze geflohen.«
»Repressalien! Weil wir der Wehrmacht in Busca und Dronero Vieh abgenommen haben, das schon verladen war. Die Überfälle auf die Bahnhöfe haben sie ziemlich überrascht.« Gianna war gut informiert. »Aber unsere Kämpfer kommen zurück, Toto, das tun sie immer. Und wir werden jedes Mal mehr. Wir haben jetzt sogar deutsche Deserteure in der Brigade und Jugoslawen, die sich freiwillig gemeldet haben. Ehemalige Kriegsgefangene, Russen und Polen.«
»Aber doch keine Frauen, Gianna!«
»Selbstverständlich! Was denkst du denn?« Ihre Tränen wichen der Wut und dem wiedererwachten Kampfgeist. »Dass wir nur zum Postboten taugen? Wir kämpfen wie ihr, und wenn der Krieg vorbei ist, werden wir wählen wie ihr!«
Kein Wunder, dass Salvatore ausgerechnet heute daran dachte, an Francescas Todestag. Die Abschiede wucherten in einem langen Leben wie ein Myzel, ein unterirdisches Pilzgeflecht, und sie wurden immer mehr. Ganz im Gegensatz zum teuren tartufo bianco, der Königin der Trüffel, den fand er immer seltener.
Verfluchte Mittagshitze! Eigentlich hätte er sich ein bisschen hinlegen sollen. Er war immerhin neunzig und nicht mehr ganz so fit wie früher. Aber die Malven leuchteten so schön neben seinen Tomaten, und er beschloss, ein paar zu schneiden und sie zur Marienstatue in dem kleinen ummauerten Garten an der Straße unterhalb von Marianis Plantage zu bringen. Sie gehörte zu dessen Anwesen, aber jeder konnte durch das niedrige schmiedeeiserne Tor am Gehweg treten, das den langen Zaun unterbrach. Als Salvatore zuletzt dort gewesen war, um der Maria mit dem Haselnusszweig Blumen zu bringen, hatte er sich verliebt.
4
Das war der dritte und letzte Erntezyklus gewesen. Endlich hatte Michele Mariani alle Haselnüsse eingebracht. Das Reinigen und Auslesen von Steinen, Ästen und sogar toten Mäusen, die der Vollernter mit eingesammelt hatte, lief schon seit Wochen. Das Waschen, Polieren und Sortieren nach Größen. All das hatte er sich selbst beigebracht, aber er verließ sich auch auf seinen Vorarbeiter, der sich auf der Plantage zurechtfand, als hätte er nie woanders gearbeitet. Bruno hatte die Saisonarbeiter für ihn eingestellt und koordinierte und überwachte alle Abläufe. Eigentlich arbeitete Michele unter ihm, aber das war in Ordnung, schließlich war er der Neue und hatte von Landwirtschaft keine Ahnung. Michele war Konstruktionsingenieur. Er hatte in den letzten zwölf Jahren in Albenga an der Ligurischen Küste bei Piaggio Aerospace gearbeitet. War maßgeblich an der Konstruktion eines Turboprops beteiligt gewesen, dessen Technik in eine Aufklärungsdrohne einfloss. Doch seit die Firma Aufträge für das Verteidigungsministerium ausführte, hatte sich sein Aufgabenfeld verändert und er jede Begeisterung für seine Arbeit verloren. Pippa hatte ihm zugeredet. Sie meinte, es wäre ein Karrieresprung und den Einsatz wert. Sie verbrachte selbst sechzig, siebzig Stunden die Woche am Schreibtisch und arbeitete für eine PR-Firma mit internationalen Auftraggebern in Genua. Sie hatte sich ein Büro im Haus eingerichtet, weil sie Teile ihrer Kampagnen von hier aus betreute. »Wie lange muss ich diesen Baulärm noch ertragen, Michele?«, fragte sie ihren Mann, der gerade vor der Halle mit der Sortieranlage und den angrenzenden Lagerräumen eine Hammermühle modifizierte. Den veralteten Maschinenpark auf Vordermann zu bringen und an Innovationen zu tüfteln, machte ihm Freude.
»Es sind doch nur noch ein paar Malerarbeiten an der Fassade, Pippa«, versuchte er, sie zu besänftigen. »Dann kommt das Gerüst weg. Das dauert höchstens noch zwei Tage. Der Installateur hat mir gerade gesagt, dass die Bäder heute fertig werden. Also kannst du dir am Abend ein Bad mit Blick über die Hügel der Langhe einlassen.« Er nahm seine Frau in den Arm, küsste sie und wandte sich wieder der Hammermühle zu. Mit ihr wurden die Haselnussschalen zu Granulat vermahlen, das später zum Polieren der Nüsse oder als Dünger verwendet wurde. Sein Vorarbeiter hatte es ihm gezeigt.
»Ich habe einen Abgabetermin, Michele. Ich sitze seit heute Morgen um fünf an dem Projekt. Zweimal ist mein Rechner abgestürzt, und die WLAN-Verbindung in diesem gottverdammten Nest ist viel zu langsam.« Pippa fuhr sich nervös durchs glatte blonde Haar – ein kinnlanger Schnitt. »Wenn ich in deinem sogenannten Paradies nicht arbeiten kann, fahre ich in die Agentur!«
»Bitte, Pippa, wenn man in ein altes Haus einzieht, gibt es eben viel zu tun, das wussten wir. Aber dafür haben wir jetzt alles nach unseren Wünschen gestaltet.«
»Nach unseren? Wohl kaum!«, gab sie zurück und spielte auf Micheles Mutter an, die auf seine Bitte hin zu ihnen gezogen war und seither »dem Geist des Hauses« nachspürte, wie sie sagte, »seinem alten Glanz« und seiner Geschichte. Sophia Mariani hatte ihr Haus in Turin aufgegeben, wo Michele groß geworden war, und das Geld in das Land und das Haus auf dem Hügel gesteckt – der Traum ihres einzigen Sohnes. Auf den ersten Blick war es ein Hirngespinst, den sicheren Job bei Piaggio Aerospace aufzugeben und aufs Land zu ziehen, um Haselnüsse anzubauen. Die typischen Aussteigerfantasien eines Mannes Anfang vierzig! Doch wenn Michele träumte, dann mit ganzem Herzen, dann war er mutig und hoffnungsfroh. Wie viele Hürden hatte er in seinem Leben schon allein durch seinen Optimismus bezwungen? Und der war es auch, in den Pippa sich vor dreizehn Jahren verliebt hatte. Sein Optimismus und der jungenhafte Blick aus dunkelgrünen Augen, die sie an die windgepeitschten Wacholderbüsche sardischer Strände erinnert hatten. Damals hatten sie sich ein Leben versprochen, heute kämpften sie um jeden Tag.
Micheles verrückter Traum sollte ein Neuanfang werden und ihn darüber hinwegtrösten, dass sie keine Kinder hatten. Er sollte die Flucht in die Arbeit beenden und ihnen mehr gemeinsame Zeit verschaffen. Doch Pippa wollte nicht loslassen, sie konnte es nicht, nicht einmal hier. Michele fand seinen Frieden in der Natur, er hatte einen Gott, der ihn hielt, und damit ein Schicksal, auf das er vertraute, aber Pippa fand diesen Glauben und diese Bestimmung nicht in sich. Sie war nur, was sie selbst schuf, und schuf sie nichts, empfand sie Leere und Versagen. »Was hältst du von einem Picknick unter den alten Bäumen am Haus?«, fragte Michele seine Frau und nahm sie in den Arm, als könnte ein Lächeln alle Widrigkeiten fortzaubern. »Bruno meint, wir müssen sie fällen und neu anpflanzen, sie bringen kaum noch Ertrag. Aber ich mag sie so gerne, du nicht?«
»Wenn du meinst.«
»Pippa, das ist doch jetzt auch dein Zuhause. Gib ihm eine Chance, bitte. Gib uns eine Chance.« Pippa löste sich aus Micheles Umarmung und sah zum Haus hinauf. Der rote Anstrich, die grünen Fensterläden … Sie war in Genua groß geworden und liebte die Farben des Meeres. Ihr Haus in Albenga mit Blick auf die Italienische Riviera war weiß gewesen mit türkisfarbenen Fensterstöcken und einer blauen Tür – hell und einladend modern. Doch hier hatten sie die alten Dielen lediglich aufarbeiten und den Putz nur teilweise erneuern lassen, die Türstöcke, Türen und Fenster nicht ersetzt, sondern saniert. Michele war geschickt und arbeitete mit den Handwerkern zusammen, den Schreinern, dem Elektriker, dem Heizungsbauer, ja, sogar mit den Zimmerleuten und Dachdeckern. Am Abend nahm er Pippa oft bei der Hand und ging mit ihr durch die Zimmer, um mit einem Glas Wein auf die Fortschritte anzustoßen. Einmal hatten sie sich im Wohnzimmer geliebt, vor dem offenen Kamin auf weichen Decken. Doch diese Liebe war Routine, lieb gewonnene Gewohnheit und vielleicht nicht mal mehr das.
»Darf ich stören?«, fragte Micheles Vorarbeiter. »Ich hab die Liste mit den Arbeiten, die anstehen, Signor Mariani. Und wir müssen über die Pachtflächen reden … und die Ölpumpe.«
»Kein Problem, wir sind fertig«, gab Pippa dem Mann zur Antwort und ging. Sie wusste noch nicht, was sie von ihm halten sollte. Er war ein einfacher Kerl, genügsam, wie ihr schien, und tüchtig. Sie schätzte ihn auf Ende dreißig, aber vielleicht ließen sein sonnengegerbtes Gesicht und die Falten um die grauen Augen sowie seine wortkarge Art ihn auch älter erscheinen. Manchmal sprach er in einer seltsamen Sprache und entschuldigte sich, wenn er es bemerkte. »Lenga d’òc«, erklärte er dann, »das Okzitanisch steckt mir in den Knochen.« Pippa wusste, dass Bruno ihrem Mann keine Zeugnisse vorgelegt hatte und auch keinen Ausbildungsnachweis. Er war aus dem Nichts aufgetaucht, hatte eine Woche zur Probe gearbeitet und sich schnell unentbehrlich gemacht.
»Setzen Sie sich, Signor Bruno«, forderte Michele den Mann auf und ließ sich seine Notizen geben. Seine Schrift war ordentlich, aber er machte Rechtschreibfehler.
»Ich schreib nicht gern«, entschuldigte sich Bruno. »Das war schon in der Schule so.« Er zupfte an seinem Hemdkragen und überlegte, ob er die Legasthenie erwähnen sollte. Aber das wenige war schon mehr, als er im Mairatal an einem ganzen Tag gesagt oder gar von sich selbst erzählt hatte, mehr, als sie in den langen Wintern dort oben in einer Woche miteinander sprachen.
»Mir geht es nicht anders«, erwiderte Michele und lächelte freundlich. »Ich habe mein halbes Leben auf dem Papier verbracht und die Nase voll davon!«
»Ach ja? Was haben Sie gemacht?«
»Flugzeugbau, wir haben Drohnen konstruiert, für die Aufklärung in Kriegsgebieten.« Bruno nickte, über den Krieg sprach er auch nicht.
»Wir müssen im Herbst die Pachtflächen bepflanzen. Da drüben können Sie dann sofort biologisch wirtschaften, aber die Sträucher tragen in den ersten Jahren nicht viel.« Das war Michele klar. »Wissen Sie schon, was mit den alten Bäumen oben am Haus passieren soll?«
»Ich will sie behalten. Sie sind wie das Haus, das habe ich ja auch nicht einfach abgerissen und neu gebaut.«
Hätte nicht geschadet, dachte Bruno, wäre einiger Ballast entsorgt worden. Aber manche Menschen lebten anscheinend gern in der Vergangenheit, selbst in der anderer Leute. »Das wird Sie einiges kosten«, sagte er nachdenklich, »und Sie haben schon so viel investiert.«
»Die Bank hat das Darlehen genehmigt«, erklärte Michele seinem Vorarbeiter, »damit bringen wir den Betrieb wieder auf Vordermann. Wenn ich auf Selbstvermarktung setze und gute Produkte produziere, amortisiert sich das bald.« Davon verstand Bruno nichts. Er kannte nur Landwirte, die ihre Ernte an Ferrero verkauften, damit die Firma mit den piemontesischen Haselnüssen werben konnte, angeblich die besten der Welt. Tatsächlich bezog Ferrero jedoch den Großteil seiner Nüsse aus der Türkei, die Ernte in der Region war, am Bedarf gemessen, gering. »Dafür könnte ich einen Partner brauchen«, ergänzte Michele.
»Für die Selbstvermarktung?«
»Ja. Meine Frau arbeitet in der Werbung, sie versteht sich also aufs Verkaufen, und ich mache mich gerade mit den ganzen Auflagen vertraut, der Kennzeichnungspflicht, den Euronormen und diesen Dingen, aber ich habe keine Ahnung von den Produkten selbst.« Michele wollte seine Haselnüsse den Restaurants und Konditoreien in der Region anbieten und kleine, edel verpackte Gebinde übers Internet verkaufen, aber er brauchte auch Produkte, die sich von den anderen absetzten, die eine gewisse Magie verströmten und Begehrlichkeiten bei den Feinschmeckern weckten. Das nahe gelegene Bra war die Geburtsstätte der Slow-Food-Bewegung. Wer ins Piemont reiste, tat es der Küche und der erstklassigen Weine wegen. »Ich bräuchte jemanden, der kreativ ist und ein paar Geheimrezepte in der Schublade hat.«
5
Neben Ellas torta di nocciole, die sie zu jedem Geburtstag backte, stand wie immer auch eine Kerze für ihre Mutter. Ein kleines, verlässliches Ritual, wie Salvatores Bänder am Haselnussstrauch, das der Willkür des Lebens entgegenwirkte – eine Kerze, ein Kuchen, ein Anker in der Zeit. Die Zwillinge saßen mit ihr am Abend an dem kleinen Esstisch in der Küche ihrer Wohnung und feierten. Mahesh wollte später noch kommen, und Salvatore hatte vorbeigeschaut, nachdem sich die Runde der Neun vom Stadtplatz aufgelöst hatte. Viele Freunde hatte Ella nicht, aber sie hatte sich ja auch immer um ihren Vater gekümmert, um den Haushalt und – so gut es eben ging – die Plantage. Hatte Kochrezepte, Düngevorschriften und Krankenakten studiert und ihre Kinder großgezogen. Von ihrer Schwangerschaft hatte sie erst erfahren, als Nicolo schon in Amerika gewesen war. Damals wollte er nach Hause kommen und seinen Traum von einem Leben im Silicon Valley aufgeben, aber sie hatte ihn gebeten, dort zu bleiben, und versprochen, nachzukommen. Doch als dann an einem Tag im März das blaue Leuchten in ihr Leben zurückgekehrt war – es umspülte Lauros Blick wie ein klarer, von Kornblumen umstandener Bach –, da hatte sie sich gar nicht mehr fortgesehnt.
Es klingelte. Ella sprang auf, Mahesh hatte es früher geschafft. Sie drückte den Türöffner und hörte seine Schritte. Er ließ sich Zeit, sonst nahm er immer zwei Stufen auf einmal. Vielleicht trug er etwas Schweres? Die Eismaschine womöglich, die sie sich wünschte und die sie in die Pralinenküche würde stellen müssen, da in der Wohnung zu wenig Platz war.