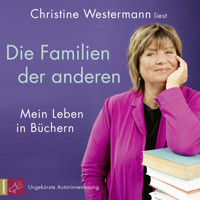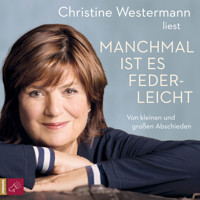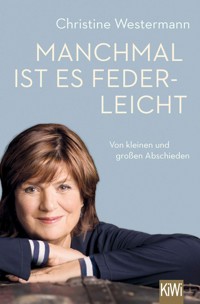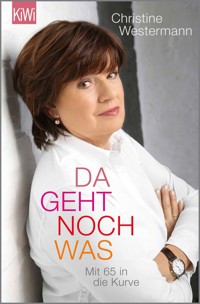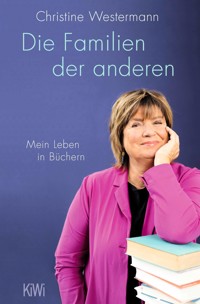
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Christine Westermann, preisgekrönte Journalistin und Bestsellerautorin, genießt mit ihren Buchempfehlungen großes Vertrauen bei einem breiten Publikum. Bücher sind aus ihrem heutigen Leben nicht wegzudenken, sie sind für sie Fenster in ein fremdes Leben. Dabei war ihr Weg zu den Büchern kein selbstverständlicher, eher ein Hindernislauf. Elegant, ehrlich und mit wunderbarer Selbstironie erzählt Christine Westermann, wie sie zu den Büchern (und Thomas Mann) fand – und begibt sich dabei auf eine fesselnde Zeitreise in ihre eigene, von Brüchen gezeichnete Familiengeschichte. Eine Bibliothek mit Leiter wünscht sich Christine Westermann. Damit sie auch mal an die Bücher in der obersten Reihe kommt. An den Zauberberg von Thomas Mann aus dem Regal der Eltern zum Beispiel, an den sie sich lange nicht gewagt hat. Mit welchen Büchern ist sie aufgewachsen, welche sind noch heute eng mit ihrem Leben verknüpft? Warum hat Lesen lange Zeit nur eine kleine Rolle in ihrem Leben gespielt? Warum ist sie aus allen Wolken gefallen, als sie gefragt wurde, ob sie Lust habe, Buchempfehlungen fürs Radio zu machen? Wie schreibt man eine Empfehlung und warum soll es bei ihr nie ein Verriss sein? Christine Westermann schreibt über die Lust zu lesen. Und damit eng verbunden über die Neugier auf das Leben der anderen. Mit ihrem neuen Buch erlaubt sie einen Einblick ins eigene Leben. Und in die vielen Bücher, die darin vorkommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Christine Westermann
Die Familien der anderen
Mein Leben in Büchern
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Christine Westermann
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Christine Westermann
Christine Westermann ist mit ihren Buchempfehlungen im »Stern«, ihren Sendungen im Hörfunk (Buchtipps im WDR), als Kolumnistin des »Buchjournals« und als Podcasterin eine der bekanntesten Buchkritikerinnen. Sie war festes Mitglied in der Fernsehsendung »Das literarische Quartett«. Für ihre gemeinsam mit Götz Alsmann moderierte TV-Sendung »Zimmer frei« erhielt sie u.a. den Adolf-Grimme-Preis. Christine Westermann hat bislang fünf Bücher veröffentlicht, die allesamt Bestseller wurden.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Als Kind wünschte sich Christine Westermann eine Bibliothek mit Leiter. Damit sie auch mal an die Bücher in der obersten Reihe kommt. An Thomas Manns »Zauberberg« aus dem Regal der Eltern zum Beispiel, an den sie sich lange nicht gewagt hat. Bücher sind aus Christine Westermanns Leben nicht wegzudenken, sie sind für sie Fenster in andere Leben. Dabei war ihr Weg zum Lesen kein selbstverständlicher, eher ein Hindernislauf. Mit welchen Büchern ist sie aufgewachsen, welche sind noch heute eng mit ihrem Leben verknüpft? Warum hat das Lesen lange Zeit nur eine kleine Rolle in ihrem Leben gespielt? Feinsinnig und mit wunderbarer Selbstironie erzählt sie, wie sie zur Literatur fand – und begibt sich dabei auf eine fesselnde Zeitreise in ihre eigene, von Brüchen gezeichnete Familiengeschichte.
Inhaltsverzeichnis
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Danksagung
Vorgestellte Bücher in »Die Familien der anderen«
Ich teile alle Bücher in zwei Sorten ein: solche, die mir gefallen, und solche, die mir nicht gefallen.
Ein anderes Kriterium habe ich nicht.
Anton Tschechow (Čechov)/1860–1904
1
Ein Klassiker ist ein Buch, das jeder gelesen haben möchte, aber keiner lesen will.
Mark Twain
Mein lieber Mann. Da kommt es ja gleich ziemlich dicke. Fast tausend Seiten. Das wird beim Lesen kein Schnelldurchlauf werden, das ist wohl auch dem Autor klar. Im Handumdrehen, schreibt er, werde der Leser mit der Geschichte nicht fertig werden. Die sieben Tage einer Woche würden dazu nicht reichen und auch sieben Monate nicht.
Am besten, so fährt der Autor im Vorwort selbstgewiss fort, mache sich der Leser im Voraus nicht klar, wie viel Erdenzeit ihm verstreichen wird, während sie ihn umsponnen hält. Jene Geschichte, die ihm in höchstem Maße erzählenswert erscheint.
Und es werden, das fügt er begütigend hinzu, ja nicht geradezu sieben Jahre sein.
Na, da habe ich ja wirklich Glück gehabt, vermutlich keine sieben Jahre, aber unter einem Jahr komme ich wohl nicht davon, das Gefühl habe ich deutlich.
Es kommt noch schlimmer. Er neige der Ansicht zu, schreibt der Mann, dass nur das Gründliche wahrhaft unterhaltend sei.
Heißt im Klartext, was unter 984 Seiten daherkommt, taugt seiner Meinung nach nichts.
Sieht also so aus, als habe ich zeitlebens die falschen Bücher gelesen. Es waren viele dabei, fast würde ich sagen, es waren die meisten, die nicht mehr als 350 Seiten, 400 Seiten aufzuweisen hatten. Nicht immer waren sie gründlich erzählt. Vielleicht aber gerade deshalb besonders unterhaltend.
Weil eben etwas im Ungefähren blieb, weil man das Buch sinken ließ, um den Faden selbst weiterzuspinnen. Ich habe jene Romane gelesen, weil sie gut erzählt waren, mich unterhalten, mich oft genug auch etwas gelehrt haben. Über das Leben der anderen, in denen ich meines wiedergefunden habe.
Der Autor nennt sich selbst den raunenden Beschwörer des Imperfekts.
Uff. Nicht wirklich, oder?
Der raunende Beschwörer des Imperfekts, das war’s dann wohl. Das wäre genau die Stelle, an der ich das Buch entnervt beiseitelegen würde. Nach nicht mal einer Seite Vorwort. Aussortiert wegen nervender Selbstbeweihräucherung des Autors. Und natürlich auch wegen der angedrohten sieben Monate plus X Lesezeit.
Nur kann ich diesen Roman nicht einfach so beiseiteschieben. Nicht den Roman eines Nobelpreisträgers für Literatur.
Nicht einen Roman, den man gelesen haben muss, weil er zur Weltliteratur gehört.
Ein Buch, das die ganze Welt gelesen hat?
Wer bestimmt, was Weltliteratur ist?
Hinterfrage ich erst gar nicht, sondern beuge mich dem Diktat, das ich selbst aufgestellt habe.
»Der Zauberberg« von Thomas Mann. Seit er zu Hause im Bücherregal im Wohnzimmer hinter Glas stand, schleiche ich um ihn herum. Gefühlte 60 Jahre.
Hellgrün mit silberner Schrift auf dem Buchrücken. Ein Trumm von einem Buch, damals wie heute, unnahbar, etwas Heiliges, zu dem der Zutritt nicht jedermann gestattet war.
Neben dem Zauberberg stand »Der große Regen« von Louis Bromfield, einem amerikanischen Autor. An den hätte ich mich locker herangewagt, aber mein Interesse für einen indischen Maharadscha, der auf Regen wartet, hält sich bis heute in Grenzen.
Dritter in der Reihe, der »ADAC-Reiseatlas«. Wie er es hinter Glas geschafft hat, wir aber dennoch beim Reisen nie weiter als bis nach Bocholt kamen, ist mir bis heute ein Rätsel.
Jetzt mache ich mich also viele Jahre später auf in Richtung Davos, werde mich heranwagen an den Zauberberg. Während ich über den Hindernislauf zu den Büchern in meinem Leben schreibe, werde ich ihn zwischendurch in kleinen Häppchen lesen. Vom ersten Kapitel, der »Ankunft«, bis zum letzten, »Der Donnerschlag«.
Ich finde dieses Vorhaben reichlich beängstigend. Nicht nur, weil die Lektüre umfangreich ist. Vor allem, weil ich mich davor fürchte, ich könnte diesen großen Roman der Weltliteratur langweilig finden. Öde, gespreizt. Werde ich mich trauen, das zu schreiben, zu bekennen? An Weltliteratur zu (ver)zweifeln?
Ich werde mich vermutlich durchquälen müssen. Quälbücher haben bei mir sonst nach dreißig Seiten verspielt. Bei Thomas Mann hat fürs Quälgefühl schon eine Seite Vorwort gereicht. Er nennt es natürlich nicht Vorwort, bei ihm heißt es Vorsatz.
Der Zauberberg, das vermute ich einfach mal, stellt große Ansprüche an den Leser, an seine Geduld und seine Bildung. Heißt im Umkehrschluss: Bin ich ungebildet, falls er mich tatsächlich langweilt? Muss man studiert haben, um den Roman literaturgeschichtlich, hauptseminarmäßig einordnen zu können?
Und was passiert, wenn man es nicht getan hat?
Ich bin neugierig, auch auf mich selbst.
Ich werde den Roman lesen, immer mal wieder innehalten und von meinen Fortschritten hier in diesem Buch berichten.
Rückschritte wird es nicht geben, ich ziehe das Projekt Zauberberg durch.
Das ist mein Vorsatz, ich halte durch bis zur letzten Seite, zum letzten Satz. Auch wenn der schon jetzt Schlimmes ahnen lässt: »Wird aus diesem Weltfest des Todes, auch aus der schlimmen Fieberbrunst, die rings den regnerischen Abendhimmel entzündet, einmal die Liebe steigen?«
Ich werde den Zauberberg lesen und besprechen, so wie ich Hunderte von Büchern im Radio und Fernsehen empfohlen habe.
Verrissen, niedergemacht habe ich kein einziges. Vorher habe ich es lieber aussortiert, nicht weitergelesen. Wer bin ich, dass ich öffentlich kundtue, warum mir ein Buch nicht gefällt. Man das bitte auf keinen Fall kaufen oder lesen sollte. Daumen runter, Daumen hoch.
Was fängt ein Leser damit an?
Vergeudete Zeit.
Weitaus überzeugender scheint mir zu beschreiben, warum mir ein Roman gefallen hat. Was mir beim Lesen durch den Kopf und ans Herz ging, das ist mein Ding.
Ich glaube, ich bin da sehr verlässlich.
Wer ein-, zweimal ein Buch gelesen hat, das ich empfohlen habe, weiß, woran er ist.
Kann davon ausgehen, dass die Westermann für ihn ein guter Navigator im Labyrinth der unzähligen Neuerscheinungen ist. Oder eben auch nicht. Vergiss es, Fehlanzeige – wenn die Westermann Bücher empfiehlt, da war noch nie was Gescheites dabei.
»Mich interessiert an Literatur nur der Mensch. Mäuse und Kühe interessieren mich nicht.«
Mich auch nicht, da bin ich mit Marcel Reich-Ranicki einer Meinung.
Jeder Roman, der mehr als fünfhundert Seiten umfasst, ist schlecht. Noch so ein Reich-Ranicki-Satz. Da gehe ich nicht ganz mit, aber fast.
Und jetzt kommt’s.
Bei den dicken Büchern nimmt er eines aus: den Zauberberg. Er kenne keinen besseren deutschen Roman als diesen (und Goethes »Die Wahlverwandtschaften«). Spannend findet er ihn, deswegen sei er so gut.
Also bitte keine Langeweile beim Lesen.
Stimmt, könnte bei 984 Seiten höchst quälend sein.
Ich fang jetzt mal an. Mit dem Lesen und dem Schreiben.
Erster Satz in Thomas Manns Zauberberg:
»Ein einfacher junger Mann reiste im Hochsommer von Hamburg, seiner Vaterstadt, nach Davos-Platz im Graubündischen.«
Der erste Satz in meinem Buch?
Den suche ich noch.
2
Ich erzähle eine Geschichte. Und das ist alles.
Georges Simenon
Ich fange meine Geschichte mit einer Standortbestimmung an.
Es gab schon früh in meinem Leben zwei sehr unterschiedliche Bücherregale.
Der Zauberberg hinter Glas stand im Wohnzimmer meiner Mutter. Ein paar Straßen entfernt lebte mein Vater mit anderen Möbeln und anderen Büchern.
Dass es mal eine Zeit gab, in der sie sich Tisch und Bett und wohl auch Bücher teilten, weiß ich nur von Fotos. Auf einem dieser Bilder sieht man eine üppige Bücherwand, davor mein Vater in einem Lesesessel, ein Buch im Schoß, eine Stehlampe taucht die Beinahe-Idylle in warmes Licht. Idyllisch ging es vermutlich nicht zu, weil es einen professionellen Fotografen mit Stativ und Scheinwerfern gab, der damals die Fotos von Mutter, Vater, Kind machte. Das Kind, die Legende haben sich später die Eltern so zurechtgelegt, hat sich schon früh für Bücher interessiert, stand mit gerade mal anderthalb vor der Riesenwand, die sich da über ihm auftürmte. Brabbelte vor sich hin, derweil es an den Buchrücken herumfingerte, bis sie endlich nachgaben, sich von den gebundenen Seiten lösten und auf den Boden fielen.
Ich erinnere mich nicht an die Zeit, in der mein Vater, meine Mutter und ich noch eine Familie waren. Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich fünf Jahre alt war. Heute kein großes Ding mehr, so eine Scheidung, aber zu Beginn der 50er-Jahre nicht unbedingt häufig. Man wahrte besser den Schein und blieb zusammen, auch wenn es bei den Bruchstücken einer Ehe nichts mehr zu kitten gab.
Vielleicht konnte bei meinen Eltern auch nie wirklich etwas wachsen, zusammenwachsen. Dafür war die Distanz, die zwischen ihnen lag, von Anfang an zu groß. Meine Mutter war 21, mein Vater 60, als sie heirateten. Die eine fing mit ihrem Leben gerade erst an, der andere bog mit seinem langsam auf die Zielgerade ein. Was vielleicht auch eine naheliegende Erklärung dafür ist, warum ihre Bücherregale so unterschiedlich aussahen.
Die vielen Bücher, die mein Vater im Laufe seines Lebens gelesen hatte, reihten sich in der Erfurter Wohnung zu beachtlichen Regalmetern auf. So viele, dass man an die oberen Bände nur noch mit einer Leiter rankam. Das ist bis heute ein Traum in meinem Leben geblieben. Eine Bücherleiter. Und wenn man die nicht auch noch umständlich auf- und zuklappen muss, sondern elegant von Regal zu Regal schieben kann, hat man es geschafft.
Hin und wieder wird man von Zeitungen mit bunten Blättern freundlich genötigt, sich zu sehr persönlichen Fragen zu äußern. Wie die eigene Beerdigung aussehen könnte. Oder im nächsten Leben der Traummann. Oder welchen anderen Beruf man gerne hätte, wäre man nicht schon für sein Leben gern Journalistin. Gäbe es vielleicht noch einen Zweit-Lieblingsberuf?
Chirurgin natürlich. Da muss ich nicht zweimal nachdenken. Im OP stehen und gucken, wie der Mensch von innen aussieht. Und miterleben, wie so ein Krankenhausbetrieb funktioniert.
Das Innenleben interessiert mich mächtig.
Überall, wenn ich es mir recht überlege. Auch wenn ich zum Beispiel im Zirkus sitze und nach der perfekten Lachnummer am liebsten mit den Clowns hinter dem Samtvorhang verschwinden würde, um zu sehen, was passiert. Wenn es nicht mehr komisch ist.
Oder als Fußballer in einer Kabine zu sitzen, wenn man gerade einen spielentscheidenden Elfmeter versemmelt oder einem der FC Bayern mal wieder fünf Tore reingedrückt hat. Das Leben der anderen, da möchte ich reingucken, das ist es vielleicht auch, was mich zu Büchern hinzieht. Lesen, wie es auch gehen kann mit dem Leben.
Als ich 13 Jahre alt war, hatte ich keine Ahnung, wie es gehen könnte. Mit dem Weiterleben. Die Verbindung zu meinem Vater, die so eng und innig war, wurde überraschend gekappt. Er starb innerhalb weniger Tage.
Es gab niemanden, dem ich geglaubt hätte, dass es weitergehen könnte. Dass der Tod des Vaters nicht das Ende des eigenen Lebens bedeutet. Vielmehr eine der Herausforderungen ist, die das Leben oft unerwartet bereithält. An der man scheitert. Oder wächst. Das habe ich erst viel später verstanden.
Was ich in dieser Zeit der inneren Orientierungslosigkeit gelesen habe?
»Sie blieb draußen stehen, nachdem die Eltern sie verlassen hatten. Die frische Herbstluft kühlte ihre heißen Wangen. Die Lichter des Krankenhauses waren kleine goldene Punkte in der Dunkelheit.
Hinter ihr öffnete jemand die Tür. Susy wusste, dass es Bill war. Er trat neben sie. So standen sie eine Weile Seite an Seite, ohne zu sprechen, und sahen auf die Lichter des Krankenhauses, das sie liebten; die blinkenden Lichter der Krankensäle, die Dächer, die sich schwarz gegen den Himmel abhoben. Der Wind flüsterte in den Ulmenblättern und spielte mit den Efeuranken, die sich an rote Ziegelwände und grauen Granit klammerten.
Weit unten in der Straße ließ ein Krankenwagen seine schrille Signalglocke ertönen und forderte freie Bahn für seine eilige Fahrt zum Krankenhaus – zu jungen Ärzten und Krankenschwestern. ›Sie sind bereit, ebenso wie wir bereit sind‹, sagte Bill.«
Ende der Geschichte. Ein glückliches natürlich. Schwester Susanne und Assistenzarzt Bill kriegen sich. Heiraten, haben Kinder, das volle Programm.
Ich kann mich nicht erinnern, ob ich damals schon begriffen habe, wie süßlich dieser Heile-Welt-Kitsch daherkam. Aber dass ich mir wünschte, meine Welt möge auch wieder heile sein, das weiß ich noch.
Der erste Band der Susanne-Barden-Krankenschwester-Geschichte erschien 1936, der letzte Anfang der 50er-Jahre. Die Autorin Helen D. Boylston war selbst lange Jahre Krankenschwester, bevor sie mit dem Schreiben begann. Die Barden-Bücher waren in den USA sehr erfolgreich, nicht nur wegen der blinkenden Lichter des Krankenhauses, in deren Schein sich Schwester Susanne Barden und Assistenzarzt Bill Barry das erste Mal küssten. Sie wurden von Lesern und Kritikern auch geschätzt, weil sie ziemlich unsentimental und lebensnah den Beruf der Krankenschwester beschrieben.
Für ein neues Rollenverständnis warben.
Die Bücher hatten verheißungsvolle Titel wie »Reifen und Wirken« oder »Weite Wege«.
Am Ende dieses weiten Weges sollten für Susanne Barden zwar durchaus Ehemann und Kinder stehen, aber zwischen den Zeilen konnte man, wenn man es denn wollte, ein Plädoyer lesen für die Unabhängigkeit der Frauen in den 30er- und 40er-Jahren des letzten Jahrhunderts.
Titel einer der sieben Bände war: »Zeig, was du kannst.« »Lass dir Zeit, zeig, dass du es allein kannst, bevor du dich endgültig bindest«, heißt es an einer Stelle.
Die Autorin Helen D. Boylston hat das getan. Sie wollte wie ihr Vater Medizin studieren, aber die Ausbildung schien ihr zu langwierig, zu groß die Hindernisse, die ihr männliche Kollegen in den Weg stellen würden. Sie wurde stattdessen Krankenschwester. Ging im Ersten Weltkrieg mit einer Gruppe von Ärzten nach Frankreich, versorgte Verwundete, spezialisierte sich auf Anästhesie. Machte eine Spezialausbildung zur Psychiatrieschwester. Schrieb Bücher. Wurde erfolgreich. Hat gezeigt, was sie kann. Wollte diese Erfahrung weitergeben an junge Mädchen, wie ich eines war.
Gebunden hat sie sich nie, sie blieb unverheiratet. Wie viele Dr. Bills ihren Weg gekreuzt und ihr Bett geteilt haben, ist nicht überliefert.
Ist jetzt natürlich ein verwegen weiter Bogen, den ich spanne, wenn ich behaupte, mein Wunsch, Chirurgin zu werden, habe möglicherweise etwas mit Helen D. Boylstons Büchern zu tun, die ich als junges Mädchen gelesen habe. Zu zeigen, was ich kann. Am besten in einem Krankenhaus, denn da war die Wahrscheinlichkeit am größten, einem Wiedergänger von Dr. Bill zu begegnen, der um meine Hand anhalten würde. Happy End. Die Welt wieder im Lot.
Etwas an diesem Bild stimmt heute nicht. In den mehr als achtzig Jahren seit Erscheinen des ersten Susanne-Barden-Buches hat sich das Bild gewandelt. Ist die Rolle der Frau in der Gesellschaft eine andere geworden.
Das Happy End müsste im Idealfall so aussehen: Die Chirurgin Susanne fragt den Krankenpfleger Bill, ob er ihr Mann werden möchte.
Weite Wege?
Es war ein Tag im März 1953, der das Leben meines Vaters und das unserer Kleinfamilie komplett auf den Kopf stellte. Jener Tag, an dem er aus seiner Heimatstadt Erfurt in den Westen, in die Bundesrepublik, floh.
Mein Vater war bekannt als einer, der den Nationalsozialisten die Stirn geboten hatte. Der seinen Sohn im zweiten Jahr des Krieges verloren hatte, ein junger deutscher Soldat, getötet von einer Granate auf einem Feld bei Smolensk.
Als mein Vater Hitler einen Verbrecher nannte, kam er ins Zuchthaus. Gründete nach Kriegsende in der sowjetisch besetzten Zone mit Gleichgesinnten die Liberaldemokratische Partei Deutschlands.
Als sie zur Blockpartei ohne Einfluss mutierte, weigerte er sich, der SED beizutreten. Aus seiner Abneigung gegen die Kommunisten hatte er ohnehin nie einen Hehl gemacht.
Heute weiß ich, dass es auch Bücher aus jenem Regal in Erfurt waren, die ihm den Mut gaben, für eine gerechte Sache einzutreten.
Er kam als Regimegegner auf eine schwarze Liste, Endstation ein Straflager in der Sowjetunion. Er war damals noch immer gut vernetzt, wurde gewarnt, als die Verhaftungswelle anrollte. Er packte eine Aktentasche mit wichtigen Papieren, mehr konnte er nicht mitnehmen bei seiner Flucht nach Westberlin im März 1953.
Er fing kurz vor der Pensionierung im Westen noch mal von vorne an. Hatte alles zurückgelassen, was ein Leben gemeinhin ausmacht. Freunde, Erinnerungsstücke, alle Bücher in den hohen Regalen mit der Leiter.
Wie eng einige dieser Bücher mit seinem Leben verknüpft waren, das habe ich erst nach und nach verstanden. Als Kind konnte ich nur ahnen, dass sie etwas direkt mit ihm zu tun haben mussten. Warum sonst hat er mich gebeten, sie zu lesen?
Vielleicht ist es genau das, was mich auch jetzt noch, viele Jahre nach seinem Tod, traurig macht. Keine Chance gehabt zu haben, mehr als nur ein paar Bruchstücke aus seinem Leben vor meiner Geburt zu erfahren. Hinterlassene Bücher als Puzzlestücke, mit denen ich versuche, mir ein Bild von dem Mann zu machen, der mein Vater war.
Er wurde Ende des vorletzten Jahrhunderts geboren. Als junger Soldat im Ersten Weltkrieg in die Schlacht von Verdun geschickt, die er mit einer schweren Kopfverletzung überlebte. Er heiratete, war mit seiner ersten Frau mittendrin im Getümmel der Goldenen Zwanzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts.
Es gibt ein vergilbtes rötlich braunes Foto von den beiden, sie schwingen die Beine, sieht nach Charleston aus, aber vielleicht ist es auch nur das Klischee, das ich von jener Zeit im Kopf habe.
Später die Machtergreifung, der Beginn des Zweiten Weltkrieges, in dem er gleich zu Beginn seinen Sohn verliert. Seine Frau erleidet einen Schock, stirbt wenig später.
Mein Vater hält sich nicht mehr zurück, er macht aus seiner Abscheu gegen Hitler und die Nazidiktatur keinen Hehl. Er arbeitet zu dieser Zeit im Erfurter Rathaus, macht öffentlich, was er in der BBC, dem »Feindsender«, über Konzentrationslager und Kriegslage gehört hatte. Eine Mitarbeiterin schwärzt ihn an. Gestapo, Verhöre, kurzer Prozess. Das Urteil: Haftstrafe im Zuchthaus, danach Überstellung ins Konzentrationslager Buchenwald als politischer Häftling. Buchenwald war nicht weit, zwischen KZ und Zuchthaus lagen gerade mal 50 Kilometer.
Vor ein paar Jahren war ich für eine Fernsehdokumentation über meine Vorfahren in dem Zuchthaus nahe Arnstadt.
Ging in die Zelle, die man meinem Vater damals zugewiesen hatte. Wenn man sich vor dem kleinen Zellenfenster auf die Zehenspitzen stellte, sah man einen üppigen, alten Kastanienbaum. Was ging wohl in meinem Vater vor, wenn er auf die Kastanie blickte, habe ich mich gefragt. Wie groß war seine Angst, wie ist er mit seiner Trauer und Verzweiflung umgegangen? Wie stark war er? Wer hat ihm geholfen, was hat ihn getröstet?
Jenen Baum zu sehen, auf den mein Vater schon geblickt hatte, hat mich emotional ziemlich durcheinandergewirbelt. Es waren Gefühle von Traurigkeit, von Wehmut, von Stolz und der absurde Wunsch, ihm beizustehen, ihm zu helfen. Wo es doch schon lange nichts mehr zu helfen gab. 1944 sollte er ins Konzentrationslager Buchenwald überstellt werden. Einer seiner guten Freunde, der als überzeugter Nationalsozialist beste Kontakte hatte, konnte das verhindern, mein Vater blieb im Zuchthaus. Ein paar Jahre nach Kriegsende wird jener Retter und Freund mein Großvater werden. Mein Vater heiratet dessen Tochter, die um so vieles jünger ist. Die beiden Männer kannten sich schon viele Jahre, ihre politischen Ansichten hatten sie entzweit, aber die Freundschaft hielt. Wenn mein Großvater sich mit den Nazileuten zum Skat im großen Wohnzimmer traf, schloss er die Vorhänge. Geheimes Zeichen für meinen Vater, jetzt mal besser nicht raufzukommen.
Bei Kriegsende kommt mein Vater frei. Als die Amerikaner in Thüringen einmarschieren, machen sie ihn übergangsweise zum Bürgermeister, später wird er Verwaltungsdirektor des Erfurter Theaters.
Was hätte er mir alles erzählen wollen, wenn ich endlich alt genug gewesen wäre, ihn zu fragen? Die Zusammenhänge zu verstehen? Was erzählen mir stattdessen die Bücher, die er mir hinterlassen hat?
An einem Dezembertag im Jahr 1905 bekam Bertha von Suttner den Friedensnobelpreis. Eine Sensation, gleich zweifach. Eine Frau als Preisträgerin, das war unerhört, schier undenkbar.
Ausgezeichnet auch noch für ein Antikriegsbuch.
»Die Waffen nieder!«: Aus der Sicht einer Frau beschreibt sie, welches persönliche Leid Kriege anrichten, die von Männern angezettelt werden.
Vier Kriege erlebt die Protagonistin Gräfin Martha Althaus. Sie ist Österreicherin, verliert ihren ersten Mann 1859 im Krieg Österreich gegen Sardinien.
Sie heiratet wieder, der zweite Ehemann wird im Krieg Österreich gegen Preußen verwundet, später erschossen.
Bertha von Suttner schildert die Grausamkeiten auf den Schlachtfeldern bis ins Detail, die Verletzungen der Soldaten, ihre Verstümmelungen, das Leid und den Schmerz der Familien, der Frauen, die mit Kindern zurückbleiben.
Sie schrieb nicht einfach nur ein leidenschaftliches Plädoyer gegen den Krieg.
Sie verpackt den Wahnsinn zweier kurz aufeinanderfolgender Kriege in einen Roman, erzählt die Lebens-und Liebesgeschichte einer jungen Frau. Die Liebe, der Glanz und Glamour der Donaumonarchie mit ihren ausschweifenden Festen, spielen eine wichtige Rolle. Bertha von Suttner hat das ganz bewusst so geschrieben, weil sie möglichst viele Menschen aus möglichst unterschiedlichen Schichten mit ihrem Buch erreichen wollte.
Zunächst aber will es keiner lesen. Sie geht mit dem Manuskript von Verlag zu Verlag, es wird immer wieder abgelehnt. Geduld bringt Rosen, sagt ein tschechisches Sprichwort, schließlich erbarmt sich einer, der Roman wird gedruckt.
»Die Waffen nieder!« wird ein Bestseller, in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt, erscheint in drei Dutzend Auflagen. Die Leser lieben das Buch, die Kritiker schreiben es nieder.
Einer schmäht das Buch mit den Worten: »Wo Männer fechten, hat das Weib zu schweigen.«
Der junge Rainer Maria Rilke empört sich und schreibt: »Es gibt kein Waffen nieder, weil’s keinen Frieden ohne Waffen gibt.«
Rilke war 17, er wusste es (noch) nicht besser. Verherrlichte den Kampf, stimmte gemeinsam mit Thomas Mann 1914 zu Beginn des Ersten Weltkrieges in die allgemeine Begeisterung ein.
»Die Waffen nieder!« erschien 1889, im Geburtsjahr meines Vaters.
25 Jahre später begann der Erste Weltkrieg, mein Vater wurde Soldat, in der Schlacht um Verdun 1916 schwer verletzt. Es gibt ein Schwarz-Weiß-Foto, das ihn in einem Lazarett zeigt, er sitzt mit einem Verbandsturban in seinem Bett, um ihn herum Krankenschwestern, alle strahlen um die Wette. Schließlich war mein Vater ein Überlebender, dem Gemetzel zwischen Franzosen und Deutschen entkommen. Nicht unversehrt, nein, eine Kugel aus einem französischen Gewehr traf seinen Kopf. Noch viele Jahre später zeigte eine kleine Delle knapp oberhalb seiner Stirn, wo sie eingetreten war. Die Ärzte hatten Angst, im Hirn noch größeren Schaden anzurichten, wenn sie versuchten, die Kugel zu entfernen, und so ließen sie das Ding da, wo es eingedrungen war. Mein Vater lief also mit einer Kugel im Kopf durchs Leben. Dass sie möglicherweise in seinem Kopf wandern, die Position wechseln würde, haben die Ärzte ihm damals nicht gesagt.
Die Schlacht bei Verdun dauerte fast ein Jahr, war nicht nur die längste, sondern auch die verlustreichste des Ersten Weltkrieges.
Was mein Vater in diesen langen Monaten in den Schützengräben erlebt hatte, machte ihn zu einem überzeugten Pazifisten, der nicht müde wurde, den Irrsinn eines jeden Krieges anzuprangern.
»Die Waffen nieder!«, jener Titel, den Bertha von Suttner für ihr Buch gewählt hatte, wurde ihm zeitlebens zu einer Herzensangelegenheit.
Außen dunkelroter Stoffeinband, innen Frakturschrift, die Seiten vergilbt, weil schon lange im Gebrauch, oft gelesen. An den Seitenrändern Anmerkungen meines Vaters, ich kann sie nicht lesen, sie sind in Sütterlin geschrieben. Die Handschrift, die mein Vater in der Schule lernte.
Ich war zwölf oder dreizehn Jahre alt, als er mir das Buch von Bertha von Suttner gab. Zu früh für ein fast noch Kind, für ein junges Mädchen?
Ich glaube nicht.