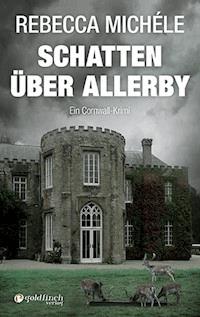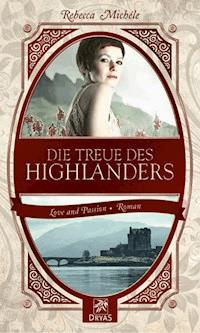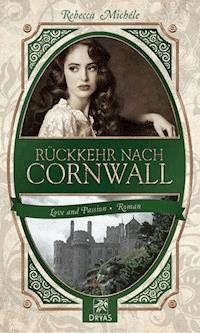9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ich will einfach alles wissen – aber heiraten tue ich nie!« Schon die junge Maria Gräfin von Linden interessierte sich mehr für die Natur als fürs Handarbeiten. Sie war 1891 Württembergs erste Abiturientin und die erste Studentin an der Universität in Tübingen. 1910 wurde ihr als erster deutscher Naturwissenschaftlerin der Professorentitel verliehen. Auch privat lebte sie unkonventionell und nahm sich das Recht heraus, zu lieben, wen sie wollte – blieb aber tatsächlich unverheiratet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Komtess Maria von Linden, 1869 geboren und aufgewachsen auf Schloss Burgberg am Rand der Schwäbischen Alb, weiß schon als Kind, dass sie anders ist als die anderen Mädchen in ihrer wohlbehüteten Gesellschaft. Statt für Handarbeiten und Puppen interessiert sie sich für die Natur, die Tiere und Pflanzen um sie herum. Gegen die Widerstände des Elternhauses gelingt dem wissensdurstigen und begabten Mädchen die Zulassung zum Abitur am Stuttgarter Realgymnasium. Kurz darauf wird sie erste Studentin an der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Tübingen. Hartnäckig kämpft sie für das Recht der Frauen auf Bildung und für ihren eigenen Weg in der männerdominierten Wissenschaftswelt. 1910 wird der Zoologin und Parasitologin als erster deutscher Frau der Professorentitel verliehen. Auch privat lebt Maria von Linden unkonventionell und nimmt sich das Recht heraus, denjenigen zu lieben, den sie will. Ihrem Leitspruch in der Kindheit bleibt sie allerdings treu – sie heiratet niemals.
Von Rebecca Michéle ist bei dtv außerdem erschienen:
Das Geheimnis des blauen Skarabäus
Rebecca Michéle
Die Farben der Schmetterlinge
Roman
Die Frau soll studieren, weil jeglicher Mensch Anspruch hat auf die individuelle Freiheit, ein seiner Neigung entsprechendes Geschäft zu betreiben.
Hedwig Dohm, 1893
Deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
Prolog
Straßburg – 1894
Auf den ersten Blick war Maria verliebt. Verliebt in die großen schiefen Fachwerkhäuser und die engen verwinkelten Gassen mit den schmalen Durchlässen. Verliebt in die Delikatessengeschäfte und Patisserien, in deren Schaufenstern die feinsten herzhaften und süßen Köstlichkeiten lagen. Allein beim Anblick lief ihr das Wasser im Mund zusammen. Leichtfüßig erklomm Maria die über dreihundert Stufen zum Turm der Cathédrale Notre-Dame. Von der Aussichtsplattform ging der Blick weit über die Dächer der Stadt bis hin zum Elsass, zum Schwarzwald und zu den Vogesen, die im Sonnenlicht bläulich schimmerten. Auch die Menschen schloss Maria sofort in ihr Herz. Obwohl Straßburg und Elsass-Lothringen mehr als zwanzig Jahre zuvor dem Deutschen Reich zugesprochen worden waren, fühlte sich Maria wie in Frankreich. Sie liebte das Land und die sanfte, melodische Sprache seit ihrer Kindheit. Hier perlte das Leben wie Champagner in einem edel geschliffenen Glas. Auch die Luft roch anders, köstlicher als in Marias Heimat. Sie schnupperte Zwiebeln, Knoblauch und Gewürze, die ihr unbekannt waren. Die Gerüche drangen aus den Restaurants rund um die mächtige Kathedrale, und überall waren Tische und Stühle vor die Lokale gestellt.
Heute war Maria unterwegs zu einer Adresse am nordwestlichen Stadtrand. Keinesfalls wollte sie sich in Pierres Privatleben einmischen, denn er hatte sie um einen Besuch bei seiner Familie, über die er sich sowieso ausschwieg, nicht gebeten. Obwohl Maria seit Wochen mit dem Franzosen zusammenarbeitete, war ihr Pierres Vergangenheit ein Rätsel. Sie wusste über sein Leben in Straßburg nahezu nichts.
»Was ist schon dabei, seinen Eltern bonjour zu sagen und zu erzählen, dass sich Pierre in Tübingen gut eingelebt hat?«, murmelte Maria, während sie zügig ausschritt. Leider hatte eine vordringliche Forschungsarbeit verhindert, dass Pierre sie auf der Reise in seine Heimatstadt begleitete.
Etwas mulmig war ihr schon zumute, denn Pierre war weit mehr als nur Marias Mitarbeiter. Er war ihr Freund und Geliebter. Der Mann, mit dem sich Maria eine Zukunft vorstellen konnte. Heiraten, Kinder, ein kleines hübsches Haus … Ob in Tübingen oder im Elsass, das war gleichgültig. Wobei sie sich einen dauerhaften Wohnsitz im zauberhaften Straßburg durchaus vorstellen konnte. Von einer Ehe hatte Pierre bisher nicht gesprochen, ihre intime Freundschaft war aber auch noch jung. Zu Hause sollte vorerst niemand davon erfahren. Maria fand es aufregend, ein Geheimnis zu haben. Das war wie das Salz in der Suppe dieser Beziehung und machte jedes verstohlene Treffen zu einer prickelnden Begegnung.
Nachdem Maria ihr Ziel erreicht hatte, blieb sie stehen und betrachtete die dreistöckige Villa aus dunklen Klinkersteinen und den weißen Fensterrahmen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Das Haus mit seinem hübschen Vorgarten lag in einer guten Wohngegend und war gepflegt. Jetzt klopfte ihr Herz schneller. Wie Pierres Familie wohl war? Seine Mutter, die den Haushalt führte, und sein Vater, der, wie Maria wusste, Rechtsanwalt war? Maria überquerte die Straße, stieg fünf Stufen zur Eingangstür hinauf und betätigte zweimal den Messingklopfer.
Ein Hausmädchen in einem dunkelgrauen Kleid mit einer blütenweißen Schürze und ebensolcher Haube öffnete die Tür. »Bonjour. Ils souhaitent?«
Maria nannte ihren Namen. »Ich möchte Madame Beaudemont Grüße von ihrem Sohn Pierre ausrichten. In Württemberg arbeiten wir zusammen, und ich weile zu Forschungszwecken derzeit in Straßburg«, sagte sie auf Französisch.
»Ihrem Sohn?« Das Mädchen stutzte und runzelte die Stirn, öffnete die Tür dann ganz und bat Maria herein.
Maria trat in eine kleine quadratische Vorhalle mit hellem Fliesenboden, geschmackvoller mintgrüner Tapete und einer filigran gearbeiteten Kommode, über der ein goldgerahmter Spiegel hing. Marias erster Eindruck bestätigte sich. Die Familie war bestimmt finanziell gut gestellt.
Das Mädchen bat um Marias Mantel. »Ich gebe Madame Beaudemont Bescheid«, sagte das Mädchen und bat um Marias Mantel. Es vergingen nur ein paar Minuten, dann kehrte sie zurück. »Madame erwartet Sie im Salon.«
Sie öffnete eine der drei Türen, die von der Halle abgingen, und ließ Maria an sich vorbei eintreten. Auf einem mit Chintz bezogenen Diwan saß eine Frau mit einer bunt bestickten Decke über Bauch und Beinen. Sie war noch jung, jünger als Maria, und mit ihrem goldblonden Haar ausgesprochen schön.
»Bitte verzeihen Sie, dass ich nicht aufstehe«, sagte die Frau mit heller, klarer Stimme. In ihren hellblauen Augen lag ein trauriger Ausdruck. »Das Mädchen sagt, Sie kommen aus Tübingen?«
»Ja, Madame Beaudemont. Ich bin Maria von Linden und arbeite zusammen mit Monsieur Beaudemont im Laboratorium der Universität«, antwortete Maria, während ihr der Gedanke durch den Kopf schoss, dass diese junge Frau unmöglich Pierres Mutter sein konnte. Vielleicht seine Schwester? Pierre hatte aber nie von einer Schwester gesprochen, sondern nur zwei Brüder erwähnt. »Sie sind doch Madame Beaudemont?«, fragte sie vorsichtig.
»Sicherlich«, erwiderte die Frau lächelnd, aber der Ausdruck in ihren Augen hatte etwas Trauriges. Mit einer Handbewegung deutete die Frau auf den nächststehenden Stuhl. »Bitte, setzen Sie sich. Ihr Französisch ist ausgezeichnet.«
Maria ließ sich auf der Kante des Stuhls nieder. Jetzt erst bemerkte sie unter der Decke die deutliche Wölbung. Marias Magen krampfte sich zusammen. Ihr feines Gespür sagte ihr, dass sie gar nicht erfahren wollte, was unweigerlich folgen würde.
»Sie bringen Nachrichten von meinem Mann?«, fragte Madame Beaudemont prompt. »Hat er gesagt, wann er wieder nach Hause kommt? Jetzt, wo es nicht mehr lange dauern wird …« Ihre Hand legte sich auf ihren Bauch.
»Professor Eimer wird Verständnis zeigen, wenn P… Docteur Beaudemont bald wieder bei seiner Familie sein möchte.« Ihre eigene Stimme klang fremd in Marias Ohren, und als würde sie aus weiter Ferne kommen. Jahrelang in Disziplin geschult, zeigte keine Regung in Marias Gesicht ihre innere Erregung und Enttäuschung. Zugleich empfand sie Empörung und eine grenzenlose Wut. »Nächste Woche kehre ich nach Tübingen zurück, dann wird Ihr Mann bestimmt entbehrlich sein«, fügte sie unter großer Selbstbeherrschung hinzu. Ihre Zunge schien wie Blei in ihrem Mund zu liegen.
»Das wäre schön.« Pierres Frau seufzte. »Es ist unser erstes Kind, Mademoiselle de Linden. Natürlich verstehe ich, dass für meinen Mann die Arbeit Vorrang hat und der Aufenthalt in Deutschland für seine Forschungen unverzichtbar ist und ihn auf dem Weg, Professor zu werden, voranbringt. Ich wusste, auf was ich mich einlasse, als ich einen ehrgeizigen Wissenschaftler heiratete. Trotzdem wäre ich froh, wenn er gerade jetzt an meiner Seite wäre.«
»Wie lange sind Sie denn schon verheiratet?«
Die Frage schien Madame Beaudemont nicht zu stören. »Etwas über zwei Jahre«, antwortete sie offen. »Da ist eine so lange Trennung besonders schmerzhaft.«
Maria stand auf. Ihre Knie zitterten, die Beine vermochten sie kaum zu tragen. »Danke für Ihre Zeit, Madame Beaudemont. Ich werde Ihre Grüße Monsieur Docteur ausrichten.«
»Merci, Mademoiselle de Linden. In einem seiner Briefe erwähnte mein Mann Ihren Namen und schrieb wohlwollend über Sie.« Marias Herzschlag setzte für einen Moment aus. »Sie sind die erste Studentin in Ihrem Königreich, außerordentlich begabt, zielstrebig und ehrgeizig. Gegen alle Widerstände werden Sie Karriere als Wissenschaftlerin machen. Ich bewundere Sie für Ihre Entschlossenheit und Energie.«
Marie neigte den Kopf. »Merci beaucoup, Madame Beaudemont. Ich wünsche Ihnen alles Gute.« Maria wusste nicht, wie es ihr gelang, so gelassen zu bleiben und dabei noch zu lächeln.
»Merci, Mademoiselle de Linden, ebenfalls für die Grüße meines Mannes.« Die Frau lächelte verlegen und legte eine Hand auf ihren Bauch. »Das Kleine meldet sich gerade wieder mit kräftigen Stößen. Sie werden es eines Tages, wenn Sie das Glück der Mutterschaft ereilt, selbst erleben, Mademoiselle.«
»Davon ist auszugehen.«
Mit einem hastig gemurmelten Au revoir floh Maria geradezu aus dem geschmackvoll eingerichteten Zimmer, durch die Halle, aus dem Haus hinaus und die Straße entlang. Erst an der zweiten Straßenkreuzung blieb sie stehen. Sie japste nach Luft, und ihre Augen brannten, ohne dass Tränen aufgestiegen wären. Das Blut rauschte in ihrem Kopf. Die Wut wuchs wie ein hässliches Geschwür in ihrem Magen. Am liebsten hätte sie laut geschrien und mit den Fäusten gegen die nächstbeste Hausmauer getrommelt. Ihr Leben lang daran gewöhnt, ihre Gefühle unter Kontrolle zu halten, straffte sie jetzt die Schultern und setzte ihren Weg gemächlichen Schrittes fort. Neben der grenzenlosen Enttäuschung war sie so zornig wie nie zuvor in ihrem Leben. Wie hatte sie nur derart blind sein können?
»Mich trifft keine Schuld«, sagte sie laut zu sich selbst.
Es hatte keine Anzeichen gegeben, dass Pierre Beaudemont ein so gerissener Lügner und Betrüger war.
Maria erreichte den großen Platz vor der Kathedrale. An dem sonnigen, warmen Frühlingstag herrschte dort rege Betriebsamkeit. Männer und Frauen eilten geschäftig an ihr vorbei, Kinder spielten mit Bällen und Reifen, Fuhrwerke ratterten über das Kopfsteinpflaster und Händler lieferten ihre Waren aus. Eine elegant gekleidete Dame, etwa in Marias Alter, saß auf einer der grün gestrichenen Bänke und blätterte in einer kleinen handlichen Zeitung. Sie trug keine Kopfbedeckung. Das war es aber nicht, warum sie Marias Aufmerksamkeit auf sich zog.
Zielstrebig trat Maria näher. »Excusez-moi, Mademoiselle. Sind Sie so freundlich, mir zu verraten, wer Ihnen das Haar geschnitten hat?«
»Mein Haar?« Die Dame griff sich an den Kopf und sah Maria skeptisch an. »Gefällt es Ihnen nicht?«
»Im Gegenteil!«, versicherte Maria. »Deswegen möchte ich den Namen Ihres Coiffeurs gern erfahren.«
»Charles. Er ist der Beste der ganzen Stadt.« Die Frau mit dem ungewöhnlichen Kurzhaarschnitt, der gerade ihre Ohrläppchen bedeckte, deutete auf eine der Gassen, die von dem Platz abgingen. »Seinen Salon finden Sie gleich da vorn.«
Maria bedankte sich höflich und betrat wenige Minuten später den Frisiersalon.
»Schneiden Sie mir bitte die Haare ab«, forderte sie den Coiffeur auf, während sie die Nadeln aus dem Knoten an ihrem Hinterkopf zog. Ihr dichtes brünettes Haar ergoss sich über ihre Schultern. »So kurz wie bei einem Mann«, fügte sie entschlossen hinzu.
»Aber Mademoiselle!« Der Mann rang verzweifelt die Hände. »Sie haben wundervolles Haar! Es wäre eine Schande –«
»Ich bezahle Sie gut dafür«, fuhr Maria ihm ins Wort und setzte sich unaufgefordert auf einen der freien Stühle. Der Coiffeur seufzte zwar, tat dann aber seine Arbeit. Ein solch exzentrisches Äußeres einer Dame war in Straßburg ja nicht selten, wie Maria bei der Frau auf der Bank selbst gesehen hatte.
Eine Stunde später suchte Maria ein Herrenbekleidungsgeschäft auf. Auch hier äußerte sie ihre Wünsche, auch hier erntete sie verständnislose Blicke und zunächst ablehnende Worte. Dann jedoch eilte ein Geselle herbei und nahm ihre Maße ab. Schließlich war der Kunde König, außerdem war Maria eine Ausländerin.
»Wahrscheinlich ist in Deutschland Herrenkleidung für Damen derzeit in Mode«, hörte sie den Schneider seinem Gesellen zuraunen. »Es soll nicht unsere Angelegenheit sein. Tun wir Mademoiselle einfach den Gefallen.«
Drei Tage später nahm Maria ein Päckchen in Empfang, entrichtete den Preis und verließ den Laden. Ein silbernes Glöckchen bimmelte, als sie auf die Straße trat. Ein zarter, dezenter Klang – für Maria der Beginn eines neuen Lebensabschnittes.
Bitter lächelnd presste sie das Päckchen an ihre Brust. Sie hatte ihre Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung, die überfällig gewesen war. Auch wenn andere hinter ihrem Rücken wieder tuscheln würden, sie sei nicht normal, sei keine richtige Frau, nicht das weibliche Geschöpf, das die Gesellschaft erwartete und einforderte. Dabei fühlte sich Maria ganz als Frau, wollte sich aber nicht in eine Rolle zwängen lassen, weil es eben immer schon so gewesen war.
Bereits als Kind hatte Maria sich über geltende Ordnung hinweggesetzt, hatte Menschen vor den Kopf gestoßen. Immer aber war sie sich selbst treu geblieben, war der Weg auch steinig gewesen.
Und die Zukunft würde in der von Männern dominierten Welt auch nicht einfach sein. Maria war bereit, weiterhin auf die Barrikaden zu gehen und diese, wenn möglich, niederzureißen. Pierres schamlose Lügen waren nur ein weiterer Mosaikstein in dem ganzen Gefüge. Maria hatte die Enttäuschung wohl gebraucht, um den nächsten Schritt zu gehen. Wenn man sie als Frau nicht akzeptierte, musste sie sich eben auch äußerlich den Herren angleichen. Vielleicht erhielt sie dann endlich die Anerkennung, die ihr zustand. Und nach der sie sich schon ihr ganzes Leben lang sehnte.
Seit Marias Kindheit hatte ihre Zielstrebigkeit so manchen an den Rand der Verzweiflung gebracht. Trotzdem war sie nie von ihrem Weg abgekommen und hatte unermüdlich für ihre Träume gekämpft. Sie hatte auch geliebt, geweint und gelacht. Zurückblickend hatten die schönen, glücklichen Momente die Oberhand gehabt. Auch den Verlust Pierres würde sie überstehen. Sie würde sich nicht unterkriegen lassen und ihren Weg unermüdlich fortsetzen.
EINS
Schloss Burgberg auf der Ostalb – 18. Juli 1875
Ein Sonnenstrahl fiel auf den dicken runden Leib und ließ das helle Braun golden aufleuchten. Wie mit einem feinen Pinsel gemalt, war der Körper von weißen Tupfen übersät, die wie ein kunstvoll gearbeitetes Kreuz wirkten.
Vorsichtig streckte Maria einen Finger aus. Kurz vor dem Kopf des Tieres mit den dunklen kreisrunden Augen hielt sie inne. Sie wollte es nicht erschrecken, wollte nicht, dass es davonlief. Maria wollte sich an seiner Schönheit erfreuen, an dem Liebreiz der Natur, wie nur Gott ihn hervorbringen konnte.
»Maria!« Laut klang der Ruf über die steile Wiese mit den alten Obstbäumen bis hin zu der Hecke, hinter der sie saß. Um sie herum blühten weiße und gelbe Rosen in voller Pracht und verströmten einen betörenden Duft. Maria tat, als höre sie nichts.
»Maria! Kind! Wo steckst du nur wieder?«
Leichtfüßige Schritte kamen näher. Maria wünschte, sie könne mit der Hecke eins und nicht gesehen werden, wusste aber gleichzeitig, dass sie sich nicht länger verstecken konnte. Langsam richtete sie sich auf.
»Hier bin ich, Fräulein Bonne.« Sie legte einen Finger an ihre Lippen. »Sehen Sie, was ich gefunden habe! Sie müssen ganz leise sein, sonst läuft sie fort. Sind ihre filigranen und doch kräftigen Beine nicht faszinierend?«
Die noch junge Frau in dem dunkelgrauen Kleid, die aschblonden Haare zu einem Dutt aufgesteckt, der sie deutlich älter wirken ließ, seufzte. »Filigran! Wo hast du denn das Wort aufgeschnappt? Du weißt doch gar nicht, was es bedeu-tet.«
»Das weiß ich sehr wohl!« Unwillig verzog Maria das Gesicht. Ihre Wangen waren gerötet. Dem Impuls, mit dem Fuß aufzustampfen, widerstand sie jedoch.
Wenn sie zornig oder bockig war, würde Fräulein Bonne sie nur wieder ermahnen: »Komtess, Sie müssen lernen, Ihre Gefühle zu beherrschen und sich nicht wie das Kind armer Leute zu benehmen.« Auch von der Mutter würde sich Maria dann eine ausufernde Strafpredigt anhören müssen.
Ruhig und mit der Andeutung eines Lächelns fügte Maria hinzu: »Ich bin immerhin schon sechs Jahre alt.«
»Ja, und zwar genau seit heute, Komtess. Die gnädige Frau ist bereits vor einer halben Stunde eingetroffen. Nach dem langen Weg aus Stuttgart ist sie durstig und möchte ihren Tee trinken.« Sie musterte Maria von Kopf bis Fuß und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. »Meine Güte, wie siehst du wieder aus? Deine Haare sind zerzaust, dein Kleid voller Erde und ein Ärmel zerrissen.«
Betreten zog Maria an der rechten Armmanschette des zartgelben Sommerkleides. Tatsächlich klaffte ein etwa fingerlanger Riss in dem duftigen Stoff. Es musste passiert sein, als sie auf der Suche nach Insekten durch die Rosenhecke gekrochen war. Dabei hatte ihr die Mutter eingeschärft, sich nicht schmutzig zu machen. Schließlich wurde die strenge Großmutter erwartet, deren scharfem Auge nicht der kleinste Fleck entging.
»Ich komme sofort«, murmelte Maria. Vom Kindermädchen unbemerkt schloss sich ihre Hand um das Tierchen. Sie pflückte es aus der Hecke und ließ es in der Tasche ihres Kleides verschwinden. Später in ihrem Zimmer wollte sie die Schönheit und den perfekten Körperbau der Spinne in aller Ruhe betrachten und eine Zeichnung anfertigen.
Während Maria dem Kindermädchen, das sie, ans Französische angelehnt, Fräulein Bonne nannte, zum Haus folgte, strich sie sich mehrmals über das dunkle Haar, um es zu bändigen. Es war ein sinnloses Unterfangen. Marias Haare waren dick, gewellt und so widerborstig wie die eines Ferkels.
Wenn ihre Eltern nur erlauben würden, die Haare abzuschneiden, dachte Maria. Mit dieser Bitte durfte sie ihnen aber nicht kommen. Maria verstand nicht, warum. Ihr Bruder hatte schließlich auch kurze Haare. Das Argument der Mutter, Wilhelm sei ja schließlich ein Junge, konnte Maria nicht gelten lassen. Welche Privilegien genoss denn ein Junge noch? Warum durfte er wählen, wie er das Haar trug? Die Locken ihres Cousins Bertie ringelten sich bis auf dessen Schultern, aber bei ihm mäkelte niemand herum und forderte, er möge sich die Locken kürzen, weil er wie ein Mädchen aus-sah.
Maria seufzte so herzergreifend, dass sich Fräulein Bonne zu ihr umdrehte. »Geht es dir gut, Maria?«, fragte sie besorgt. »Du freust dich sicher, dass deine Großmutter den weiten Weg aus der Stadt gekommen ist, um dir zum Geburtstag zu gratulieren.«
Maria nickte, weil es von ihr erwartet wurde. Natürlich mochte sie die Großmutter. Gleichzeitig fürchtete sie sich auch ein bisschen vor der alten Frau mit dem strengen Gesicht. Ihre steingrauen Augen schienen direkt in Marias Seele zu blicken. Es war unmöglich, vor der Freiin Hiller von Gaertringen, der Mutter ihrer Mutter, etwas zu verbergen.
Auf dem Steilhang lief das Kind dem Fräulein Bonne leichtfüßig davon und huschte vor ihr durch eine niedrige Pforte in den westlichen Flügel des Wohnhauses. Das Gebäude, in dem Maria von Linden geboren worden war, als Haus zu bezeichnen, wurde dem fünfstöckigen Bau nicht gerecht. Schloss Burgberg war, wie der Name es schon sagte, ein mittelgroßes Schloss, erbaut auf den Überresten einer festungsartigen Burg aus dem 15. Jahrhundert. 1838 hatte Marias Großvater, Graf Edmund von Linden, den gesamten Burgberg gekauft und das einst marode Gemäuer zu einem wohnlichen Schloss umbauen lassen. Maria liebte ihr Heim mit seinen zahlreichen Räumen, den Kämmerchen und verwinkelten Fluren und Treppenhäusern. Sie war der festen Überzeugung, irgendwo müsse ein Geheimgang existieren, der vom Burgberg hinunter zu dem Fluss Hürbe und zu der Mühle aus dem 14. Jahrhundert führte. Durch den verborgenen Stollen flohen einst Menschen, um bei Belagerungen ihr Leben zu retten. Allerdings lagen die letzten Kampfhandlungen um den Burgberg über zweihundert Jahre zurück. Seither lebten sie in einer ruhigen und friedvollen Gegend. Wenn Maria ihrer Mutter von ihren Fantasien erzählte, lachte diese sie nicht aus. Im Gegenteil, die Mutter beruhigte sie, dass Schloss Burgberg zwar einmal stark beschädigt, nie jedoch belagert worden war, auch nicht in dem furchtbaren Dreißigjährigen Krieg. Maria hingegen war von der Überzeugung nicht abzubringen, dass sich in den alten Mauern tragische Schicksale abgespielt haben mussten, von denen nur niemand mehr wusste.
Vor der Tür im ersten Stock des Haupthauses, hinter der sich der kleine Salon befand, in dem der Tee serviert wurde, holte Fräulein Bonne Maria wieder ein. Sie war ein wenig außer Atem geraten.
»Warte, Kind.« Aus der Rocktasche holte die junge Frau ein weißes Taschentuch, spuckte zweimal darauf und fuhr mit dem Tuch über Marias Gesicht. Maria rümpfte die Nase. Sie fand es ekelig, aber offenbar war das eine Angewohnheit von Kindermädchen, denn bisher hatten alle ihr das Gesicht mit Speichel geputzt, besonders, wenn Besuch im Schloss war. Dann klopfte Fräulein Bonne an die Tür des Salons und öffnete sie. »Komtess Maria, gnädige Frau«, rief sie hinein.
Mit durchgestrecktem Rücken betrat Maria den Raum, das Kinn hoch erhoben. Auf dem zierlichen Sofa mit den gedrechselten Beinen saß die Großmutter, daneben Maman, wie Maria ihre Mutter nannte, am Tisch gegenüber auf einem Stuhl der Vater.
»Du hast uns warten lassen, Maria«, sagte Marias Mutter, Gräfin Eugenie, geborene Hiller von Gaertringen, tadelnd. »Warst du wieder im Garten?«
Bevor Maria antworten konnte, dröhnte die tiefe, raue Stimme der alten Freiin durch den Raum: »Sei nicht so streng, Eugenie. Es ist Marias Geburtstag, da darf sie die Zeit ruhig vergessen. Komm her zu mir, Kind.«
Maria trat dicht vor die Großmutter und hielt ihrem kritischen, abschätzenden Blick stand, ohne die Lider zu senken. Trotz ihrer jungen Jahre hatte Maria längst festgestellt, dass die Großmutter selbstbewusste Menschen lieber mochte als Duckmäuser, die kuschten und ihr nach dem Mund redeten.
»Herzlichen Glückwunsch, Maria von Linden. Ich finde, du bist recht hochgewachsen für dein Alter. Hoffentlich wirst du nicht so riesig, dass kein Mann dich heiraten will. Männer wollen zu ihren Frauen nämlich nicht aufsehen.«
»Maman, bitte …«, sagte Gräfin Eugenie. »Bis Maria sich Gedanken über eine Ehe machen muss, ist es noch lange hin.«
Ein strenger Blick traf Gräfin Eugenie. »Für ein Mädchen ist es nie zu früh, sich mit der Zukunft zu beschäftigen«, betonte die Freiin. »Das Kind muss lernen, wo sein Platz im Leben ist. Ihr erzieht Maria viel zu nachlässig und lasst ihr Freiheiten, die einer Komtess unwürdig sind.« Mit zwei Fingern hob die Großmutter Marias Kinn und sah ihr in die Augen. »Ich werde eine Woche hierbleiben. Die Zeit werden wir nutzen, um deine Stick- und Strickkünste voranzutreiben. Wenn du mich zu Weihnachten in Stuttgart besuchen kommst, erwarte ich von dir mindestens ein Paar Wollstrümpfe und einen dicken Schal, der mich bei eisigen Temperaturen warmhält.«
Maria verzog die Mundwinkel zu einem Lächeln. Sie verabscheute Handarbeiten! Beim Sticken stach sie sich ständig in den Finger, Blut tränkte die feinen Stoffe, und die Stricknadeln verhedderten sich ständig ineinander, und sie ließ Maschen fallen. Aus dem Augenwinkel schielte Maria zu ihrem Vater. Graf Edmund schwieg, wie meistens, wenn es um Marias Erziehung ging.
»Sicher wartest du schon gespannt auf dein Geschenk«, fuhr die Großmutter fort. Hinter ihrem Rücken zog sie ein in buntes Papier gewickeltes, längliches Paket hervor und reichte es Maria mit einem wohlwollenden Lächeln.
»Danke, Grand-mère«, sagte Maria artig und nahm das Geschenk entgegen. Sie wusste, was es beinhaltete: eine weitere Puppe. Die Großmutter schenkte ihr ständig Puppen, allesamt hochwertig gefertigt und bestimmt sehr teuer. Puppen rangierten in Marias Prioritätenliste jedoch gleich hinter Handarbeiten – am liebsten hatte sie mit beidem nichts zu tun. Wieder dachte sie an ihren vier Jahre älteren Bruder. Zum letzten Christfest hatte Wilhelm eine kleine Maschine bekommen. Wenn man sie mit Wasser füllte und eine Kerze darunter stellte, zischte und dampfte sie. Man konnte sogar ein Hämmerchen anschließen, das sich durch den Druck des Dampfes auf und nieder bewegte. Stundenlang konnte Maria zusehen, wenn sich der Bruder mit der Maschine beschäftigte. Warum bekam sie nicht auch so etwas? Ein solches Gerät war nicht nur interessant, sondern auch nützlich. Eine Puppe hingegen war zu gar nichts nutze, saß nur auf dem Sofa und schien sie aus regungslosen Glasaugen vorwurfsvoll anzustieren, weil Maria sich nicht um sie kümmerte.
Pflichtschuldig bedanke sich Maria ein weiteres Mal, als sie das Geschenk ausgepackt hatte und die Puppe in den Händen hielt. Sie hatte ein fein gearbeitetes, lebensecht bemaltes Gesicht aus Porzellan und trug ein hellblaues Kleid mit zart geklöppelten elfenbeinfarbigen Borten.
Eines der Hausmädchen, Elsa, trat in den Salon und brachte den Tee für die Erwachsenen und für Maria warmen Kakao, dazu eine Kuchenplatte. Maria lief das Wasser im Mund zusammen. So wenig sie Puppen mochte, so sehr liebte sie den saftigen Kuchen, den die Köchin zur Kirschenzeit buk und mit dunklen, im Mund zart schmelzenden Schokoladenstreuseln verzierte. Maria setzte sich auf den freien Stuhl neben ihren Vater, entfaltete die blütenweiße Serviette aus feinstem Leinen und legte sie auf ihren Schoß. Aber kaum hatte Elsa den Kakao eingeschenkt und ein Stück Kuchen für Maria bereitgelegt, ließ sie den Teller mit einem gellenden Schrei unvermittelt fallen. Mit erhobenen Händen wich sie vom Tisch zurück.
»Meine Güte, Elsa, bist du von Sinnen?«, herrschte Gräfin Eugenie das am ganzen Körper zitternde Hausmädchen an.
»Da, da …« Mit einem Ausdruck von Panik im Gesicht, als sei sie dem Beelzebub persönlich begegnet, deutete Elsa auf Marias Rock.
Erstaunt sah Maria an sich hinunter und lächelte. Sie hatte völlig vergessen, dass sie sich das Tierchen in die Tasche gesteckt hatte. Jetzt krabbelte es über Marias Schoß. Vorsichtig nahm sie die Spinne auf die Hand und setzte sie dann auf den Tisch direkt neben der Kuchenplatte. In die Freiheit entlassen, lief das Tierchen schnell davon und verbarg sich unter dem Rand der Platte. Während sich die Gräfin Eugenie die Serviette vor den Mund presste, um ihr Glucksen zu verbergen, zog die Großmutter scharf die Luft ein.
»Pfui, Maria! Wie kannst du nur?«, schimpfte sie zwar, zeigte aber kein Anzeichen von Ekel.
»Ist sie nicht wunderschön?«, fragte Maria versonnen. Ganz anders als beim Auspacken der Puppe zuvor leuchteten ihre Augen jetzt. »Gartenkreuzspinnen sind ganz besondere Tiere. Sie spinnen sehr große Netze, und sie können –«
»Es reicht, Maria! Geh sofort auf dein Zimmer.« Zum ersten Mal erhob Marias Vater das Wort. Trotz der Strenge war sein Tonfall bedächtig, beinahe schleppend. Er sah zu dem immer noch bebenden Hausmädchen. »Elsa, schaffe das Viech aus dem Zimmer.«
Maria sprang auf. »Ich mache das, Elsa könnte ihr wehtun.«
Bevor sie jemand aufhalten konnte, hatte Maria die Spinne wieder in die Hand genommen. Sie wusste genau, dass sich das Hausmädchen vor dem kleinen harmlosen Tierchen nicht nur ekelte, sondern sich derart fürchtete, als könne es jeden Moment an ihren Hals springen und sie erwürgen. Fassungslos schüttelte Maria den Kopf und fing den Blick ihrer Mutter auf. Maman lächelte verhalten und zwinkerte Maria verstohlen zu.
»Zum Abendessen darfst du wieder herunterkommen«, rief der Vater ihr nach, als Maria das Zimmer verließ.
»Es ist doch ihr Geburtstag, Edmund …«, hörte sie die Großmutter noch sagen, aber der Vater blieb unnachgiebig.
Maria war es recht. So konnte sie sich in Ruhe der Spinne widmen und die Steine sortieren, die sie in den letzten Tagen gesammelt hatte. Um den Kirschkuchen und den Kakao tat es ihr indes leid.
In ihrem Zimmer im dritten Stock öffnete Maria einen Fensterflügel und ließ die Spinne auf den Sims krabbeln. Rund um das Fenster rankte sich Efeu, darin würde sich das Tier ein neues Netz weben können. Die Spinne schien zu spüren, dass ihr von Maria kein Leid drohte, und blieb noch ein paar Minuten im Sonnenlicht sitzen und hob ein Beinchen in die Höhe, als würde sie Maria zuwinken.
Maria gluckste. Sie liebte alle Lebewesen. Angefangen von den stolzen, edlen Rössern mit ihren glänzenden Leibern, die ihre Eltern ritten, über die kräftigen Kutschpferde mit den stämmigen Beinen; die Schafe, die von Mai bis Oktober auf den Wiesen rund um den Burgberg weideten, die Milchkühe des Nachbarhofes; ebenso die zahlreichen Katzen, die Haus und Hof frei von Mäusen und Ratten hielten. Wobei es Maria jedes Mal beinahe das Herz zerriss, wenn sie eine der Katzen mit einer toten Maus im Maul sah, denn auch Mäuse waren faszinierende Geschöpfe, deren Anatomie zu studieren sich besonders lohnte. Drei Katzen lebten ständig im Schloss und wurden nicht zum Jagen hinausgelassen. Marias Lieblingskatze hieß Souris, sie war eine stolze Schönheit mit einem weiß-schwarzen Fell, einem langen, buschigen Schwanz und großen Ohren.
Die Spinne hatte von der Sonne nun wohl genug und verschwand zwischen den Efeublättern. Maria wandte sich ab, ließ das Fenster aber offen, damit die warme, nach Lindenblüten duftende Luft ins Zimmer strömen konnte. Sie konnte sich nicht erinnern, dass es an ihrem Geburtstag jemals geregnet hätte. Am Tag ihrer Geburt war es, das wusste sie, sogar ungewöhnlich heiß gewesen. Maria fand das nur gerecht, schließlich hatte sie an einem Sonntag das Licht der Welt erblickt, und Sonntagskinder standen bekanntlich auf der Sonnenseite des Lebens. Immer wieder bat sie die Mutter, vom Tag ihrer Taufe zu berichten, und die Gräfin wurde nicht müde, Maria an ihren Erinnerungen teilhaben zu lassen.
»Es ist Vorschrift, Taufen in der Dorfkirche von Burgberg vorzunehmen. Da es aber ein außergewöhnlich heißer Julitag und der Weg vom Schloss ins Dorf steil und beschwerlich war, bat dein Vater den Patronatsgeistlichen, deine Taufe hier durchzuführen. Außerdem fühlte ich mich noch sehr schwach, und hier oben konnte ich dabei sein, als du in die heiligen Hände Gottes gegeben wurdest, mein Kind. Der Geistliche entsprach zwar dem Wunsch, es war eine kleine, sehr feierliche Zeremonie, danach aber erstattete der Mann Anzeige gegen uns. Dein Vater musste ein ärztliches Zeugnis beibringen, dass bei der großen Hitze die Fahrt dein Leben in Gefahr gebracht hätte, denn du warst ein sehr zarter Säugling. So wurde deinem Vater recht gegeben. Auf sein Bestreben hin wurde der Patronatsgeistliche in eine andere Gemeinde versetzt, und der neue Pfarrer zeigt sich nicht derart engstirnig. Mit ihm kommen wir gut zurecht.«
Maria liebte diese Geschichte. Zeigte sie nicht, dass sie bereits unmittelbar, nachdem sie ins Leben getreten war, gegen bestehende Konventionen gehandelt hatte? Obwohl noch so jung, begriff Maria, dass ihr Vater nicht ohne Einfluss in der Gegend war. Nun ja, er war schließlich ein Graf. Eigentlich hatte Edmund von Linden seinen Weg in der Armee gesehen, er war aber immer von zarter Konstitution gewesen. Mit erst fünfzehn Jahren erkrankte er im österreichischen Militärdienst schwer an Typhus und Malaria und musste den Dienst quittieren. Über diese Krankheiten wusste Maria nichts, sie mussten aber sehr schlimm sein, denn der Vater war stets etwas schwermütig und in sich gekehrt. Ganz anders Maria. Sie konnte sich nicht erinnern, in ihrem jungen Leben jemals ernsthaft krank gewesen zu sein. Mal einen kleinen Schnupfen, einmal – im Winter des vergangenen Jahres – hatte sie auch ein leichtes Fieber gehabt, und es hatte in ihrem Hals gekratzt. Fräulein Bonne hatte sie ins Bett gesteckt und kalte Wickel um Marias Waden geschlungen. Nach zwei oder drei Tagen war Maria die Untätigkeit langweilig geworden, sie musste aber noch eine ganze Woche im Bett ausharren. Daraufhin hatte Maria beschlossen, in ihrem Leben niemals wieder krank zu werden.
Sie zog eine der Schubladen ihrer Frisierkommode auf. Fein säuberlich nebeneinander aufgereiht verwahrte sie hier zwei Dutzend Steine. Manche schlicht grau, andere mit schwarzen oder weißen Maserungen, in zweien funkelten kleine Einsprenkelungen wie die Diamanten an Mamans Halskette, die diese zu besonderen Anlässen trug. Zärtlich strich Maria über ihre Fundstücke. Rund um den Burgberg gab es eine Vielzahl von kleinen und größeren Steinen. Alle waren sie verschieden und übten auf Maria großen Reiz aus. Sie wünschte sich, auch einmal Steine mit Fossilien darin zu finden. Bisher kannte sie dieses Wunderwerk der Natur nur von Zeichnungen. Sie lebten im Nordosten der Schwäbischen Alb, und vor Jahrmillionen war das Mittelgebirge ein riesiger Ozean gewesen. Wobei Maria keine rechte Vorstellung hatte, wie lange Jahrmillionen wirklich waren. Sicher länger, als sie, ihre Eltern und sogar ihre uralte Großmutter auf der Welt waren. Auf jeden Fall hatten sich früher an der Stelle, wo heute das Schloss auf dem Burgberg in die Höhe ragte, Fische und anderes Getier im Wasser getummelt. Eines ihrer Kindermädchen, die sich sehr für die Natur interessierte, hatte Maria erzählt, dass viele dieser Tiere in Stein eingeschlossen worden seien, als das Wasser verschwand, und dass es Stellen gebe, wo man solche Versteinerungen fand. Seit Maria das wusste, richtete sie den Blick bei ihren Streifzügen durch die Umgebung immer auf das Erdreich in der Hoffnung, eine Muschel oder sogar einen ganzen Fisch in einem Stück Felsen zu finden. Bisher leider ohne Erfolg.
Marias Magen knurrte so laut, dass sie laut auflachte. Bis zum Abendessen war es aber nicht mehr lange hin, und Maria war sicher, dass die Mutter ihr ein oder zwei Stücke von dem Kirschkuchen aufgehoben hatte, den sie zum Nachtisch essen konnte. Bedauern, dass sie die Spinne in den Salon gebracht hatte, empfand Maria nicht. Vielmehr absolutes Unverständnis für die dumme Elsa, die wegen eines winzigen Tierchens ein derartiges Theater veranstaltete. Ein Mann hätte sich nicht so gehen lassen. Es gab Momente, und jetzt war wieder einer davon, in denen sich Maria fragte, ob Gott nicht einen Fehler gemacht hatte, weil er sie als Mädchen auf die Erde geschickt hatte. Schnell leistete sie stumme Abbitte. Alles, was Gott tat, war richtig und gut und hatte einen tieferen Sinn. Sie seufzte. Wahrscheinlich war sie tatsächlich noch zu jung, um alles zu verstehen. Trotzdem würde nichts und niemand sie je dazu bringen, mit Puppen zu spielen und langweilige Socken und Schals zu stricken!
Während Maria diese für ein sechsjähriges Kind außergewöhnlichen Gedanken durch den Kopf gingen, ahnte sie nicht, dass das Gespräch unten im Salon um sie kreiste.
»Ihr lasst dem Kind zu viele Freiheiten«, sagte die Freiin schmallippig. »Jetzt bringt sie schon Ungeziefer ins Haus!«
Gräfin Eugenie sprang für ihre Tochter in die Bresche: »Spinnen sind sehr nützliche Tiere, Maman. Sie halten uns anderes Ungeziefer fern.«
»Trotzdem!« Die Freiin runzelte unwillig die Stirn. »Das Mädchen verwildert regelrecht. Im Winter werde ich alle Hände voll zu tun haben, um Maria wieder zu zähmen und ihr etwas Kultur beizubringen.«
»Im September bekommt Maria einen Hauslehrer«, sagte Graf Edmund. »Herr Fischer ist der Dorfschullehrer, er wird zwei- oder dreimal in der Woche ins Schloss heraufkommen, um Maria zu unterrichten.«
Diese Nachricht schien die Freiin nicht zu beruhigen, eher das Gegenteil war der Fall. »Ein Dorfschullehrer?«, sagte sie mit verächtlichem Unterton. »Wie gewöhnlich! Aber kein Wunder, ihr lasst das Kind ja auch mit den schmutzigen Dorfkindern spielen.«
»Die einzigen Kinder in Marias Alter sind nun mal die des Verwalters«, erwiderte Gräfin Eugenie äußerlich ruhig, denn sie wusste, dass sie bei ihrer dominanten Mutter keinen Schritt weiterkam, wenn sie sich entrüstete. »Maria spielt ohnehin nicht oft mit ihnen. Sie hält sie nämlich für dumm und kann sich mit ihnen nicht richtig unterhalten, wie sie findet.«
Von Graf Edmund kam ein Glucksen. »Nun, da hat sie nicht unrecht«, murmelte er. »Keines der Verwalterkinder spricht Französisch. Ich muss meiner Frau recht geben: Maria ist viel zu sehr mit der Natur, ihren Steinen und den Tieren beschäftigt, als dass sie an wilden Spielen mit Gleichaltrigen interessiert ist.«
Erleichtert atmete Gräfin Eugenie auf. Es war gut, dass ihr Mann auch einmal Partei für die Tochter ergriff. »Manchmal werden Maria und Fräulein Bonne von der netten Familie Danner, die Müller unten an der Hürbe, zu Kaffee und Kakao eingeladen«, fügte sie hinzu. »Wenn es meine Zeit erlaubt, begleite ich sie, wobei die Frau des Müllers immer kaum ein Wort herausbringt und sich ständig nervös die Schürze glattstreicht. Als sei ich die Königin höchstpersönlich.«
»Keine Königin, aber eine Gräfin«, bemerkte die Freiin trocken. »Und eine Adlige deines Standes verkehrt nun mal nicht im Hause eines Müllers.«
»Maman, hier auf dem Land ist es zwangloser als in Stuttgart«, erwiderte Gräfin Eugenie. »Ich …«, sie sah zu ihrem Mann, der aber wieder seinen teilnahmslosen Blick aufgesetzt hatte, »wir stellen nicht fest, dass Maria in irgendeiner Weise Schaden nimmt, weder physisch noch psychisch. Sicher hast du ihre roten Wangen und die gesunde Statur bemerkt, Maman. Kinder, die ständig über ihren Schulbüchern sitzen, anstatt sich in der Natur aufzuhalten, wirken kränklich und sind wenig ansehnlich.«
Zwar nicht überzeugt, aber wohl, weil sie erkannte, dass der Wille ihrer Tochter ihrem ähnelte, lächelte die Freiin versöhnlich und schenkte sich eine zweite Tasse Tee ein. »Marias geistliche Erziehung darf allerdings auch nicht vernachlässigt werden«, konnte sie sich nicht verkneifen noch hinzuzufügen.
»Maria ist ein gottesfürchtiges Kind«, sagte die Gräfin. »Regelmäßig besuchen wir die Kirche, und Marias Liebe zur Natur und den Tieren zeigt doch, wie sehr sie alles von Gott Geschaffene ehrt.«
Die Freiin trank einen Schluck Tee. »Wenn Maria älter ist, in zwei oder drei Jahren«, schlug sie dann vor, »kann sie zu mir nach Stuttgart kommen. In der Stadt gibt es ausgezeichnete Schulen für junge Mädchen ihres Standes. In ihrer Freizeit werde ich mich um das Kind kümmern, damit sie der Familie einst keine Schande machen wird.«
Das hielt Gräfin Eugenie für übertrieben, wollte das Thema für heute jedoch beenden. Sie warf ihrem Mann einen Blick zu. Dieser hielt den Kopf weiterhin gesenkt und schwieg. Gräfin Eugenie unterdrückte einen Seufzer. Sie liebte Edmund, er war ihr immer ein guter Ehemann gewesen, und auf seine Art liebte er auch seine beiden Kinder. Manchmal jedoch wünschte sie sich, er wäre entschlossener und würde seine Meinung äußern – bei allem Verständnis dafür, dass sein Leben nicht so verlaufen war, wie er es sich erträumt hatte. Auch hatte er Schloss Burgberg eigentlich nie übernehmen wollen, sein Vater hatte ihm aber keine andere Wahl gelassen. Gräfin Eugenie wünschte sich, Edmund wäre nicht nur ihr Ehemann, sondern auch ihr Freund. Ein Kamerad, mit dem sie alles teilen und auf den sie sich stets verlassen konnte.
»Träumst du, Kind?«
Die Worte ihrer Mutter rissen die Gräfin aus ihren Gedanken. »Was hast du gesagt, Maman?«, fragte sie pflichtschuldig, denn sie hatte wirklich nicht zugehört.
»Ich möchte wissen, wann mit eurer Ankunft in Stuttgart zu rechnen ist.«
»Es sind noch fünf Monate bis Weihnachten, Maman!«
Die Freiin lehnte sich zurück. »Du weißt, ich muss rechtzeitig Bescheid wissen, um alle Angelegenheiten zu regeln«, erklärte sie leicht vorwurfsvoll und seufzte verhalten. »Eigentlich wollte ich nur eine Woche bei euch bleiben, denke nun aber, ich sollte meinen Besuch bis zum Ende des Sommers ausdehnen. So kann ich mich hinlänglich um Maria kümmern und außerdem den Dorfschullehrer in Augenschein nehmen. Es muss schließlich geprüft werden, ob er für die Erziehung meiner Enkelin befähigt ist.«
Die Gräfin griff nach einem zweiten Stück Kuchen und wich dem Blick ihrer Mutter aus, die nie Anstalten machen würde zu fragen, ob ein so langer Aufenthalt der Familie überhaupt gelegen kam. Tatsächlich hatten sie den Sommer über keine Vorhaben, und sie konnte die eigene Mutter schlecht bitten, wieder abzureisen. Und Gräfin Eugenie wusste auch, wie Maria reagieren würde. Fraglos liebte das Kind seine Großmutter, und eigentlich waren sie sich auch ähnlich: Beide hatten einen eisernen Willen und feste Vorstellungen. Gräfin Eugenie ließ ihrer Tochter gern ihre Freiheiten. Der Bürde des Lebens, der Bürde, eine adlige Frau im Königreich Württemberg zu sein, würde sich Maria noch früh genug stellen müssen.
ZWEI
Schloss Burgberg auf der Ostalb – September 1876
Vor der Fensterscheibe surrten zwei Wespen, umspielten sich gegenseitig, als würden sie zu einer unhörbaren Musik tanzen. Obwohl Maria einige Meter vom Fenster entfernt war, erkannte sie, dass es sich um gemeine Faltenwespen handelte. Für Hornissen waren die gelb-schwarz gestreiften Leiber zu klein, für Bienen die Zeichnung zu ausgeprägt. Ein drittes Insekt gesellte sich zu dem Duo, gleich darauf ein viertes. Maria vermutete, dass die Wespen sich in den Streben unterhalb der Dachkante ein Nest gebaut hatten. Sie würde sich hüten, ihre Beobachtung jemandem mitzuteilen. Im vergangenen Frühjahr wurde ein solches Genist nämlich zerstört und die Insekten dem Tod preisgegeben.
»Wespen sind gefährlich«, hatte ihr Vater gesagt und Maria befohlen, sich von der südlichen Burgmauer fernzuhalten, bis das Nest entfernt worden war. Er wusste nicht, dass Maria regelmäßig Wespen, Bienen und auch Hornissen, die aus den vielfältigen Blüten im Garten ihren Nektar schöpften, aus nächster Nähe eingehend studierte.
Die faszinierenden Tierchen genossen die Sonnenstrahlen des Septembertages. In der Luft lag schon der Geruch des Herbstes, aber die Tage waren noch sonnig und für die Jahreszeit warm. In den Morgenstunden waberte bereits dichter Nebel über das Land, selbst der hoch gelegene Burgberg verschwand in der grauen Masse. Wenn sich der Dunst dann jedoch lichtete, zeigte sich der Herbst von seiner ganzen Schönheit.
Maria seufzte verhalten. Draußen schien die Sonne, und sie hockte in dem kleinen, düsteren Studierzimmer mit den dunkel getäfelten Wänden und der niedrigen Decke. Wenn sie wenigstens das Fenster öffnen dürfte, denn die Luft war zum Schneiden dick.
»Träumst du wieder, Kind?« Die Stimme von Herrn Fischer riss Maria aus ihren Gedanken. Sofort streckte sie den Rücken durch, richtete sich kerzengerade auf dem unbequemen Holzstuhl auf und wandte ihren Blick vom Fenster ab. »Warum seufzt du während meines Unterrichtes, als läge alle Last der Welt auf deinen Schultern, Maria?«
»Verzeihen Sie, Herr Lehrer, aber hier drinnen ist es so warm.« Zur Bestätigung ihrer Worte fuhr sich Maria mit zwei Fingern in den eng anliegenden eierschalenfarbenen Kragen ihres grauen Kleides.
»Ich empfinde es als angenehm, und in den Ländern, über die wir gerade sprechen, ist es noch viel wärmer.« Er tippte auf die aufgeschlagene Seite des Atlasses, der vor Maria auf dem Tisch lag. »Noch einmal, Maria: Welcher ist der größte Fluss in Südamerika?« Maria zögerte, die Antwort wollte ihr partout nicht einfallen, wohl auch, weil sie in den letzten Minuten durch die Wespen abgelenkt gewesen war. »Kind, denk nach! Wir haben die Länder Südamerikas in den letzten Unterrichtsstunden durchgenommen.«
Daran erinnerte sich Maria, ebenfalls, dass sie sich die ganze Zeit über fragte, warum sie etwas über einen Kontinent lernen sollte, der auf der anderen Seite eines riesigen Ozeans lag.
»Der größte Fluss Südamerikas ist der Nil«, reagierte sie schließlich auf den fragenden Blick des Lehrers. Ein anderer Name fiel ihr nicht ein.
»Ach, Maria, Maria …« Aus der Westentasche zog der Lehrer ein beiges Taschentuch, nahm seine Brille mit dem dünnen Drahtgestell von der Nase und polierte bedächtig die Gläser. Als würde er zu sich selbst und nicht zu einem siebenjährigen Kind sprechen, philosophierte er: »Der Nil ist der längste Strom Afrikas. Er entspringt tief im Süden im undurchdringbaren Urwald und mündet an der Nordküste Ägyptens in das Mittelmeer. Der Fluss, nach dem ich dich fragte, Kind, ist der Amazonas. An manchen Stellen ist er so breit, dass das gegenüberliegende Ufer mit bloßem Auge nicht zu erkennen ist und man den Eindruck gewinnt, man stünde an einem großen Meer.«
»Waren Sie schon am Ama… Amasonis?«, fragte Maria.
»Amazonas!« Herr Fischer schüttelte den Kopf. »Wo denkst du hin, Kind! Südamerika ist weit weg, dorthin kann man nicht einfach so reisen.«
»Woher wissen Sie dann, dass der Fluss wirklich so breit ist, wenn Sie die Weite nicht mit eigenen Augen gesehen haben?«
»Es steht in den Büchern«, antwortete Herr Fischer geduldig. »Die Pyramiden in Ägypten habe ich auch nicht besucht, trotzdem weiß ich, wie imposant und beeindruckend die uralten Bauwerke sind. Nahezu alle Antworten auf alle Fragen findest du in Büchern.«
Maria verzog das Gesicht. Das Lesen von Büchern mochte sie ebenso wenig wie die Lehrstunden über fremde Länder und Kontinente. Dementsprechend schlecht war ihre Orthografie. Wenn sie den Griffel führte, wollten sich die Buchstaben auf der Schiefertafel einfach nicht in der richtigen Reihenfolge zusammensetzen. Zumindest nicht in der Reihenfolge, die der Lehrer für richtig hielt. Für sie selbst ergaben die Wörter durchaus Sinn. Wenigstens in dieser Woche musste sich Maria nicht mit Lesen und Grammatik plagen, denn auf dem Plan standen Geografie und Naturgeschichte, zu Marias Bedauern mit Schwerpunkt auf Ersterem. Geografie mochte Maria ebenso wenig wie Grammatik. Dorfschullehrer Fischer folgte nämlich der Methodik, nicht jede Stunde ein anderes Fach zu bearbeiten, sondern sich eine ganze Woche einem oder zwei Themen zu widmen. Trotz ihrer jungen Jahre spürte Maria, dass das keine schlechte Sache war, kamen sie doch mit dem Stoff rascher voran, und das zu erledigende Pensum war überschaubar. Der Lehrer beließ es allerdings nicht bei den drei bis vier Stunden Unterricht am Vormittag. Täglich erhielt Maria Aufgaben, die sie am Nachmittag selbst lösen musste.
Seit über einem Jahr stapfte der hochgewachsene, hagere Lehrer nun schon bei Wind und Wetter zwei- oder dreimal pro Woche den steilen Weg aus dem Dorf zum Schloss empor. Maria mochte den jungen Mann, der oft wirkte, als befände sich sein verklärter Geist in einer anderen Welt. Das täuschte jedoch. Herr Fischer war hochgebildet, klug und liebenswürdig, ein ebenso guter Lehrer wie ein geduldiger Pädagoge, der es verstand, auf die Bedürfnisse eines Kindes einzugehen. Langsam führte er Maria an den Stoff heran. In den ersten Wochen hatte es reinen Anschauungsunterricht gegeben. Marias erste Schreibübungen hatten aus dem Zeichnen von Linien und Strichen bestanden, dann musste sie ein Schönschreibheft führen. Auch nach über einem Jahr war ihre Schrift krakelig und so groß, dass auf jeder Seite nur wenige Wörter Platz fanden. Maria störte sich nicht daran, ebenso wenig, dass sie beim Lesen die Wörter häufig anders interpretierte und aussprach, als sie in den Büchern standen.
Herr Fischer, die Brille immer noch in der Hand, lehnte sich zurück und begann über den großen Fluss Amazonas, den dichten Urwald und das Kaiserreich Brasilien zu referieren. Maria machte es sich auf ihrem Stuhl, so gut es ging, bequem, schloss die Lider und döste vor sich hin. Der Lehrer war derart kurzsichtig, dass er ohne Brille nicht bemerkte, dass seine Schülerin längst abgeschweift war. In den letzten Monaten hatte Maria diese Taktik entwickelt. Besonders an schönen Tagen wie heute, an denen sie am Morgen vor dem Unterricht draußen herumgetollt war, überfiel sie eine bleierne Müdigkeit. Ein paar Minuten Schlaf – dann fühlte sie sich wieder frisch und erholt.
In einer Stunde würde es Mittagessen geben, an dem auch Herr Fischer teilnahm. Seine hagere Statur ließ nicht vermuten, dass der Lehrer ein großer Esser war, aber er ließ sich stets nachlegen und aß bis zum letzten Krümel alles auf. Maria vermutete, dass die einzigen warmen Mahlzeiten des Lehrers die auf Schloss Burgberg waren. Da er allein lebte und auch niemanden hatte, der ihm den Haushalt führte, würde Herr Fischer wohl auch nicht kochen können.
An Marias Ohr drangen das Getrappel von Hufen und das Knirschen der Räder einer Kutsche auf dem Kopfsteinpflaster im Innenhof. Mit einem Schlag war sie hellwach, eilte zum Fenster, öffnete einen Flügel und beugte sich weit hinaus.
»Es ist die Kutsche meines Onkels«, rief Maria und klatschte begeistert in die Hände. »Ich wusste nicht, dass er zu Besuch kommt.«
Bedächtig setzte Herr Fischer die Brille auf seine lange, spitze Nase, schlug den Atlas zu und stand auf. »Dann beenden wir die heutige Lektion. Ich glaube nicht, dass ich weiterhin deine Aufmerksamkeit erringen kann. Erstelle als Hausaufgabe eine Liste mit allen Ländern Mittel- und Südamerikas und deren Hauptstädte. Nächste Woche widmen wir uns dann wieder der Grammatik.«
Maria rümpfte die Nase. Was jedoch nächste Woche sein würde – darüber wollte sie sich heute nicht den Kopf zerbrechen. Sie eilte die steinernen Stufen des engen Treppenhauses hinunter. In der Eingangshalle traf sie mit ihrer Mutter zusammen.
»Es ist Onkel Ferdinand!«, rief Maria mit roten Wangen.
Gräfin Eugenie nickte, sie war nicht minder aufgeregt. Mutter und Tochter verließen die Halle und traten in den Innenhof. Aus der schwarzen Equipage stieg gerade ein großer, schlanker Mann mit hellen gewellten Haaren. Er trug die blaue Uniform seines Reiterregiments, den württembergischen Ulanen, in dem er viele Jahre als Hauptmann gedient hatte.
Beim Anblick seiner Nichte breitete Ferdinand Hiller von Gaertringen die Arme aus und Maria flog in sie hinein. »Du bist schon wieder gewachsen, Kind.«
»Ich muss doch groß werden wie du, Onkel, damit ich auch eine so schöne Uniform tragen kann«, erwiderte Maria im Brustton der Überzeugung.
»Sie wird dir ausgezeichnet stehen, Maria, und mit deinem ebenmäßigen, ansprechenden Gesicht wirst du die schönste Hauptmännin des ganzen Regimentes sein.«
Das Kompliment versetzte Maria nicht in Verlegenheit. Sie wusste, dass sie hübsch war, aber es war ihr nicht wichtig. Sie legte bei sich und bei anderen keinen Wert auf Äußerlichkeiten.
Gräfin Eugenie lachte. »Setz dem Mädchen keine Flausen in den Kopf, Ferdi, sonst will sie eines Tages wirklich zum Militär.«
Ferdinand löste sich von Maria und begrüßte seine jüngere Schwester mit einem Wangenkuss. »Auch du siehst gut aus, Eugenie. Ich hoffe, du verzeihst unser unangemeldetes Erscheinen. Ich hatte in Geislingen zu tun und dachte, wir könnten ja mal wieder den schönen Burgberg besuchen.«
»Wir?«, fragte Eugenie. In diesem Moment kletterte auch schon ein neunjähriger Junge aus der Kutsche.
»Bertie!«, rief Maria erfreut, und die Kinder umarmten sich. »Warum bist du nicht in der Schule?«
»Im Realgymnasium sind die Masern ausgebrochen, die Schule ist für zwei Wochen geschlossen«, antwortete Marias Cousin. Mit erstem Namen hieß er zwar Edmund, Berthold war jedoch sein zweiter Taufname, und er wurde stets Bertie genannt, um Verwechslungen in der Familie zu vermeiden. Verschmitzt zwinkerte er Maria zu. Der Cousin war ein guter und eifriger Schüler, die unerwarteten Ferien kamen ihm dennoch nicht ungelegen.
»So nahm ich Bertie mit auf die Fahrt«, erklärte Ferdinand. »Reisen bildet, und der Junge ist alt genug, um erste geschäftliche Kontakte zu knüpfen. Mimmi hingegen musste zu Hause bleiben, ihren Unterricht darf sie nicht verpassen.«
»Sehr zu ihrem Verdruss«, warf Bertie ein. »Ich soll dich herzlich von Mimmi grüßen, Maria. Sie freut sich schon auf Weihnachten, wenn du wieder zu Großmama nach Stuttgart kommst.«
Maria winkte ab. »Das ist lange hin, noch ist Sommer. Jedenfalls ist es heute fast so warm wie im Sommer.«
»Wie lange könnt ihr bleiben?«, erkundigte sich Gräfin Eugenie.
»Ich dachte, übers Wochenende, wenn es keine Umstände macht.«
»Nie und nimmer!« Die Gräfin hakte sich bei ihrem Bruder ein. »Ich lasse schnell zwei Zimmer richten, und jetzt ist es ohnehin Zeit fürs Mittagessen. Es gibt nur einfache Kost, da wir mit Gästen nicht gerechnet haben.«
»Selbst Wasser und Brot munden köstlich, wenn man es mit lieben Menschen teilt«, erwiderte Ferdinand galant.
Das Mittagessen bestand natürlich nicht aus Wasser und Brot, sondern aus einer kräftigen Gemüsesuppe mit Rindfleisch, dazu frisch gebackenes Weißbrot, und zum Nachtisch wurde Apfelkompott aufgetragen. Graf Edmund von Linden zeigte keine Regung, ob er sich über den Besuch seines Schwagers und Neffen freute. Er nahm es einfach hin. Aber Maria bemerkte, wie ihre Mutter auflebte. Sie und Ferdinand waren sich immer sehr zugetan gewesen. Der diplomatische Dienst zwang Ferdinand regelmäßig zu Reisen, die ihn auch ins Ausland führten. Dementsprechend selten sahen sich die Geschwister.
Unter dem Tisch zappelte Maria ungeduldig mit den Beinen. Kaum, dass der letzte Bissen vertilgt war und ihre Mutter die Serviette vom Schoß nahm und neben den Teller legte, sprang Maria auf.
»Komm, Bertie, wir wollen in den Stall, es gibt ein neues Fohlen.« Pflichtschuldig sah Maria zu ihrer Mutter. »Wir dürfen doch nach draußen, Maman?«
»Geht nur, Kinder, und genießt die Sonne«, antwortete Eugenie lächelnd.
Sich an den Händen haltend liefen Maria und ihr Cousin über den Hof zum Pferdestall. Das vor drei Tagen geborene Fohlen stand auf staksigen Beinen neben seiner Mutter, einer Fuchsstute, und sah die Kinder aus seinen schönen dunklen Augen an. Sie begnügten sich damit, das neue Leben durch die Gitterstäbe zu betrachten, denn die Box zu öffnen war streng verboten.
»Hat es schon einen Namen?«, fragte Bertie.
Maria schüttelte den Kopf. »Es ist ein Hengst, und Vater denkt über einen Namen noch nach.«
Nach ein paar Minuten verloren sie das Interesse an dem Fohlen, der Sonnenschein lockte sie wieder nach draußen. Maria führte ihren Cousin in das nahe gelegene Wäldchen und dort zu einer Lichtung mit einem Weiher. Sie setzten sich auf einen gefällten Baumstamm, sammelten kleine Steine und warfen sie in das von Entengrütze überzogene Wasser.
»Im Sommer habe ich hier eine fette, enorm hässliche Kröte eingefangen«, erzählte Maria. »Ich habe sie Magda genannt.«
»Magda?« Bertie grinste. »Heißt nicht eure Köchin so?«
»Wie die Köchin hatte auch die Kröte eine dicke Warze am Kinn. Am Abend habe ich sie dem Fräulein Bonne ins Bett gesetzt. Die hat vielleicht geschrien, dann musste erst die ganze Wäsche gewechselt werden, bevor das Fräulein sich schlafen legte.«
Bertie gluckste. »Warum hast du das getan?«
»Dieses Fräulein war dumm und einfältig, fürchtete sich vor allen Tieren, selbst vor meiner Souris«, antwortete Maria mit unwillig gerunzelter Stirn. »Sie sagte, Katzen seien schmutzig und schleppten Krankheiten ins Haus. Ich bin froh, dass sie Hals über Kopf gegangen ist, nachdem sie wenige Tage später einen Feuersalamander zwischen ihren Laken vorgefunden hatte.«
Bertie sah Maria bewundernd an. »Was du dich traust! Mein Vater hätte mir eine Tracht Prügel verabreicht, dass ich drei Tage lang nicht mehr hätte sitzen können.«
»Ach, meinen Vater interessiert es nicht sonderlich, was ich mache, und Maman mochte das sauertöpfische Fräulein ebenfalls nicht sehr. Sie hat es zwar nicht offen gezeigt, aber sie war immer sehr kühl zu ihr.«
»Hast du ein neues Kindermädchen?«
Maria nickte, nun strahlten ihre Augen. »Sie heißt Molla. Sie kommt zwar nicht aus Frankreich, sondern aus dem Schwarzwald und spricht deswegen einen lustigen Dialekt. Mit Maman spreche ich aber oft Französisch, die Sprache mag ich. Das neue Fräulein mag Tiere, hat nichts dagegen, wenn Souris in meinem Bett schläft, und ekelt sich weder vor Kröten noch vor Spinnen.«
Bertie seufzte. »Ich hätte auch gern ein Haustier, am liebsten einen schönen Hund mit langem Fell. Meine Eltern sind aber der Meinung, in der Stadt könne man keine Hunde halten.«
»Dann musst du mich eben öfters besuchen kommen. Ich teile meine Tiere gern mit dir, Bertie.«
»Nun ja, die Echsen, Spinnen und Schnecken kannst du ruhig für dich behalten, Maria«, erwiderte er lachend. »Wenn wir heiraten, ziehen wir aufs Land und halten uns ganz viele Tiere.«
Maria knuffte Bertie in die Seite und stimmte in sein Lachen ein. Am letzten Weihnachtsfest hatte die Großmutter gesagt, Maria und Bertie könnten einander heiraten, wenn sie erwachsen seien, weil sie sich ständig neckten und so gut verstanden. Dass sie Cousin und Cousine waren, sollte sie nicht daran hindern, eine solche Eheschließung würde von der Kirche akzeptiert. Maria hatte eingewilligt, aber nur, wenn sie täglich Rehbraten essen und Champagner trinken würden. Bertie hingegen hatte gefordert, als seine Frau müsse Maria Harfe spielen lernen. Er wusste genau, dass die Cousine das Instrument nicht mochte, während seine Schwester Mimmi das Harfenspiel nahezu in Perfektion beherrschte.
Maria betrachtete den Cousin von der Seite. Er war ein schöner Junge, hatte hellblondes welliges Haar und himmelblaue Augen. Sein schlanker Wuchs ließ erahnen, dass er seinem Vater an Größe nicht nachstehen würde. Sie wusste, dass sie eines Tages würde heiraten müssen. Das taten alle Frauen, außer sie traten in ein Kloster ein, wie eine entfernte Verwandte. Da Maria zur Religion noch weniger Zugang als zur Grammatik fand, schied dieser Weg für sie aus. Bertie war sicher eine gute Wahl, besser, als die Frau eines Fremden zu werden.
»Wer weiß, was noch alles passiert, bis wir heiraten«, sagte sie mit Blick auf den Weiher. »Wir müssen erst erwachsen werden.«
»Das geht schneller, als man denkt«, erwiderte Bertie. »Ich jedenfalls will dich als Frau, niemanden sonst mag ich so gern wie dich, Maria.«
»Das hast du lieb gesagt.« Sie seufzte. »Ich wünschte, Wilhelm wäre ein bisschen wie du. Mein Bruder ist immer so ernst, und mit seinen Sachen darf ich nicht spielen. Wenn er in der Schule ist, schließt er sogar den Schrank ab, dass ich ja nichts anfasse. Wilhelm fürchtet, ich könne etwas kaputt machen, ohnehin seien seine Spielsachen nichts für Mädchen.«
Bertie zuckte mit den Schultern. Seinen Cousin kannte er kaum, denn wenn die Familie von Linden das Weihnachtsfest in Stuttgart verbrachte, zog sich Wilhelm lieber mit einem Buch auf sein Zimmer zurück, anstatt mit den Verwandten Zeit zu verbringen.
Der Nachmittag schritt voran und im Schatten unter den Bäumen wurde es kühl. Die Kinder liefen zurück zum Haus. Maria freute sich, dass Bertie noch drei Tage auf Schloss Burgberg bleiben würde. Morgen könnten sie die Familie des Müllers unten am Fluss besuchen. Trotz ihres niedrigen Standes und einfacher Herkunft konnte Maria die Töchter des Müllers gut leiden. Bertie würde sie bestimmt auch mögen.
Maria hatte sich nicht getäuscht. Da es ein unterrichtsfreier Tag war, brachen sie und Bertie in Begleitung von Fräulein Bonne zu einem Besuch in der Mühle auf. Das Kindermädchen war in Marias Augen uralt und von wenig ansprechendem Äußeren. Das Haar mausbraun, ihre Gesichtszüge eckig, ihre Nase spitz und die Lippen schmal, aber das Fräulein mochte Tiere, interessierte sich für Floristik und sprach mit dem ulkigen Dialekt ihrer Heimat, der Maria oft zum Lachen brachte. Nur dass auch dieses Kindermädchen den Hang dazu hatte, ein Taschentuch mit ihrem Speichel zu benetzen und Marias Gesicht zu säubern, störte das Mädchen. Maria beschloss: Wenn sie erwachsen war, würde sie sich von niemandem mehr das Gesicht putzen lassen! Ach, es gab so vieles, dem sich Maria nicht mehr beugen und was sie tun wollte, ohne gegängelt zu werden. »Das tut ein Mädchen nicht«, hieß es ständig. Die Zeit schien stillzustehen, es würde noch ewig dauern, bis sie endlich erwachsen sein würde.
Heute wollte sich der Nebel nicht lichten, und die Luft war feucht und kühl. Die Kinder störte es nicht, sie stoben den steilen, in Serpentinen angelegten Weg ins Dorf hinunter. Bertie tat, als könnte er Maria nicht einholen und müsste sich in dem Wettrennen geschlagen geben. Am Steg, der über die Hürbe führte, warteten die Kinder auf Fräulein Bonne, die ihnen gemächlichen Schrittes gefolgt war. Das Mühlrad ratterte und quietschte, in dem hoch aufragenden Gebäude knirschte der Mühlstein. Die Gäste waren bemerkt worden, und die Tür unter dem steinernen Bogen wurde von einer kleinen, untersetzten Frau geöffnet.
»Frau Danner, ich hoffe, Sie verzeihen diesen unerwarteten Besuch«, sagte Fräulein Bonne. »Aber –«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: