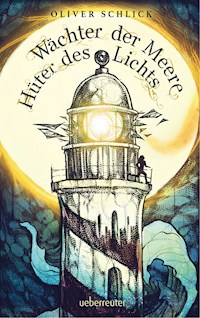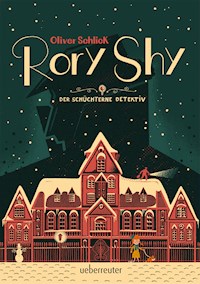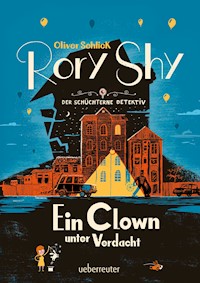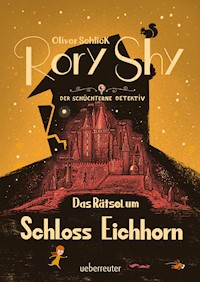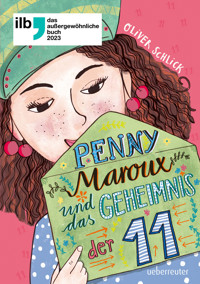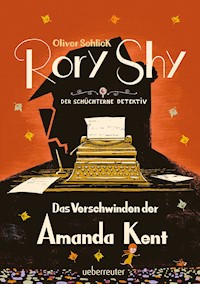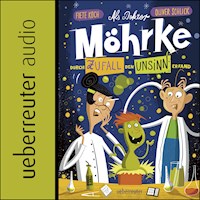7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Ein berührender Roman über das Geheimnis eines einzigartigen Sommers
Eine mysteriöse Erbschaft führt den Arzt Lukas in das abgelegene Dorf Erzbach zurück, in dem er vor Jahrzehnten einen Sommer verbracht hat. Doch er hat keinerlei Erinnerung mehr an den Ort seiner Kindheit – bis ihm ein altes Familienfoto in die Hände fällt. Bald ist er fasziniert von dem rätselhaften kleinen Dorf und seinen Bewohnern, die auf unerklärliche Weise mit seinem Schicksal verknüpft sind.
Es ist der Beginn von sieben unvergleichlichen Sommertagen, die ihn tief in seine Vergangenheit eintauchen lassen.
Was geschah damals im Sommer 1963 wirklich? Auf der Suche nach Antworten lernt Lukas langsam wieder zu träumen: Von einer einzigartigen Liebesgeschichte, einem alten Geheimnis und einer ganz besonderen Magie …
Erste Leserstimmen
„Mitreißende Geschichte. Großartig erzählt. Ideale Sommerlektüre – unbedingt lesen!“
„spannend, geheimnisvoll und mit einer Prise Humor“
„eine einzigartige, wirklich besondere Geschichte“
„packend, magisch und voller Faszination für die besonderen Momente des Lebens“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 592
Ähnliche
Über dieses E-Book
Eine mysteriöse Erbschaft führt den Arzt Lukas in das abgelegene Dorf Erzbach zurück, in dem er vor Jahrzehnten einen Sommer verbracht hat. Doch er hat keinerlei Erinnerung mehr an den Ort seiner Kindheit – bis ihm ein altes Familienfoto in die Hände fällt. Bald ist er fasziniert von dem rätselhaften kleinen Dorf und seinen Bewohnern, die auf unerklärliche Weise mit seinem Schicksal verknüpft sind. Es ist der Beginn von sieben unvergleichlichen Sommertagen, die ihn tief in seine Vergangenheit eintauchen lassen. Was geschah damals im Sommer 1963 wirklich? Auf der Suche nach Antworten lernt Lukas langsam wieder zu träumen: Von einer einzigartigen Liebesgeschichte, einem alten Geheimnis und einer ganz besonderen Magie …
Impressum
Überarbeitete Neuausgabe Februar 2019
Copyright © 2024 dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH Made in Stuttgart with ♥ Alle Rechte vorbehalten
E-Book-ISBN: 978-3-96087-714-1 Taschenbuch-ISBN: 978-3-96087-715-8
Copyright © 2014, books2read Dies ist eine überarbeitete Neuausgabe des bereits 2014 bei books2read erschienenen Titels Salamandersommer (ISBN: 978-3-73378-418-8).
Covergestaltung: Buchdesign Traumstoff dp DIGITAL PUBLISHERS Korrektorat: Sofie Raff
E-Book-Version 05.07.2024, 12:58:38.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Sämtliche Personen und Ereignisse dieses Werks sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen, ob lebend oder tot, wären rein zufällig.
Abhängig vom verwendeten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Unser gesamtes Verlagsprogramm findest du hier
Website
Folge uns, um immer als Erste:r informiert zu sein
TikTok
YouTube
Die Farben des verschwundenen Sommers
Siehe, der Salamander geht durch die Flammen.Unverletzt bleibt immer auch die Reinheit.Joachim Camerarius, Symbolorum et Emblematum ex Aquatilibus et Reptilibus
Prolog
Es ist der Regen, der mich weckt. Dumpfe, satte Schläge auf die straff gespannten, grünen Trommelfelle, hoch über meinem Versteck.
Ich richte den Vorderkörper auf und lausche.
Für einen Moment ist es mucksmäuschenstill – gerade mal so lange, wie es dauert, »Samandarin« zu denken – und in der nächsten Sekunde legt der große Tropfentrommler los, wie ein tausendhändiger Drummer-Gott: volle Kraft voraus! Über mir prasselt und poltert und knallt und kracht es; der Rhythmus explodierender Tropfen dröhnt durch den Wald.
Der einzig wahre Sound! Das einzig wahre Wetter!
Endlich. Die Dinge ändern sich.
Erst mal die Beweglichkeit testen. Schön langsam. Bloß nichts überstürzen. Ich erwähne es nur ungern, aber meine charismatische Erscheinung hat stark gelitten: Meine Haut ist trocken wie Pergament und bei jeder Bewegung entsteht ein Geräusch, das sich anhört, als würde ein Stück dünnes Butterbrotpapier reißen. Die gelbe Zeichnung auf meinem Rücken hat ihr schickes, aphrodisierendes Glitzern eingebüßt und ist blasser als ein Nonnenarsch im Mondschein.
Ich war wirklich schon mal in besserer Verfassung.
Alles nur wegen dieser Dreckshitze. Wer braucht so was schon? — Doch nur die bekloppten Eidechsen. Ein Haufen Schwachköpfe, die nichts anderes zu tun haben, als den lieben langen Tag in der Sonne zu liegen und sich das Resthirn rausbrennen zu lassen. Hoffnungslose Fälle! Wer sein Hirn noch hat, der mag es feucht und nass und glitschig!
Aber in den vergangenen drei Wochen hat die Sonne gebrannt, als hätten die Eidechsen dafür bezahlt. Kein einziger Tropfen. Der Erzbach ist zu einem erbärmlichen Rinnsal verkommen und der aufregende Schlamm am Bachufer zu furztrockener Bröselerde mutiert. An manchen Tagen war es so heiß, dass die Rinde von den Bäumen geplatzt und einem um die Ohren geflogen ist. Alles, was noch halbwegs bei Verstand war, hat sein Versteck nur verlassen, wenn es unbedingt sein musste. Das Einzige, was mir während meiner kurzen nächtlichen Ausflüge vor die Schnauze geraten ist, waren dürre, bittere Krabbeltierchen. Es kommt mir schon hoch, wenn ich nur dran denke. Aber die Zeit der Notspeisepläne ist jetzt Vergangenheit.
Die richtigen Dinge geschehen zur richtigen Zeit.
Ich schüttele mir ein paar lockere Erdbrocken vom Rücken und setze mich in Bewegung. Im langsamen Kriechgang aufwärts, an der toten Wühlmaus vorbei. Ein bedauernswertes Opfer ihrer hektischen Lebensweise. Dieses ständige sinnfreie Hin- und Hergerenne. Und dann – zack! Herzkasper! Das, was noch von ihr übrig ist, streckt die dünnen Beinchen in die Luft und riecht unerfreulich. Kein Mitbewohner, auf den man sonderlich scharf ist.
Ich lasse den Kadaver links liegen und krabble einen schmalen Durchgang hoch, den Kopf direkt über dem Boden. Der Gang ist von unzähligen dünnen Wurzeln durchzogen, zwischen denen ich mich hindurchschlängeln muss. Nicht unbedingt eine Spaßveranstaltung, wenn man in einer Haut steckt, die sich anfühlt, als wäre sie zu heiß gebadet worden. Noch eine kleine Steigung, dann eine Biegung nach rechts — und ich sehe Tageslicht. Der Eingang des Verstecks liegt, gut geschützt, unter einer dicken Baumwurzel. Ich quetsche mich durch die enge Öffnung, schleppe mich zum nächsten Mooskissen, strecke alle Gliedmaßen von mir und lasse die Regentropfen auf meinem Rücken zerplatzen.
Dicke, schwere Tropfen.
Sommerregen. So wie damals.
Ein paar Minuten lang ringe ich mit der Versuchung, einfach liegen zu bleiben. Der wirklich arbeitsintensive Teil der ganzen Angelegenheit steht mir noch bevor und ich hege gegen jede Art von Arbeit eine gesunde Abneigung. Aber es hilft nichts, durch die Nummer muss ich durch. Wenn sich die Dinge verändern, muss man sich mit ihnen verändern. Wobei das natürlich leichter gesagt als getan ist: Wer kann schon so einfach aus seiner Haut?
Menschen jedenfalls nicht!
Auch auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen — aber es muss mal gesagt werden, Freunde: Das Unvermögen, sich zu häuten, ist eines eurer größten Defizite. Amphibien sind hier klar im Vorteil. Also: Sehen! Staunen! Lernen!
Ich suche mir einen Stein mit scharfen Kanten und fange an, den Kopf daran zu reiben. Hin und her, vor und zurück, wieder und wieder und wieder und wieder ...
Ganz allmählich löst sich die trockene Haut und schiebt sich in einem dicken Wulst über meinem Hals zusammen. Das fühlt sich genauso fies an, wie es klingt — und ist nicht ganz ungefährlich. Ganz entspannt bleiben. Wer jetzt in Panik gerät und anfängt zu zappeln, riskiert, dass sich die Haut immer enger um den Hals schließt — und das war es dann: Aus die Maus! Aber das sind Anfängerfehler. Ich weiß, was ich tue. Schlängelnde und ruckelnde Bewegungen, immer abwechselnd. Keine Hektik. Schlängeln und ruckeln und schlängeln und ruckeln und so weiter und so weiter ... Nach einer halben Ewigkeit schaffe ich es endlich, die Haut über die Brust bis zu meinem Schultergürtel hinaufzuziehen.
Willkommen auf der Zielgeraden! Der Rest ist ein Kinderspiel: Jetzt nur noch mit den Vorderbeinen aus der verbliebenen Hauthülle steigen und — wow! Heiliges Samandarin! Ich habe es hinter mir. Noch ein bisschen zittrig und ziemlich groggy, aber dafür wieder wie neu. Eine Häutung ist ungefähr so amüsant wie ein Magendurchbruch, aber die ganze schäbige Plackerei ist in dem Moment vergessen, in dem man seine neugeborene, feuchte Haut spürt und wieder frei durchatmen kann.
Vom Waldrand aus sehe ich auf die roten Dächer des Dorfes, bis der Regen so dicht wird, dass sie hinter einem grauen Schleier verschwinden.
Er kommt.
So wie damals.
Er kommt mit dem Regen.
Aber — noch ist er nicht da und wie ich die Sache so sehe, spricht nichts gegen einen gepflegten kleinen Imbiss.
Ich krabble zu meiner abgelegten Haut zurück und reiße sie mit den Vorderfüßen in winzige, appetitliche Fetzen. Das Auge isst schließlich mit.
Es stimmt schon, denke ich, während ich an den Hautstückchen schnuppere: Die richtigen Dinge geschehen zur richtigen Zeit. Man sollte ihnen aber keinesfalls mit leerem Magen begegnen. Also nichts wie runter mit den kleinen Knusperhappen!
1. Kapitel
Die Hand war auf einer schwarzen, matt schimmernden Leichtmetall-Konstruktion befestigt.
Jeroen de Vries betrachtete sie neugierig, während er auf seinem Stuhl hin und her rutschte. Er war ein fröhlicher Fünfzehnjähriger mit strubbligen Haaren, der jeden möglichen Blödsinn veranstaltete, sobald man ihm den Rücken zuwandte. Sein rechter Unterarm fehlte.
»Wir sind sogar einen Monat früher fertig geworden als geplant. Sieht ganz so aus, als hättest du unsere kleine Wette verloren«, sagte ich.
Er knirschte mit den Zähnen. »Ich schulde Ihnen einen Zehner, Doc. Falls ihr Spielzeug wirklich funktioniert.«
Ich zuckte innerlich zusammen. An dem Spielzeug hatten wir in der Entwicklungsabteilung von »Vaanenberg Prosthetics« über drei Jahre lang gearbeitet.
»Die Hand schlägt dein altes Modell um Längen. Sie ist viel beweglicher. Und sie wiegt so gut wie nichts.« Ich nahm die künstliche Hand von dem Gestell und half Jeroen beim Anlegen der Prothese.
Vor vier Jahren war er auf dem Weg zur Schule an einer vereisten Haltestelle ausgerutscht und vor eine anfahrende Straßenbahn gestürzt. Er gehörte zu den Patienten, die während der Entwicklung der Fluidhand bereits mit mehreren Prototypen trainiert hatten. Heute würde er das endgültige Ergebnis unserer Arbeit testen.
Die Hand war die erste einer ganz neuen Generation von Prothesen. Während bei den herkömmlichen Modellen Elektromotoren zum Einsatz kamen, verwendeten wir hydraulische Antriebe, flexible Fluidaktoren, die in den Fingergelenken platziert waren. Am Armansatz der Prothese saßen Sensoren, die Muskelbewegungen aus dem Armstumpf aufnahmen. Über eine Mikroprozessorsteuerung wurden dann die Griffmuster aktiviert; eine Miniaturpumpe befüllte die Fluidaktoren mit einer Flüssigkeit und bewirkte so letztlich eine Fingerbewegung.
Jeroen hob die Hand vor sein Gesicht. »Von mir aus können wir loslegen.«
Ich nahm einen Bleistift aus der Tasche meines Kittels und legte ihn auf den Labortisch. »Fangen wir mit dem Pinzettengriff an!«
Jeroen kaute auf seiner Unterlippe herum und starrte konzentriert auf die Prothese. Schweißperlen traten auf seine Stirn. Plötzlich erwachte die Hand zum Leben: Daumen und Zeigefinger streckten sich und griffen nach dem Stift.
Er lächelte erleichtert.
»Nicht schlecht für den Anfang. Kann ich dir vielleicht etwas zu trinken anbieten?« Ich stellte eine Wasserflasche und ein Glas auf die Tischplatte.
Die Finger der künstlichen Hand krümmten sich nach innen. Der Zylindergriff. Jeroen umschloss die Flasche mühelos, hob sie an und schenkte das Glas bis zum Rand voll.
Pinzetten- und Zylindergriff waren nur zwei der Griffmuster, die die Prothese ausführen konnte. Es gab zudem den Hakengriff, mit dem Koffer und Taschen getragen werden konnten, und den Schlüsselgriff, mit dem es möglich war, flache Gegenstände aufzunehmen. Ich zog eine Kreditkarte aus meiner Geldbörse und legte sie in Reichweite der künstlichen Hand.
Jeroen sah mich an und schüttelte den Kopf. »Sie spielen mit dem Feuer, Doktor Klinger.« Seine Rechte schnellte vor und kassierte die Karte ein.
»Sehen wir doch mal, was passiert, wenn es wirklich schwierig wird.« Ich schob meine Computertastatur über den Tisch. »Schreib, was dir gerade so einfällt.«
Der Zeigefinger der Prothese streckte sich langsam aus und Jeroen begann zu tippen: F-U-C-K-T-H-E-P-O-L-I-
»Vielen Dank, das reicht schon. Du bist wirklich ein Goldkind.« Ich löschte den Text. »Und, wie lautet dein abschließendes fachmännisches Urteil?«
Er blickte auf und strahlte mich an. »Ich bin der coolste Cyborg der westlichen Welt. Sie haben es drauf, Doktor Klinger! Das Ding ist perfekt — sagen wir, fast perfekt. Die Sache mit dem Zeigefinger ist super. Aber es gibt eine Menge Leute, denen ich auch mal den ausgestreckten Mittelfinger zeigen möchte. Kriegen Sie das hin?«
»Ich freue mich immer wieder über deine innovativen Beiträge. Wir sehen uns in zwei Wochen«, brachte ich seufzend hervor.
»Klar. Es sei denn, mir wächst über Nacht ein wunderschönes Händchen nach.«
»Darauf würde ich nicht setzen. Ach, und bevor du gehst, hätte ich gerne meine Kreditkarte zurück. Und denk das nächste Mal an den Zehner, den du mir schuldest.«
Er reichte mir die Karte und grinste. »Für ihr biblisches Alter sind Sie noch gut beisammen. Sie vergessen nichts, was, Doc?«
Ich tippte mir mit dem Finger an die Schläfe. »Hier drin kommt nichts weg!«
»Vaanenberg Prosthetics« hatte seinen Sitz in einem Industriegebiet am Rande Rotterdams. Als ich das Gelände des Instituts am frühen Abend verließ, hätte ich eigentlich in Hochstimmung sein sollen: Drei Jahre harter Arbeit hatten sich endlich ausgezahlt. Die Fluidhand war eine Revolution in der Prothetik! Ihre Flexibilität würde das Leben vieler Patienten entscheidend verbessern.
Aber während mich die Straßenbahn in Richtung Innenstadt schaukelte, fühlte ich mich plötzlich unbehaglich: Zum ersten Mal seit langer Zeit hatte ich pünktlich Feierabend gemacht. Während der Entwicklung der künstlichen Hand hatte ich so gut wie im Institut gelebt, ich war selten vor zehn Uhr abends nach Hause gekommen und hatte auch den Großteil der Wochenenden im Labor verbracht.
Unter meinen Mitarbeitern kursierten einige halb respektvoll, halb spöttisch gemeinte Spitznamen für mich.
»Prothesen-Eremit« war dabei noch eine der netteren Bezeichnungen. Meine fachlichen Fähigkeiten wurden von allen Kollegen geschätzt, aber die meisten sahen mich wohl auch als einen etwas merkwürdigen, lebensfremden Sonderling, der nichts als seine Arbeit kannte.
Und während ich mich meinem Zuhause näherte und mich ziemlich ratlos fragte, was ich eigentlich mit dem langen Abend, der vor mir lag, anfangen sollte, beschlich mich das unangenehme Gefühl, dass diese Sichtweise vielleicht ein Körnchen Wahrheit enthalten könnte.
Nichts an dem braunen Umschlag erschien ungewöhnlich. Er steckte zwischen Werbeprospekten und Rechnungen in meinem Briefkasten. Ich beachtete ihn zunächst nicht, legte ihn mit der übrigen Post auf dem Küchentisch ab und nahm ein Fertiggericht aus dem Kühlschrank. Erst nachdem ich die Hähnchenbrust Pikant in die Mikrowelle geschoben und eine Flasche Bier geöffnet hatte, warf ich einen Blick auf den Absender: H.J. Langhard,Fachanwalt für Vertragsrecht,Beerburg, Deutschland.
Noch nie gehört — aber Post von Anwälten bedeutet selten Gutes. Ich zögerte einen Moment, bevor ich nach einer Schere griff und das Kuvert öffnete.
Sehr geehrter Herr Doktor Klinger,
anbei erhalten Sie eine Kopie des Testaments meines verstorbenen Klienten, Herrn Carl Niklas Linnert. Herr Linnert hat mich beauftragt, Ihnen diese Kopie unmittelbar nach seiner Bestattung zukommen zu lassen. Das Original wurde beim Amtsgericht Beerburg hinterlegt und dürfte Ihnen ebenfalls in Kürze zugehen. Sie werden feststellen, dass das Testament eine Auflage enthält. Ich bin als Testamentsvollstrecker eingesetzt und mit der Überwachung der Durchführung dieser Auflage betraut.
Hochachtungsvoll,
H.J. Langhard (RA)
Was sollte der Blödsinn? Ich kannte keinen Carl Niklas Linnert. Das musste eine Verwechslung sein. Oder versuchte irgendein schräger Witzbold, mich hochzunehmen? Verärgert blickte ich auf das zweite Blatt Papier: ein handschriftliches Gekritzel, das sich nur mit Mühe entziffern ließ. Als hätte jemand ein unwilliges Kind zum Schreiben gezwungen.
Hiermit setze ich, Carl Niklas Linnert, *17.10.1917, Herrn Doktor Lukas Klinger, *21.04.1946, wohnhaft: Badstraat 153, Rotterdam, Niederlande, als Erben der Immobilie »Im Vogelsang 7« in Erzbach, Kreis Beerburg ein.
Die Erbschaft wird erst dann rechtskräftig, wenn der Erbnehmer sieben aufeinanderfolgende Tage in dem Objekt verbracht hat. Bei Nichterfüllung der Auflage ...
Ich ließ mich auf einen Stuhl fallen und starrte mit offenem Mund auf das Dokument, während die Schrift vor meinen Augen verschwamm.
Meine Daten stimmten. Das war keine Verwechslung!
Aber ich hatte noch nie von einem dieser Orte gehört. Beerburg?Erzbach? Im Vogelsang? Die Begriffe schwirrten wie ein aufgescheuchter Spatzenschwarm durch meinen Kopf. Die Mikrowelle klingelte, aber ich hatte plötzlich keinen Hunger mehr.
Wer war Carl Niklas Linnert?
»Carl Niklas Linnert ... Carl Niklas Linnert ...« Ich lief in der Küche auf und ab, während ich den Namen wie ein Mantra vor mich hinmurmelte — so lange, bis ich beinah glaubte, ihn vor langer Zeit tatsächlich schon einmal gehört zu haben.
Kurz entschlossen bewaffnete ich mich mit einer Taschenlampe und kletterte die schmale Holzstiege zum Dachboden hinauf. Hier oben lagerte meine Vergangenheit: Kisten und Kartons mit all dem, was sich im Laufe eines Lebens ansammelt.
Ich verbrachte die halbe Nacht lang auf den staubigen Dielen des Speichers, arbeitete mich durch alte Aufzeichnungen, kramte Kalender hervor, wälzte Adressbücher und halb vermoderte Notizhefte. Nirgends fand sich auch nur der geringste Hinweis auf einen Carl Niklas Linnert.
Der Morgen dämmerte bereits und ich war kurz davor aufzugeben, als ich in einer dunklen Ecke des Dachbodens über einen eingedellten Karton stolperte: Meine Mutter war vor zwei Jahren gestorben und die wenigen Habseligkeiten, die nach der Auflösung ihres Haushaltes übrig geblieben waren, verstaubten seitdem auf meinem Speicher. Ohne große Erwartungen öffnete ich den Karton und wühlte mich durch einen Wust aus gehäkelten Platzdeckchen, Backrezepten und frommen Traktätchen hindurch — als ich plötzlich ein verblasstes Schwarz-Weiß-Foto in den Händen hielt: mein Vater und ich vor einem alten VW Käfer, im Hintergrund ein baufälliges Häuschen. Auf der Rückseite der Fotografie die penible Handschrift meiner Mutter:
Georg und Lukas, Erzbach, Sommer 1963.
Von meinem Nacken ausgehend breitete sich ein Kribbeln aus, das immer stärker wurde, bis es sich anfühlte, als würde eine ganze Ameisenkolonie über meine Kopfhaut marschieren, und in
meinen Ohren rauschte es plötzlich, als wäre eine Sturmflut im Anmarsch.
Erzbach ... Ich war dort gewesen! Vor über vierzig Jahren!
Damals waren wir ständig umgezogen, aber selbst wenn ich nur ein paar Monate in Erzbach gelebt hatte, musste es doch irgendetwas geben, an das ich mich erinnern konnte. Ich versuchte mir Straßen ins Gedächtnis zu rufen, einen Platz, ein Gebäude ... nichts! Es war, als würde ich in ein schwarzes Loch blicken. Als hätte es diesen Sommer nie gegeben. Mein Mund fühlte sich plötzlich trocken an, und ich bemerkte, dass meine Hände zitterten, als ich über die Fotografie strich.
»Sie vergessen nichts, was, Doc?«
Das Rauschen in meinen Ohren wurde zu einem unerträglich hohen Fiepen.
In meiner Vergangenheit gab es einen blinden Fleck!
An Schlaf war nicht mehr zu denken. Mein Tinnitus pfiff in den höchsten Tönen und ich war so aufgedreht, als hätte mir jemand literweise Kaffee eingeflößt. Immer wieder betrachtete ich das Foto und ließ meine Augen über die krakeligen Zeilen des Testaments wandern.
Warum fehlte mir ein Sommer meines Lebens?
Früh am Morgen rief ich im Institut an und nahm mir — zum allgemeinen Erstaunen meiner Kollegen — eine Woche frei. Dann telefonierte ich mit der Anwaltskanzlei Langhard und kündigte mein Erscheinen für den späten Nachmittag an.
Eine Stunde später bestieg ich, nur mit dem Nötigsten bepackt, in Rotterdam Centraal einen Zug nach Deutschland.
Ich hatte mir für meine Reise den heißesten Tag des Jahres ausgesucht. Schon morgens, bei meiner Abfahrt, herrschte eine solche Hitze, dass die Eisverkäufer im Bahnhof Spitzenumsätze machten.
Am frühen Nachmittag erreichten die Temperaturen Rekordniveau.
Die Bahn quälte sich zwischen zwei Hügelketten hindurch, schlich einen trägen Fluss entlang und kroch an Dörfern vorbei, die wie vom Sonnenstich getroffen reglos in der Landschaft lagen.
Die Klimaanlage hatte sich bereits vor geraumer Zeit in eine bessere Welt verabschiedet. Ich hing in den klebrigen Sitzpolstern wie die Fliege am Fliegenfänger und die Flecken auf meinem Hemd standen kurz davor, sich zu einem schweißigen Superkontinent zu vereinen.
Noch eine Stunde bis Beerburg.
Und dann noch ein paar Jahrzehnte zurück.
Der Zug nahm den Kampf mit einer lang gezogenen Steigung auf. In der Ferne erschien eine Kirchturmspitze, dahinter zogen am Horizont erste Gewitterwolken auf. Für einen Moment schloss ich die Augen.
Die Waggons rollten Beerburg entgegen.
Erzbach entgegen.
Einem vergessenen Sommer entgegen.
Die Attraktionen von Beerburg waren schnell aufgezählt: der »Historische Marktplatz«, das »Alte Stadttor« und eine regionale Landwirtschaftsschule. Nicht ganz das Ende der Welt, aber ziemlich nahe dran.
Als ich auf den kleinen Bahnhofsvorplatz trat, begann das Vorspiel zum Gewitter: Der Himmel hatte sich zugezogen und die Straßen lagen in einem unwirklichen Zwielicht vor mir.
Die Kanzlei war, zum Glück, nur ein paar Minuten vom Bahnhof entfernt. In dem Moment, als ich an der Tür klingelte, fielen die ersten schweren Tropfen.
H.J. Langhard entpuppte sich als sprechender Aktenordner mit Knittermund und ungesunder Gesichtsfarbe. Auf seinem monumentalen Schreibtisch war eine ganze Armada von Pillen, Pülverchen, Magentropfen und Heilerde aufgebaut.
Während er meine Papiere studierte, warf er mir über die Medikamentenpackungen hinweg immer wieder prüfende Blicke zu: »Sie sind Deutscher, leben aber in den Niederlanden, Herr Doktor Klinger?«
»Ich arbeite seit fünfundzwanzig Jahren in Rotterdam.«
Der Anwalt rang sich ein dünnes Lächeln ab und reichte mir meinen Pass. »Darf ich fragen, in welcher Beziehung Sie zu Herrn Linnert standen? Er hat Sie mir gegenüber nie erwähnt.«
»Ich kannte ihn nicht.«
Langhards rechtes Augenlid zuckte. »Wie meinen Sie?«
»Ich habe Carl Linnert nicht gekannt! Als ich siebzehn Jahre alt war, habe ich — so wie es aussieht — einen Sommer in Erzbach verbracht. Möglicherweise bin ich ihm damals begegnet. Aber ich habe keinerlei Erinnerung daran. Nicht an Erzbach und auch nicht an Carl Niklas Linnert.«
»Das ist ... wie soll ich sagen ...« Der Anwalt zupfte nervös an seinen Nasenhaaren.
Ich zog meinen Stuhl an den Schreibtisch und ging zur Offensive über. »Wer war Carl Linnert? Wieso vererbt er einem Fremden sein Haus? Sie waren sein Anwalt. Sie kannten ihn.«
»Sicher. Aber ich weiß nicht, ob es angemessen wäre, wenn ich ...«
»Er ist tot.«
»Ja. Zweifellos.« Langhard schloss die Augen und gab einen Seufzer von sich. »Und ... im Vertrauen gesagt: Für mich ist es ein Rätsel, wie dieser Mann es überhaupt geschafft hat, so alt zu werden. Fast neunzig. Dabei kann ich mich nicht erinnern, ihn auch nur einmal ohne Zigarette gesehen zu haben. Und dann seine Vorliebe für fette Hausmannskost ...« Der Anwalt presste eine Hand gegen den Magen und stöhnte leise auf. »Er fand beim Essen einfach kein Maß. Herr Linnert war sehr ... nun, er war selbst im hohen Alter noch ein äußerst korpulenter ...«
»Fett! Natürlich! Er war ganz unglaublich fett!« Für den Bruchteil einer Sekunde riss der Nebel über meiner Erinnerung auf und vor meinem inneren Auge erschien eine Gestalt, die mehr als nur entfernt an ein Bierfass erinnerte. »Carl Linnert ... Carlo ... natürlich ... der dicke Carlo, so haben wir ihn genannt.«
Wir? Ich stutzte. Wer waren wir gewesen? Und warum hatte ich plötzlich so einen merkwürdigen Geruch in der Nase?
»Kann es sein, dass er roch?«, fragte ich. »Süßlich und irgendwie — muffig?«
»Nun ... jetzt, da Sie es erwähnen ...« Der Anwalt rümpfte die Nase.
»Aber selbst wenn ich ihm damals begegnet bin ... das ist über vierzig Jahre her. Wie kommt er auf die Idee, mich als seinen Erben einzusetzen?« Ich sprang aus meinem Stuhl auf; Langhard sah mich an wie ein verängstigtes Kaninchen. »Und dann diese merkwürdige Auflage: sieben Tage in seinem Haus. So eine Bedingung ist doch wohl kaum alltäglich?«
Der Anwalt schielte sehnsüchtig zu seinen Magentropfen.
»Nun, Herrn Linnert konnte man auch nicht unbedingt als alltäglich bezeichnen. In Erzbach galt er als etwas wunderlich. Sprach mit Tieren und Pflanzen ... In den letzten Jahren hat er sein Haus kaum verlassen, er lebte sehr zurückgezogen. Und das Haus selbst hatte natürlich auch einen Anteil an seinem ein wenig exzentrischen Ruf.«
Langhards Lippen falteten sich zusammen, er strich über seine Krawatte und nahm einen zerknitterten Umschlag vom Schreibtisch, auf dessen Vorderseite sich schwarze Fingerabdrücke abzeichneten. Neben den penibel ausgerichteten, teuren Füllfederhaltern wirkte das Kuvert wie ein peinlicher Verwandter auf Überraschungsbesuch.
»Herr Linnert hat mich beauftragt, Ihnen das hier bei Ihrer Ankunft zu übergeben.«
Ich öffnete den Umschlag: ein karierter Zettel. Aus einem billigen Notizblock gerissen. Carlo Linnerts Krakelschrift. Vier Worte.
Bald träumst du wieder.
Augenblicklich war das merkwürdige Kribbeln in meinem Nacken wieder da. Im nächsten Moment begann sich das Büro um mich herum zu drehen. Ich schnappte nach Luft, meine Hände umklammerten die Armlehnen des Stuhls. Vor meinen Augen wirbelten schwarze und gelbe Punkte umeinander.
»... in Ordnung?« Aus weiter Ferne drang Langhards Stimme zu mir durch. »Wahrscheinlich der Wetterumschwung, das schlägt auf den Kreislauf. Hier, bitte, nehmen Sie doch ein Glas Wasser.«
Ich griff hastig nach dem Glas, stürzte den Inhalt in einem Zug hinunter und atmete tief durch. »Danke. — Danke, es geht schon wieder.« Ich erhob mich, faltete den Zettel zusammen und steckte ihn in meine Hemdtasche. »Sagen Sie, wie komme ich denn von hier aus nach Erzbach? Gibt es eine Busverbindung?«
Langhard räusperte sich. »Wenn ich Ihnen einen Vorschlag machen dürfte: Ich fahre nachher zur Geburtstagsfeier meiner Cousine. Sie lebt in Biber, dem Nachbardorf von Erzbach. Ich könnte einen kleinen Umweg machen und Sie an Herrn Linnerts Grundstück absetzen. Vielleicht decken Sie sich in der Zwischenzeit mit etwas Proviant ein — und Sie sollten einen dicken Pullover kaufen, falls Sie keinen dabei haben. Erzbach liegt ein gutes Stück höher als Beerburg. Abends wird es dort empfindlich kühl — auch im Sommer.«
Ich dankte ihm und war schon an der Tür, als mir noch etwas einfiel. »Als Sie vorhin sagten, das Haus habe dazu beigetragen, dass Carlo Linnert als Exzentriker galt ... Was meinten Sie eigentlich damit?«
Langhard zog ein Pillendöschen aus der Tasche seines Anzugs. »Nun, es ist natürlich nur meine persönliche Meinung, Herr Doktor Klinger, aber ich finde, dieses Haus ...« Er schob sich eine grüne Pille zwischen die Lippen und verzog das Gesicht. »... dieses Haus ist ein Monstrum.«
Der Regen trommelte unablässig auf das Wagendach. Ich nahm das Gepäck aus dem Kofferraum und schlug den Kragen meiner Jacke hoch.
H.J. Langhard und ich hatten ein Abkommen unter Ehrenmännern: Ich würde selbstverständlich die Auflage erfüllen und sieben Tage am Stück in Linnerts Haus verbringen; er würde dies selbstverständlich nicht kontrollieren.
Der Anwalt wendete umständlich und hob noch einmal die Hand zum Gruß, als er an mir vorüberfuhr. Einen Moment später war er, mitsamt seinen Magengeschwüren, im dichten Regen verschwunden.
Eine Bruchsteinmauer, nur unterbrochen von einem großen, schmiedeeisernen Tor, bildete die Grenze zur Straße. Dahinter erstreckte sich ein unübersichtliches, parkähnliches Grundstück, das einen reichlich verwahrlosten Eindruck machte. Im vorderen Teil des Gartens standen Apfel-, Pflaumen- und Birnbäume; ein gutes Stück entfernt konnte ich eine Gruppe von Fichten ausmachen, die dicht aneinandergedrängt dem Regen trotzten. Dahinter reckte sich ein schemenhafter, grauer Umriss in den wolkenverhangenen Himmel. Ich blinzelte durch den Regen und traute meinen Augen nicht: Das graue Ding hinter den Bäumen war ein Turm!
Ich brauchte eine Weile, bis ich an dem Bund, den Langhard mir in der Kanzlei übergeben hatte, den richtigen Schlüssel fand. Als es mir endlich gelang, das Tor zu öffnen, war ich bereits nass bis auf die Knochen.
Es gab keine direkten Nachbarn. Das Haus war das letzte in der steil ansteigenden Straße. Sie machte ein gutes Stück vor Linnerts Besitz eine Kurve, die wieder bergab führte, und erst weit unterhalb der Biegung waren die Dächer einiger vereinzelt stehender Häuser zu sehen. Zur linken Seite grenzte das Grundstück direkt an einen Wald; zur rechten wuchsen hohe, verwilderte Brombeerhecken, deren lange Ranken vom Regen durchgeschüttelt wurden. Das Gras stand kniehoch, dazwischen wucherten Wildblumen, riesige Silberdisteln und mehrere bedrohlich aussehende Zusammenrottungen von Brennnesseln.
Der Weg zum Haus war mehr zu erahnen, als zu erkennen, es herrschte nur etwas weniger Wildwuchs als in dem übrigen Unkrautparadies. Der Pfad lief zunächst auf die Fichten zu und führte dann, in einem kleinen Bogen, links an ihnen vorbei. Das Wasser in meinen Schuhen machte rhythmische, schmatzende Geräusche, während ich durch den Morast stapfte. Auf der Hälfte des Weges brauchte ich eine Atempause und stellte das Gepäck ab.
Um den Stamm eines verkrüppelten Apfelbaumes hatte jemand vor Urzeiten eine Rundbank gebaut, die so verrottet aussah, als würde sie schon beim bloßen Anblick eines Menschen zusammenbrechen.
Der Regen lief in meinen Kragen und tropfte mir von den Haaren in die Augen. Langsam zog ich Linnerts Zettel aus der Tasche und las die vier Worte. Wieder und wieder. Bis das Papier völlig durchnässt war.
Bald träumst du wieder.
Ich hatte seit Jahren nicht mehr geträumt.
Auf den ersten Blick sieht er ganz passabel aus, das muss ich schon sagen. Man weiß ja nie, was einen erwartet: Er hätte auch zu einem von den Typen werden können, die sich ihre drei verbliebenen Härchen quer über die Glatze kämmen. Oder zu irgend so einem wichtigen Entscheidungsträger, der vor lauter Aufgeblasenheit kaum laufen kann. Oder zu einem großen Stück fleischgewordener Langeweile, wie der öde Anwalt von Carlo, der immer aussieht, als hätte er gerade einen Liter Essig auf ex gekippt.
Im Vergleich zu solchen Horrorgestalten schneidet er wirklich gut ab. Klar, ganz so stramm wie damals sieht er nicht mehr aus. Ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Aber er hat einen halbwegs wachen Blick und hält sich einigermaßen aufrecht. Und Haare hat er noch jede Menge, auch wenn zwischen dem Braun so einiges an Silberlametta rumhängt. Vor ein paar Jahren sah er bestimmt noch richtig lecker aus. Man könnte glauben, dass die Weibchen bei ihm Schlange gestanden haben. War aber wohl nicht so, wie ich hörte. Eine gab es mal, er war sogar mit ihr verheiratet, aber die hatte schon nach kurzer Zeit genug von ihm. Das hat Carlo zumindest behauptet, und der war für gewöhnlich bestens informiert.
Ich tripple ein paar Schritte durch das hohe Gras auf ihn zu. Wenn ich mir seine ausgelatschten Treter so angucke: Besonders eitel scheint er nicht zu sein.
Aus der Nähe betrachtet sieht man dann doch, dass der Zahn der Zeit auch an ihm genagt hat: an den vielen Fältchen um den Mund und unter den Augen — und die sehen nicht unbedingt so aus, als hätte er sie vom vielen Lachen. Überhaupt wirkt er ein bisschen verloren, wie er da mit eingezogenen Schultern im strömenden Regen steht und auf das Papier starrt. Um die Nase herum ist er ziemlich blass. Wen wundert’s? Carlo hat mir erzählt, dass er jeden Tag von frühmorgens bis spätabends schuftet. In einem Laboratorium. Wenn man mich fragt: Wer so viel Zeit mit Arbeit verschwendet, mit dem stimmt was nicht. Und als ich erfahren habe, was er da macht, hat es mir beinah die Farbe aus der Schwanzspitze gehauen: Er bastelt künstliche Arme und Beine. Zum Schießen! Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
Er steckt den Zettel weg, auf den er die ganze Zeit geglotzt hat, und greift nach seinen Taschen. Höchste Zeit für den Schnuppertest! Das Aussehen kann täuschen. Der Geruch lügt nie.
Ich recke den Kopf und nehme Witterung auf. Zuerst rieche ich Schweiß, dann ein herbes Rasierwasser. Mittleres Preissegment, würde ich sagen.
So weit, so gut. Das könnte sogar ein Mensch mit seinem rudimentär entwickelten Geruchsapparat wahrnehmen. Aber jetzt kommt die Meisterklasse; das, was nur ein feines Salamandernäschen erschnüffeln kann: der Geruch, der sich unter allen anderen Gerüchen versteckt. Der, den man immer mit sich trägt. Der, der verrät, was wirklich mit einem los ist.
Ich ziehe Luft durch die Nasenlöcher ein, mein Mundboden hebt und senkt sich — und eine Sekunde später weiß ich Bescheid.
Rinde! So was in der Richtung hatte ich beinah befürchtet. Er riecht nach trockener Rinde.
Wie alle einsamen Seelen.
Ich sehe ihm hinterher, als er sich langsam auf die Fichten zubewegt.
Das kann ja heiter werden.
Der Anblick meiner Erbschaft war wie ein unerwarteter Faustschlag in den Magen — nur dass dieser Schlag auf die Augen zielte: In einer kleinen Senke hinter den Fichten stand das merkwürdigste Gebäude, das ich je gesehen hatte. Nichts hätte weniger in diese Umgebung gepasst. Das Haus sah aus, als hätte ein Riesenbaby im Vorübergehen einen Spielklotz fallen lassen, oder als wäre es eines schönen Tages einfach vom Himmel gefallen und rein zufällig in diesem Garten aufgeschlagen: ein massiver Ziegelsteinbau mit einem steilen Dach und spitzen Giebelfenstern.
Auf den ersten Blick wirkte das Haus gedrungen und schwer, wie eine mittelalterliche Festung im Miniaturformat. An den Seiten fanden sich überall runde, turmartige Erker. Die hohen Fenster im Erdgeschoss waren hinter Klappläden versteckt, deren grüner Anstrich an den meisten Stellen abgeblättert war. Breite, ausgetretene Treppenstufen führten zu einer Eingangstür, die fast verdeckt wurde von vier dicken, runden Säulen. Sie waren an ihrem oberen Ende durch einen Rundbogen miteinander verbunden, und darauf saß der Turm, den ich von der Straße aus gesehen hatte. Er überragte das Dach um einige Meter.
All das war schon seltsam genug, aber als ich näher kam, wurde mir klar, dass die verstörende Wirkung des Hauses vor allem dadurch hervorgerufen wurde, dass es Elemente gab, die überhaupt nicht zu der massiven Bauweise passten. So war der Turm mit grünen, zerbrechlich wirkenden Kacheln verkleidet, die sich auch, in waagerechten Streifen angeordnet, am Haus selbst wiederfanden. Alle wiesen sie das gleiche filigrane Blumenmuster auf: Glockenblumen – Moosglöckchen, um genau zu sein.
Das Seltsamste aber war ein fein gearbeitetes, federleichtes Dach, das über der runden Aussichtsplattform des schweren Turms schwebte wie ein Eisschirmchen über einer Schweinshaxe. Ein luftiger Baldachin, der beim geringsten Windstoß davonfliegen konnte.
In diesem Moment — während ich in den grauen Himmel blickte und die Tropfen auf meiner Stirn zerplatzten — begann sich eine verschlafene, unscharfe Erinnerung in ihrem Gedächtnis-Versteck zu regen ...
Ich war nicht zum ersten Mal hier.
Durch diesen Garten war ich schon einmal gelaufen, ich hatte auf den Stufen vor der Haustür gestanden — und ich war auch schon dort oben auf dem Turm gewesen.
Irgendwann, in einem Sommer vor über vierzig Jahren.
Die Eingangstür klemmte, ich musste mich mit der Schulter dagegenstemmen, bis sie sich endlich öffnete. Kaum hatte ich zwei Schritte in den dunklen Hausflur gemacht, als ich über einen Telefonapparat stolperte, der mitten in der Diele lag. Ich hob den Hörer ans Ohr: Der Anschluss war tot. Kein Problem; für den Notfall hatte ich mein Handy. Ich hoffte nur, dass das Telefon das Einzige war, was nicht funktionierte. H.J. Langhard hatte mir versichert, dass es im Haus Strom, warmes Wasser und eine Ölheizung gäbe.
Ein süßlicher, muffiger Geruch schlug mir entgegen. Genau das Aroma, das ich in der Kanzlei zu riechen geglaubt hatte.
Ich zog mir die nassen Schuhe und Socken von den Füßen und machte mich zu einem ersten Erkundungsgang auf.
Geradeaus gelangte ich in eine kleine Küche, von deren Decke getrocknete Blumensträuße hingen. Zwei große, alte Küchenschränke waren bis oben hin mit allem Möglichen vollgestopft: angeschlagenem Geschirr, einem Silberpokal für den »Naturfreund des Jahres«, diversen Angelhaken und einem beeindruckenden Vorrat an Fußpuder. Es gab einen rustikalen Holztisch und zwei Stühle: einer rot, einer blau lackiert. Auf einem schiefen Brett über dem Herd stand ein Sammelsurium von Gläsern und Tassen. Der dickbauchige Kühlschrank sah aus, als wäre er schon ein paar Jahre in Rente, aber als ich ihn an die Steckdose anschloss, begann er fleißig vor sich hin zu rattern. Durch eine schmale Glastür sah man auf eine Terrasse und auf den hinteren Teil des Gartens, der genauso verwildert war wie die Vorderseite.
Nachdem ich meine Vorräte verstaut hatte, setzte ich meine kleine Exkursion fort und öffnete eine der beiden Türen, die von der Diele abgingen: Mitten im Raum stand eine gelbe, durchgesessene Couch mit aufgeplatztem Bezug. Drei wuchtige Sessel — keiner von ihnen passte zum anderen — sahen ähnlich ramponiert aus. Der rote Teppich war mit etlichen Brandlöchern verziert; auf einer monströsen Kommode lag eine dicke Staubschicht. Als hätte der Besitzer des Hauses nicht letzte Woche, sondern schon vor Jahrzehnten das Zeitliche gesegnet.
An den Wänden bogen sich wurmstichige Regale unter der Last viel zu vieler Bücher, und auch vor dem Kamin, auf dem Parkettboden und auf einem kleinen, wackligen Tisch waren Bücher aufgestapelt. Ich zog einen abgegriffenen Einband aus einem der Regale: Die Märchen der Gebrüder Grimm. Daneben ein Buch mit dem schönen Titel Lecker, lecker — Kochen mit Tante Trudi. Ich fand eine zerfledderte Ausgabe von Moby Dick, Das Kapital, Das Große Gärtner Lexikon, ein obskures Werk namens Das Geheimnis der Ley-Linien und mehrere miteinander verklebte Asterix-Ausgaben. Irgendeine erkennbare Ordnung gab es nicht. Das Ganze sah aus wie die apokalyptische Schreckensvision eines nervenkranken Bibliothekars.
In der Ecke neben der Tür stand eine Musiktruhe: ein täuschend schöner Name für ein ausnehmend hässliches Möbelstück. Hinter einer Klappe verbarg sich ein Fach, in dem ein mittelgroßer Schallplatten-Berg aufgestapelt war, in den oberen Teil der Truhe waren ein Radio mit Drehknöpfen und ein Plattenspieler eingebaut. Das Ding musste in den 50er-Jahren der letzte Schrei der Technik gewesen sein.
Herzlichen Glückwunsch: Ich hatte eine Dauerausstellung zur Adenauer-Ära geerbt!
Welche verstaubten Wirtschaftswunder-Relikte würden mich wohl in dem anderen Zimmer erwarten?
Ich huschte über den Flur.
Als ich auf den Lichtschalter drückte, tat sich nichts. Ich tastete mich durch den dunklen Raum, stieß mir den Oberschenkel an einer Tischkante, humpelte fluchend weiter zum Fenster und öffnete die Klappläden.
Im nächsten Moment stand ich wie versteinert da und versuchte zu begreifen, was ich vor mir sah: Auch in diesem Zimmer waren die Wände mit Regalen vollgestellt, aber auf den Brettern standen keine Bücher — sondern Gläser. Große, kleine, runde, eckige, breite, schmale, dicke, dünne Glasbehälter. Bis unter die Decke.
Und in jedem dieser mit Alkohol gefüllten Gläser schlief ein kleines Wesen mit vier Füßen, einem flachen Kopf und großen Augen seinen ewigen Schlaf. Selbst im trüben Licht des Regennachmittags glänzte die Haut der Tiere. Es schien, als würden sie in der Flüssigkeit schweben.
Salamander!
Zögernd trat ich an das Regal und nahm eines der bauchigen Gläser in die Hand. Bergmolch, Europa stand in Linnerts Kinderschrift auf dem Etikett des Glasbehälters. Das Tier, ich schätzte es auf etwa zehn Zentimeter, hatte einen leuchtend orangen Bauch und einen schönen, blau gemusterten Schwanz. Im Glas nebenan fand sich ein Goldstreifensalamander, ein Lurch mit einem außergewöhnlich schlanken Körper. Auf seinem Rücken trug er zwei goldbraune Längsstreifen, die auf dem Schwanz zusammenliefen. Sein Nachbar war der Geknöpfte Krokodilmolch: schwarz, roter Schwanz, mit dicken Warzen an den Seiten; ein ziemlich fettes Exemplar. Ich betrachtete den Spanischen Rippenmolch und den Kalifornischen Wurmsalamander, bestaunte den Feuerbauchmolch — ein Tierchen mit knallroter Unterseite —, bewunderte den Chinesischen Kurzfußmolch und den grünlich gefärbten Marmormolch. Der Letzte in dieser Regalreihe, ein Rotrücken-Waldsalamander aus Nordamerika, hatte kurze, stummelige Beine und einen dermaßen langen Schwanz, dass er auch als Schlange durchgegangen wäre.
Die Farben der Tiere leuchteten so intensiv, dass man kaum glauben konnte, dass sie tot waren. Es sah aus, als würden sie schlafen und nur auf den richtigen Zeitpunkt warten, um wieder zu erwachen.
Erst als das Licht ganz schwach wurde, schaffte ich es, mich von dem Anblick der Amphibien loszureißen. Ich war schon fast aus dem Zimmer, als mein Blick an einem schmalen Glas hängen blieb. Der Salamander, der darin schwamm, hatte einen schwarzen Körper und eine platte, abgerundete Schnauze.
Salamandra atra, Alpensalamander, Europa, stand auf dem Etikett.
Die Schrift war meine Schrift.
Mein einsames Abendessen bestand aus zwei Käsebroten, einer Gewürzgurke und einer Flasche Bier. Das Glas mit dem Alpensalamander hatte ich mitgenommen; es stand vor mir auf dem Küchentisch. Während ich, ohne richtigen Appetit, auf meinem Brot herumkaute, grübelte ich darüber nach, bei welcher Gelegenheit ich mich auf dem Gefäß verewigt haben konnte. Ich hatte nicht einmal den Ansatz einer Idee.
Es war schon nach Mitternacht, als ich beschloss, ins Bett zu gehen — ohne dass ich eine Antwort auf meine Frage gefunden hatte. Ich stieg die knarrende Treppe zu meinem Schlafzimmer hinauf, einer zugigen Kammer im Obergeschoss. Das Mobiliar bestand aus einem morschen Kleiderschrank, einem Nachttisch und einem quietschenden Metallbett. Bevor ich in das Bett stieg, zögerte ich einen Moment: Wo genau war Carlo eigentlich gestorben?
Aber ich war viel zu müde, um mir darüber ernsthaft Gedanken zu machen. In dem Moment, in dem mein Kopf das Kissen berührte, schlief ich bereits.
Es ist Nacht. Ich bin in einem Wald. Der Boden unter meinen Füßen ist weich. Ich bewege mich langsam vorwärts. Ich trage etwas mit mir, eine Last auf meinem Rücken. Die Dunkelheit um mich herum ist in Bewegung: Laub raschelt, Zweige knacken, durch das Blattwerk der Bäume springen unsichtbare Kreaturen von Ast zu Ast. Aus der Ferne ist das Brüllen großer Tiere zu hören.
Ich muss weiter!
Ein Hohlweg zwischen hohen, dunklen Felsen. Riesige Farne leuchten in der Dunkelheit und verbreiten ein diffuses grünes Licht.
Ich lege meine Last auf dem Weg ab und sehe zum Himmel.
Der Mond ist leuchtend gelb.
Auf einer Felsspitze sitzt ein Tier mit glänzender, feuchter Haut und großen, schwarzen Augen. Der Salamander sieht mich an und eine Stimme schlängelt sich flüsternd in meinen Kopf: »... präpariert ... die Stoffe ... präpariert ... sind die Stoffe präpariert ... sind die Stoffe präpariert ... sind die Stoffe ...«
»Präpariert!«
Ich fuhr aus dem Kissen hoch und saß senkrecht im Bett.
Mein Atem ging stoßweise, ich war schweißgebadet. Nur langsam realisierte ich, dass es mein eigener Schrei war, der mich geweckt hatte.
Ich hatte geträumt. Ich hatte tatsächlich geträumt.
Der erste Traum seit Jahren.
Wie konntest du das wissen, Carlo Linnert?
Noch lange spukten die Traumbilder von leuchtenden Farnen und sprechenden Salamandern vor meinen Augen herum — bis das erste Tageslicht sie ganz allmählich verscheuchte.
Ich gähnte ausgiebig, dann raffte ich mich auf und stattete dem Badezimmer einen Besuch ab. Der winzige Raum war ein Fall für das Gesundheitsamt. An der Decke befand sich eine Schimmelkolonie von beeindruckenden Ausmaßen, der Zustand der Badewanne war besorgniserregend und der Versuch zu duschen erwies sich als Himmelfahrtskommando. Das Wasser, das aus dem altertümlichen Duschkopf spritzte, wechselte in schöner Unregelmäßigkeit zwischen eiskalt und brühend heiß, und ich war gezwungen, ein paar interessante Tänze zu vollführen, bis ich es geschafft hatte, mich wenigstens halbwegs zu restaurieren.
Kurz darauf stand ich in der Küche und nahm den pfeifenden Wasserkessel vom Herd, als mein Blick in den Garten fiel. Der Regen hatte nachgelassen, es nieselte nur noch leicht. Nachdem ich mir einen extrastarken Kaffee aufgegossen hatte, trat ich, eine Tasse in der Hand, auf die Terrasse und stieg die von Unkraut überwucherten Stufen in den Garten hinab. Es roch nach Wald und feuchter Erde. Zum ersten Mal fiel mir auf, wie still es war. Kein Autoverkehr, keine Straßenbahn, keine Passanten.
Nur das gleichmäßige Geräusch des Regens.
Hinter dem Garten schlängelte sich ein schmaler Fußweg vorbei, der ein Stück weiter oben im Wald verschwand. Er war von Linnerts Grundstück durch ein undurchdringliches Dickicht aus Brombeersträuchern getrennt. Erst als ich direkt vor der verwilderten Hecke stand, sah ich, dass sie ein niedriges Gartentürchen überwucherte, das fast vollständig unter dem Gestrüpp verschwunden war.
Ein paar Schritte weiter, in einer Ecke des Gartens, in die kaum Licht fiel, stand ein Schuppen, ein schiefes Ding aus Bruchsteinen mit einem rostigen Wellblechdach. Vorsichtig zog ich den Riegel an der Holztür zurück. Nach dem Erlebnis mit dem Zimmer voller Salamander war ich auf so ziemlich alles gefasst — aber der Schuppen erwies sich als Enttäuschung: Ich hatte die Tür nur einen Spalt weit geöffnet, als mir bereits Tonnen von Gartenabfällen entgegenquollen: ausgerupftes Unkraut, vertrocknete Zweige, vor allem aber dornige, verholzte Stängel alter Brombeerhecken. Ich hatte alle Hände voll zu tun, das Dornengestrüpp zurückzuschieben, und holte mir beim Kampf mit dem Unkraut etliche fiese Kratzer. Meine Unterarme waren mit roten Streifen übersät, in meinem rechten Daumen steckte ein dicker Dorn. Ich zog ihn heraus und trat den Rückzug an, während ich dem Schuppen einen letzten, bösen Blick zuwarf. Von dem hinterhältigen Ding würde ich mich für den Rest meines Aufenthaltes fernhalten.
Nachdem ich meine Kratzer desinfiziert hatte, nahm ich das obere Stockwerk des Hauses in Augenschein. Neben der Schlafkammer und dem Bad gab es noch einen weiteren Raum, der fast die Hälfte der Etage einnahm. Ich hatte mich am vergangenen Abend dort noch nicht umsehen können, da es auch in diesem Zimmer keine funktionierende Glühbirne gab und es bereits viel zu dunkel gewesen war, um Genaueres zu erkennen.
Als ich die Tür öffnete, blieb ich überrascht im Rahmen stehen. Für einen regnerischen Tag wie heute wirkte der Raum außergewöhnlich hell. Das Dach über diesem Teil des Hauses war nicht mit Ziegeln gedeckt; man blickte durch riesige, wenn auch reichlich dreckige Glasscheiben direkt in den Himmel.
Das hier musste eine Art Gewächshaus gewesen sein. Zwar fand sich keine einzige Pflanze mehr, aber auf den flachen Tischen, die in vier langen Reihen angeordnet waren, standen Gießkannen und angeschlagene Pflanzentöpfe aus Ton. Auf dem Boden waren kleine Häufchen trockener Pflanzenerde verteilt.
Ich schob mich langsam zwischen den Tischreihen hindurch. An der gegenüberliegenden Seite des Zimmers führte eine stählerne Wendeltreppe zu einer niedrigen hölzernen Tür in der Wand. Das musste der Zugang zum Turm sein. Ich stieg die Treppe hoch und versuchte die Luke zu öffnen, doch keiner meiner Schlüssel passte. Schließlich lehnte ich mich mit meinem ganzen Gewicht gegen das Holz und drückte mit beiden Händen gegen die Tür — auch Gewalt brachte mich in diesem Fall nicht weiter. Ich setzte mich auf die Treppe und betrachtete die Schlüssel an dem Bund. Einer davon musste doch passen. Es sei denn ...
Mein Handy lag auf dem Küchentisch. Die Nummer der Anwaltskanzlei war gespeichert.
Langhard klang zutiefst beleidigt: »Nein, natürlich nicht, Herr Doktor Klinger. Alle Schlüssel, die ich hatte, habe ich Ihnen ordnungsgemäß ausgehändigt. Aber wenn Sie es wünschen, werde ich natürlich noch einmal nachsehen. Ich melde mich bei Ihnen. Einen schönen Tag. Auf Wiederhören.«
Fehlanzeige.
Ich ließ meinen Blick durch die Küche wandern. Vielleicht war der Schlüssel ja irgendwo hier, inmitten des ganzen Krimskrams, in einem der Schränke. Es würde Stunden dauern, alles zu durchsuchen — aber ich hatte ja auch keine dringende Verabredung.
Also ... wo würde ich einen Schlüssel aufbewahren?
Auf dem größeren der beiden Küchenschränke standen mehrere Teedosen. Das sah doch schon ganz vielversprechend aus. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und versuchte nach einer davon zu greifen, als meine Hand in etwas Klebriges fasste. Ich machte einen Satz zur Spüle, wusch mir die Hände und entschied mich, ziemlich angeekelt, die Untersuchung der klebrigen Dosen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben und mich fürs Erste den Schränken zuzuwenden.
Neben Geschirr und ein paar einsamen Küchenutensilien fand ich allen möglichen und unmöglichen Krempel. Linnert war offenbar nicht der Typ gewesen, der sich leichten Herzens von Dingen trennen konnte. Ich stieß auf eine Tonpfeife, einen Stapel Suppenkonserven mit überschrittenem Haltbarkeitsdatum und entdeckte Dutzende von Postkarten aus allen möglichen Gegenden der Welt. Zwischen einem Jahrhundertvorrat an Zahnstochern und einer ausgelaufenen Flasche mit Ohrentropfen fand ich in einer der Schubladen etwas, das wie der abgebrochene Zahn eines großen Tieres aussah. Nach drei Stunden hatte ich mich durch die Schränke durchgearbeitet und alles Mögliche zutage gefördert — drei Schneekugeln, eine Handvoll Flusskiesel und eine Mundharmonika — aber keinen Schlüssel.
Vielleicht hatte ich im Wohnzimmer mehr Glück.
Die oberste Schublade der alten Kommode klemmte. Ich ruckelte daran herum, dann zog ich mit aller Kraft — bis die Lade plötzlich ihren Widerstand aufgab, mir entgegen geschossen kam und auf den Boden krachte. Eine Flut aus angelaufenem Silberbesteck ergoss sich laut scheppernd über das Parkett. Ich sprang zurück, stieß dabei gegen einen kleinen Tisch und brachte mehrere Bücherstapel zum Einsturz. Vor mich hin schimpfend, kniete ich mich in das Chaos und begann, die Bücher wieder aufzustapeln. Dabei fiel mir eine zerfledderte Schwarte in die Hand, deren Rückseite von der Zeichnung eines sehr erleuchtet dreinblickenden Südasiaten geziert wurde. Behutsam drehte ich das Buch in meiner Hand.
Dr. Timotheus Leer
Mensch und Pflanze
Band 3
Kräuter — Heiler und Helfer
Der gute Carlo war ja wirklich vielseitig interessiert gewesen. Ich blätterte, nur mäßig begeistert, durch die Seiten — als plötzlich mehrere zusammengefaltete Blätter aus dem Buch rutschten.
Sie stammten von demselben billigen Block wie der Zettel, den Langhard mir übergeben hatte.
Und sie waren mit der gleichen krakeligen Schrift beschrieben!
Lieber Lukas, mein lieber Freund,
jetzt hab ich gerade, für einen Moment, überlegt, ob ich dich mit Lukas oder mit Herr Doktor Klinger anreden soll. Nachdem, was man so hört, bist du ja eine echte Koryphäe auf deinem Gebiet, so was wie der Prothesen-Papst. Ein paar der Artikel, die du in Fachzeitungen veröffentlicht hast, hab ich sogar gelesen. Ich hab zwar höchstens die Hälfte davon kapiert, aber das, was ich verstanden hab, klang wirklich beeindruckend. (Und, unter uns gesagt, auch reichlich gruselig.)
Jedenfalls, ich schätze mal, eine ganze Reihe von Leuten kennt dich nur als Herr Doktor Klinger. Aber das funktioniert bei mir einfach nicht. Für mich bleibst du Lukas Klinger. So hab ich dich schließlich gekannt, damals.
Du warst ein guter Junge — manchmal ein bisschen verwirrt. Aber in dem Alter sind alle verwirrt, das ist nichts Besonderes. Und in deinem Fall muss man sagen, dass du ja weiß Gott genug Grund dazu hattest. Es sind schon ein paar ganz schön seltsame Sachen passiert in dem Sommer, in dem wir uns kennengelernt haben. Sachen von der Art, die einem keiner glaubt, wenn man sie erzählt. Aber so ist das eben. Ich hab mal — das war in Hongkong — eine Geschichte mit einem Kapuzineräffchen, einer singenden Säge und einem norwegischen Transvestiten erlebt ... Äußerst merkwürdig, muss ich sagen. Hat mir natürlich niemand geglaubt. Genauso wenig wie die Sache mit dem Bergsee, der ganz plötzlich verschwunden ist, einfach so über Nacht. Als ich wach wurde, war er weg. Das war zu der Zeit, als ich in Südamerika unterwegs war und in den Anden rumgeklettert bin. Auch schon ganz schön lange her.
Irgendwann war es dann vorbei. Erst mit dem Klettern und dann auch mit dem Wandern. Jetzt schlurfe ich höchstens mal eine Runde durch den Garten und guck den Brombeeren beim Wachsen zu. Aber so schlecht ist das auch nicht. Es gibt jede Menge toller Sachen, direkt vor der eigenen Haustür. Wenn man älter wird, kriegt man den richtigen Blick für die kleinen Dinge und man lernt, sich jeden Tag ein paar besondere Momente zu schaffen. Wo ich gerade dabei bin: Der beste Weg, den Tag in diesem Haus zu beginnen, ist der, in der Küche zu sitzen, den Garten zu betrachten und abzuwarten, wie sich der Morgen so entwickelt. Dazu ein lauwarmer Kaffee mit Schuss und eine Selbstgedrehte. Während es in deinem Bauch gluckert, prostest du dem jungen Tag mit dem Kaffeebecher zu und begrüßt ihn mit einem Rauchopfer.
Probier es mal aus. (Mein Vorrat an Mandellikör und Tabak dürfte mich überdauern — sieh mal in dem kleinen Schrank unter der Spüle nach, hinter den Putzlumpen.) Ach, und wenn du diese Momente genießen willst und Wert auf deine Ruhe legst: Öffne auf keinen Fall die Tür, wenn es klingelt. Wahrscheinlich ist es diese nervtötende Frau, die vor ein paar Jahren mit ihrer Familie in das Haus weiter unten in der Straße eingezogen ist. So eine, die ihre Brut nur mit Quark und Schnittlauch und tonnenweise Möhren füttert, damit sie auch alle garantiert zweihundert Jahre alt werden. Die nervt gerne ihre Nachbarn und ist neugieriger als eine Horde Brüllaffen. Einmal kam sie während meines Morgenrituals vorbei und wollte ihre Schnüffelnase hier reinstecken. Weil ich ein höflicher Mensch bin, hab ich ihr natürlich auch einen Kaffee mit ordentlich Schuss angeboten. Sie hat mich völlig entgeistert angeguckt. Als hätte ich gefragt, ob ich sie mal kurz auf dem Küchentisch flachlegen könnte.
»Nein, Herr Linnert, doch keinen KAFFEE. Und dann auch noch mit ALKOHOL. Und die ZIGARETTEN. Wissen Sie, was Sie Ihrem Körper damit ANTUN? Sie müssen SOFORT damit aufhören. Und machen Sie SPORT! Es gibt da auch Angebote für Senioren.«
Die Frau hat sie doch nicht mehr alle. Ich bin fast neunzig und geb demnächst den Löffel ab. Das Einzige, was ich noch trainieren muss, ist mit gefalteten Händen stillzuliegen. — Also bleib weg von der Tür. In deinem eigenen Interesse.
Mein lieber Mann, jetzt hab ich mich mal wieder völlig verfranzt. Eigentlich wollte ich auf was ganz anderes raus. Aber das war schon immer mein Problem: der rote Faden. Wenn ich erst mal anfange, dann kommt eins zum anderen und auf einmal bin ich irgendwo gelandet und frage mich, wie ich eigentlich dahin gekommen bin. Als ich noch gewandert bin, war es auch immer so. Die meisten haben ihre feste Route, aber wenn ich irgendwo was Interessantes gesehen hab, dann bin ich eben abgebogen. Klar kam ich viel später ans Ziel als die anderen, aber dafür hab ich auch eine ganze Menge mehr gesehen: in Zürich mal einen Dackel, der bis fünfzig zählen konnte, zum Beispiel. Oder diese merkwürdige Oper, in der kein einziger Ton gesungen wurde. Und einmal, in Mexiko City, sogar ein irrsinnig schnelles, glitzerndes Ding, das fast eine Stunde lang über der Stadt gekreist ist.
Einen ganzen Haufen merkwürdiges Zeug.
Und damit bin ich über ein paar Umwege auch wieder dahin gekommen, wo ich hin wollte. Darum geht es nämlich: merkwürdiges Zeug, seltsame Sachen. Darauf wollte ich hinaus: Manchmal passieren eben seltsame Sachen!
Das Problem ist nur, dass die meisten nicht hinsehen. Wenn sie jung sind, schon — wenn man jung ist, glaubt man, dass so ziemlich alles möglich ist. Aber sobald sie erwachsen geworden sind, lässt das ganz rapide nach. Dann haben sie eine genaue Vorstellung davon, wie die Welt ist und wie sie nicht ist, und von dem, was möglich ist und was nicht. Und wenn ihnen was Seltsames widerfährt, dann sehen sie einfach weg oder sie sagen sich, dass es nur Einbildung war. Das lässt sie ruhiger schlafen.
Ohne dir zu nahe treten zu wollen — ich befürchte, du bist auch so ein Scheuklappen-Wallach geworden. Aber Kopf hoch, mein Bester! Das muss ja nicht so bleiben. Du warst ein ganz helles Köpfchen damals und ich bin mir sicher, dass sich daran nichts geändert hat. Und darum glaub ich auch, dass selbst dir als geübtem Weggucker aufgefallen sein dürfte, dass in letzter Zeit einige Dinge in deinem Leben sehr komisch laufen: Da wechselt der dicke Carlo, an den du schon ewig nicht mehr gedacht hast, die Dimension und vererbt dir mal eben so sein Haus. Und schwupps bist du hier, träumst merkwürdige Träume, liest einen Brief, den dir ein toter Mann geschrieben hat, und fragst dich, was das alles soll. Was DU hier eigentlich sollst? Die Antwort, mein lieber Freund, ist einfach:
Du bist hier, um dich zu erinnern.
Ein guter Bekannter von mir ist der Meinung, dass die richtigen Sachen immer zur richtigen Zeit geschehen. Nachdem, was ich so erlebt hab, kann ich ihm da nur beipflichten. Und das betrifft auch das Vergessen und das Erinnern. Beides hat eben seine Zeit.
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Wenn ich von Vergessen spreche, dann meine ich nicht so was wie: Wo hab ich bloß meine Zigarette abgelegt? Und dann sucht man und man sucht, und was man am Ende findet, ist ein neues Brandloch im Teppich. Das ist nur Zerstreutheit. (Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche.) Was ich eigentlich meine, ist aber eine ganz andere Art von Vergessen: Manchmal MUSS man Dinge vergessen. Wenn einem was Schreckliches zustößt; oder wenn etwas so Merkwürdiges geschieht, dass man es nicht glauben kann. Oder beides zusammen.
Das Dumme ist nur: Die Sache selbst verschwindet nicht dadurch, dass man sie vergisst. Man hat sie nur in den Keller gesperrt und da bleibt sie vielleicht auch ein paar Jahre und rührt sich nicht. Aber irgendwann fängt sie an, die Kellertreppe hochzukriechen. Natürlich kann man versuchen, die Schritte auf den Stufen zu überhören, aber auf die Dauer ist das nicht sonderlich gesund — und bringt einen nicht weiter. Ich weiß, das ist Küchenpsychologie und irgend so ein superschlauer Psycho-Freud könnte dir das mit vielen Fachausdrücken sicher viel besser erklären — aber ich glaube, du verstehst schon, was ich meine. Irgendwann klopft es so laut an die Kellertür, dass man sowieso nicht mehr weghören kann.
Dann ist es höchste Eisenbahn, sich zu erinnern.
Wichtig ist aber auch, wie man es tut. Es muss ganz langsam gehen, Stück für Stück. Sonst kann es dir glatt passieren, dass du davon umgehauen wirst.
Ich vergesse zwar manchmal, was ich sagen wollte oder wo ich meine Fluppe abgelegt hab, aber mein Langzeitgedächtnis ist ein echtes Schätzchen. Ich kann mich an all das erinnern, was damals passiert ist. In dem verregneten Sommer, 1963.
Ich könnte dir alles haarklein erzählen – doch das ist eben nicht Sinn der Sache. Hier geht es nicht um meine Erinnerung, sondern um deine. Alles, was ich tun kann, ist dir ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Also, halt die Augen und Ohren auf. Und die Nasenlöcher auch.
Die richtigen Dinge finden sich zur richtigen Zeit!
(Das wirst du wohl nicht ernsthaft in Zweifel ziehen, wo du gerade diesen Brief in deiner Hand hältst.)
Siehst du?
Und denk dran: langsam. Stück für Stück.
Dein Freund Carlo
PS: Fast hätt ich es vergessen: Der Bekannte, den ich vorhin erwähnte, hat mir versprochen, dich bei Gelegenheit mal zu besuchen. — Keine Angst, der klingelt nicht an der Tür.
PPS: Vorsicht mit der Dusche! Das verdammte Wasser macht, was es will.
PPPS: Vielleicht sollte ich deinem Gedächtnis ja einen kleinen Schubs geben. Schließlich braucht jede Geschichte einen Anfang. Du weißt schon, so was wie »Es war einmal...«. Aber in deinem Fall müsste es schon was Spezielleres sein. Also ... vielleicht versuchst du es mal hiermit: Alles begann mit dem Regen.
Ich ließ mich in einen der altersschwachen Sessel fallen; sofort hüllte mich eine dichte Staubwolke ein.
Dieser Brief war mit Sicherheit das Merkwürdigste unter all den merkwürdigen Dingen, die mir in den letzten Tagen begegnet waren. Eigentlich konnte es ihn gar nicht geben. Ein Brief, den mir ein Toter geschrieben hatte und über den ich zufällig gestolpert war, weil zufällig eine Schublade auf den Boden gekracht war und ich zufällig einen Bücherstapel umgestoßen hatte.
Die richtigen Dinge finden sich zur richtigen Zeit!
Du bist hier, um dich zu erinnern.
Damals in dem verregneten Sommer, 1963 ...
Ich sah aus dem Fenster und blickte auf die Bäume hinter Linnerts Haus. Der Regen war wieder stärker geworden, die Tropfen klatschten in immer kürzeren Abständen gegen die Scheibe, liefen an dem Glas herunter und hinterließen ihre nassen Spuren, hinter denen der Wald langsam verschwamm.
Alles begann mit dem Regen ...
2. Kapitel
1963
»Gottverdammter Regen!«
Für einen Mann, der den größten Teil seiner Zeit in Kirchen verbrachte, besaß mein Vater ein bemerkenswertes Repertoire an Flüchen. Er saß so weit nach vorne gebeugt, dass seine Nase fast an die Windschutzscheibe des Käfers stieß, und umklammerte das Lenkrad, als wäre es ein Rettungsring.
Die ganze Welt schien nur noch aus Wasser zu bestehen. Der Wolkenbruch war völlig unvermittelt gekommen. Es war erst früher Nachmittag, aber von einer Sekunde auf die andere wurde es so dunkel, dass Vater die Scheinwerfer einschalten musste. Der grüne VW schob sich mühsam die Serpentinenstraße hoch, wie ein brummendes, schwerfälliges Insekt, das sich in der Dunkelheit verirrt hatte. Die abgefahrenen Reifen schwammen auf der nassen Straße; die Scheibenwischer taten, was sie konnten, aber sie hatten keine Chance gegen die Regenmassen. Selbst ein geübter Fahrer hätte, auf dieser Straße und bei diesem Wetter, Schwierigkeiten gehabt.
Vater war ein katastrophaler Fahrer. Im Normalfall vermied er es, sich ans Steuer zu setzen. Autofahren gehörte zu den praktischen Dingen des Lebens, für die meine Mutter zuständig war.
»Papa, pass auf!«
Der Wagen brach aus, schlitterte über die nasse Fahrbahn und rutschte auf die Leitplanke zu. Dahinter ging es steil nach unten. Vater trat auf die Bremse und kurbelte hektisch am Steuer. Der VW schleuderte nach links, drehte sich einmal um die eigene Achse und nur mit viel Glück kamen wir, quer auf der Fahrbahn, zum Stehen. Der Motor gab ein letztes Tuckern von sich, dann ging er aus.
»Musst du hier so rumbrüllen?«, fuhr Vater mich an.
Normalerweise war er ein ganz ruhiger Vertreter seiner Art. Der einsilbige Typ, mit dem man gut auskam, solange man nichts von ihm wollte. Aber wenn etwas von ihm verlangt wurde, dem er sich nicht gewachsen fühlte, wie einzukaufen, eine Steuererklärung abzugeben oder ein Fahrzeug zu lenken, konnte er sehr schnell gereizt werden. Er wischte sich über die Stirn und atmete durch. »Tut mir leid, Junge, ich habe mich einfach nur erschrocken. Geht es dir gut?«
»Alles in Ordnung, mir ist nichts passiert.«
Er versuchte, den Wagen zu starten. Seine Beine waren viel zu lang für den Fahrerraum. Er war ein großer, dünner Mann mit einer Vorliebe für weite, bequeme Cordanzüge, die sackartig an ihm herunterhingen, was ihm, aus der Ferne betrachtet, das Aussehen einer Vogelscheuche verlieh.
»Keine Angst, ich kriege das schon hin. ‒ Ich kriege das hin«, wiederholte er mit zittriger Stimme. Es klang nicht besonders überzeugt.
Nach mehreren Versuchen gelang es ihm aber tatsächlich, den Wagen in Bewegung zu setzen, und der altersschwache Käfer nahm seinen Kampf gegen den Regen wieder auf. Die Bäume zu beiden Seiten der Straße waren so gewaltig, dass ihre Kronen über der Fahrbahn ein Dach bildeten, das nichts durchließ außer dem Regen. Als würde man durch einen langen dunklen Tunnel fahren.
»Ist mit dem Werkzeug alles in Ordnung?«, fragte Vater.