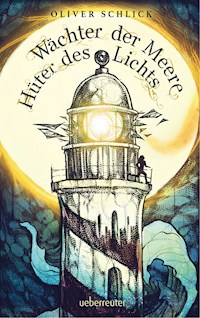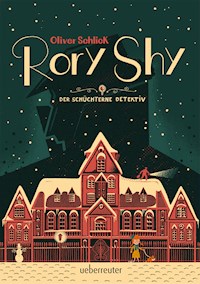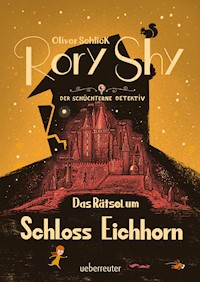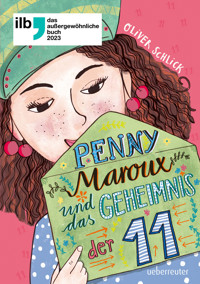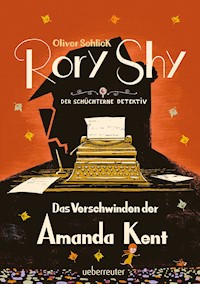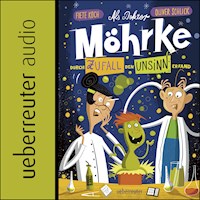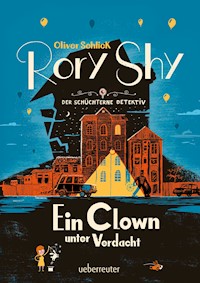
Rory Shy, der schüchterne Detektiv - Ein Clown unter Verdacht (Rory Shy, der schüchterne Detektiv, Bd. 5) E-Book
Oliver Schlick
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ueberreuter Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Rory Shy, der schüchterne Detektiv
- Sprache: Deutsch
Spannend, clever und einzigartig: Band 5 der etwas anderen Krimireihe rund um das ungleiche Ermittlerduo Der berühmte schüchterne Detektiv Rory Shy und seine 12-jährige Assistentin Matilda werden mit einem neuen kniffligen Fall beauftragt: Ein Mann wurde von einem Auto angefahren – offensichtlich ein Unfall mit Fahrerflucht. Oder war es am Ende sogar versuchter Mord? Was obendrein höchst seltsam ist: Am Steuer des Wagens saß ein Clown! Wer verbirgt sich unter dem Clownskostüm? Und welches Motiv steckt hinter der Tat? Unterstützt werden Rory und Matilda bei ihren Ermittlungen wie immer von dem hasenfüßigen Cockerspaniel Dr. Herkenrath. Ein herrlich witziger und wunderbar schüchterner Krimi!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Der berühmte schüchterne Detektiv Rory Shy und seine 12-jährige Assistentin Matilda werden mit einem neuen kniffligen Fall beauftragt: Ein Mann wurde von einem Auto angefahren – offensichtlich ein Unfall mit Fahrerflucht. Oder war es am Ende sogar versuchter Mord? Was obendrein höchst seltsam ist: Am Steuer des Wagens saß ein Clown! Wer verbirgt sich unter dem Clownskostüm? Und welches Motiv steckt hinter der Tat? Unterstützt werden Rory und Matilda bei ihren Ermittlungen wie immer von dem hasenfüßigen Cockerspaniel Dr. Herkenrath.
Ein herrlich witziger und wunderbar schüchterner Krimi!
Inhalt
Freunde und Verwandte
Clown mit Christenfisch
Leopardin in Stiefeletten
Agentur Lachmann
Streit um Tiffy
Das schnellste Geständnis aller Zeiten
Bärchen und Schneckchen
Eine überraschende Begegnung
Willst du sinnlos Geld verpulvern
Frau Zeigler wird rot
Der bimmelnde Hintern
Torkeln und Schlingern
Ein Anschlag
Alles auf den Kopf gestellt
Erkenntnisse im Aufzug
Die Maske fällt
Habgier
Pfarrer, Klempner, Känguru
1
Freunde und Verwandte
Doktor Herkenrath hat sich heute Morgen unters Sofa verkrochen. Jetzt ist es sechs Uhr abends und er liegt immer noch da. Hat sich keinen Zentimeter von der Stelle gerührt. Weil er sich schämt. Und das völlig zu Recht! Gestern hat mein überängstlicher Cockerspaniel mal wieder für reichlich Aufruhr gesorgt.
Kurz nach siebzehn Uhr war ich mit ihm am Boringer Platz, um mir den Martins-Umzug anzusehen. Bei der Gelegenheit hat sich rausgestellt, dass er nicht nur eine Heidenangst vor Eichhörnchen, Katzen, Schmetterlingen und Salamandern hat. Sondern auch vor Blasmusik.
Als sich der Umzug in Bewegung gesetzt und die Blaskapelle Ich geh mit meiner Laterne angestimmt hat, ist Doktor Herkenrath durchgedreht, in Panik über die Straße geschossen und hat – Rabimmel, rabammel, rabumm – einen Trompeter, eine Tuba-Spielerin und zu guter Letzt auch noch einen unbeteiligten Brezelverkäufer ins Stolpern gebracht. Dabei hat er dermaßen hysterisch gejault, dass zwei Polizeipferde und das Pferd von St. Martin scheuten und auf die Hinterbeine stiegen. Was ein kleines Mädchen so erschreckte, dass es ungeschickt mit seiner Laterne hantierte, die augenblicklich in Flammen aufging.
Der Laternen-Brand war schnell gelöscht, aber Doktor Herkenrath und ich haben bis auf Weiteres strengstes Martins-Umzug-Verbot. Ausgesprochen von einer berittenen Polizistin. Und von St. Martin höchstpersönlich.
Weswegen ich im Moment nicht besonders gut auf meinen feigen Hund zu sprechen bin.
Er winselt und guckt verschämt unter dem Sofa hervor, was wohl bedeuten soll: »Entschuldige, dass ich mal wieder ausgeflippt bin, Matilda. Ich verspreche hoch und heilig, mich in Zukunft am Riemen zu reißen. Großes Cockerspaniel-Ehrenwort!«
Aber so einfach mache ich es Doktor Herkenrath nicht, zeige ihm demonstrativ die kalte Schulter, nehme in einem Sessel Platz und greife nach der Tageszeitung, die Frau Zeigler heute Morgen besorgt hat.
Frau Zeigler ist unsere Haushaltshilfe und käme nie auf die Idee, sich online über die Weltlage zu informieren. Sie ist da altmodisch und bevorzugt bedrucktes Papier.
Gleich auf Seite zwei stoße ich auf einen Artikel, der sich mit dem Fall von Amanda Kent beschäftigt. Das mysteriöse Verschwinden der Schriftstellerin hat vor ein paar Wochen für gewaltiges Aufsehen gesorgt und ist noch immer Thema in der Presse. Die Titelzeile lautet: Schüchtern und erfolgreich! Wie Rory Shy die vermisste Bestseller-Autorin aufspürte.
Über dem Bericht ist ein Foto des schüchternen Detektivs zu sehen, das ihn in typischer Haltung zeigt: mit gesenktem Kopf, den Blick zu Boden gerichtet, während er mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand verlegen an seinem Ohrläppchen zupft.
Dass der zurückhaltende Rory, trotz extremer Schüchternheit, alle seine Fälle löst, hat ihn zu einer Berühmtheit gemacht. Der schüchterne Detektiv ist jedermann ein Begriff.
Wovon fast niemand weiß, ist, dass ich mit Rory zusammenarbeite. Nachdem ich ihn mal aus einer misslichen Situation befreit habe, hat er mir eine detektivische Assistentinnen-Stelle angeboten. Seither habe ich ihn schon mehrfach bei seinen Ermittlungen unterstützt. Ohne Bezahlung, dafür aber mit viel detektivischem Ehrgeiz, kriminalistischem Eifer und meinem bewährten losen Mundwerk.
Während ich den Zeitungsartikel mit gerunzelter Stirn lese (die Hälfte des Berichts ist frei erfunden), versucht Doktor Herkenrath erneut, mit einem schuldbewussten Fiepen gut Wetter zu machen.
»Schäm dich ruhig noch ein bisschen. Du hast jeden Grund dazu«, sage ich, ohne von der Zeitung aufzublicken. »Vor allem, weil du mich in die Sache reingezogen hast. Wieso habe icheigentlich Martins-Umzug-Verbot? Ich habe schließlich nicht randaliert und Angst und Schrecken verbreitet.«
Doktor Herkenrath streckt vorsichtig den Kopf unter dem Sofa hervor, schielt ängstlich zu mir herüber, versucht, auszusehen wie ein reuiger Sünder und legt seinen allertraurigsten »Bitte verzeih mir«-Blick auf.
Weil er genau weiß, dass ich bei diesem Blick die Waffen strecke und ihm nicht mehr böse sein kann.
»Ja, ja, komm schon her, du Angstschisser«, sage ich, knie mich vor die Couch und kraule ihm die Ohren – worauf er erleichtert hechelt.
In einer Familie streitet man manchmal. Und dann verträgt man sich wieder. Das gehört zum Familienleben dazu.
Doktor Herkenrath ist Teil der Familie Bond, seit Papa, Mama und ich ihn vor fünf Jahren aus dem Tierheim geholt haben. Er war erst ein paar Wochen alt, hatte aber schon damals den wehmütigen Schiele-Blick, bei dem jeder, der kein Herz aus Stein hat, augenblicklich dahinschmilzt.
Dass wir Doktor Herkenrath in unsere Familie aufgenommen und ihn (wenn man so will) ausgesucht haben, unterscheidet ihn von allen anderen Familienmitgliedern. Denn eigentlich gilt: Freunde sucht man sich aus. Bei Verwandten hat man keine Wahl.
Man kommt auf die Welt und kaum ist der erste Atemzug getan, hat man schon eine mehr oder weniger große Familie an der Backe: Eltern, Großeltern und möglicherweise noch Geschwister, Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen und jede Menge weiterer Verwandter. Und dann heißt es: Kommt mal klar miteinander!
Nicht, dass ich Grund zur Beschwerde hätte. Was Papa und Mama angeht, gibt es nur wenig zu meckern. Und das gilt auch für den Großteil der übrigen Verwandtschaft.
Besonders gerne mag ich Tante Vera, Mamas jüngere Schwester. Sie arbeitet als Fotografin, wohnt mit ihrer Freundin auf einem Hausboot und hat das ansteckendste Lachen, das ich je gehört habe. Oder meine Cousine Lucy, die Tochter von Papas Bruder Tim. Sie ist ein Jahr älter als ich, mit Sommersprossen übersät und im Chaosanrichten fast so begabt wie Doktor Herkenrath. Dass sie als Sechsjährige mal Handstand auf dem Balkongeländer geübt und damit einen Großeinsatz von Rettungskräften ausgelöst hat, ist noch heute Gesprächsthema bei Familienfeiern.
Aber natürlich gibt es auch ein paar Verwandte, die ich eher nervig finde: Onkel Achim, zum Beispiel. Er ist Papas ältester Bruder und berüchtigt dafür, lahme, unlustige Witze zu erzählen. Schlimm genug, sollte man meinen. Aber noch schlimmer als schlechte Witze sind schlechte Witze, die schlecht erzählt werden. Was das angeht, ist Onkel Achim weithin gefürchtet.
»Also … kommen ein Pfarrer, ein Klempner und ein Känguru in einen Schuhladen. Sagt der Pfarrer … Äh, nein, andersrum: Sagt der Klempner … Nein, halt: Es war ja gar kein Schuhladen, sondern ein Eissalon. Jedenfalls … sagt das Känguru: ›Aber doch nicht am Sonntag!‹ Ach, nein, das kommt ja erst am Schluss. Noch mal: Kommen ein Pfarrer, ein Klempner und ein Krokodil in eine Tankstelle … Nein, das ist auch falsch. Ich fang besser noch mal von vorne an.«
Dass er immer nur ein paar gequälte Mitleids-Lacher erntet, bringt Onkel Achim nicht etwa auf den eigentlich naheliegenden Gedanken, dass seine Witze grottenschlecht sind. Er vermutet den Grund für die verhaltene Reaktion darin, dass seine Zuhörer die Pointe nicht kapiert haben.
»Am Sonntag! Verstehst du? Am Sonntag! Hi, hi, hi. Dabei konnte das Känguru am Samstag doch noch gar nicht wissen, dass sich der Pfarrer und der Klempner auf dem Weg zur Kirche verlaufen würden. Ist doch köstlich, oder?«
Seit ich dieses traurige Schauspiel auf mehreren Familienfeiern miterleben musste, weiß ich: Es gibt noch eine Steigerung von schlecht erzählten schlechten Witzen: Schlecht erzählte schlechte Witze, die umständlich erklärt werden. Weswegen ich bei Familientreffen immer darauf achte, möglichst weit weg von Onkel Achim zu sitzen. Abgesehen von seinen müden Gags ist er aber eigentlich ganz in Ordnung.
Was man von Großtante Wally auch beim allerbesten Willen nicht behaupten kann. Sie ist ein ausgesprochen unangenehmer Charakter: verkniffen, humorfrei selbstmitleidig und rechthaberisch. Und außerdem eine falsche Schlange, die unaufhörlich Gift versprüht.
Das einzig Gute an Großtante Wally ist, dass sie fünfhundert Kilometer entfernt wohnt. Schlecht ist, dass sie uns zweimal im Jahr für eine Woche besuchen kommt.
Man kann Mama nur für ihre Selbstbeherrschung bewundern, die sie bei diesen Besuchen an den Tag legt. Ich an ihrer Stelle wäre jedes Mal versucht, Großtante Wally Arsen ins Essen zu rühren. Auf Mama hat sie es nämlich abgesehen. Mein Vater hingegen ist ihr absoluter Liebling und kann in ihren Augen nichts falsch machen.
Papa ist ein gesetzestreuer Bürger. Wäre er es nicht, sondern hätte, sagen wir mal, einen Hang zum Zündeln, und man würde ihn mit Benzinkanister und Feuerzeug vor einer brennenden Scheune erwischen, würde Großtante Wally ihn sofort in Schutz nehmen und jedermann erklären, dass der liebe Thomas auf keinen Fall was mit dem Brand zu tun haben kann. Und wenn doch, dass er bestimmt gute Gründe für sein Handeln hatte. Oder, dass das alles nur auf den schlechten Einfluss seiner Frau zurückzuführen ist.
Das Einzige, was der liebe Thomas ihrer Ansicht nach nämlich nicht ganz so richtig gemacht hat, war, Mama zu heiraten. Und darum bedenkt Tante Wally sie andauernd mit Gemeinheiten. Die tarnt sie als vorgebliche Komplimente, lächelt katzenfreundlich und sagt Dinge wie: »Oh, Kristina, was für eine entzückende neue Frisur. Da sieht man mal wieder, dass ein fähiger Frisör auch aus dünnem und glanzlosem Haar etwas zaubern kann.«
Mamas Haar ist weder dünn noch glanzlos. Großtante Wally ist einfach eine missgünstige alte Krähe. Bei ihrem letzten Besuch hat sie, während wir alle zum Abendessen um den Tisch herum saßen, in unschuldigem Ton gefragt: »Erinnerst du dich noch an die Freundin, mit der du zusammen warst, bevor du Kristina kennengelernt hast, Thomas? Ach, was war das für eine nette junge Frau. Und ihr habt so gut zusammengepasst. Ich habe sie kürzlich getroffen. Sie war zwischenzeitlich mit einem Zahnarzt verheiratet, ist jetzt aber wieder Single. Möchtest du sie nicht mal anrufen? Sie würde sich bestimmt freuen.«
Papa war peinlich berührt und Mama sah kurzzeitig so aus, als würde sie mit dem Gedanken spielen, doch noch eben schnell Arsen aus der Apotheke zu besorgen. Dann hat sie aber nur freundlich gelächelt, die Teller abgeräumt und gefragt: »Einen Schuss Mandellikör in den Kaffee, Wally? Wie üblich?«
Mir geht Großtante Wally vor allem dadurch auf die Nerven, dass sie unentwegt an meinem Aussehen und meiner Kleidung rummäkelt und mir (nicht besonders weise) Lebensratschläge aufdrängt: »Ich sehe dich immer nur in Turnschuhen, Matilda. Wer in Turnschuhen durch die Welt schlurft, aus dem wird nichts im Leben. Siehst du doch an deiner Tante Vera. Trag besser mal vernünftiges Schuhwerk. Sonst musst du am Ende auch auf einem Hausboot leben.«
Glücklicherweise habe ich herausgefunden, wie man Großtante Wally zum Schweigen bringt: Indem man sie gar nicht erst zu Wort kommen lässt. Ich verfüge über beträchtliches Talent zu schnellem und ausdauerndem Reden und texte Tante Wally einfach so lange zu, bis sie Ohrensausen bekommt. Das hält sie mir in der Regel für ein paar Stunden vom Leib.
Doktor Herkenrath ist auf meine Großtante auch nicht gut zu sprechen. Weil sie ihn mal als Fleischwurst schlingende Fressmaschine bezeichnet hat. Und sogar mit Frau Zeigler hat sie es sich verdorben. Als sie ihr unbedingt zeigen musste, wie man die Spülmaschine richtig einräumt.
Kurz gesagt: Großtante Wally ist Verwandtschaft aus der Hölle. Und jeder hier atmet erleichtert auf, wenn sie sich wieder verabschiedet.
Aktuell gibt es aber eine Sache, die ich ihr zugutehalten muss. Tante Wally hat mir, ohne es zu ahnen, ganz unverhofft die Möglichkeit verschafft, wieder mal als Detektivin tätig zu werden.
Ich habe starke Zweifel daran, dass meine Eltern in Begeisterung ausbrechen würden, wenn sie erführen, dass ihre zwölfjährige Tochter Verbrecher jagt. Weshalb ich beschlossen habe, es ihnen gegenüber nicht zu erwähnen und vorsichtshalber nur dann mit Rory zu ermitteln, wenn sie auf Reisen sind. Was recht häufig der Fall ist. Meine Eltern sind Tier- und Naturfilmer und daher oft auf Achse.
Ihre jüngste Reise hat sie vor ein paar Wochen auf die Färöer-Inseln geführt. Seit ihrer Rückkehr sind Papa und Mama mit der Bearbeitung des Filmmaterials beschäftigt. Schneiden, Kommentare einsprechen, die Bilder mit Musik unterlegen … All das geschieht in Heimarbeit, in dem kleinen Schneideraum, den sie im Keller eingerichtet haben.
Ihre nächste berufliche Reise steht erst für Mitte Dezember an. Weswegen ich eigentlich nicht damit gerechnet hatte, so bald wieder mit dem schüchternen Detektiv arbeiten zu können.
Bis vor ein paar Tagen ein Anruf von Großtante Wally kam, in dem sie uns offenbarte, dass sie ihre bisherige Wohnung aufgeben und umziehen würde.
Mir haben sich alle Nackenhärchen aufgestellt, weil ich befürchtete, sie würde uns im nächsten Moment mit der frohen Botschaft beglücken: »Und zwar zu euch!«
Was zu meiner (und Mamas) grenzenloser Erleichterung nicht der Fall war. Tante Wally hat stattdessen in vorwurfsvollem Ton erklärt, dass sie in eine Senioren-Wohnanlage zieht. »Da habe ich wenigstens ein bisschen Gesellschaft. Ansonsten kümmert sich ja keiner um mich.« In dem Stil hat sie noch etwa zehn Minuten lang weitergejammert, bis sie zu ihrem eigentlichen Anliegen kam: Papa und Mama sollten ihr bei der Haushaltsauflösung und dem Umzug helfen. »Wozu hat man schließlich Verwandte? Und zu dir, lieber Thomas, war ich immer wie eine Mutter. Da ist es ja sicher nicht zu viel verlangt, dass ihr einmal in eurem Leben was für mich tut.«
Als meine Eltern heute Morgen ins Auto gestiegen sind, um die fünfhundert Kilometer lange Fahrt zu Großtante Wally anzutreten, sahen beide aus, als hätten sie sich den Magen verdorben.
Den ganzen Nippes, den Tante Wally im Laufe ihres Lebens gesammelt hat, in Kisten und Kartons zu packen und den Umzug über die Bühne zu bringen, wird ein paar Tage in Anspruch nehmen. Heute ist Mittwoch, Papa und Mama werden höchstwahrscheinlich erst kommenden Montag oder Dienstag zurückkehren.
Vor einer Stunde habe ich Rory angerufen und ihm eröffnet, dass ich ab morgen für kriminalistische Ermittlungen zur Verfügung stehe.
»Schon ab, äh, morgen?«, hat er irritiert gestammelt. »Aber du, öhm, hast doch Schule, Matilda.«
»Nennen Sie es Zufall oder glückliche Fügung des Schicksals, aber Donnerstag und Freitag fällt der Unterricht aus. Wegen einer Lehrer-Fortbildung. Und am Samstag und Sonntag habe ich auch noch Zeit, weil meine Eltern nicht vor Montag zurückkommen.«
Natürlich arbeiten Detektive auch samstags und sonntags, denn – Achtung, Binsenweisheit! – das Verbrechen kennt kein Wochenende. Und in vier Tagen kann man durchaus schon mal einen Fall aufklären. Um die verschwundene Schriftstellerin zu finden, haben Rory und ich sogar nur zwei Tage gebraucht.
Leider steht momentan aber kein ähnlich spektakulärer Fall an, wie mir der Detektiv verlegen mitgeteilt hat: »Ich habe in den letzten Tagen in einer Routineangelegenheit ermittelt. Ein, ähm, eifersüchtiger Ehemann, der glaubte, seine Gattin hätte einen Liebhaber, weil sie jeden Dienstagabend das Haus verließ, ohne ihm zu sagen, wohin sie ging. Wie sich herausstellte, hat sie keinen Liebhaber. Sie geht jeden Dienstag zu einer Gesprächsgruppe für, öhm, Frauen mit eifersüchtigen Ehemännern. Einen Fall gibt es also nicht. Allerdings steht im Moment eine, räusper, ganze Menge an Büroarbeit an. Dabei könnte ich deine Hilfe natürlich auch gut, äh …«
In den meisten Detektivromanen sind die Ermittler ständig in Kämpfe oder Verfolgungsjagden verstrickt, hetzen Verdächtigen hinterher, entschärfen Bomben oder springen todesmutig auf die Kufe eines startenden Helikopters, um einen Schurken an der Flucht zu hindern.
Im echten Leben besteht die Hälfte der Detektivarbeit aus weitaus weniger aufregenden Tätigkeiten: Akten anlegen, Rechnungen abheften, Spesenquittungen sortieren, Berichte schreiben …
Aber was getan werden muss, muss getan werden. Ich habe Rory versprochen, ihm bei der Büroarbeit unter die Arme zu greifen. Ab morgen früh um zehn.
Wie immer, wenn Papa und Mama nicht da sind, ist Frau Zeigler bei uns eingezogen und passt auf mich auf. Und wo ich gerade von ihr spreche …
»Sie bleibt ganz schön lange weg, oder?«, sage ich zu Doktor Herkenrath und runzle nachdenklich die Stirn.
Eigentlich wollte Frau Zeigler nur mal eben zur Metzgerei Codlett am Boringer Platz. Um neue Fleischwurst für den Hund, Sülze und ein bisschen Aufschnitt zu kaufen. Aber sie müsste längst zurück sein. Wahrscheinlich hat sie eine Bekannte getroffen und sich festgequatscht.
Mit einem Mal springt Doktor Herkenrath auf die Beine und stellt die Ohren auf, im nächsten Moment höre ich, wie sich ein Schlüssel in der Haustür dreht. Dann Schritte in der Diele – und schließlich kommt Frau Zeigler mit wirrem Blick ins Wohnzimmer gestolpert.
Mir ist sofort klar, dass irgendwas nicht stimmt: Unsere Haushaltshilfe ist leichenblass und sieht aus, als wäre sie einem Gespenst begegnet. Doktor Herkenrath fiept erschrocken, während Frau Zeigler mit abwesendem Gesichtsausdruck über den Teppich taumelt. »Ich brauche einen Eierlikör, Kind. Dringend!«
Ich sehe ihr mit offenem Mund dabei zu, wie sie die Flasche aus der Hausbar nimmt, sich aufs Sofa fallen lässt, ein Gläschen Likör einschenkt und es in einem Zug runterkippt. Und danach direkt noch ein zweites.
»Was ist los?«, frage ich verstört.
»Ein Unfall!«, keucht Frau Zeigler und japst nach Luft.
»Ein Unfall? Ist Ihnen was passiert?« Besorgt lasse ich meinen Blick über sie wandern, kann aber keine Verletzungen entdecken.
»Nein. Mir geht es gut«, stößt unsere Haushaltshilfe hervor. »Aber –«
»Geht es um Raimund?«, erkundige ich mich fürsorglich. »Ihm ist doch hoffentlich nicht schon wieder was zugestoßen?«
Groß wundern würde ich mich darüber nicht. Raimund, Frau Zeiglers in vielerlei Hinsicht ungeschickter Gatte, hat andauernd Unfälle. Mal gerät er mit der Hand in einen Ventilator, mal rutscht er auf der einzigen Glatteis-Pfütze im Umkreis von zehn Kilometern aus, mal setzt er die Zeigler’sche Familienkutsche gegen einen Gartenzaun.
»Nein, nein«, entgegnet Frau Zeigler und schüttelt den Kopf. »Diesmal nicht. Raimund geht es gut. Ausnahmsweise.« Sie fährt sich nervös mit der Zunge über die Lippen und beginnt, mit vor Aufregung bebender Stimme zu berichten, was ihr widerfahren ist. Leider hat die gute Frau ein kleines Problem. Sie schafft es nie, direkt zum Punkt zu kommen, sondern holt bei ihren Erzählungen immer ganz weit aus. »Du kennst doch Hilde Mommsen«, sagt sie.
Ich habe keine Ahnung, wer das ist, nicke aber fleißig, damit Frau Zeigler nicht zu einer umständlichen Erklärung ansetzt.
»Hilde war in der Metzgerei Codlett vor mir dran«, führt unsere Haushaltshilfe aus. »Das hat ewig gedauert. Weil sie sich nicht entscheiden konnte, ob sie grobe oder feine Bratwurst nehmen sollte. Als ob das eine Rolle spielen würde. Ihr Mann, der Rüdiger, schlingt doch alles in sich rein, was man ihm vorsetzt. Und dann hat sie mir auch noch die letzten fünfhundert Gramm Blutwurstsülze vor der Nase weggekauft.«
»Ist ja erschütternd«, befinde ich. »Und was war nun mit dem Unfall?«
»Komme ich ja jetzt zu.« Frau Zeigler schenkt sich noch einen Eierlikör ein und holt tief Luft, bevor es maschinengewehrartig aus ihr herausschießt: »Auf dem Rückweg von der Metzgerei kam ich am Flora-Park vorbei und da musste ich mit ansehen, wie … Ein Passant hat die Straße überquert. Als er in der Mitte der Fahrbahn war, kam plötzlich ein Wagen angerast, ist rücksichtslos über den Asphalt gebrettert und hat den Fußgänger erwischt. Es war schrecklich! Der Mann wurde in hohem Bogen durch die Luft geschleudert. Ich habe sofort den Rettungsdienst alarmiert, während zwei andere Zeugen Erste Hilfe geleistet haben. Und weißt du, was unglaublich war? Der Fahrer des Unglückswagens hat einfach Gas gegeben und ist abgehauen! Hat Fahrerflucht begangen. Aber ich habe ihn erkannt. Als mich die Polizei befragt hat, konnte ich ihn beschreiben: Es war ein Clown!«
Ich betrachte unsere Haushaltshilfe mit einem skeptischen Blick. Entweder hat Frau Zeigler einen Schock erlitten oder sie hatte einen Eierlikör zu viel.
»Ein Clown, der Fahrerflucht begangen hat? So, so«, murmele ich. »Und auf dem Rücksitz saßen ein Zauberer und ein weißes Kaninchen?«
»Es gibt keinen Grund, sich über mich lustig zu machen«, knurrt Frau Zeigler und beharrt auf ihrer Aussage: »Wenn ich es doch sage, Kind! Ein Clown, wie man ihn aus dem Zirkus kennt. Mit Perücke und roter Nase und breitem Clownsmund!«
»Sicher«, entgegne ich, schiebe die Eierlikör-Flasche aus Frau Zeiglers Reichweite, lächle beruhigend und sage: »Ich glaube, für den Moment haben Sie genug.«
2
Clown mit Christenfisch
Wird man Zeugin eines Unfalls, nimmt einen das mit. Menschen gehen mit solchen Erlebnissen unterschiedlich um. Manche ziehen sich zurück und versuchen, das Geschehnis innerlich zu verarbeiten. Anderen hilft es, über das, was sie erlebt haben, zu reden. Frau Zeigler gehört erwartungsgemäß zur zweiten Gruppe. Beim Abendessen ist sie immer noch so aufgewühlt von dem, was sie gesehen hat (oder gesehen zu haben glaubt), dass es kein anderes Gesprächsthema gibt.
»Was ist mit dem Unfallopfer?«, erkundige ich mich. »Wissen Sie, wie es ihm geht?«
»Ich war ja dabei, als sie den Mann mit dem Rettungswagen abtransportiert haben. Wenn ich den Notarzt richtig verstanden habe, hat das Opfer Kopfverletzungen und Knochenbrüche erlitten, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Gott sei Dank!«
Alles, was Frau Zeigler über den Unfall erzählt, klingt nachvollziehbar und plausibel. Bis auf die Sache mit dem Clown und einem weiteren Detail, mit dem sie aber erst während des Abendessens aufwartet: »Mit Automarken kenne ich mich nicht aus, Kind. Aber ich konnte der Polizei sagen, dass es ein silberfarbener Kleinwagen war. Und hinten, am Kofferraum, hatte er einen Aufkleber. Mit einem Fisch-Symbol. Du weißt schon: so ein Fisch, wie ihn auch Pfarrer Ladwig an seinem Auto hat. Ein Christenfisch.«
»Aha?«, mache ich, runzele argwöhnisch die Stirn und frage mich, ob sich Frau Zeigler auch schon vor ihrem Aufbruch zur Metzgerei Codlett den ein oder anderen Eierlikör gegönnt haben könnte.
Mal ehrlich: Ist ein rasender Clown nicht schon unglaubwürdig genug? Muss es jetzt auch noch ein Fahrzeug mit Christenfisch gewesen sein?
Pfarrer Ladwig ist bekannt dafür, so langsam durch die Gegend zu zockeln, dass er den gesamten Verkehr aufhält. Und auch ansonsten sind Fahrer mit Christenfisch-Aufklebern nicht unbedingt als rücksichtslose Raser verschrien.
Fährt ein Clown in einem Wagen mit Christenfisch … Das klingt wie der Anfang von einem von Onkel Achims schlechten Witzen.
»Und das Nummernschild des Fahrzeugs? Konnten Sie das auch erkennen?«, versuche ich, das Gespräch in stichhaltigere Gefilde zu lenken.
»Nein.« Frau Zeigler schüttelt den Kopf. »Aber einer der anderen Zeugen hat sich das Kennzeichen gemerkt und konnte es der Polizei sagen.«
»Wirklich?«, murmele ich und ziehe überrascht die Augenbrauen hoch. »Dann dürfte es doch kein Problem sein, den Fahrer ausfindig zu machen.«
»Ich hoffe, sie schnappen diesen Clown!«, schnauft Frau Zeigler wütend.
»Ja, das hoffe ich auch. Also … dass sie ihn schnappen. Wen auch immer.«
»Und jetzt, wo ich noch mal darüber nachdenke«, murmelt unsere Haushaltshilfe, stellt das Kauen ein und legt einen grüblerischen Blick auf. »Der Fahrer hat nicht mal versucht, zu bremsen. Es sah beinahe so aus, als hätte er es darauf angelegt, den Fußgänger zu überfahren. Aber … vielleicht habe ich mir das nur eingebildet.«
Wahrscheinlich. Genauso wie den Clown und den Christenfisch, denke ich.
Was ganz schön überheblich von mir ist.
Denn wie sich schon bald herausstellen soll, liegt Frau Zeigler mit ihren Beobachtungen vollkommen richtig.
Als ich am nächsten Morgen aufwache, schlummert Doktor Herkenrath am Fußende meiner Matratze. Wie immer. Eigentlich lautet unsere Abmachung: Ich schlafe im Bett, er auf dem Bettvorleger. Da liegt er auch jeden Abend, wenn ich einschlafe. Um mich jeden Morgen mit einem freudigen Hecheln vom Fußende des Bettes zu begrüßen. Dabei schafft er es, so auszusehen, als hätte er nicht die geringste Ahnung, wie er dahingelangt ist.
Ich recke mich, steige aus dem Bett und schlurfe ins Bad. Frau Zeigler habe ich nicht erzählt, dass ich heute und morgen schulfrei habe. Natürlich darf auch sie von meiner Detektivarbeit mit Rory nichts erfahren. Frau Zeigler würde entsetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Außerdem wüssten meine Eltern es dann auch ganz schnell.
Sie soll ruhig glauben, dass ich heute und morgen Vormittag in der Schule bin. Und was die Nachmittage angeht, habe ich sie angeflunkert und behauptet, ich würde mich gleich nach dem Unterricht mit Klassenkameraden treffen, um für eine Mathearbeit zu lernen. Was Frau Zeigler sofort geschluckt hat.
Als erfahrene Flunker-Expertin weiß ich: Menschen kaufen einem ein falsches Alibi viel leichter ab, wenn man vorgibt, etwas zu tun, das sie als positiv erachten. Für die Schule zu lernen, ist die Königs-Ausrede und wird von Frau Zeigler ohne jede Nachfrage geglaubt. Das Einzige, was sie gesagt hat, war: »Für eine Mathearbeit üben? Das ist gut. Mathe ist ja nicht gerade deine starke Seite, Kind. Ich heb dir was vom Mittagessen auf. Aber um acht bist du zu Hause.«
Doktor Herkenrath beobachtet interessiert, wie ich mir die Haare trocken rubbele. Mein Cockerspaniel hat Rory und mich schon häufig bei unseren Ermittlungen unterstützt. Trotz seiner Ängstlichkeit konnte er sich dabei einige Verdienste erwerben. Er beginnt, im Zimmer hin und her zu laufen und wedelt aufgeregt mit dem Schwanz. Kurz vor Besuchen in der Detektivagentur wird er immer unruhig. Nicht wegen der Aussicht auf einen spannenden Kriminalfall, sondern in der Hoffnung, Charlotte Sprudel zu begegnen, Rorys schüchterner Freundin. Doktor Herkenrath ist bis über beide Cockerspaniel-Ohren in sie verknallt und schmachtet Charlotte bei jeder Begegnung mit verträumten Schiele-Augen an.
Frau Zeigler sitzt am Küchentisch, hält in der Rechten eine Kaffeetasse, in der Linken ihr Uralt-Handy, und telefoniert mit ihrem Raimund. Gesprächsthema ist – wie könnte es anders sein – der gestrige Unfall. Offenbar hat aber auch Frau Zeiglers Gatte so seine Zweifel an der Geschichte. Weswegen sie genervt mit den Augen rollt.
»Herrgott, Raimund! Wenn ich es dir doch sage: Es war ein Clown!«, versucht sie, ihren Ehemann zu überzeugen. »Ob er einen singenden Hut aufhatte? Hältst du das für witzig?«, faucht sie in den Hörer. »Ich finde nicht, dass so ein Unfall witzig ist. Du müsstest du es doch am besten wissen. Schließlich bist du selbst schon angefahren worden. Auch wenn es bei dir nur ein Dreijähriger mit einem Bobbycar war.«
»Ihr Mann ist mal von einem Bobbycar angefahren worden?«, sage ich verwundert, nachdem Frau Zeigler aufgelegt hat. »Wie hat er das denn angestellt?«
»Ach, frag nicht«, stöhnt sie und winkt ab. Dann hält sie mir eine aufgeschlagene Zeitung vor die Nase und deutet mit dem Zeigefinger auf eine kleine Notiz im Lokalteil:
Unfall mit Fahrerflucht am Flora-Park
Gestern kam es gegen 18 Uhr auf der Lindemannstraße in Höhe des Flora-Parks zu einem Unfall, bei dem ein Fußgänger von einem PKW erfasst wurde. Das Unfallopfer, ein fünfundvierzigjähriger Mann, erlitt schwere Verletzungen und befindet sich zur Behandlung im Martinus-Krankenhaus. Der Fahrer des PKW (silberfarbener Kleinwagen) flüchtete vom Unfallort. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeugführer oder zum Unfallhergang an die Polizei unter der Telefonnummer …
»Siehste? Alles so, wie ich gesagt habe«, erklärt Frau Zeigler mit selbstbewusster Miene.
»Ja, schon …«, entgegne ich zweifelnd. »Aber von einem Clown lese ich da nichts. Und von einem Christenfisch irgendwie auch nicht.«
»Ist doch klar, dass die Polizei nicht alle Informationen preisgibt«, moppert sie und schnaubt empört durch die Nase. »Tu nicht so, als hätte ich Halluzinationen. Ich weiß, was ich gesehen habe!«
Da ich keine Lust auf weitere Clown- und Christenfisch-Diskussionen habe, packe ich eilig einen Müsliriegel in meine Schultasche und verabschiede mich: »Doktor Herkenrath und ich sind dann mal weg, Frau Zeigler. Bis heute Abend.«
»Moment, junge Frau!«, ruft sie mir mit Donnerstimme hinterher und mustert mich mit gerunzelter Stirn: »Seit wann nimmst du den Hund mit in die Schule?«
Verdammt!, durchfährt es mich. Dieses kleine Detail habe ich bei meiner Flunker-Planung nicht bedacht. Zum Glück bin ich selten um eine spontane Ausrede verlegen. »Heute und morgen haben wir »Bring dein Haustier mit!«-Projekttage«, erkläre ich mit treuherzigem Blick. »Emil Wenke bringt seinen Hamster mit, Deniz Onsur ein Beo-Pärchen und Cheyenne Sommer ihre Kornnatter.«
»Was?«, entfährt es Frau Zeigler erschrocken.
»Keine Sorge. Das mit der Natter war ein Witz«, beruhige ich sie lächelnd.
Aber Frau Zeigler scheint jeglicher Humor abhandengekommen zu sein. Sie wirft mir einen missmutigen Blick zu, dann wendet sie sich ab und räumt mit verbissener Miene die Spülmaschine ein. Offenbar ist sie schwer angesäuert, dass ich ihr den Clown mit Christenfisch nicht abnehme.
»Tschüss«, sage ich leise, aber sie ignoriert mich eisern, legt einen Reinigungs-Tab in die Spülmaschine ein und startet den Intensiv-Waschgang.
Wenn Frau Zeigler beleidigt ist, ist mit ihr nicht gut Kirschen essen. Vielleicht bringe ich ihr heute Abend ein paar Nusspralinen mit. Nusspralinen stimmen sie immer versöhnlich und heben ihre Laune ganz enorm.
Draußen ist es ziemlich ungemütlich. Es herrscht typisches Novemberwetter: Der Himmel ist grau und wolkenverhangen. Ein kalter Wind fährt durch die Äste der Bäume und weht dürres Laub über den Gehsteig, als Doktor Herkenrath und ich in Richtung Straßenbahnhaltestelle laufen.
Nach einer halbstündigen Fahrt mit der Bahn erreichen wir Rorys Agentur auf der Sailenzer Straße. Ich will gerade klingeln, als sich die Tür öffnet und Charlotte Sprudel aus dem Haus tritt.
Großtante Wally würde das Aussehen von Rorys Freundin wahrscheinlich als gammelig beschreiben. Charlotte kauft ihre Kleidung gerne in Secondhand-Läden und auf Trödelmärkten. Sie trägt einen abgewetzten Kutschermantel, verblichene Jeans und Wildlederstiefel mit Fransen, die ich so schick finde, dass ich schon überall danach gesucht habe. Bedauerlicherweise gibt es die guten Stücke nicht in meiner Größe.
Charlotte krault Doktor Herkenrath zur Begrüßung das Fell – woraufhin er sich gar nicht mehr einkriegt und ein hysterisches, verliebtes Fiepen von sich gibt. Dann lächelt sie mich an und sagt: »Guten Morgen, Matilda. Schön, dich zu sehen. Rory hat mir gesagt, dass du ihn heute bei der Büroarbeit unterstützen wirst.«
»Ich hatte mich schon gefreut, dich auch wiederzusehen«, entgegne ich und blicke sie fragend an. »Willst du nicht noch etwas bleiben?«
»So gerne ich das tun würde – es geht leider nicht«, antwortet sie mit leiser Stimme und errötet leicht. »Ich muss dringend nach Hause.«
Charlotte trägt Kleidung aus zweiter Hand, ist aber, falls ich das noch nicht erwähnt haben sollte, Erbin eines Milliardenvermögens. Ihr Zuhause ist eine in einem riesigen Park gelegene Villa, die an ein Schlösschen erinnert.
»Was gibt es denn so Dringendes?«, frage ich naseweis.
»Meine Großtante Asta kommt heute«, haucht Charlotte und seufzt tief. »Sie besucht mich zweimal im Jahr für eine Woche. Tante Asta lädt sich immer selbst ein, aber ich fände es unhöflich, ihr zu sagen, dass ich eigentlich nicht möchte, dass sie …« Rorys Freundin räuspert sich verlegen. »Großtante Asta ist ein wenig, ähm, schwierig. Sie muss immer recht behalten. Und sie schummelt beim Schach, weil sie nicht verlieren kann. Und immer krittelt sie an meiner Erscheinung herum.«
Das klingt, als hätte jemand Großtante Wally geklont. Offenbar gibt es in jeder Familie so ein nervtötendes Exemplar. Davor schützt auch kein Milliardenvermögen.
»Kleiner Tipp: Ich bringe meine Großtante immer zum Schweigen, indem ich sie gnadenlos zulabere«, lasse ich Charlotte wissen.
Sie kratzt sich verlegen an der Nase. »Ja, das funktioniert aber leider nur, weil du nicht, öhm, schüchtern bist. Mir wäre das irgendwie … unangenehm.«
Was sagt man in so einem Fall? Na dann, herzliches Beileid? Ich entschließe mich zu einem aufmunternden »Kopf hoch!«, umarme Charlotte zum Abschied und winke ihr nach, als sie durch das niedrige Törchen des Vorgartens auf die Straße tritt. Sie macht ein ähnlich unglückliches Gesicht wie meine Eltern gestern Morgen.
»Ähm, äh, guten Morgen, Matilda«, empfängt mich Rory, als ich die Agentur betrete. Der schüchterne Detektiv ist groß, dürr, hat eine schmale, spitze Nase, lockiges Haar – und wirkt aktuell etwas abwesend. Seine ganze Konzentration gilt einem blauen Tintenfleck auf seinem Hemd. Hektisch reibt er mit einem feuchten Tuch darauf herum. Was die Sache nicht wirklich besser macht, sondern dazu führt, dass sich der Fleck vergrößert.
Im Gegensatz zu Charlotte bevorzugt Rory einen konservativen Kleidungsstil und fühlt sich in Anzug, Hemd und Krawatte am wohlsten. Der schüchterne Detektiv sieht immer wie aus dem Ei gepellt aus. Normalerweise. Wenn er keine Tinte auf dem Hemd hat.
»Es ist mir wirklich sehr, öhm, unangenehm, dass du mich so sehen musst, Matilda«, wispert er verlegen, während er weiter an dem Fleck herumwischt.
Das ist ein Gedanke, wie er nur Schüchternen kommen kann. Ein Unschüchterner würde sich sagen: Tinte auf dem Hemd. Verdammter Mist! Geht doch nie wieder raus. Jetzt muss ich ein neues kaufen. Was das wieder kostet. Das Erste, was einem Schüchternen durch den Kopf schießt, ist hingegen: Tinte auf dem, öhm, Hemd. Ach du liebes bisschen. Den Anblick kann ich doch niemandem zumuten.
»Was ist passiert?«, frage ich. »Füller in der Jackentasche ausgelaufen?«
»Äh, nein. Ich, öhm, wollte eine Druckerpatrone wechseln. Aber sie ging irgendwie nicht richtig rein. Und da habe ich ein wenig gedrückt und da … Ich, ähm, weiß auch nicht …«
So scharfsinnig und blitzgescheit der schüchterne Detektiv bei der Aufklärung kniffliger Kriminalfälle ist – den Anforderungen des Alltags steht er mitunter etwas hilflos gegenüber.
Doktor Herkenrath trottet hinter mir her, während ich ins Büro spaziere und den Drucker in Augenschein nehme. »Kein Wunder, dass die Patrone nicht passt. Die ist für einen doppelt so großen Drucker gedacht. Haben Sie die bestellt?«
Rory läuft rot an. »Oh, da habe ich wohl nicht so richtig, öhm … Da muss ich dummerweise … Ähm, wärst du eventuell so nett, die richtige Patrone zu bestellen? Nur, wenn es dir keine Umstände macht. Ich, ähm, wechsle inzwischen mal das Hemd. Ich befürchte, dieses ist leider nicht mehr … Das muss ich wohl, äh … Bis gleich, Matilda.«
Kurz darauf kommt der Detektiv in einem makellosen blütenweißen Hemd zurück.
»Patrone ist bestellt«, informiere ich ihn und frage ohne allzu große Hoffnung: »Es hat heute Morgen nicht zufällig doch noch jemand wegen einer Entführung oder eines Juwelenraubs angerufen? Oder wenigstens wegen eines Diebstahls?«
»Leider, räusper, räusper, nicht«, entgegnet Rory verschämt und zupft an seinem Ohrläppchen. »Es bleibt bei der Büroarbeit. Tut mir leid.«
»Und was genau liegt an?«, frage ich.
»Ich, öhm, hatte ein paar Auslagen, als ich die Gattin des eifersüchtigen Ehemanns in dem Café oberserviert habe, wo sie sich mit ihrer Gesprächsgruppe traf. Dort, ähm, war ich ja gezwungen, etwas zu verzehren«, wispert der Detektiv und drückt mir einen Kassenbon in die Hand. »Die Kosten müssten noch abgerechnet werden.«
Der Bon weist aus, dass Rory einen Milchkaffee und ein Rosinenmürbchen hatte und beläuft sich auf die Gesamtsumme von vier Euro und fünfzig Cent.
»Oder denkst du, es wäre unverschämt, das in Rechnung zu stellen?«, fragt er unsicher und trippelt dabei von einem Fuß auf den anderen.
Diese Art von schüchternem Eiertanz führt der Detektiv jedes Mal auf, wenn es an die Spesenabrechnung geht. Er ziert sich, Taxiquittungen einzureichen (»Ich, öhm, hätte die zwanzig Kilometer doch auch zu Fuß laufen können.«), es ist ihm peinlich, Hotel-Übernachtungen abzurechnen (»Vielleicht hätte es ja auch ein Campingplatz getan?«) und sogar seine Verpflegungskosten erscheinen ihm oft unangemessen hoch.
»Ähm, genaugenommen hätte das Mürbchen ja nicht unbedingt sein müssen«, befindet er mit einem kritischen Blick auf den Bon. »Vielleicht sollte ich das doch besser aus eigener Tasche …«
»Machen Sie sich mal keine Sorgen«, beruhige ich ihn.
»Die Summe liegt absolut im Rahmen. Und was steht noch an?«
»Wenn es dir keine Umstände macht, würde ich dich bitten, anschließend den Abschlussbericht des Falls gegenzulesen und zu korrigieren. Wenn du vielleicht insbesondere darauf achten könntest, ob ich den Nachnamen der Ehepartner immer richtig geschrieben habe? Der Name lautet korrekt: Dröschenbörgerfeld-Verhemperlsdenk. Und wenn du dann, eventuell, öhm … Hat es gerade geklingelt?«
Hat es. Ich renne in den Flur und hebe den Hörer der Gegensprechanlage ab. »Ja?«
»Hier ist Kati Keuken«, kräht mir eine schrille Stimme entgegen. »Ich muss den schüchternen Detektiv sprechen!«
Kati Keuken? Genervt verziehe ich das Gesicht.
Die Berühmtheit des Detektivs hat so ihre Schattenseiten: Es ist ihm nahezu unmöglich, unerkannt zu ermitteln, weil jeder sein Gesicht kennt. Außerdem wird er ständig von Journalisten verfolgt, die hoffen, exklusive Informationen über seine Fälle (und gelegentlich auch über sein Privatleben) zu bekommen. Die Penetranteste unter ihnen ist die überforsche Kati Keuken. Die blonde Fernsehjournalistin verfügt über eine laute kreischende Stimme, die auf Rory eine ähnliche Wirkung hat, wie Blasmusik auf Doktor Herkenrath. Sobald Kati Keuken auftaucht, geht er stiften. Normalerweise rückt sie dem Detektiv aber erst dann auf die Pelle, wenn er das Haus verlässt. Dass sie jetzt sogar an der Tür klingelt, ist eine neue Stufe der Dreistigkeit.
»Herr Shy ist beschäftigt und hat keine Zeit, um mit den Medien zu sprechen«, bescheide ich ihr knapp.