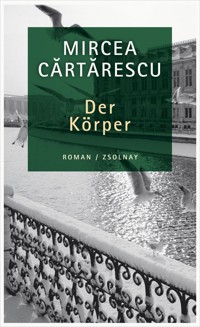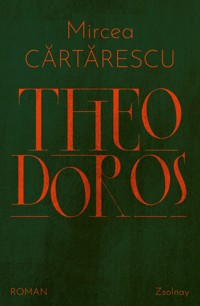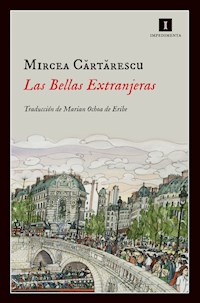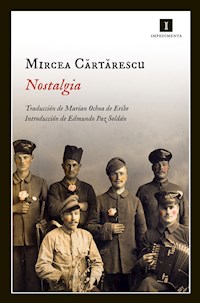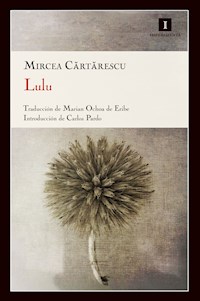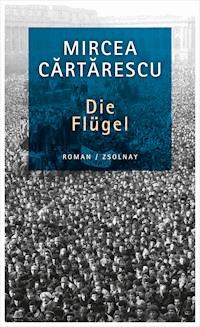
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Es war das Jahr des Herrn 1989. Die Menschen hörten von Kriegen und von Aufständen, doch sie ängstigten sich nicht, denn das alles musste sich ereignen." So beginnt der Roman "Die Flügel" des Autors Cartarescu aus Rumänien, das Finale der "Orbitor"-Trilogie. Hintergrund bildet die Wandlung der Gesellschaft während der Revolution in Bukarest. Auf den Straßen spielen sich tumultartige Szenen ab, in der Wohnung des Ich-Erzählers läuft tagein, tagaus der Fernseher, und er taucht ein in die Geschichten seiner Vorfahren. So entsteht ein Kaleidoskop von Bewusstseinssplittern – und eines der großartigsten, exzessivsten Werke der Weltliteratur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 965
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zsolnay E-Book
Mircea Cărtărescu
DIE FLÜGEL
ROMAN
Aus dem Rumänischen von Ferdinand Leopold
Paul Zsolnay Verlag
Die Originalausgabe erschien erstmals 2007 unter dem Titel Orbitor. Aripa Dreaptă im Verlag Humanitas, Bukarest.
Der Übersetzer dankt dem Verein Dialog-Werkstatt Zug und dem Deutschen Übersetzerfonds Berlin für die großzügige Unterstützung.
ISBN 978-3-552-05704-3
© Mircea Cărtărescu 2007
Alle Rechte der deutschsprachigen Ausgabe
© Paul Zsolnay Verlag Wien 2014
Umschlag: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung eines Fotos von © ullstein bild_/_Reuters
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
»Marán athá!«
»Unser Herr ist gekommen!«
Paulus, Die erste Epistel an die Korinther, 16, 22
TEIL I
Es war im Jahre des Herrn 1989. Die Menschen hörten von Kriegen und von Aufständen, doch sie ängstigten sich nicht, denn das alles musste sich ereignen. Es war wie in Noahs Tagen: Alle tranken, aßen, Männer und Frauen vermählten sich, wie sie es seit Nimrods, des berühmten Jägers, Zeiten getan hatten und wie es auch ihre Kinder tun sollten, so hofften sie, und ebenso ihre Kindeskinder, Jahrhunderte und Jahrtausende fürderhin. Keiner von ihnen würde altern und sterben, sein Geschlecht würde in alle Ewigkeit nicht erlöschen, der Mensch würde jedem Kataklysmus trotzen und ihn überwinden bis ans Ende der Zeit. Und wenn sich die Sonne in einen roten Giganten verwandelte und sich die ihr nächsten Planeten einen nach dem anderen einverleibte, würden die Menschen, die zu fliegen gelernt hatten, zu anderen Sternbildern auswandern, und dort würden sie weiterhin essen und trinken, heiraten und sich vermählen. Und wenn das ewig sich ausdehnende Weltall allmählich abkühlen sollte bis zum endgültigen Erlöschen, würden die Menschen durch Hyperräume und Wurmlöcher in Paralleluniversen übergehen, in noch in ihrer Kindheit steckende, durch darwinistische Evolution und Selektion entstandene Universen, um sie, die Unsterblichen, beherbergen zu können, damit sie weiterhin essen und trinken könnten. Es gab keine Elohim, die sagten: »So lasset nun ab von dem Menschen, der Odem in der Nase hat; denn für was ist er zu achten?«
Es hatte hie und da Erdbeben und Seuchen gegeben, die Menschen aber, die das Antlitz des Himmels deuten konnten und, wenn sie eine Wolke im Westen sahen, zu sagen wussten: »Morgen wird’s regnen«, waren blind für diese Zeichen. Sie aßen weiterhin, tranken, verkauften, pflanzten an, bauten, wie sie es in Zeiten des Krieges getan hatten und auch in den Zeiten der Pest. Sie kauften Fotoapparate und Fahrräder, gingen ins Kino, redeten am Telefon, sahen fern, schrieben Bücher, die auch nach zehn Milliarden Jahren gelesen werden sollten, sogen den Duft des Morgenkaffees ein, lasen die Nachrichten in den Zeitungen, die sie breit vor den Augen entfalteten, um die Wirklichkeit nicht zu sehen.
Sie flatterten, verstümmelten Schmetterlingen gleich, mit einem einzigen Flügel in einem linkischen Vorwärts, das weder Flug war noch Kriechen. Denn sie bauten emsig eine Geschichte der Vergangenheit, ohne sich noch um eine der Zukunft zu kümmern. Propheten gab es nicht mehr, und diejenigen, die Propheten gesehen hatten, gab es nicht mehr. Sie schritten voran, ohne zu wissen, wohin, widersinnig, wie ein Tier, das alle Sinnesorgane am Hinterteil hätte und pausenlos die Schleimspur betrachtete, die es zurücklässt. Die Scherben der auf den Zementboden gefallenen Tasse erhoben sich von selbst, fügten sich wieder zusammen, und die Tasse setzte sich in ihrer Hand von neuem in eins. Die welken Blütenblätter der Schwertlilie in der Vase auf der Fensterbank leuchteten plötzlich auf, dehnten sich aus und wurden zart, tunkten sich in reinstes Violett und flogen zum Blattstiel, um den Blütenstand malerisch und sieghaft wiederherzustellen. Ein riesenhaftes Skotom verdeckte die Hälfte ihres Blickfelds: Die Vergangenheit war alles, die Zukunft nichts. Die Menschen gingen rückwärts, zu den Pyramiden und zu den Menhiren, zu den Gebärmüttern, aus denen sie geschlüpft waren, hin zu dem Punkt von unendlicher Masse und Dichte, vor dem es nicht einmal nichts gegeben hat.
So geschah es, wenn ein Blitz von einem Rand des Himmels bis zum anderen hin aufzuckte, die dunkle Halbkugel taghell erleuchtete und auf der in grellstem Licht stehenden Seite die Sonne noch übertraf, so dass er mit einem Mal die geschlängelten Flüsse und die Ozeane, die Fjorde und die Eiskappen an den Polen überirdisch aufglänzen ließ, dass sich die Tiere der Wälder in ihren Höhlen verkrochen, die Spinnen sich auf den Grund ihrer Weben zurückzogen und die Fische in den Abgrund hinuntertauchten; die Menschen aber, die wissen, dass der Sommer naht, wenn zart das Blatt des Mandelbaums sprießt, setzten sich ihre Sonnenbrillen auf und stiegen auf die Terrassen der Plattenbauten, schalteten ihre Sicherheitssysteme ein, glotzten mit offenen Mündern den Himmel an und kehrten zu guter Letzt achselzuckend zu ihren Geschäften zurück. Der Nasdaq-Index hat in jenen Tagen keinerlei ungewöhnliche Baisse verzeichnet. Die einen Augenblick zum Stillstand gekommenen Gabeln fanden ihren Weg zurück zum Mund, und die Paare, die sich eben in Betten mit zerwühlten Laken wälzten, hatten es, nach erschrockenem Innehalten, eilig, weiter nach dem verheißenen Orgasmus zu tasten.
Auch die Bukarester haben am Ende des schicksalhaften Jahres 1989, des letzten Jahres des Menschen auf Erden, den grellen, über den Himmel gespannten Blitz mit den langgezogenen und zitternden Verästelungen wie die Beine eines über die Welt gekrochenen Schlangenwesens gesehen. Er hat sich ihnen unmittelbar nach der Mittagsstunde gezeigt, an einem düsteren Tag Mitte Dezember, als er die Gebäude am Magheru-Boulevard, die armenische Kirche, das Victoria-Kaufhaus und das Zentralkomitee weiß färbte wie auf einer überbelichteten Fotografie. Eine Million dem Himmel zugewandter Gesichter, gequält und mit dunklen Ringen unter den Augen, ausgehungert und mit kariesbefallenen Zähnen, kaum sichtbar unter den Lammfellmützen und den Kopftüchern, bekamen eine grauenerregende Maske aufgesetzt, die sie einen Wimpernschlag lang in rachsüchtige Gespenster verwandelte, gekommen, ihr Blut zurückzufordern. In der Buzești-Straße vergaßen einige von der heftigen Entladung geblendete Fahrer die im Pflaster klaffenden Schlaglöcher und kippten in ihren verrosteten Dacias zur Seite. Dann verdüsterte sich die Stadt abermals, versank in ihrer Farbskala von Grautönen, in ihrem leichenhaften Aschgrau, das ihr tagtägliches Gesicht war. Um halb fünf herrschte völlige Dunkelheit. Die Lichter an den Masten am Rand der Chausseen hatten vergessen anzugehen, ebenso wie die Glühbirnen in den Häusern, in ganzen Stadtvierteln. Durch die Fenster der Arbeiterwohnblocks, der »Streichholzschachteln«, wie man sie nannte, sah man Männer und Frauen wie Schlafwandler um den goldenen Tropfen einer Kerze herumtappen. Von oben betrachtet schien Bukarest in jenen Augenblicken zwischen den Schneewolken hindurch wie ein weit ausgedehntes Dorf, sichtbar nur durch das schwache Schimmern der Talglampen. In Kriegszeiten hätten die Bomber es überflogen, ohne es zu bemerken. Stadt der Toten und der Nacht, der Trümmer und des Unglücks. Eine aschgraue, staubige Flechte, formlos über die endlose Bărăgan-Steppe gebreitet.
Um sieben Uhr abends, während, nach Westen ins verschneite Europa vorrückend, Wien, Paris und Rom und Stockholm und Lissabon von ebenso vielen in den Himmel geschossenen Feuerwerken nacheinander aufblitzten, während die Ströme der Automobile sich auf den Chausseen wie endlose Würmer dahinschlängelten, mit roten Lichtern in die eine Richtung und weiß strahlenden in die andere, während die Sendemasten und die überhohen Schlote der Wärmekraftwerke und die Reklametafeln der Motels und die Flutlichtanlagen an den Ecken der Fußballfelder den Kontinent in einen exzentrischen Flipper verwandelten, während die blinkenden Positionslichter der Flugzeuge das Licht der Sterne dämpften, war Bukarest gestorben und die Erinnerung daran von der Erdoberfläche getilgt. Nicht ein Stein auf dem anderen war davon übrig geblieben. Es war eine staunenswerte Landschaft, ein Sprichwort unter den Völkern, eine Ruine, in der sich Eule und Igel ihr Nest bauten. Doch wie in seiner großen Weisheit der Herr den Gelehrten die heiligen Dinge verborgen und sie den Kindlein enthüllt, wie er nicht in Jerusalem, sondern im verachteten Galiläa Menschengestalt anzunehmen beschloss, so ward auch diese unglückliche Stadt aus Beton und Rost auserkoren, vor allen anderen das Wunder zu sehen.
Denn in jener dunklen Stunde hörte der eisige Raureif auf, der den ganzen Tag lang herabgeschwebt war. Über der Stadt klarten die Himmel auf, und Sterne erschienen, funkelnd und duftend, als hätte sich ein Streifen des über den Herăstrău-See gespannten Sommerhimmels zwischen die über der Stadt zusammengeballten Wolken verirrt. Sodann löste sich aus den Sternen eine Erscheinung, die zunächst ein winziges Insekt zu sein schien, wie eine der kleinen Heuschrecken, die vor unseren Schritten im Gras hüpfen. Während sie sich mit großer Langsamkeit, gleichsam bedächtig, aus der Nacht herabsenkte, begannen die Einzelheiten jenes von einer inneren Strahlung matt erleuchteten Gegenstandes deutlicher erkennbar zu werden. Er hatte eine Gestalt wie die einer Qualle und war ebenso durchsichtig. Ein Gewölbe wie aus Saphir, an Reinheit wie der Kern des Himmels, beherbergte unter sich vier ultramarine Pfeiler, die sich auf den zweiten Blick als vier erstarrte Wesen erwiesen, mit ausgebreiteten Schwingen wie die des Albatros. Neben jedem Einzelnen war je ein mit Augen bedecktes Rad. Als das Wunderding herabgestiegen war und einige Hundert Meter über dem Hotel Intercontinental verharrte, konnten die auf dem leeren Platz vor dem ZK patrouillierenden Milizionäre sehen (und es ihren alarmierten Vorgesetzten melden), dass über dem Gewölbe aus durchscheinendem Saphir, wie eine Statue an der Spitze einer Basilika, ein Thron stand, aus derselben mineralischen, massigen, mit unverständlichen Zeichen und Arabesken verzierten Substanz gehauen. Auf dem Thron saß ein menschenähnliches Wesen in einem Gewand, das wie Kupfer gleißte. Um das Wesen her schimmerte ein Regenbogenlicht. Das mystische Gerät erzeugte tosenden Lärm wie das Getrampel großer Menschenmengen, ein Brausen wie das großer Wasser, dermaßen dröhnend und einstimmig, dass sich die Dreher, die Elektriker und die Kellnerinnen, die in engen und bedrückenden Zimmern einen schweren Schlaf schliefen, in Decken gewickelt wie etruskische Statuen, für einen Augenblick aufwachten, den Kopf vom Kissen hoben und horchten, bis das Brausen mit dem Sausen des Bluts in den Ohren verschmolz. Dann stürzten sie zurück in ihre Träume von Schweinekoteletts, Salamistangen und Zwetschkenknödeln, die Träume eines ausgehungerten Volkes. Nur ein dunkelhäutiges Kindchen war, irgendwo in der Rahova-Straße, aus dem Bett aufgesprungen und zur geborstenen, mit Klebestreifen zusammengehaltenen Fensterscheibe geeilt. Mit einer Hand hatte es den kalten Heizkörper ergriffen und, einen krummen Finger himmelwärts richtend, sich die Lunge aus dem Leib geschrien: »Vater mein! Vater mein! Wagen Gottes und Reiterheer!« Darauf folgten ungestüme Schläge an die pappdünne Wand der Einzimmerwohnung in einem Wohnblock Komfortklasse drei.
Schließlich blickten die über Nacht beim Auffüllen der Propangasflaschen, beim Metzger oder beim Käsehändler Schlange Stehenden, aneinandergedrängt, um nicht vor Kälte umzukommen, einen Augenblick zum Himmel hinauf, doch entweder der Schmerz im Nacken oder der verheerende Frost oder die Schicksalsergebenheit von Sträflingen, die man in ihren Augen gewahrte, beugte ihre Scheitel abermals tief zur Erde.
»Da ist was los in Timișoara«, sagt Mutter, indes sich auf der braunen Wölbung jedes Auges je ein glänzendes Fenster abzeichnet. Um die Pupillen herum weisen ihre Iriden ein verwickelt gewundenes Regenbogenschillern auf, Fasern in Ocker und Kaffeebraun, Zonen in Bernstein und Violett. Wenn eine durchs Schneewetter rudernde Taube das Küchenfenster einen Augenblick lang verdunkelt, legt sie auch einen Tropfen Schatten auf Mutters Augen. Und wenn sie sich mit ihren Korallenkrällchen auf das flaumbedeckte Geländer gesetzt hat, schält sich von ihrer unvermeidlich frostdurchschauerten Form eine Photonenschicht ab, die flatternd durch die Winterluft wandert und durch Mutters vom Alter ausgeblichene Wimpern einsinkt. Sie dringt durch die Pupillen und windet sich dort durch die Linse aus durchsichtigem Fleisch, die sich unvermittelt verdickt, um das Köpfchen mit den runden Augen und dem sonderbar grausigen Schnabel und das urplötzlich von einer Windbö zurückgeschlagene Gefieder der Flügel scharf einzufangen. Mutter legt Maiskörner in den losen Schnee am Geländer, so haben wir immer aschgraue Tauben auf dem Balkon.
In das milchige Licht, das durch die Fensterscheibe zu uns sickert, mischt sich der Hauch eines zarten Rosa. Das kommt von der gigantischen Mauer der Dâmbovița-Mühle hinter dem Wohnblock. Die gelbliche Haut von Mutters Gesicht glänzt von den aus den Kochtöpfen aufsteigenden Dämpfen. Gott weiß, was ihr heute in die Töpfe zu geben gelungen ist. Wenn man sie danach fragt, antwortet sie immer mit einem Wort, das sie irgendwo beim Schlangestehen aufgeschnappt hat, dass sie nämlich immer Suppe mit vier Hendln koche: hendeln müsse sie Wasser, hendeln müsse sie Salz und hendeln und noch mehr hendeln … Jeden Morgen verschwindet sie irgendwohin. Violett angelaufen kehrt sie heim, mit Schatten unter den Augen. Selbst wenn sie mit einer Tüte Hühnerkrallen und -hälsen nach Hause kommt, selbst wenn sie dieses Wunder fertiggebracht hat, blickt sie trotzdem wirr und missmutig um sich: Sie hat uns den Fraß gebracht, damit wir uns vollstopfen, was wissen wir schon davon, was dies Schlangestehen bedeutet, von fünf Uhr morgens bis … »na, seht ihr, ’s ist fast zwölf. Diese gottverfluchten Halunken, was denken die denn, was die Menschen essen sollen? Dies nicht, das nicht … na, seht her, wofür ich angestanden hab, dass mir die Seele im Leib gefroren ist, verflucht sollen die sein, diese Elenden!« Und auf das Wachstuch kippt Mutter ein feuchtes Häufchen leichenblasser Hähnchenfüße mit verkrümmten Krallen, unterhalb der Keulen abgehackt, denn die Keulen sind für den Export … Für diese reptilienartigen Schuppen schlagen sich die Leute tot. Ein andermal knallt sie uns ein großes wackelndes Stück Muntenia-Schinken auf den Tisch. Keiner weiß, woraus der besteht. Er bibbert wie Sülze. Darin findet man Fetzen wie Verbandsmull. Im Mund löst er sich in Knorpel und in etwas Mehliges auf. Man weiß nicht, ob er nach Benzin riecht, weil er im Lastwagen transportiert oder weil er aus wer weiß welchen Chemikalien hergestellt wurde. »Strafe sie Gott!« Mutter hört nicht mehr auf damit. Es hat sie fertiggemacht. Dem ist sie nicht mehr gewachsen. Und dabei geht es nicht mal um sie, darum, dass sie sich die Füße wundläuft, wenn sie hinrennt, um sich in all den Schlangen anzustellen, oder mit Eiszapfen an den Augenbrauen zurückkehrt, aber uns hat sie nichts Essbares mehr vorzusetzen, und das war doch ihre Aufgabe, seit sie auf der Welt ist. Das macht sie rasend. Einmal im Monat legt sie ein Stück Schafskäse, in patschnasses Papier gewickelt, auf den Teller. »Die haben Käse gebracht in die Halle bei Obor. Aber nur ein Stück haben sie hergegeben, und es hat den Leuten nicht einmal für den hohlen Zahn gereicht.« Wir sehen den Käse an wie ein Ding aus einer anderen Welt. Uns scheint er eine diffuse Aura um sich zu verbreiten. Fast läuft uns das Wasser im Mund zusammen. Er riecht etwas ranzig, doch was macht das schon? Das nimmt man nicht so genau! Es ist Käse und damit basta, Gott sei Dank gibt es welchen! Doch ich weiß nicht, was zum Teufel die reingetan haben. Wenn man die Gabel hineinsteckt, quietscht er. Er quietscht auch, wenn man hineinbeißt. Und er ist elastisch, als sei er aus Gummi. »Hast du ihn nicht etwa bei den Bauern geholt?«, sagt Vater manchmal, fern wie immer von allen und allem. Nie weiß man, woran er denkt. Er sagt irgendetwas, nur um etwas zu sagen. »Grad gestern hab ich gehört, dass sie einen geschnappt haben, der Käse mit Holzleim verkauft hat, halbe-halbe.« »Auch die Bauern sind gemein geworden, Liebling … Denen isses egal, dass die Menschen abkratzen, ihnen selber soll’s gut gehen … Und wenn man bedenkt, dass Käse mit Tomaten früher das Essen der Armen war. Erinnerst du dich, Costel, erst vor etwa zehn Jahren, diese Möbelpacker: Grad hier, hinterm Wohnblock, haben sie einen Küchentisch hingestellt, ein paar Hocker, haben sich drum herum in den Schatten gesetzt, um zu essen. Aus Zeitungspapier packten sie Käse aus, gekochte Eier, die sie dort auf dem Tisch schälten, Tomaten holten sie raus, die großen und saftigen wie auf dem Land, eine Salamistange … Dann machten sie noch eine Dose mit Bohnen auf (wie sie das wohl, Gott vergib mir, so essen konnten, so kalt und abgestanden?) und … so hastig, als würden die Türken einfallen. Und wir sahen ihnen vom Balkon aus zu und sagten: Schau dir diese Rüpel an, diese Grobiane … Die essen so vor aller Leute Augen … Tja, iss jetzt auch so was wie die, wenn du kannst!«
Alle reden nur noch vom Essen. Sogar die Makkaroni mit Marmelade, die es nach dem Krieg gab, kommen ihnen heute köstlich vor. Und danach, etwa 1960, als die Selbstbedienungsläden aufkamen … Das war ihr Paradies gewesen. Und die überquellenden Läden mit Obst und Gemüse. Mutter hat vergessen, wie ihr die Arme bis zum Boden hingen vor so viel Schleppen mit ihren rosa Bastnetzen. Wie sie mir sagte: »Halt dich am Netz fest, Mircișor, pass auf, sonst wirst du von den Autos überfahren!« Und waren wir mit Ach und Krach zu Hause angelangt, kam es vor, dass der Aufzug nicht ging. Mutter weinte, während sie Stockwerk um Stockwerk hinaufstieg, die Einkaufsnetze schnitten ihr in die Hände (sie zeigte sie mir, aufgeschürft, als sie die Netze endlich vor der Tür absetzte: Sie konnte nicht einmal mehr den Schlüssel halten, um aufzuschließen, und bat mich, ihn ins Schloss zu stecken). Sie erinnerte sich nicht einmal mehr daran, wie verzweifelt sie gewesen war, als sie wie jeden Abend nachrechnete, wie viel Geld auch an jenem Tag wieder weg war. Ihre kindliche Handschrift mit den übertrieben gerundeten Kringeln, ihre Handschrift mit Bleistift, stark aufgedrückt, ohne Grammatik … »So ist’s auch heute weg, einfach so!« Und dabei klatscht sie die Handflächen mit gespreizten Fingern rasch aufeinander, bald auf der einen, bald auf der andern Seite. »Futsch ist’s. Jeden Tag ein Hunderter! Einhundert Lei jeden Tag! Zum Weglaufen ist das, am liebsten würde ich abhauen …« Stattdessen redet sie unaufhörlich mit einer Lust, die sie plötzlich jünger macht, als wäre sie tatsächlich dorthin zurückgekehrt, von ihrem gemeinsamen guten Leben zwanzig Jahre zuvor. Sie sitzt, verliest die weißen Bohnen auf dem Tisch (auch ich picke hin und wieder eine schrumpelige oder faule Bohne heraus und lege sie auf den Haufen mit Steinchen, verkrusteter Erde und schwarzen, hohlen oder abgeblätterten Bohnen. Die fetten und glänzenden wandern prasselnd in den Topf der Gerechten. Die unbrauchbaren nehmen den Weg zum Müll, dorthin, wo Heulen und Zähneknirschen ist) und erfüllt die Küche mit ihrer Stimme, die keine Stimme ist wie jede andere, denn ich nehme sie wahr, bevor ich sie höre, mit dem besonderen, für ihre Stimme in mir offenen Sinn. »Na, war das etwa wie heute? Dass der Mensch nichts zum Beißen hat? Damals gab’s alles, erinnerst du dich, Herzchen? Wir standen nicht wie heute Schlange ab vier Uhr in der Früh, wo man ja doch nichts mehr kriegt. Wir gingen wie die hohen Herrschaften erst dann hin, wenn das Essen im Kühlschrank alle war. Erinnerst du dich, welche Konfitüren ich dir geholt hab, in den ovalen Gläsern, in denen ich jetzt das Schmalz aufbewahre, das von Opa? Aprikosen-, Himbeerkonfitüre, was immer man wollte. Ich hab dir auch dieses Zeug gekauft, das man in die Milch tat, wie hieß das gleich? Sündhaft teuer, aber man konnt’s kriegen. Und was für Waffeln, was für Schokoladen! Ich hab’s nie übers Herz gebracht, dir nicht wenigstens eine kleine Tafel Schokolade mitzubringen, zumindest eine dieser kleinen mit dem Jäger und Rotkäppchen drauf. Sobald ich zur Tür reinkam, hast du in meiner Handtasche gewühlt. Am Tag des Kindes1 hab ich dir etwas Besseres gekauft, ›Dănuț‹-Waffeln, die mit Kakaocreme … Tja, wo soll man heute so was herholen für die armen Kinder? Mutter darf man heutzutage nicht sein … Als du krank warst – Orangen, dort um die Ecke, im Obstladen. Man ist auch damals ein bisschen Schlange gestanden, stimmt, und manchmal kam einem ein Verkäufer unter, der einen übers Ohr haute, aber Hauptsache, es gab welche, oder? Wer hat denn noch in den letzten vier, fünf Jahren Orangen gesehen? Die Leute werden ganz vergessen, wie die heißen. Oder Kaffee. Als ich Vater geheiratet hab, trank man keinen Kaffee. Vielleicht die feinen Herren, die hohen Tiere, was weiß ich, die haben welchen getrunken. Aber wenn man zu jemandem auf Besuch ging, holte der nicht wie heute schnell Kognak und Kaffee raus. Er gab einem Konfitüre, so auf einem kleinen Teller, und ein Glas Wasser. Jetzt sind die Leute vornehm geworden, können nicht mehr ohne Kaffee. Nur gibt’s keinen mehr. Ich wundere und frage mich, Liebling, woraus die diesen Malzkaffee machen: als wären Baumrindenstücke drin … gemahlene Borke … Und da heißt es: Mischkaffee. Wie einer meinte: Das hat mit Kaffee so viel zu tun wie ein Pferd mit einem Küken … Jetzt trinken vielleicht nur die Ärzte echten Kaffee, denn alle bringen ihnen welchen mit. Wir bleiben beim Malzkaffee. Erinnerst du dich, wie ich dich nach Kaffee ausgeschickt hab, als du klein warst? War das damals etwa ein Problem? Hier hast du acht fünfzig, geh mal, Schatz, und hol hundert Gramm Kaffee. Ja, manchmal holten wir sogar bloß fünfzig Gramm … Man hat ihn dort, vor deinen Augen, aus Bohnen gemahlen, und du stecktest die heiße Papiertüte in die Hosentasche, und wenn du zu Hause ankamst, war sie immer noch warm … und duftete … füllte das ganze Haus mit dem Duft! Als du noch kleiner warst, in Floreasca, hab ich Zichorien gekauft. Ich tat sie in die Milch. Sie sahen aus wie Drops, in einer Papiertüte waren so bröcklige Scheibchen, wie Erde, aber sie rochen nach Kaffee. Ich brach je eines dieser Scheibchen in drei, vier Stückchen und gab sie in die Milch, dann wurde sie so cremefarben. Das schmeckte gut. Ich gab dir auch welchen, denn damals gab’s keinen Kakao. Ach, als wir hierhergezogen sind, in den Wohnblock, du warst fünf, waren die Leute zufrieden … Wir kamen schlecht und recht mit einem einzigen Lohn aus … Heute kann man auch, wenn man Geld hat, nichts damit anfangen. Damals sparten die etwas Bessergestellten, um sich ein Auto anzuschaffen … Diese Ärmsten aßen nur Joghurt und häuften Pfennig um Pfennig an. Wie sagte Căciulescu?2 Die Ärzte fragten ihn: Was hast du zu Mittag gegessen? Und er sagte: einen Tee. Und abends?, fragte der Doktor. Abends etwas Leichteres … Leichter als Tee: ha-ha! So auch die mit ihren Autos: Joghurt und wieder Joghurt, bis er ihnen sauer wurde. Wir hatten gar nichts. Als wir heirateten, hat uns keiner was gegeben. Wir standen beim Essen an, wie man damals sagte, das heißt, wir aßen der Reihe nach, denn wir hatten nur einen einzigen Löffel. Opa, geizig, du kennst ihn ja. Seine Leute haben mich nicht gemocht, weil ich aus Muntenien bin. Sie kamen nicht einmal zur Hochzeit. Zum Glück gab’s da Vasilica, denn wir haben bei ihr gewohnt, bis wir eine Bleibe bei Ma’am Catana gefunden haben, sonst hätten wir unter der Brücke geschlafen … Und dann … O je, o je! Ein Kämmerlein mit Zementboden, ein Bett aus Brettern, das eines Nachts unter uns zusammengekracht ist, so gut war’s, ein Kochherd, den man mit Holz heizte, das war alles. Ein Lautsprecher an der Wand. Du warst klein, in der Kinderkrippe konnte ich dich nicht lassen, denn du hast gebrüllt, bis du dunkelblau angelaufen bist (hast drei Wochen lang gebrüllt, von morgens an, als ich dich hinbrachte, bis ich dich nachmittags abholte), und ich hatte Angst, dich auch noch zu verlieren wie den Victoraș. Was hätten wir tun sollen? Vater ging in die ITB-Werkstätten arbeiten, ich blieb bei dir den ganzen Tag. Und alle Leute im Hof rückten dir auf die Pelle, denn du warst das einzige Kleinkind: Du wurdest von Arm zu Arm rumgereicht, alle küssten dich ab, dass sie dich fast erstickten. Erinnerst du dich noch an Coca, an Victorița, an Onkel Nicu Bă? Sie waren alle verrückt nach dir. Die Diebin, so lebte die: mal im Knast, mal auf freiem Fuß. Und wenn sie draußen war, nahm sie Arbeit an als Köchin in Kinderkrippen, Kindergärten … Die war wild nach dir. ›Komm her, Mircișor, schau mal, was dir Victorița mitgebracht hat!‹ Und sie gab dir Rahatlokum und Kekse. Du warst ziemlich mager, wurdest dauernd krank. Halt auf Zementboden aufgewachsen, ist doch so … Ich hatte einen gefunden, der eine Kuh hatte, auch in der Silistra-Straße, etwas weiter, gegen Ende. Vater gab ein Viertel seines Lohns aus, damit du jeden Tag frische Milch hattest, und das, obwohl du sie nicht trinken wolltest. Heikel warst du, dies schmeckte dir nicht, das nicht … wie heute noch, gib’s doch zu!«
Mutter lacht. Nicht nur in ihren Augen, auf ihrer ganzen glänzenden und dünnen Gesichtshaut spiegelt sich jetzt die Winterdämmerung: die Zitadelle aus Backstein, vom Schneegestöber angefressen, die Wipfel der Pappeln, nunmehr nackte Ruten, in zartes Glas gehüllt. Ich höre ihr zu und betrachte das Wachstuch der Tischdecke. In deren kaffeebraunen Quadraten schiebe ich mit dem Finger trockene Krümel hin und her, zwischen die weißen Bohnen verirrte Kornradensamen. Ich kann nur an eines denken: Erinnert sie sich? Weiß sie, wer sie gewesen ist? Wer sie ist? Gibt es irgendwo, hinter ihrem Zirbelauge, das zwischen ihren Brauen so deutlich zum Vorschein kommt, wenn sie glücklich ist, neuronale Inselchen, auf tausenderlei Art gedämpft, die mit Tausenden Stimmen die Geschichte Cedrics und der wunderbaren Diva Mioara Mironescu erzählen? Und wie es war, als Mutter mit einer entblößten Brust auf ihrem Serotoninthron in der Mitte der Welt das Kind mit der Bergkristallhaut in ihrem Schoß hielt und es allen Völkern aus allen Universen zeigte? Erinnerte sie sich noch daran, dass sie Maria war? Etwas sagte mir, dass ich, wenn ich geduldig Stunden um Stunden herumsuchte in ihrer scharlachroten Handtasche aus ihrer Fräuleinzeit, die zu einem Speicher vergilbter, zur Hälfte in Fetzen und Würmer verwandelter Sächelchen geworden war – alte Quittungen, elektrische Sicherungen, aus dem Umlauf gezogene Münzen, ein paar angeplatzte und auf der Rückseite mit Tintenstift beschriebene Schwarzweißfotos, das Gewerkschafts- und das Poliklinikbuch, der Wehrpass meines Vaters, der ihn als tauglich, nicht zur kämpfenden Truppe gehörend auswies, der abgegriffene, zerknitterte, nach abgelaufenen Arzneimitteln riechende Briefumschlag mit meinen Kinderzöpfchen, der andere Umschlag mit der scheußlichen Zahnprothese, die sie nie vertragen hatte –, dass ich schließlich in wer weiß welcher geheimen Falte voller Krümel und vertrockneter Fliegen auf den Mammuthaar-Ring der Sängerin aus dem Bisquit stoßen würde, auf ein zusammengefaltetes Stückchen vom Flügel eines Riesenschmetterlings, an den Rändern angesengt, aber im Regenbogenhologramm seiner Schüppchen den Geruch von Marillen bewahrend und den gekelterter Trauben aus Tântava, wo einst eine andere Maria, Mutters Urgroßmutter, sich im Morgengrauen in eine Schmetterlingsfrau verwandelt hatte; auf eine Ampulle mit einer schillernden, strohgelben Flüssigkeit gleich der Rückenmarksflüssigkeit, auf deren bläulichem Glas ein sonderbares Wort stand: QUILIBREX … Nach und nach hatten das Kreisen der Stunden, die Schleifscheibe aller Uhren der Welt ihren Leib kleiner, ihre Haare und Knochen dünner gemacht, ihre Brüste hängen lassen … Mutter hatte sich mit Alter und Nachlässigkeit durchtränkt. Maria war zu Marioara geworden, wie Vater und die ganze Verwandtschaft sie rief, zu der Frau, die für alle sorgte und niemals für sich selbst, zu der verbannten, entthronten, vergesslichen Marioara. Deck den Tisch, räum den Tisch ab. Bring morgens alle auf Trab. Wasch, bügle, koch ihnen das Essen. Räum die im Haus rumliegenden Sachen auf. Fege, bring den Müll weg, erledige die Einkäufe. Schäl die Kartoffeln, spül das Geschirr. Tag für Tag, wieder und wieder, bis Ostern, bis Weihnachten, bis ans Ende des Lebens. Ohne ein »Dankeschön« von irgendjemandem, mit der einzigen Befriedigung, dass sie allen ein menschenwürdiges Leben in der Gesellschaft ermöglicht, dass sie nicht in Lumpen rumlaufen, dass sie ’ne Suppe auf dem Tisch haben. Der tägliche Fraß in diesen Zeiten, die schlimmer sind als im Krieg.
»Dann ist es auch uns etwas besser gegangen. Vater haben sie zur Journalistik geholt, zur Akademie ›Ștefan Gheorghiu‹. Er schrieb für die Wandzeitung, die aus seiner Werkstatt (erinnerst du dich, als ich dich hinbrachte, damit du Papa an der Drehbank siehst, und du, da warst du so zwei Jahre und etwas, hast auf ’ne Maschine gezeigt, auf der etwas geschrieben stand, und hast gesagt: ›Da teh Tockemich‹, denn du hast geglaubt, dass überall ›Trockenmilch‹ geschrieben steht wie auf deinen Dosen, und da ham sich die Schlosser alle halb totgelacht …). Und was er da schrieb, hat wohl den Chefs gefallen, sie sagten, er is’ ein blutjunger Kerl, ein vielversprechender Junge, Sohn armer Bauern, wie’s damals in den Akten hieß. Und so hat Vater zwei Jahre lang Journalistik gelernt und hat dann bei Die rote Fahne angefangen, mit gutem Gehalt, mit einem Wolga für Dienstfahrten … Die bei der Zeitung haben ihm auch eine Wohnung gegeben, zuerst in einem Wohnblock in Floreasca, wo wir nur einige Monate geblieben sind, denn jemand hat uns bei der Miliz verpfiffen, weil ich an Teppichen arbeitete. Und der Webstuhl machte Lärm, da konnte man nichts machen. Man musste mit dem Weberkamm kräftig klopfen, damit die Wolle zwischen den Litzen fest zusammengedrückt wird. Ich arbeitete mehr am Vormittag, wenn die Leute zur Arbeit gingen, aber man hörte das trotzdem. Und da war eine Madame Gângu, die immer Streit vom Zaun brach, alle Welt hat sie gehasst deswegen. Die hat uns verpetzt. So habe ich mit den Teppichen aufgehört und bin zu Hause geblieben, um dich aufzuziehen. Aber dann sind wir in ein Wohnhaus umgezogen, auch in Floreasca, ganz in der Nähe der alten Wohnung. Das war in einer Straße, sie hieß Puccini, einer ruhigen Straße, durch die den ganzen Vormittag kaum ein Auto fuhr. Damals war Bukarest nicht so voller Autos wie jetzt. Am Ende der Straße gab es eine ganz große Abfallgrube mit Gras an den Rändern, da hatten sich die Zigeuner ihre armseligen Hütten gebaut … Und es qualmte den ganzen lieben Tag lang, wie in einem Zigeunerlager halt … Wenn der Wind von dort rüberwehte, hat’s uns ordentlich eingeräuchert … Erinnerst du dich, wenn ich dich dort spazieren führte, wie wir in die Bruchbude von dem Zigeuner reingingen, der Ohrringe und Ringe machte, und seine Tochter schlief mit dem Ferkel im Bett, und seine Mutter hatte lauter Goldmünzen in den Zöpfen, solche, die die Miliz beschlagnahmte, wenn sie sie damit erwischte. Vasilica und ich, wir hatten auch ’ne Goldmünze aus Omas Halskette, aber da hab ich mir gesagt: Was soll ich mit ’ner halben Münze? Und hab ihr meine Hälfte gegeben, als sie Onkel Ștefan geheiratet hat, damit sie sich Trauringe draus machen. Danach tat’s mir leid, denn, sieh mal, ich und dein Vater haben bis heute keine, da schäm ich mich fast. Nun ja! In Floreasca haben wir etwa zwei Jahre gewohnt, in einem Haus, bevor wir hierher in die Ștefan-cel-Mare-Chaussee gezogen sind. Das war gut … Das war gut! Zwar etwas eng und mit ’ner klitzekleinen Küche, nur Spüle und Kochplatte, nicht dran zu denken, dass man dort am Tisch sitzt, wir aßen im großen Zimmer, wo wir auch das Bett hatten. Und wir hatten noch ’n Zimmer, es war mehr deins, und das Badezimmer dazwischen, mit zwei Türen, die nach beiden Richtungen aufgingen. Das war nicht gut, denn wenn jemand auf die Toilette ging, wurde die ganze Wohnung verstunken. Und wir heizten mit Gas. Wem das wohl eingefallen ist, den Ofen zwischen den Zimmern, in der Wand, einzubauen, eine Hälfte hier, eine Hälfte drüben? Aber na ja, gut, dass er heizte. Und im Badezimmer hatten wir eine dieser kurzen Wannen, mit einem Sitz, so dass man sich nicht so richtig ausstrecken konnte. Ansonsten war’s gut, es war schön, immer Frühling, alle Bäumchen vor dem Haus waren voller Blüten … Du kamst rein durchs Fenster und gingst raus durchs Fenster, denn wir wohnten ja im Erdgeschoss. Hinter dem Haus hattest du einen Spielplatz mit Sandkasten, hast mit Nicki gespielt (erinnerst du dich noch an Nicki vom andern Hauseingang?), mit Helga, der Tochter von Frau Elenbogen, wo wir zum Fernsehen hingegangen sind, mit Aurica … Den ganzen Tag lang seid ihr dort im Sand gehockt. Ich musste mir keine Sorgen um dich machen. Das Viertel war ruhig, Gott, es war wie im Paradies. Ich drückte dir einen Zettel und Geld in die Hand und schickte dich zum Bäcker oder zum Lebensmittelladen am Ende der Straße. Alle Verkäuferinnen kannten dich. ›Geben Sie mir, was hier draufsteht, und das Restgeld!‹, sagtest du zu ihnen, und da schüttelten sie sich vor Lachen. Du warst kaum vier. Du warst so sauber, dass alle bloß staunten. Ich hab dich nur in Weiß gekleidet. Und wenn du im Sand spieltest, bist du dagehockt und hast nur mit einem Stöckchen rumgewühlt. Da sagte mir ’ne Nachbarin: Wie stellst du das an, meine Liebe, dass er immer so saubere Sachen anhat? Meiner saut sich furchtbar ein, ich wasch ihm die Sachen jeden Abend. Aber du warst mager, hast nichts essen wollen … Jede Mahlzeit war ’ne Quälerei. Ich wusst nicht mehr, was in Gottes Namen ich dir denn noch vorsetzen soll …«
»Warum sind wir aus Floreasca weggezogen?«, frage ich aufs Geratewohl, merke aber plötzlich auf, denn Mutter hält beim Verlesen der Bohnen inne. Sie steckt die Hand in den Topf und betrachtet ihre Finger, die im prasselnden Haufen auftauchen und verschwinden. Die großen, wasserschweren Flocken, die mit rasender Geschwindigkeit aus dem winterlichen Himmel taumeln, sind jetzt schmutzigrosa auf dem misslaunigen, immer dunkler werdenden Himmel, der anfängt, mit der Mühle in eins zu verschwimmen. Irgendwo, in weiter Ferne, dringt ein rotes, kaum sichtbares Lichtchen durch: Es ist der Stern auf der Turmspitze am Haus des Funkens. Ich stehe auf, öffne die Balkontür und verlasse gleichzeitig mit dem Dampf die überheizte Küche. Kälte und Feuchtigkeit lassen mich plötzlich schauern. Der Schnee fällt heftig, rosig-braun, ich zerschmelze in der Abenddämmerung, in Frost und Einsamkeit. Die Pappeln hinter dem Wohnblock stechen ihre Ruten in den Himmelsdunst, in jenen fernen Ort, von dem die Flocken kommen, schwarz am braunen Himmel, schmutzig-schillernd, wenn sie sich auf die Hunderten Backsteinfensterbänke unter den Fenstern der Mühle legen, auf ihre Frontgiebel einer halluzinatorischen Festung, in ihren riesigen leeren Hof. Schrittspuren kommen durch eine der Türen heraus, führen bis zur Mitte des Hofes und enden dort. Ringsum legt der Schnee sich langsam hin, zischt kaum hörbar im fahlen Licht einer einzigen Glühbirne. »Meine Welt«, flüstere ich, »die Welt, die mir gegeben worden ist.« Ich strecke die Hände aus, spüre den eisigen, wässrigen, süßlichen Kuss jeder einzelnen Flocke auf der Haut. Ich wende das Gesicht himmelwärts, so sehr, dass ich das Geländer mit jedem Knochenfortsatz der Wirbel spüre, die es berühren. Es schneit mir auf das Gesicht, auf meine geschlossenen Lider, ich spüre den Flaum des Schnees auf meiner Maske wachsen, in jener eirunden Zone, wo sich beinahe die ganze Menschheit in mir bündelt, so wie das Auge fast alles empfängt, was ein Mensch fühlt. Ich bin mein Gesicht, das Gesicht einer Spinne und eines Erzengels, einer Milbe, das Gesicht des Windes und des Donners und des Erdbebens. Mein Gesicht, das strahlt, ohne dass ich es weiß, und das ich mir nun mit dem milden Schleier des Schnees bedecke. Wenn ich spüre, dass mir Lippen und Wimpern erstarren und hinter ihnen die Schädelknochen aus dünnem Eis, mit Luftblasen da und dort, erhebe ich mich, schüttle die wassergetränkten Kristalle ab und trete wieder in den dunklen, um Mutter gesponnenen Kokon. Noch immer lässt sie durch die Finger die Bohnen gleiten, die jetzt in der olivfarbenen Finsternis der Küche wie Perlen glänzen, und betrachtet sehr aufmerksam einen Punkt auf dem Wachstuch, wo nichts ist. Eigentlich weiß ich, was sie tut, das habe ich auch getan, Tausende Male. Sie lässt ihre Augäpfel auseinanderstreben, leicht, über der beigen Oberfläche des Wachstuchs mit den kaffeebraunen Quadraten, blickt unaufmerksam, alles in allem blickt sie eigentlich nicht, sondern schaut, schaut, ohne zu blicken, auf die Quadrate, die zu wandern beginnen, gespensterhaft, das eine hin zum andern, bis sich die benachbarten Quadrate in Reihen, die sich von ihrer Ebene lösen, übereinanderlagern und das Wachstuch mit einem Mal zu einem Würfel aus Licht, aus leuchtender und tiefer Luft wird, in den die Reihen in einer spektralen, scharfen, mystischen und kristallenen Perspektive eintauchen, so dass du weißt, dass du nicht mehr ein Ding aus der Wirklichkeit betrachtest, sondern ein im Innersten deines Hinterhaupts, im Sehfeld deines Geistes hypnotisch glitzerndes Ding. Mit parallel gerichteten Augäpfeln wie jenen von Blinden siehst du dann dein Sehfeld, siehst du dein Sehen, lebst glücklich und meditativ deine reine, leuchtende, ins Endlose ausgedehnte Innerlichkeit des Geistes. Verstehst dann, wie du sähest, wenn du keine Augen hättest, wie sich der blinde und intelligente Kosmos selber sieht, der wie verdickter Honig in die Waben unserer Schädel rinnt. Nun herrscht fast vollkommene Dunkelheit, nur die blauen Blütenblätter des Gasherds erhellen schwach den Tisch, die uralte Anrichte mit einigen gesprungenen Tassen und Gläsern in der fensterlosen Vitrine, Mutter mit ihrem weichen und sich jedem Ordnen widersetzenden Haar. Wenn sie zu einer Taufe oder Hochzeit muss, geht auch sie zum Friseur, gibt eine Menge Geld aus für eine lächerliche Dauerwelle, mit Locken wie Krautwickelchen, doch anderntags ist ihr Haar ebenso glatt, nichtssagend, ohne Eigenschaften. So legt sie es gewöhnlich um diese Lockenwickler, diese grässlichen Eisenteile mit schmuddeligen Gummibändern, die aber immerhin ein Fortschritt sind gegenüber den Lockenwicklern aus Papier von dazumal. Die mit schlechtester Druckerschwärze durchtränkten Zeitungen, »Der Funke«, »Das freie Rumänien«, »Der Volkssport« und »Die Information«, mit denen wir uns auch den Hintern abwischten, in die wir auch das Schulbrot einwickelten und die wir im Sommer vor die Fensterscheiben hängten, um sie, nahte der Herbst, vergilbt wieder abzunehmen, erreichten in Mutters Haar gleichsam eine Art Höhepunkt ihrer Allgegenwart, der Hunderten von Verwendungen, die man für sie hatte: Mit den Lockenwicklern im Haar wurde Mutter zu einer seltsamen Blume oder einer rätselhaften, phantastisch geschmückten Gottheit. Zu einem Kern der Papierwelt, in die sie eingetaucht war. In die Haarsträhnen gedreht und gewickelt, gaben die Zeitungsfetzen noch den Blick frei auf einen Staatsführer, ein Fußballerbein, einen Artikel über die Kollektivierung der Landwirtschaft. Eine Sichel verschränkt mit einem Hammer, ein fünfzackiger Stern, den kabbalistischen Schwarten entrissen (ja, Fulcanelli, das Pentagramm, das dich in seine Mitte sperrt), eine Kästchenreihe für Kreuzworträtsel. Nachdem sie sich die Haare gewaschen hatte, vertrödelte sie einen ganzen Vormittag lang damit, sich die Dinger ins Haar zu drehen. Wenn sie fertig war, wurden diese gleich den Zipfeln der mit Stanniol umwickelten Bonbons oder gleich der Telomerase, des Unsterblichkeitsmoleküls, feucht von ihrem Haar und hingen jämmerlich um ihre Kopfhaut, so weiß, als wachse ihr das Haar unmittelbar aus dem Schädelknochen. Das Wasser lief in Strömen hinter Mutters Ohren, an ihren Wangen, am Hals hinab, benetzte ihren Morgenrock aus Finette bis zwischen die Schulterblätter. Darauf steckte sie den Kopf in den Backofen und harrte in der heißen Luft des Gasbrenners aus, bis das Haar trocknete und sich die Lockenwickler so sehr aufblähten, dass sie fast das ganze Zimmer ausfüllten. Dann war Mutter schön. Sie betrachtete sich im Spiegel, strich mit der Hand über den riesigen Strauß aufgeblühter, raschelnder Zeitungen und beging, um es nicht bedauern zu müssen, dass sie sie abnahm, eine Verrücktheit: Sie trat aus unserer Wohnung, lief durch den stets eiskalten mattgrünen Flur der Villa und zeigte sich vor dem Eingangstor, unter den Nachmittagshimmeln voller Wolken und Schwermut. Dort stand sie wie ein aufgeplusterter Pfau minutenlang da, schaute nichts an, ließ sich nur anschauen und rannte rasch zurück, entsetzt über ihren Mut, denn sich jemandem mit Lockenwicklern im Haar zu zeigen war eine große Schande. Dann nahm sie sie ab und warf sie, einen aschgrauen Haufen, auf den Läufer im Zimmer. Auf dem Kopf hatte sie nun, wenigstens bis zum Abend, dieselben Krautwickel wie alle Frauen, die ich kannte, Krautwickel, die angeblich elegant unter den mit türkischen Mustern bedruckten Kopftüchern hervorlugten.
Und so saßen wir beim Licht des Gasherds, das auf unseren Gesichtern flackerte wie jenes der Wandleuchte in Tântava, und Mutter kam wieder und wieder auf unser täglich Essen, das Schlangestehen, die Armut zurück. »Früher war ich immer darum besorgt, was ich euch noch zum Essen machen sollte, ich dachte, dass ich auch ein Frikassee zubereiten könnte, oder einen Pilaw, denn ihr würdet ja so viel Schweinefleisch satthaben … Dann und wann kochte ich eine gesäuerte Meldensuppe, tat Joghurt rein … Die schmeckte gut! Doch das gab’s so einmal im Monat. Was, das war doch kein Problem? Man ging in die Halle bei Obor und fand auf einer Seite Fisch, auf der andern die Schlachterei mit ganzen Schweinehälften, die am Haken hingen, ich sehe sie noch vor mir, mit Schweineköpfen für die, die sie kaufen wollten (nur die Ärmeren nahmen welche) … Die Schlachter hatten ihre Holzblöcke, da drauf haben sie die Rinderrippen mit dem Beil zerhackt, dass ihre Schürzen ganz blutig wurden. Man stellte sich da an, ließ sich den Platz in einer andern Schlange freihalten, und in einer Stunde hatte man seine Besorgungen erledigt. Nur Geld musste man haben! Wenn man Hackfleisch wollte, wurde es einem vor den Augen durch den Wolf gedreht. Wollte man Würstchen? Da gab’s alle möglichen Sorten, auch frische (in echten Därmen, nicht in Plastik, wie sie das später machten), auch geräucherte, Dauerwurst, Bratwurst, was immer man wollte. O ja, das waren andere Zeiten. Heute schämt man sich, Liebes, noch jemanden als Gast zu empfangen. Die Leute gehen gar nicht mehr zu Besuch, denn sie wissen, dass man nichts vorgesetzt bekommen kann. Vor zehn, fünfzehn Jahren, als Vasilica und Onkel Ștefan oder die Patentante zu uns kamen, hab ich am Abend davor gekocht. Da servierte man erst mal ’ne Vorspeise, Schafskäse, Würstchen, Oliven, einen Leckerbissen (was gab’s damals für einen Prager Schinken, was für ein Kaiserfleisch! Da leckte man sich die Finger ab!), ein paar gefüllte Eier, eine Țuica3 vom Lande … Danach kam die gesäuerte Suppe, denn die macht den Bauch voll. Man saß eine Weile, plauderte, dann hieß es laufen und den Braten aus dem Rohr holen. Ich kam ja gar nicht erst dazu, am Tisch zu sitzen, ich lief mit den Tellern hin und her … Und der Wein? Wir kauften keinen, denn er war schlecht, der Neun-Lei-Wein, Wein aus Zaunlatten. Angeblich Murfatlar, Târnave, Dealu Mare … Von wegen, die waren alle gleich. So machten wir selber zu Hause Wein, füllten ihn in Korbflaschen ab. Im Herbst gingen wir auf den Markt und kauften ein, zwei Säcke Gutedeltrauben, hellgrüne, zartbraune, wie’s sich traf. Wir zerstampften sie in Kochtöpfen, und den Most gossen wir in Korbflaschen. Daraus wurde ein roter Schaumwein, den konnte man gut trinken. Davon hatten wir bis weit in den Sommer hinein … Ich machte auch Sauerkirschlikör, doch der gelang mir nicht so gut. Und er schmeckte mir auch nicht besonders, machte mich schwindlig. Dann brachte ich Kuchen, Quarkkuchen, Apfelkuchen … Hör zu, Vasilica, jetzt hab ich mich daran erinnert … Als wir sie einmal besuchten. Sie sagt: ›Marioara, heute geb ich euch nur Suppe.‹ Sie wurde krebsrot vor Scham, doch dann lachte auch sie über die Dummheit, die sie gemacht hatte. Sie hatte daran gedacht, Krautwickel zu kochen, hatte das Hackfleisch genommen, es mit Reis, Brot zusammengeknetet, wie man das halt so macht, tja, alles war fertig, nur musste sie noch Sauerkohlkraut kaufen. So geht sie zu ihrem Markt in Dudești-Cioplea und – was ist los? Keine Spur von denen, die Sauerkohlkraut- und Weinblätter verkauften. Die waren an dem Tag nicht gekommen. Was soll sie tun, was soll sie tun? Sie hatte auch keine Zeit mehr, um etwas Fleisch für einen Braten zu kaufen, denn wir mussten ja jeden Augenblick kommen … Na, was glaubst du, ist ihr da in den Sinn gekommen? Sie hatte auf dem Herd ein bisschen Zellophan zum Abdecken der Einmachgläser, wenn sie Pflaumenmus machte. Sie hat also das Zellophan genommen, es in Stücke geschnitten und – ach du großer Gott, was es in deinem Garten nicht alles gibt! – die Fleischröllchen reingetan. Sie hat Kohlrouladen in Zellophan gemacht! Sie hat sie kochen lassen, und als sie hinschaute, war nur Wasser mit Hackfleisch im Topf, das Zellophan war total geschmolzen …
Damals war’s schön. Man nahm sich vor: Komm, lass uns morgen den und den besuchen. Die Leute hatten kein Telefon, man ging ganz spontan hin. Aber alle freuten sich, wenn man bei ihnen vorbeikam. Und sofort luden sie einen zum Essen ein, es ging nicht anders. Man konnte so lange sagen, wie man wollte, dass man gegessen, dass man keinen Hunger hatte, zuletzt ging man trotzdem vollgestopft weg. Und was für ein Kampf, wenn man vom Stuhl aufstand: Bleibt noch, bleibt noch, sonst werden wir böse … Wenn’s nach denen ging, konnte man überhaupt nicht mehr fort. Und es wurde Nacht, bis man sich schließlich in Bewegung setzte. Mein Gott, was waren da für Sterne in Dudești-Cioplea, bei meiner Schwester! Es war richtig stockfinster, nicht wie hier in der Stadt. Und eine Unzahl von Sternen am Himmel. Du bist zwischen mir und Vater gegangen, schläfrig, bis zur Haltestelle, wir warteten in dieser Öde auf die Straßenbahn (es war die Endstation: kein Haus in der Nähe, so weit das Auge reichte, nur diese alte verlassene Fabrik), und wir sahen von weitem, wie sie kam, langsam, auf ihrem Gleis schlingernd … Sie war immer leer, nur der Fahrer und die Schaffnerin, die schlief, den Kopf auf ihrer Theke … Du hast in meinen Armen geschlafen, eine geschlagene Stunde, bis wir zu Hause ankamen … Ich trug dich ins Bett, zog dich aus, zog dir den Pyjama an, und du wurdest trotzdem nicht wach, so müde warst du. Kein Wunder, bei Vasilica bist du ja nur im Wipfel des Sauerkirschbaums gehockt. Oder auf dem Acker, mit den Kindern, da holtet ihr die Hornissen aus den Löchern. Ach, Liebes, geh doch mal hin, wenn du kannst! Ich meine nicht zu Vasilica, s’ ist meine Schwester, aber zu den andern, zu Ionel, zu Grigore, zur Patentante … Oder bitte sie zu dir, wenn du’s dir leisten kannst. Was sollst du ihnen anbieten? Die Brüder Petreuș?4 Adidas-Sportschuhe? Malzkaffee? Sommersalami, auch die gibt’s nur auf Bezugsschein, zweihundert Gramm im Monat. Die Eier, auf Bezugsschein. Das Brot? Ich hab gehört, dass es in manchen Gegenden auch auf Bezugsschein zu kriegen ist, bei uns nicht, aber man steht dafür Schlange, um etwas zu ergattern, bis einem schlecht wird. Ist uns nicht vorgestern das Brot ausgegangen? Da gnade uns Gott … Und so verrohen die Leute: Man geht zu niemandem mehr hin, man bleibt zu Hause und ringt die Hände vor Ärger. Aber wie heißt es so schön, umsonst brichst du Streit vom Zaun, wenn du keinen Mumm hast … Was soll man machen? Bei wem soll man sich beschweren? Früher gab’s in jedem Lebensmittelladen ein fadengeheftetes Büchlein, es hieß ›Beschwerdebuch‹. Dort schrieb man rein, wenn man, wie’s mir einmal passiert ist, einen Nagel in einer Dose Gemüseeintopf fand oder eine Fliege in einer Flasche Bier. Oder wenn die Verkäuferinnen einem unverschämt gekommen sind. Das hatte keine Folgen, doch man machte sich wenigstens Luft. Hier an der Ecke ist eine Verrückte gekommen, die eines Tages das Beschwerdebuch vollgeschrieben hat: Albernheiten, Weltuntergang … halt lauter Spinnereien von der. Die Geschäftsführerin las es den Leuten vor, bekreuzigte sich und lachte. Doch seit einigen Jahren machen die nur noch Quatsch. Man sagt ja: Der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Ich weiß nicht, Liebes, reden wir leiser, damit uns keiner hört. Sie sind nicht mehr zu ertragen: er und sie, sie und er, überall, nur Schmeicheleien und Schweinereien … Ich guck mir ja auch diese Sendungen für Kinder an. Was sollen die sich noch angucken? Gibt es noch Mihaela? Danieluța und Splitterchen? Früher brachten sie noch Zeichentrickfilme, schöne Sendungen, mit Kapitän Wirbelsturm … Ich guckte auch mit dir mit, die mochte ich gern … Und Sonntagvormittag gab’s Daktari, Der Planet der Giganten (der lief ungefähr vier Jahre, Sonntag für Sonntag, bis die Leute den überhatten), erinnerst du dich noch, der Hengst Fury, dieser Delphin … Die Kinder mochten das. Du hocktest vor dem Fernseher, erinnerst du dich, nur im Unterhemdchen, auf dem Teppich, winters beim größten Frost. Was machte uns das schon aus? Die Heizkörper liefen auf Hochtouren, man konnte sie gar nicht anfassen. Gott gnade den Kinderchen, die jetzt auf die Welt gekommen sind. Womit soll man sie denn waschen? Wie soll man sie schlafen legen in dieser Kälte, denn, guck mal, wir sitzen den ganzen Tag lang in unseren Wintermänteln rum … Diese Hundsgemeinen! Wenn man das im Fernsehen sieht, meint man, sie werden von allen Leuten geliebt. Die bringen nur noch solche Huldigungssendungen. Es ist zum Kotzen. Da stehen hübsche Kinder steif in Pionieruniform auf der Bühne und sagen bloß: ›Genoooosse Nicolae Ceaușescu, und so weiter, und so weiter, wir lieben dich so sehr … Genoooossin Elena Ceaușescu, liebevolle Mutter und Wissenschaftlerin …‹ Von wegen Wissenschaftlerin, ich hab mehr Schulbildung als die. Von ihm ganz zu schweigen. Du kennst doch den Witz, wie ihr Haus Feuer fängt und sie hinauslaufen, und als das Feuer so richtig wütet, rennt er schnell ins Haus und kommt in Pantoffeln wieder raus. ›Aber, Liebling, ich weiß nicht‹, sagt sie, ›wieso du dein Leben wegen dieser Pantoffeln aufs Spiel setzt.‹ ›Wieso denn, hast du dein Diplom denn nicht auch mitgenommen?‹ Die Pantoffeln waren sein Diplom, das hat er als Beruf gelernt, das Schusterhandwerk. Deswegen, sagt man, lacht er auf Fotos so schief, das kommt von den Schusternägeln, die er im Mundwinkel hatte … Das ist nicht zum Lachen, es ist zum Heulen, wehe uns, dass solche Leute über uns herrschen. Ach … wenn Gott will und wir auch diesen Winter überstehen, kommen wir schon irgendwie zurecht. Du, Mircea, rede nicht mit andern über diese Dinge. Nicht einmal mit den besten Freunden. Du weißt nicht, wer hingeht und was sagt. Die wissen alles und können’s kaum erwarten, dich bei irgendwas zu ertappen. Ich wär fast gestorben, als sie dich im Frühling mitgenommen haben. Du Ärmster, was haben wir damals alle durchgemacht … Der arme Vater lief ganz baff herum, dann hat auch er gesehen, wozu die imstande sind. Er schmiss die Sachen durch die Gegend, hat seine Medaille ins Klo geworfen (die schöne mit der Vergenossenschaftung der Betriebe, mit der du gespielt hast, als du klein warst, erinnerst du dich, du hast sie auch in die Schule mitgenommen, und Porumbel hat sie dir gestohlen, aber die Lehrerin hat ihn erwischt und sie uns zurückgegeben) … Mein Gott, hatte ich eine Angst … Ich dachte sogar … da siehst du, was einem in solchen Augenblicken durch den Kopf geht … Ich dachte: Wenn diese Medaille unter die Erde gerät, durch die Rohre, und irgendwo stecken bleibt (sie war ziemlich groß und hatte auch so ein Stoffbändchen mit einer Sicherheitsnadel, damit man sie an die Brust heften kann) und die Kanalräumer sie in die Finger bekommen – früher nannten wir sie Scheißer – und zur Partei bringen? Wenn sie auch Vater mitnehmen? Und ich weinte, ich weinte den ganzen Tag. Nachts träumte ich nur von der Medaille, wie sie zwischen Kotklumpen und Dreck in den Abwasserkanälen vom Wasser weggespült wird … Und in diesen Träumen – lach mich nicht aus – landete der Orden in Ceaușescus Badezimmer, plumpste vom Warmwasserhahn in die Badewanne, als er gerade badete. Und er sagte: ›Holt mir die Liste mit allen, die den Orden bekommen haben!‹ Und er hielt sie in der Hand, wendete sie mal auf die eine, mal auf die andere Seite … Mal war die Medaille da, mal verwandelte sie sich in eine Goldmünze, so eine wie aus Mütterchens Halskette … Träume! Unser Glück war wieder der arme Ionel, genauso wie damals mit den Teppichen, in Floreasca. Er lief mit kleinen Aufmerksamkeiten zu seinen Chefs (denn auch die Securitate-Leute sind Menschen, sie trinken auch gerne einen echten Bohnenkaffee, rauchen ab und zu eine Kent, lesen hin und wieder ›Der Meistgeliebte unter den Erdbewohnern‹5 … nun ja, mancher verdaut den Hafen, ein anderer kaum das Mus …), lief in die Psychiatrie, wo sich dich hingebracht haben. Er hat dir auch diese Seiten zurückgegeben, denn du wolltest ja nicht von den Irren weg, du hast nicht lockergelassen: die Seiten, die Seiten! Als ich eines Tages plötzlich sehe, dass Ionel mit einem großen, mit Bindfaden verschnürten Paket nach Hause kommt: ›Da ist das Manuskript, Marioara. Zum Glück hat er nichts über den Genossen oder die Partei geschrieben, sonst hätte ich ihn nicht rausholen können. Vier Kumpel haben sich die Köpfe über ihn zermartert, einer ist sogar Schriftsteller, denn bei uns gibt’s auch solche; er hat ein paar Krimis geschrieben. Er hat zu mir gesagt: Der Junge ist durch den Wind, nicht von ungefähr ist er in der Psychiatrie gelandet. Da steht nichts Gefährliches drin. Nichts als Larifari, da geht’s um Grüfte, um Gott, um irgendwelche Holländer … Es lohnt sich nicht, uns die Köpfe über ihn zu zerbrechen, wir haben unsere eigenen Probleme.‹ Ist doch so, Liebling, ich hab auch am Anfang ein bisschen reingesehen und war böse mit dir: Wie konntest du nur so über uns schreiben, dass ich eine Zahnprothese, dass meine Hüfte … Woher willst du wissen, was ich auf der Hüfte habe, was geht das die andern an? Wie oft hab ich dir nicht gesagt, Liebling, dass du nicht mehr alles schreiben sollst, was dir durch den Kopf geht, dass du schreiben sollst, was verlangt wird … Vielleicht hätten sie inzwischen auch ein Buch von dir veröffentlicht, wie Nicușor vom andern Treppenhaus, oder dieser andere Schriftsteller in unsrem Wohnblock, der beim Eingang Nummer sechs wohnt (Gott, wie hieß der gleich?) und der bei den Wohnblockversammlungen mir nichts, dir nichts aufsteht und sagt: Ich bin Schriftsteller, als würde ihn jemand fragen, was er ist … Du hast nichts Besseres zu tun gehabt, als zu schreiben, dass Vater Damenstrümpfe auf dem Kopf trug. Na und? Das taten damals alle Männer; nachts legten sie sich mit Damenstrümpfen auf dem Kopf ins Bett, damit das zurückgestrichene Haar so bleibt, denn so trug man es damals: nach hinten gekämmt und mit Walnussöl eingeschmiert. Das ist gar keine Schande. Nur, warum musst du darüber schreiben? Schreib doch über etwas Schönes, bist ja kein dummer Junge und hast eine Menge Bücher gelesen. Schau mal, ein gutes Buch liest man zigmal, ohne sich zu langweilen. Mein Gott, wie schön ist ›Donauflut‹ oder die Sache mit Șuncărică und mit Ducu-Năucu Păr Cărunt … wie die Diebe dasaßen und Ketten aus Teigwarenschneckchen machten, sie bemalten, auffädelten und sagten, es sind Perlen … Oder ›Die Insel Tombuktu‹: Ganze Nachmittage saß ich mit dir unter der Decke und las dir daraus vor, bis ich heiser wurde und die Schrift nicht mehr sah, denn es wurde schon dunkel … Mit den Wilden, die auf Palmblättern schreiben … Ich hab’s nicht geschafft, ›Mit vollen Segeln‹ anzufangen, das ist zu dick, ebenso ging’s mir mit ›Die verfemten Könige‹. Aber von Geschichten kann ich nie genug bekommen. Das da, ›Rumänische Volksmärchen‹, ist wunderschön. Damit hast du ganz allein lesen gelernt. Ich seh dich noch vor mir: Du lagst da auf dem Kasten vom Bettsofa im Vorderzimmer, das Buch über dem Kopf. Als du ›Ileana Cosânzeana, in ihrem Zopf die Rose singt, neun Kaiser hören zu‹, das längste Märchen im Buch, zu Ende gelesen hattest, warst du außer dir vor Freude. Jetzt lese ich gar nicht mehr, ist mir noch nach Lesen zumute? Wenn ich mir doch den lieben langen Tag den Kopf zerbreche: Was werde ich euch morgen auf den Teller tun? Und wo soll ich bei diesem Schneesturm noch hingehen, um etwas zu ergattern, wenn ich höre, dass sie Joghurt haben, Eier, dass sie Rinderknochen gebracht haben? Für ein paar Hühnerkrallen laufen die Leute verzweifelt überallhin. Ob die wohl auch so was essen? Ob er ihr etwa sagt: Leana, geh und stell dich an, vielleicht ergatterst du noch ein Crevedia-Hühnchen … Diesen Sommer gab’s eine Ausstellung im Messepavillon. Als du klein warst, gingen wir oft hin, das war ja in der Nähe von Vaters Arbeit, beim Haus des Funkens. Erinnerst du dich, als es die ersten Plastikkugelschreiber gab? Die Leute kamen aus dem Staunen nicht mehr raus. Dort haben wir welche mitgenommen. Und als die Russen die Rakete brachten, mit der Gagarin geflogen war … Wir haben auch ein Foto von dort, irgendwo in meiner alten Handtasche. Na, dieses Jahr haben sie wieder eine Ausstellung gemacht, mit vielen Firmen aus der ganzen Welt, mit Möbeln, mit Autos, mit allem Möglichen. Und da war, hörst du, Schatz, auch ein Pavillon mit Lebensmitteln. Also das, was wir für den Export produzieren. Dort durften die Leute nicht rein. Das glaub ich gern! Dort waren alle Leckerbissen von der Welt. Als die Ausstellung zu Ende war, haben sie Heftchen in die Mülltonnen geworfen, also … diese Prospekte von allem, was dort ausgestellt worden war. Und da gab’s Leute, die sie rausgeholt und klammheimlich den Passanten auf der Straße gegeben haben, sie haben sie auch in die Briefkästen gesteckt. Die hatten Mumm! Wenn man sie erwischt hätte, wer weiß, was ihnen passiert wär. Mir hat Madame Soare auch eines dieser Büchlein gezeigt. Groooßer Gott, was da alles drin war! Schau mal, ich muss heute noch schlucken. Was gab’s da für einen Schinken, was für Würstchen, was für einen gepressten Schafskäse, ganze Laibe, Schatz, was für eine Leberpastete, von der guten, wie früher. Was gab’s da nicht alles! Fette Hähnchen mit in Stanniol gewickelten Keulen, ihre Haut glänzte vor Fett, Edelschimmelkäse, wie man’s nur in Filmen sieht (ich wusste nicht, dass man den auch bei uns macht), Wiener Würstchen, Schweinenacken nach Zigeunerart, so groß wie kleine Melonen, mit Bindfaden verschnürt … Auf einer anderen Seite war Fisch zu sehen, Lachskaviar, geräucherter Hausenrücken, allerlei Spezialitäten, wer sich das alles wohl ausgedacht hat … Dann gab’s Weine, und in was für schönen Flaschen, mit vergoldeten Etiketten … Säfte, Eis in großen Plastikschachteln. Und Schokolade, Schatz, alle möglichen Sorten, mit Creme gefüllte Bonbons … Alles, alles, alles geht nach draußen, ins Ausland. Alles ist für den Export, damit er seine Schulden bezahlen kann, seine gottverfluchten Schulden! Ich würde sagen: Exportieren wir die doch auch, aber etwas soll auch dem armen Menschen bleiben, damit er sein Leben fristen kann. Doch davon wissen die nichts! Nichts, Schatz, die Hunde. Die machen uns die Tage bitter, bringen uns noch ins Grab, diese Halunken. So weit haben wir es gebracht, dass man in Rumänien verhungert, wo gibt’s denn so was? Nicht einmal, als man beim Bojaren arbeitete (auch damals war’s alles andere als gut), auch nicht im Krieg ist’s schlimmer gewesen. Und in der großen Hungersnot, ’48–’49, als die Moldauer kamen und alles, was sie hatten, für ein Stück Brot verkauften, war’s auch nicht wie heute. Mein Gott, mein Gott, wo kommen wir noch hin …«
Wie an jedem Abend beginnt sie zu weinen. Ich lege ihr nicht die Hand auf den Arm, streichle nicht ihr ungefüges Haar. Am nächsten Tag werde ich nicht im Morgengrauen aufstehen, um an ihrer Stelle Schlange zu stehen. Auch diesmal wird sie es sein, die mir das Futter in den Teller füllt. Ich werde die runzlige Haut der Hähnchenkrallen und -hälse in der Suppe essen, als wäre der gequälte Leib der Mutter selbst in der klaren Brühe zerstückelt. Wir alle machen allen das Leben zur Hölle, wir richten sie zugrunde. In meinem zerschlissenen Pyjama, von derselben Art wie jener, in dem ich fünfzehn Jahre zuvor auf dem Kasten des Bettsofas saß und durch das dreiflügelige Fenster meines Zimmers in der Ștefan-cel-Mare-Chaussee das Panorama von Bukarest betrachtete, den Fes über die Brauen gezogen und barfuß, stehe ich vom Stuhl auf, betrachte sie lange (eine in Kohle gezeichnete Ikone, verwildert vom Schmerz, nur die Spuren der Tränen glitzern im Licht der blauen Blütenblätter des Feuers auf dem Gasherd), höre, wie der Fahrstuhl in der Tiefe des Wohnblocks scheppert, wie durch die Ritzen der Balkontür der frostige Winterwind fährt. Ich gehe auf den Flur hinaus, trete ins Wohnzimmer, wo Vater in einem Winkel des dunklen Raumes gedankenverloren fernsieht, und gelange in mein Zimmer. Wie immer schließe ich die Tür hinter mir, die Tür zwischen mir und dem Weltall. Das Licht knipse ich nicht an. Die Dinge um mich sind schwarz und stumm: das Bett und der Kleiderschrank, der Tisch, der Stuhl. Sie sind latent, unerschaffen, so wie die Dinge sind, wenn niemand sie sieht. Nur wenn eine Trambahn vorbeidröhnt oder ein Auto mit eingeschalteten Scheinwerfern, gewinnen auch sie gespenstische Phosphoreszenz. Dann flitzen Streifen elektrisch blauen oder grünlichen Lichts und breiten sich an der Decke aus. Sie ziehen an meinem Manuskript vorüber, an Tausenden auf dem Tisch gestapelten Blättern, die obersten, letzten, flattern in der Luftwoge meines Vorbeigehens. Ich drücke die linke Handfläche darauf und spüre das tiefe, störrische Zucken der Arterien unter der Haut. Lebendig, lebendig und hyalitartig, durchscheinend in den Lichtstreifen, die durchs Zimmer sausen. Ich gehe ans Fenster und recke mich, stelle mich auf die Zehenspitzen, um mich auf den Bettsofakasten zu setzen. Ich lege meine nackten Fußsohlen auf den Heizkörper und presse sie dagegen, obgleich sein lackiertes Eisen jetzt eiskalt ist. Ich drücke meine Stirn gegen die Eisschicht der Fensterscheibe. Mein Atem beschlägt sie nach allen Seiten, zeichnet über dem ungestümen Schneefall draußen zwei zarte Schmetterlingsschwingen. Erst jetzt, hier, übermannt mich das Weinen, das verzweifelte Weinen des einsamsten Menschen auf Erden. Die Tränen, die meine Hornhäute überfluten, werden augenblicklich zu scharfkantigen Eiskrusten.