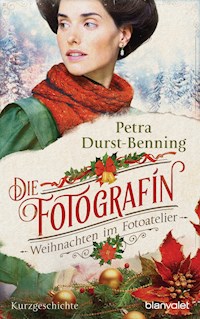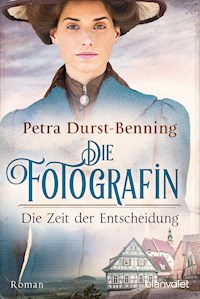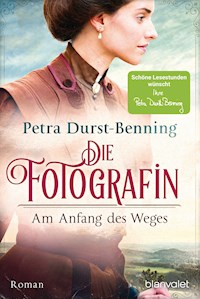
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fotografinnen-Saga
- Sprache: Deutsch
Gegen alle Widerstände wird Mimi Reventlow Fotografin, und findet nicht nur ihre Freiheit, sondern auch die Liebe …
Mimi Reventlow war schon immer anders als die Frauen ihrer Zeit. Es ist das Jahr 1911, und während andere Frauen sich um Familie und Haushalt kümmern, hat Mimi ihren großen Traum wahr gemacht. Sie bereist als Fotografin das ganze Land und liebt es, den Menschen mit ihren Fotografien Schönheit zu schenken, genau wie ihr Onkel Josef, der ihr großes Vorbild ist. Als dieser erkrankt, zieht sie in das kleine Leinenweberdorf Laichingen, um ihn zu pflegen und vorübergehend sein Fotoatelier zu übernehmen. Ihm zuliebe verzichtet sie nicht nur auf ihre Unabhängigkeit, sondern sieht sich in Laichingen zunächst auch den misstrauischen Blicken der Dorfbewohner ausgesetzt, da sie mehr als einmal mit ihrem Freigeist aneckt. Und als bald ein Mann Mimis Herz höher schlagen lässt, muss sie eine Entscheidung treffen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Minna Reventlow, genannt Mimi, war schon immer anders als die Frauen ihrer Zeit. Es ist das Jahr 1911, und während andere Frauen sich um Familie und Haushalt kümmern, hat Mimi ihren großen Traum wahr gemacht. Sie bereist als Fotografin das ganze Land und liebt es, den Menschen mit ihren Fotografien Schönheit zu schenken, genau wie ihr Onkel Josef, der ihr großes Vorbild ist. Als dieser erkrankt, zieht sie in die kleine Leinenweber-Stadt Laichingen, um ihn zu pflegen und vorübergehend sein Fotoatelier zu übernehmen. Ihm zuliebe verzichtet sie nicht nur auf ihre Unabhängigkeit, sondern sieht sich in Laichingen zunächst auch den misstrauischen Blicken der Dorfbewohner ausgesetzt, da sie mehr als einmal mit ihrem Freigeist aneckt. Und als bald ein Mann Mimis Herz höher schlagen lässt, muss sie eine Entscheidung treffen …
Autorin
Petra Durst-Benning wurde 1965 in Baden-Württemberg geboren. Seit über zwanzig Jahren schreibt sie historische und zeitgenössische Romane. Fast all ihre Bücher sind SPIEGEL-Bestseller und wurden in verschiedene Sprachen übersetzt. In Amerika ist Petra Durst-Benning ebenfalls eine gefeierte Bestsellerautorin. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Hunden südlich von Stuttgart auf dem Land.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Band 1
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.Der Abdruck des Zitats von Henri Cartier-Bresson mit freundlicher Genehmigung der Fondation Henri Cartier-Bresson, Paris.
Copyright © 2018 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Gisela Klemt
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von kemai/photocase.de, Shutterstock.com (MarkauMark; Vasya Kobelev) und Richard Jenkins Photography
NG · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-23080-7V005www.blanvalet.de
»Fotografieren bedeutet den Kopf, das Auge und das Herz auf die selbe Visierlinie zu bringen. Es ist eine Art zu leben.«Henri Cartier-Bresson (1908–2004)
1. Kapitel
Esslingen, 11. Februar 1905
»… und so möchte ich dich, liebe Minna, fragen, ob du meine Frau werden willst!« Heinrich Grohe nahm Mimis Hände in seine und sah sie erwartungsvoll an.
Minna?, fuhr es Mimi durch den Kopf. So wurde sie nur von ihrer Mutter genannt, und auch immer nur dann, wenn diese etwas an ihr zu kritisieren hatte. Nur mit Mühe unterdrückte sie ein nervöses Lachen. Da bekam sie einen Heiratsantrag, und das Einzige, was ihr dazu einfiel, war, zu monieren, dass Heinrich nicht ihren Spitznamen verwendete!
Darauf bedacht, das kleine Sträußchen Freesien, das zwischen ihnen auf dem Tisch stand, nicht umzuwerfen, entwand Mimi Heinrich ihre rechte Hand und griff nach ihrem Sektglas. Die kleinen Perlen des sprudelnden Getränks zerplatzten auf ihrer Zunge genauso wie die Gedanken in ihrem Kopf, noch bevor sie einen davon zu fassen bekam.
Er strahlte sie an. »Jetzt bist du baff, nicht wahr? Ich weiß, das kommt ein wenig plötzlich. Und mit deinen Eltern habe ich auch noch nicht gesprochen. Aber heute ist dein Geburtstag. Und da dachte ich, dies wäre doch ein passendes Geschenk!« Er machte eine ausschweifende Handbewegung, die das Café, in dem sie saßen, den Sekt, den Blumenstrauß und sie beide einschloss.
Ein Heiratsantrag als Geschenk? Mimi blinzelte ein paarmal, als wollte sie sich vergewissern, dass sie nicht träumte. Im Wintersonnenlicht, das durch die Milchglasscheibe des Cafés einfiel, leuchtete Heinrichs blonder Schopf, als habe der liebe Gott ihm persönlich einen Heiligenschein aufgesetzt.
Es war Samstag, der elfte Februar, ihr Geburtstag. Heinrich hatte sie kurz nach zwölf von der Arbeit im Fotoatelier Semmering abgeholt, so, wie er es samstags fast immer tat. Dann bummelten sie meistens eine Weile durch die Stadt, schauten sich die Schaufenster der eleganten Geschäfte an, schlenderten durch den Park. Anfang des Monats, mit dem Lohn in der Tasche, kehrten sie hin und wieder auch in eins der günstigen Gasthäuser rund um den Esslinger Marktplatz ein. Zum Klang des Glockenspiels vom nahegelegenen Rathaus aßen sie dann Kutteln oder Bratkartoffeln mit Speck. Normalerweise teilten sie sich die Rechnung, da weder Heinrich als Vikar in der Pfarrei ihres Vaters noch sie als Angestellte eines Fotoateliers sonderlich gut verdienten. Aber wen kümmerte das, wenn man jung und verliebt war? Heinrich mit seinen blauen Augen, der hohen Denkerstirn und den blonden Haaren, und sie, die Pfarrerstochter Mimi Reventlow, sechsundzwanzig Jahre alt, stets in ein Ausgehkostüm gekleidet, die kastanienbraunen Haare elegant hochgesteckt – sie waren ein schönes Paar. Wenn sie Arm in Arm durch die Straßen der alten Reichsstadt spazierten, drehten sich öfter die Köpfe nach ihnen um. Noch einmal so jung sein und die Zukunft vor sich haben!, las Mimi in den Blicken der Menschen.
Als Heinrich sie heute pünktlich um zwölf abgeholt hatte, hatte Mimi an ein ähnliches Samstagsprogramm gedacht, einzig vielleicht mit dem Unterschied, dass Heinrich sie anlässlich ihres Geburtstags wahrscheinlich einladen würde. Er hatte ihr die Blumen überreicht, ihr zum Geburtstag gratuliert und einen Kuss auf die Wange gegeben. Statt in eins der Gasthäuser zu gehen, in denen es nach Spiegeleiern und Sauerkraut roch, hatte er sie dann in ein elegantes Café geführt und dort eine ganze Flasche Sekt bestellt. Mimi hatte erstaunt die Brauen hochgezogen. Eine solche Extravaganz – wie würde sie sich nach dem Genuss von so viel Alkohol wohl fühlen?, hatte sie sich gefragt. Und auch, wie ihr später – vom Alkohol benommen – der steile Weg hinauf in die Esslinger Oberstadt gelingen sollte. So gesehen war ihr einiges durch den Kopf gegangen – dass sie heute einen Heiratsantrag bekommen würde, wäre ihr allerdings im Traum nicht eingefallen.
Da sie noch gar nicht reagiert hatte, wurde Heinrichs strahlende Miene leicht unmutig. »Minna?«, sagte er ungeduldig.
Sie lachte nervös auf. »Das kommt ein wenig überraschend!«
»Ja, freust du dich denn nicht?« Er runzelte die Stirn. Als habe ein Bühnenbildner die Hände im Spiel, kroch in diesem Moment am Winterhimmel eine Wolke vor die Sonne. Schlagartig wurde es im Café dunkler.
»Doch natürlich! Welche Frau würde sich da nicht freuen?«, verteidigte sie sich lahm.
Heinrich strahlte. »Das habe ich mir gedacht! Mit sechsundzwanzig Jahren bist du ja auch nicht mehr die Jüngste. Manch einer würde vielleicht sagen, es ist höchste Zeit, dass du unter die Haube kommst, bevor du zur alten Jungfer wirst.« Er zwinkerte ihr zu. »Aber sollen die Leute doch reden! Ich finde es gut, wenn Frauen sich vor der Ehe verwirklichen. Wer hat schon eine Frau mit Abitur und einer abgeschlossenen Berufsausbildung?« Heinrich nickte wohlwollend, dann beugte er sich ihr über den Tisch entgegen, ergriff erneut ihre Hände. »Deine Eltern werden bestimmt auch hocherfreut sein. Am besten gehen wir nachher gleich gemeinsam zu ihnen, damit ich bei deinem Vater um deine Hand anhalten kann. Eine reine Formalität – vor allem, wo es noch mehr Neuigkeiten gibt …« Seine Augen funkelten vor Erregung, Mimi sah ihm an, dass er sich kaum zurückhalten konnte.
»Ja …?«, sagte sie schwach.
»Ich bekomme die Pfarrei in Schorndorf übertragen! Das bedeutet, wir können deine Eltern weiterhin regelmäßig besuchen und umgekehrt.«
Schorndorf? Nun war es Mimi, die die Stirn runzelte. Obwohl die Stadt nur einen Steinwurf von Esslingen entfernt lag, war sie noch nie dort gewesen. »Leben dort nicht vor allem strenge Pietisten, bei denen Tanzfeste, Musik und Alkohol verboten sind?« Sie zeigte demonstrativ auf die Sektflasche.
»Du hast recht. Am besten trinken wir, solange wir noch können!« Über seinen eigenen Scherz lachend, schenkte er Sekt nach. »Aber ich kann dich beruhigen, der Einfluss der Pietisten in Schorndorf ist bei weitem nicht so groß, wie es immer heißt. Viel größer als die pietistische Gemeinde ist nämlich die der evangelischen Kirche. Als evangelischer Pfarrer werde ich allerdings auch Ansprechpartner für die Pietisten sein, ein gottgefälliges Leben ist von daher tatsächlich angebracht. Zum Wohl!« Er prostete ihr zu.
Um etwas zu tun zu haben, trank Mimi ebenfalls einen Schluck. Doch das Prickeln war verflogen, der Sekt schmeckte nur noch schal. Als habe ein gestrenger Pietist ihn verwünscht, dachte Mimi. Was bist du nur für ein undankbares Wesen, schalt sie sich gleichzeitig. Freu dich endlich! Der Hochzeitsantrag gehörte schließlich zu den schönsten Dingen im Leben einer Frau. Doch statt erregte Freude zu verspüren, hatte sie das Gefühl, als habe sich in ihrer Herzgegend eine Kröte niedergelassen, die eine dumpfe, feuchte Kälte verbreitete. Gab es nicht die Redensart, jemand habe eine »Kröte schlucken« müssen? Mimi, du spinnst, schalt sie sich.
Heinrich schien ihre gedrückte Stimmung nicht wahrzunehmen. Schwungvoll stellte er sein Glas ab und nahm den Gesprächsfaden wieder auf. »Gleich nach Ende meines Vikariats im Sommer darf ich die Schorndorfer Gemeinde übernehmen. Der dortige Pfarrer ist schon fast achtzig und kann es kaum erwarten, aufs Altenteil zu gehen. Scheinbar ist er gesundheitlich nicht mehr gut beieinander, das heißt, er wird mir nicht viel in die Arbeit hineinreden. Ein wenig werden wir uns um ihn kümmern müssen, das erwartet die Gemeinde von uns, aber das ist ja sowieso selbstverständlich.«
»Aha«, sagte Mimi. Sie hatte noch nicht einmal ja gesagt!
»Ich war Anfang der Woche in Schorndorf. Die Pfarrei ist überschaubar, nicht so groß wie die deines Vaters. Aber ich betrachte das als Übung für spätere, größere Aufgaben. Und das Haus, in dem wir wohnen werden … Es ist kein Palast, zugegeben. Vielmehr ist es ein wenig baufällig, und das Inventar ist abgelebt. Kein Wunder, Pfarrer Weidenstock, so heißt mein Vorgänger, hat nie geheiratet, und eine Haushälterin hatte er wohl auch nicht, niemand hat sich also um Haus und Hof gekümmert. Aber wenn du dich erst einmal der Sache angenommen hast, wirst du den Haushalt in Windeseile gut in Schuss gebracht haben!«
»Ich bin doch keine Hausfrau!«, protestierte Mimi. »Ich bin Fotografin, wie man einen Haushalt führt, habe ich nie gelernt. Und dann soll ich auch noch den alten Herrn Pfarrer mit versorgen?«
Heinrich winkte ab. »So was liegt Frauen im Blut, keine Sorge! Und wenn du dir doch mal bei etwas unsicher bist, wird dir ein Gemeindemitglied bestimmt gern helfen.« Mit einem schwärmerischen Lächeln fuhr er fort: »Ach Mimi, ich sehe es schon genau vor mir – du in der ersten Reihe der Kirche und ich auf der Kanzel! Die Schorndorfer werden begeistert sein von meinen fortschrittlichen neuen Predigten. Unser Vater im Himmel hat den Menschen einen Kopf zum Denken gegeben, er will keine unterwürfigen Schäfchen, das möchte ich den Menschen vermitteln! Und dass Fortschritt und Gottesglaube sich nicht ausschließen, sondern Hand in Hand gehen können – auch darüber will ich predigen. Dein Vater war mir der beste Lehrmeister, ich fühle mich inspiriert und gewappnet zugleich. Er wird stolz auf mich sein! Und wenn ich Hausbesuche bei den armen Leuten mache, darfst du mich natürlich begleiten. Eine Pfarrersfrau kann so viel Gutes bewirken! Aber wem erzähle ich das – hast du doch das beste Beispiel in deiner Mutter zu Hause. Apropos zu Hause – habe ich eigentlich schon erwähnt, dass das Haus auch ein kleines Gärtchen hat? Am Ende des Gartens fließt sogar ein Bach, dort könnte man sehr gut Wäsche waschen. Wenn wir erst Kinder haben, wirst du diesen Umstand sicher zu schätzen wissen.«
»Aha …«, sagte Mimi erneut und kam sich vor wie ein Papagei. Welche Kinder? Unwillkürlich rutschte sie auf ihrem Stuhl nach hinten, als wolle sie Distanz zwischen Heinrichs Pläne und sich bringen.
Heinrich nickte. »Du wirst die Wäsche draußen aufhängen können, genau wie es eure Haushälterin bei euch im Garten tut. Ist das nicht schön? Wäsche, getrocknet von Sonne und Wind, duftet so viel besser, findest du nicht?«
»Der Garten und die Wäsche sind mir gerade ziemlich egal«, sagte Mimi und konnte nichts gegen den kratzbürstigen Ton in ihrer Stimme tun. »Sag mir lieber, ob es in Schorndorf auch ein Fotoatelier gibt.«
»Ein Fotoatelier?« Heinrich schaute sie an, als habe sie gefragt, ob der Kaiser von China im Nachbarhaus residiere. »Ich glaube nicht. Das wäre mir aufgefallen, und …«
»Wie stellst du dir das dann vor?«, schnitt sie ihm das Wort ab. »Soll ich jeden Tag mit dem Zug oder der Postkutsche zur Arbeit nach Esslingen fahren?«
»Aber Mimi!« Heinrich lachte prustend auf. »Als verheiratete Frau musst du doch nicht mehr arbeiten gehen! Der alte Felix Semmering und sein verstaubtes Atelier können dir dann endlich gestohlen bleiben. Du wirst dich komplett den Pflichten einer Ehefrau widmen können.«
Das Glockenspiel ertönte. Mimis Herz pochte im selben schnellen Rhythmus. Sie schaute Heinrich mit aufgerissenen Augen an. »Oh, schon drei Uhr! Ich muss gehen! Ein dringender Termin, gerade fällt es mir wieder ein. Bitte verzeih mir …« Sie riss ihre Handtasche so abrupt in die Höhe, dass sie ihr gegen die Hüfte schlug, lächelte entschuldigend, dann lief sie davon.
»Aber Mimi! Du hast doch noch nicht mal ja gesagt!«, rief Heinrich ihr hinterher.
Eben, dachte sie. Eben.
2. Kapitel
Und nun? Vom Sektgenuss ein wenig benommen schaute Mimi sich auf dem Esslinger Marktplatz um. Bloß nicht nach Hause! Sobald sie die Pfarrei betrat, würde ihre Mutter sie für irgendwelche wohltätigen Zwecke einspannen, Geburtstag hin oder her. Wahrscheinlich würde Heinrich ebenfalls dort auftauchen und darauf bestehen, dass sie sich ihm gegenüber erklärte – dass sie ihn einfach hatte sitzenlassen, würde er bestimmt nicht gutheißen!
Um sich im Park auf eine Bank zu setzen, war es zu kalt. Die Sonne, die bis Mittag geschienen und den Esslinger Bürgern einen trügerischen Hauch von Frühjahr vorgespielt hatte, hatte sich längst wieder hinter dicken Wolkenbergen verzogen. Eisige Windböen zerzausten Mimis Frisur.
Wütend und hilflos zugleich wickelte sie ihren Schal enger um sich. Verflixt! Sie wollte doch nur ein bisschen allein sein. In Ruhe nachdenken können, ihre Gedanken schweifen lassen. In sich hineinhören und auf Klarheit hoffen.
Sie würde in eine Kirche gehen, beschloss Mimi. Schon so manches Mal hatte der liebe Gott ihr einen guten Rat gegeben, wenn sie Sorgen hatte oder nicht wusste, wie sie sich in einer Sache entscheiden konnte. Und wenn nicht, dann hatte sie dort wenigstens ihre Ruhe. Die Frauenkirche lag nur einen Steinwurf entfernt, unter ihrer blau-goldenen Decke würde sie bestimmt gut nachdenken können.
Mimi wollte gerade loslaufen, als ihr jemand von hinten auf die Schulter tippte. Heinrich? Bang drehte sie sich um. Doch es war eine junge Frau, die sie ansprach. »Verzeihung, ich bin fremd in Esslingen und suche den Gasthof Hirsch in der Ulmer Straße. Können Sie mir bitte den Weg nennen?« Ein Paar so strahlend blaue Augen, dass selbst Heinrichs Augen dagegen blass wirken würden, schauten Mimi erwartungsvoll an.
Mimi zeigte hinter sich. »Die Ulmer Straße liegt unten am Neckar, wenn Sie in diese Richtung laufen, kommen Sie dorthin«, antwortete sie der Fremden mit einem Lächeln. Die blauen Augen, die buschigen Brauen, die vollen Lippen – was für eine attraktive Frau, dachte sie im selben Moment. Und was für eine ungewöhnliche Frisur sie trug – die zu einem Kranz um den Kopf gelegten strohblonden Haare wirkten wie eine Krone. Die Frau hier und jetzt zu fotografieren, das wäre was! Mimi kribbelte es regelrecht in den Händen.
Die schöne Fremde strahlte Mimi weiter an. »Kein Problem, wenn die Richtung stimmt, finde ich mich schon zurecht.« Liebevoll, als hielte sie ein Kind im Arm, strich sie über ein in dünnes Leinen gewickeltes Bündel, das sie über dem linken Arm trug. »Mein Brautkleid«, sagte sie stolz. »Ich habe es gerade bei Brunners am Markt abgeholt.«
Mimi stieß einen kleinen Schrei aus und legte eine Hand auf ihr Herz. War das schon das Zeichen Gottes, das sie sich von dem Kirchenbesuch erhofft hatte?
»Halten Sie Brunners am Markt etwa nicht für die allererste Wahl?«, fragte die Fremde stirnrunzelnd.
»Doch, doch! Mathilde Brunner ist eine Künstlerin mit Nadel und Faden, sogar die Königsfamilie aus Stuttgart kommt zu ihr«, beeilte Mimi sich zu sagen. »Es ist nur so …« Fahrig strich sie sich über ihr zerzaustes Haar und fuhr schüchtern fort: »Ich habe gerade eben auch einen Heiratsantrag bekommen.«
Die blauen Augen der Fremden weiteten sich. »Das gibt’s doch nicht! Wie romantisch! Herzlichen Glückwunsch!« Bevor Mimi sich versah, umarmte die Fremde sie herzlich. »Achtung, das Brautkleid!«, rief Mimi lächelnd.
Die andere ließ sie augenblicklich wieder los und sagte: »Darauf müssen wir unbedingt anstoßen, finden Sie nicht auch? Bei meinem letzten Besuch hier war ich in einem hübschen Café im Maille-Park, wollen wir dorthin gehen? Ich lade Sie natürlich ein. O mein Gott, ich habe mich noch nicht einmal vorgestellt, wie unhöflich von mir! Mein Name ist Bernadette Furtwängler, ich komme aus Münsingen, das liegt auf der Schwäbischen Alb.« Ohne dass sie einmal Luft holte, purzelten die Worte aus dem Mund der Fremden.
Mimi lachte auf. Vielleicht würde ihr ein bisschen Ablenkung ganz guttun? »Also gut. Auf ein Glas mehr oder weniger kommt es heute auch nicht mehr an«, sagte sie, was ihr erneut einen erstaunten Blick der Fremden eintrug. »Mein Name ist übrigens Mimi Reventlow, mein Vater ist Pfarrer in der Esslinger Oberstadt. Und ich bin Fotografin.« Eigentlich, fügte sie im Stillen an.
»Dann können Sie ja meine Hochzeitsbilder machen«, sagte die Fremde begeistert.
Mimi zog eine Grimasse. »Schön wär’s! Aber in den Augen meines Chefs bin ich nur gut genug, um Kaffee zu kochen.«
»Männer!«, sagte Bernadette und verdrehte die Augen. Kameradschaftlich, als würden sie sich schon ewig kennen, hakten die beiden Frauen sich unter.
»Unsere Hochzeit wird am zehnten Mai stattfinden«, sagte Bernadette Furtwängler, kaum dass sie ihre Bestellung im Parkcafé aufgegeben hatten. Auf Sekt hatten sie am Ende doch verzichtet und sich stattdessen für Kaffee entschieden. »Der Sommer wäre mir lieber gewesen, aber ab Mitte Mai sind alle mit der Schafschur beschäftigt. Und danach dann auf Wanderschaft mit den Schafen.« Bernadette Furtwängler verzog den Mund. »So war das schon immer. Die verdammten Schafe bestimmen unser ganzes Leben. Was bin ich froh, wenn das ein Ende hat! Mein zukünftiger Mann ist nämlich Lehrer, musst du wissen. Dann können die Schafe mir gestohlen bleiben.«
Mimi lachte. Bernadettes Art, frei von der Leber weg zu erzählen, gefiel ihr. »Und mir können Kröten gestohlen bleiben! Aber das musst du jetzt nicht verstehen«, fügte sie hinzu.
Schon unterwegs zum Café hatte Bernadette Mimi vorgeschlagen, du zu sagen – immerhin waren sie im gleichen Alter, und das Schicksal hatte es gewollt, dass sie sich an diesem Tag über den Weg liefen. Dem hatte Mimi nichts entgegensetzen wollen.
»Dann seid ihr also Schäfer?«, nahm Mimi den Gesprächsfaden wieder auf. Dass es sich eine Hirtentochter leisten konnte, in die Stadt zu fahren, um sich ein Brautkleid anfertigen zu lassen, hätte sie nicht gedacht.
»Um Gottes willen, nein!« Das Lachen der anderen klang ein wenig hochmütig. »Uns gehört der größte Schäfereibetrieb weit und breit, wir besitzen Tausende von Schafen. Das halbe Dorf ist bei uns angestellt, wir beschäftigen Hirten, Scherer, Männer, die sich um die Zäune kümmern, und welche, die die Hütehunde ausbilden. Und wenn die Schafe lammen, kommen noch Hilfskräfte hinzu. Mein Vater ist nicht nur reich, sondern auch ein mächtiger Mann!«, sagte sie stolz. »Und er hütete mich all die Jahre wie seinen Augapfel. Das ist mir fast zum Verhängnis geworden …«
»Inwiefern?«, fragte Mimi, die spürte, dass Bernadette gern ihre Geschichte zu Ende erzählen wollte. Ihr war das nur recht – der Blick in eine ihr völlig fremde Lebenswelt lenkte sie nicht nur ab, sondern machte richtig Spaß. Außerdem – solange sie zuhörte, musste sie sich keine Gedanken über ihr eigenes Dilemma machen.
Bernadette zuckte mit den Schultern. »Die allermeisten Burschen und Männer haben ziemlichen Respekt vor Vater. Kaum einer traute sich jemals, auch nur ein Wort mit mir zu wechseln oder mich beim Schäfertanz aufzufordern, weil sie Vater nicht gegen sich aufbringen wollten. Viele Tränen habe ich deswegen vergossen, am Ende dachte ich schon, ich würde als alte Jungfer enden. Aber dann kam Michael!«, endete sie triumphierend.
Das Wort »alte Jungfer« hatte Heinrich vorhin auch in den Mund genommen, dachte Mimi. In dem Moment war sie vor Schreck fast starr geworden, doch im Nachhinein ärgerte sie sich, ihm nichts entgegnet zu haben. Dass es für ledige Frauen abfällige Begriffe gab und für Männer nicht, war wieder einmal typisch, dachte Mimi ärgerlich. Dann zwang sie sich, sich wieder auf ihr Gegenüber zu konzentrieren.
»Dein Schatz heißt also Michael«, sagte sie.
Bernadettes Strahlen war zurück. »Ja. Er ist Lehrer an unserer Dorfschule. Als der alte Lehrer starb, wurde Michael von Ulm nach Münsingen versetzt. Wir begegneten uns auf dem Wochenmarkt – es war Liebe auf den ersten Blick.« Sie seufzte auf. »Jedenfalls …«, sie drehte an dem silbernen Ring an ihrem linken Ringfinger – »hat Michael letzten Herbst um meine Hand angehalten. Als Lehrer ist er selbst eine Respektsperson, und vor Vater hat er keine Angst, ist das nicht wunderbar? Seitdem bin ich die glücklichste Frau der Welt, aber wem erzähle ich das? Du weißt ja selbst, wie sich das anfühlt …« Vertraulich drückte Bernadette Mimis Hand.
Mimi biss sich auf die Lippen. Glücklich? Glücklich war sie, wenn ihr Chef Herr Semmering sie im Fotoatelier ausnahmsweise einmal an die Kamera ließ. Glücklich war sie in der Dunkelkammer, wenn ihr beim Entwickeln der Fotografien der scharfe Geruch der Chemikalien sagte, dass die Magie, die aus Silberplatten Fotografien zauberte, eingesetzt hatte. Und glücklich war sie auch, wenn sie sonntags nach dem Gottesdienst zu einer Wanderung in den Schurwald aufbrachen. In Gottes freier Natur – da spürte sie Glücksgefühle in sich aufsteigen! Aber vorhin, bei Heinrichs Antrag, hatte sie sich mit jedem seiner Worte beklommener gefühlt. Fast so beklommen wie damals, in der Falle der Wilderer …
»Im Dorf wundern sich viele, dass ich Michaels Antrag angenommen habe. Die Leute waren wohl davon überzeugt, ich würde meinen Zukünftigen nach dem Motto ›Geld heiratet Geld‹ aussuchen. Dabei hatte Vater das schon für mich übernommen …«
»Du warst schon einem anderen versprochen?« Von solchen Dramen hatte Mimi bisher nur in Romanen gelesen.
»Na ja, versprochen nicht gerade, aber gewisse Hoffnung hat man sich wohl gemacht! Im letzten Jahr war verdächtig oft ein reicher Wollhändler bei uns zu Gast. Und immer, wenn das gemeinsame Essen zu Ende war, verließen Mutter und Vater unter irgendeinem Vorwand den Raum, damit der feine Herr Ringschmied und ich allein sein konnten. Aber da haben alle die Rechnung ohne mich gemacht! Ich heirate doch nicht einen zwanzig Jahre älteren Mann, nur weil er steinreich ist«, sagte Bernadette empört.
Mimi nickte heftig. Undenkbar! »Und wie hast du deine Eltern dann davon überzeugt, dass Michael der Richtige für dich ist?«
Bernadettes Augen waren voller Wärme und Innigkeit, als sie sagte: »Das Einzige, was zählt, ist die Liebe. Es fiel Vater nicht leicht, dies zu akzeptieren, aber mir zuliebe hat er es getan.« Sie lachte. »Seitdem ist er wie umgewandelt. Er hat zur Hochzeit das ganze Dorf eingeladen! ›Wenn meine Prinzessin heiratet, dann wird dies das Fest des Jahres!‹, sagt er immer wieder. Wein und Bier sollen in Strömen fließen, und Lammbraten für alle wird es geben. Und ich wünsche mir einen großen Tisch mit allen möglichen Kuchen und Torten zum Dessert …« Schwärmerisch seufzte Bernadette auf. »Und danach bin ich endlich Michaels Frau. Ich kann es kaum erwarten.«
Welche Innigkeit aus Bernadettes Worten sprach, welches Glück! Bevor Mimi wusste, wie ihr geschah, schossen ihr Tränen in die Augen.
»Um Gottes willen, was ist denn? Habe ich etwas Falsches gesagt?« Entsetzt reichte die Schäfereitochter Mimi ein spitzenbesetztes Taschentuch.
Mit nassen Augen nahm Mimi es entgegen. Sie schnäuzte sich geräuschvoll, dann sagte sie: »Es liegt nicht an dir. Es ist nur so … Auch wenn ich wollte – ich kann nicht heiraten!«
3. Kapitel
Schluchzend weihte Mimi die Fremde in ihre Nöte ein. Und obwohl sie sich selbst ihrer Sache so sicher war, verstand Bernadette Mimis Zweifel. Helfen konnte sie ihr jedoch auch nicht. Dennoch empfanden beide ihre Begegnung als fast schon schicksalhaft und trennten sich später entsprechend ungern. Irgendwann, irgendwo würden sie sich wiedersehen, versprachen sich die beiden jungen Frauen. Dann wünschten sie sich gegenseitig alles Gute.
Mit schwerem Herzen lief Mimi in die Esslinger Oberstadt hinauf. Daheim angekommen, empfingen ihre Eltern sie mit erwartungsvollem Blick. Vor allem ihre Mutter sah aus, als würde sie vor Aufregung und Ungeduld fast platzen. Wussten sie etwa schon Bescheid?, argwöhnte Mimi. Es würde Heinrich ähnlich sehen, dass er zuerst mit ihren Eltern und danach erst mit ihr gesprochen hatte, auch wenn er ihr gegenüber etwas anderes behauptet hatte.
Doch weder ihre Mutter noch ihr Vater machten eine entsprechende Bemerkung, und auf einmal war sich Mimi ihrer Sache nicht mehr sicher. Mit der Entschuldigung, dass sie Kopfweh habe – was nicht einmal gelogen war –, zog sie sich in ihr Zimmer zurück.
Heinrich und sie als Mann und Frau. Esslingen adieu! Kein Fotoatelier mehr, keine Dunkelkammer. Begraben auch all ihre Träume vom Fotografieren. Dafür ein heruntergekommenes Haus in Schorndorf und die Pflichten einer Ehefrau und Mutter. War das das Leben, das sie wollte? Immer und immer wieder kreisten Mimis Gedanken um diese Frage.
Die Dämmerung brach herein, unten im Haus war das Scheppern von Geschirr zu hören. Vaters Lachen und der Duft von Bohnensuppe mit Maggikraut zogen durchs Haus. Mimis Magen knurrte, als wolle er sich in Erinnerung bringen. Seit dem Frühstück hatte sie nichts mehr gegessen. Einen Moment lang war sie versucht, nach unten zu gehen und am Abendessen teilzunehmen. Doch dann würde sich das Gespräch gewiss Heinrichs Antrag zuwenden, schlimmer noch – womöglich würde Heinrich mit am Tisch sitzen, wie er es am Wochenende so oft tat.
Ihr Vater würde ihr wie so oft sagen, dass er in seinem gewissenhaften, ehrgeizigen Vikar sich selbst in jungen Jahren sah. In seinen Augen war Heinrich bestimmt der geeignetste Schwiegersohn, und die Tatsache, dass sie noch nicht ja gesagt hatte, würde bei ihm auf Unverständnis stoßen.
Und ihre Mutter würde ihr von den Pflichten vorschwärmen, denen sich eine Pfarrersgattin hingebungsvoll zu widmen hatte. Wahrscheinlich würde Amelie Reventlow mit ihrem weiten Wohltätigkeitsnetz längst jeden einzelnen Bedürftigen in Schorndorf mit Namen benennen können, dachte Mimi in einem Anflug von Bitterkeit. Darauf konnte sie nun wirklich verzichten!
Und wenn sie verhungerte – sie würde erst dann wieder ihr Zimmer verlassen, wenn sie eine Lösung für ihr Problem gefunden hatte, beschloss Mimi. Resolut kramte sie in ihrer Handtasche nach der Tafel Schokolade, die Herr Semmering ihr am Morgen zum Geburtstag geschenkt hatte. Am Morgen … Mimi kam es vor, als sei es in einem anderen Leben gewesen. Vorsichtig wickelte sie die Schokolade aus dem Stanniolpapier und brach eine Rippe ab.
Heinrich sah ihre gemeinsame Zukunft glasklar vor sich, dachte sie, während die Schokolade langsam in ihrem Mund schmolz. Dass er nicht auch noch die Anzahl ihrer zu erwartenden Kinder genannt hatte, war erstaunlich. Was sie von all seinen Plänen hielt, schien ihn hingegen nicht zu interessieren. Vielmehr ging er davon aus, dass sie überglücklich war und seinen Heiratsantrag als Fügung Gottes betrachtete.
Warum nur wollte ihr das nicht gelingen? Warum konnte sie nicht ein bisschen sein wie Bernadette, die stolz mit ihrem Brautkleid auf die Schwäbische Alb zurückfuhr und es nicht erwarten konnte, vor den Altar zu treten? Dann würde ihr Vater die Hochzeitspredigt schreiben und ihre Mutter selig alles organisieren können.
Um drei Uhr nachts hatte Mimi noch immer kein Auge zugetan. Eigentlich ist Onkel Josef an allem schuld, dachte sie wütend, und ihr Magen knurrte zustimmend. Ohne ihn wäre sie vielleicht eine »ganz normale« junge Frau wie Bernadette und die meisten anderen. Dann hätte sie schon seit Jahren von einem Hochzeitsantrag geträumt und wäre entsprechend glücklich über den Verlauf des heutigen Tages gewesen. Tatsächlich war es jedoch so, dass sie jeden Gedanken an eine Eheschließung bisher einfach vor sich hergeschoben hatte. Sie wollte als Fotografin doch noch so viel lernen!
Froh, in Onkel Josef endlich einen Sündenbock gefunden zu haben, schob sie sich das letzte Stück Schokolade in den Mund.
Josef Stöckle. Er war der ältere Bruder ihrer Mutter und einer der ersten Wanderfotografen überhaupt. Gutaussehend, wanderlustig, mutig. Ein verwegener Bursche, der es gut mit den Leuten konnte. Ein Zauberer hinter der Kamera! Ein Meister seines Fachs. Er hatte die Liebe zur Fotografie in Mimi geweckt. Und dank ihm hatte sie am Ende als eine der ersten Frauen überhaupt den Beruf der Fotografin erlernen dürfen. Ihre Eltern waren entsetzt gewesen, als sie ihren Berufswunsch geäußert hatte. Der größte Wunsch ihrer Mutter war nämlich, dass sie, Mimi, in Amelie Reventlows Fußstapfen trat und sich um andere Menschen kümmerte. Lehrerin sollte Mimi werden! Oder besser noch Ärztin, falls dies eines Tages den Frauen erlaubt sein würde. Zur Not hätte die Mutter sich auch mit Mimi als Missionarsgattin zufriedengegeben. Doch aufgrund eines alten Schwurs, in den auch Onkel Josef verwickelt gewesen war, hatte ihre Mutter sich am Ende verpflichtet gefühlt, Mimis außergewöhnlichem Berufswunsch nachzugeben.
So gesehen hatte kein anderer Mensch ihr Leben derart beeinflusst wie Josef, dachte Mimi. Dabei lebte er nicht einmal in ihrer Nähe! Mit seinem mobilen Fotoatelier, das in einem großen Pferdekarren untergebracht war, kam er nur wenige Male im Jahr hier in Esslingen vorbei.
Auf Mimis Miene erschien ein leises Lächeln, als sie an Josefs »Sonnenwagen« dachte – schwarz lackiert und mit einer goldenen, aufgemalten Sonne in der Mitte. Sie hätte Josefs Gefährt unter Tausenden von Kutschen wiedererkannt!
Wenn der Onkel in der Stadt war, hatte er meist viel zu tun. Irgendetwas war immer zu erledigen, manchmal war es ein Arztbesuch, und sein Pferd ließ er auch am liebsten vom Esslinger Hufschmied beschlagen. Trotzdem hatte er sich stets alle Zeit der Welt für sie genommen. Seine Besuche waren immer wie ein Fest für sie gewesen. Bis auf das eine Mal – sie war erst sieben –, als Onkel Josef auf sie hätte aufpassen sollen. Damals war so ziemlich alles schiefgegangen. Später hatte sich das als Glück entpuppt! Aber zu diesem Zeitpunkt, oje, da war die Hölle los gewesen! Bevor Mimi sich versah, war sie weit weg in Zeit und Raum …
4. Kapitel
Esslingen, im Oktober 1886
Warum konnten die Leute nicht ein bisschen vorsichtiger über den rot-gelben Blätterteppich laufen? Verständnislos schaute die siebenjährige Mimi zu, wie die Magd Rosa eine schwere grüne Girlande Richtung Pfarrhausgarten schleifte. Auf das bunte Laub der Ahornbäume und Buchen, das den Boden bedeckte, nahm sie genauso wenig Rücksicht wie alle andern. Jeder schlurfte über den gelb-roten Teppich, zertrat die feinen Blättchen, bis sie zu braunem Matsch wurden. Dabei sahen die vielen Farbtöne so wunderschön aus!
Die Pfarrerstochter ging in die Hocke und nahm eins der Blätter auf. Andächtig strich sie mit dem Zeigefinger ihrer rechten Hand die feinen Adern nach, die das ockerfarbene Ahornblatt durchzogen. Es war so schön, dass alle Jahre im Herbst die Blätter wie Schnee von den Bäumen rieselten! Mimi lächelte.
Im nächsten Moment ließ sie das Blatt fallen. Endlich! Da hinten war ihre Mutter! Die suchte sie schon seit einiger Zeit. Aber wie so oft war Amelie Reventlow beschäftigt. Heute war die Armenspeisung zum Kirchweihfest, die sie immer am dritten Sonntag im Oktober im Pfarrgarten ausrichtete. Seit Mimi denken konnte, gab es diese Veranstaltung. »In vielen Häusern der Altstadt, allen voran in denen der Webergasse, herrschen Armut und Hunger. Jemand muss diesen armen Menschen helfen«, hatte die Mutter ihr erklärt. Und angefügt, dass Mimi viel von der Mutter lernen konnte, um später selbst auch Gutes tun zu können.
Mimi wollte natürlich auch, dass die hungrigen Menschen Brot und Suppe bekamen. Aber manchmal war das Leben so spannend, dass sie ein wenig abgelenkt wurde von all den Wohltätigkeiten. So wie heute. Vorsichtig ertastete Mimi den Inhalt ihrer Rocktasche. Erleichtert darüber, dass ihr Schatz noch da war, schaute sie auf. Oje, nun war die Mutter schon wieder weg!
»Ist die Suppe noch immer nicht fertig?«, ertönte durch das offene Küchenfenster im nächsten Moment ihre laute Stimme.
Mimis Miene erhellte sich, sie rannte ins Haus. »Mutter! Mutter!«
»Mimi, mein Kind …«, sagte die Mutter abwesend, während sie Elke Bieringer, der Pfarreiköchin über die Schulter schaute.
»Schau mal, was ich gefunden habe …« Stolz hielt Mimi ihrer Mutter die fette Larve hin, die sie am Morgen inmitten des bunten Herbstlaubes entdeckt hatte. »Das wird bestimmt mal ein ganz besonders schöner Schmetterling …«, sagte sie andächtig. Sie konnte ihn im Geist schon vor sich sehen. Er würde blaue und hellgelbe Flügel haben, vielleicht mit ein paar roten Sprenkeln. »Hast du einen alten Karton für mich? Ich möchte meinem Schmetterling einen schönen Käfig bauen.«
»Es gibt keine schönen Käfige«, sagte die Mutter barsch. »Leg das Tier wieder dorthin zurück, wo du es gefunden hast. Nur in einem freien Umfeld können Raupen sich zu einem schönen Schmetterling entpuppen. Das ist übrigens bei Menschen nicht anders!« Die Türklinke schon in der Hand, schaute die Mutter Mimi streng an. »Was machst du eigentlich hier? Hab ich nicht gesagt, du sollst bei Onkel Josef bleiben? Dann bist du wenigstens nicht im Weg, wenn fleißige Menschen ihre Arbeit tun!«
Mit belämmertem Gesichtsausdruck stand Mimi da. Sie war doch niemandem im Weg! Und warum durfte sie das Tierchen nicht behalten?
Die Köchin, die gerade Petersilie klein hackte, schaute seufzend auf das Kind. »Hat wieder niemand Zeit für dich? Komm mal mit«, sagte sie dann und nickte in Richtung Speisekammer.
»Hast du ein Kistchen für mich?« Erfreut folgte Mimi der Köchin.
»Das nicht, aber einen Keks kannst du haben.« Die Köchin stellte sich auf die Zehenspitzen, um die Keksdose vom höchsten Regalboden herunterzuholen. »Da, einer mit Nüssen. Und bring deinem Onkel auch einen mit!«
Ob der Raupe ein paar Brösel davon schmecken würden? »Danke« murmelnd nahm Mimi die Kekse in die linke Hand. In der rechten hielt sie immer noch die Raupe.
Elke Bieringer zupfte stirnrunzelnd an Mimis Ärmel, wo der Stoff so dünn war, dass man die Haut sehen konnte. »Das muss geflickt werden. Und dann dein Rock! Ganz dreckig ist der. Bist du schon wieder auf den Knien herumgekrochen? Ach Mädchen, du läufst herum wie ein Lumpensammlerkind! Kein Wunder, dass deine Frau Lehrerin deswegen einen Brief geschrieben hat.«
»Aber so sehe ich doch immer aus«, sagte Mimi arglos.
»Genau das ist ja der Jammer …« Die Köchin strich Mimi ein letztes Mal über den Kopf und murmelte: »Die armen Kinder in Afrika, die Armenpflege in der Stadt, die neue Wohltätigkeitskasse für Härtefälle … Um alles kümmert sich die Dame des Hauses. Dabei wäre es wirklich einmal an der Zeit, dass sie ihre christlichen Wohltätigkeiten ihrer Tochter zugutekommen lassen würde!«
Die Raupe wieder in der Tasche verwahrend, spazierte Mimi durch den hinteren Gartenteil. Im Gegensatz zum Vorgarten, wo die Armenspeisung stattfinden sollte, war es hier still. Das Krächzen einiger Raben war zu hören und der monotone Schlag eines Schmiedehammers, der auf Eisen traf. War der Hufschmied da, um Onkel Josefs Wallach Gustl zu beschlagen? Mimis Miene hellte sich auf. Der Hufschmied konnte fast so spannende Geschichten erzählen wie der Onkel!
Mimi rannte auf den Karren zu, der am Ende des Gartens stand. »Wanderfotograf Josef Stöckle« stand darauf. In Mimis Augen sah der Karren aus wie ein Gefährt aus einem Märchen. Dazu passte auch der Name, den ihr Onkel ihm gegeben hatte: Sonnenwagen!
»So, Gustl, jetzt können wir getrost wieder losziehen.« Zufrieden klopfte Josef Stöckle seinem Pferd den Hals. Dann kramte er ein paar Münzen aus der Tasche und reichte sie dem Hufschmied, der dabei war, seine Siebensachen in seinem Karren zu verstauen. »Danke, dass Sie so kurzfristig Zeit für mich hatten. Aber ohne ein neues Eisen hätte ich unmöglich auf die Reise gehen können.«
Die Männer verabschiedeten sich freundschaftlich.
»Du fährst nochmals weg? Ich dachte, du bleibst den Winter über hier …« Mimi hatte Mühe, nicht vor Enttäuschung loszuheulen.
»Es ist ja noch lange kein Winter! Bis dahin werde ich Schwäbisch Hall einen Besuch abstatten. Rund um die Salinen gibt es viele kleine Orte, in denen noch immer kein Fotograf ansässig ist. Die Leute sind froh, wenn ich komme und ihnen ein bisschen Abwechslung von ihrem Alltag verschaffe. Mit meinen Fotografien können sie die kahlen Wände in ihren Wohnungen verschönern. Ein Wanderfotograf ist immer gern gesehen, mein Kind.«
Mimi nickte bekümmert. »Aber du bist erst seit zwei Wochen hier! Den ganzen Sommer über warst du weg«, sagte sie.
»Kind, als Wanderfotograf bekomme ich das Geld nicht geschenkt! Ich muss unterwegs sein, um arbeiten zu können«, sagte der Onkel lachend. »Außerdem muss ich den Menschen doch Schönheit schenken, verstehst du?«
Mimi nickte. Aber verstehen und akzeptieren zu können waren zwei Paar Schuhe. »Die Mutter hat gesagt, du sollst auf mich aufpassen«, sagte sie trotzig.
»Nichts lieber als das!«, antwortete ihr Onkel und strich ihr über den Kopf. »Ich bin beim Retuschieren, dabei schaust du mir doch immer so gern zu. Los, komm mit rein!«
Mimis Augen leuchteten auf. Erwartungsvoll folgte sie dem Onkel ins Innere des Wagens. Wie aufregend es hier roch! Nach den gemalten Leinwänden, die der Onkel als Hintergründe für seine Fotografien verwendete. Nach den Chemikalien, mit denen er seine Fotografien entwickelte. Nach den viel getragenen Zylinderhüten, die er mit Gummibändern an der Innenwand befestigte, damit sie während der Fahrt nicht durcheinanderpurzelten. Auf dieselbe Weise hatte der Onkel auch Sonnenschirme aus Spitze und Fächer an der Wand befestigt, aber sie rochen nicht.
Die Zylinder brauchte der Onkel für »Feine-Herren-Fotografien«, wusste Mimi. Die Fächer und Sonnenschirme hingegen waren für »Feine-Damen-Fotografien« bestimmt. Dabei seien die Damen manchmal gar nicht so fein, hatte der Onkel einmal erzählt. Aber wenn es darauf ankam, könne er aus jeder Bäuerin ein Edelfräulein machen!
Mimi überlegte, ob sie sich mit Fächer und Schirm selbst in Pose stellen sollte. Doch dann folgte sie ihrem Onkel in die kleine Dunkelkammer, die er im vorderen Wagenteil eingerichtet hatte und die durch eine schwarze Klapptür vom Rest des Wagens abgetrennt war.
»Was arbeitest du gerade?« Wie immer, wenn sie in das geheimnisvolle Dunkel trat, begann Mimi unwillkürlich zu flüstern.
»Das ist eine Fotografie von eurer Nachbarin Käthchen und ihrem Mann Karl, die beiden hatten letzte Woche Silberhochzeit.« Josef Stöckle lehnte sich zurück, um seiner Nichte den Blick auf die in einen Rahmen eingespannte Glasplatte zu ermöglichen. Das Silber-Brautpaar stand aufrecht und streng dreinblickend vor einer steinernen Balustrade. Die Balustrade war nicht echt, erkannte Mimi sogleich, sondern von ihrem Onkel auf eine Leinwand gemalt worden.
Josef Stöckle tippte auf die Glasplatte. »Na, erkennst du eure Nachbarn?«
»Ja!« Mimi lachte. »Der dicke Bauch von Herrn Wiedemann!« Wie der Höcker eines Kamels stand der Bauch heraus. Solche Bäuche kämen vom vielen Biertrinken, hatte ihre Mutter einmal abfällig zum Vater gesagt, als sie glaubte, Mimi sei mit einem Bilderbuch beschäftigt und würde nichts hören. Und dass er aufpassen solle, nicht auch so einen Bauch zu bekommen.
»Den Bauch haben wir gleich weg!« Vorsichtig begann der Onkel mit einer Art Messer auf der Glasplatte zu schaben. Karl Wiedemann wurde schlanker und schlanker. »So, das reicht, wir wollen es ja nicht übertreiben«, sagte der Onkel mit einem prüfenden Blick. »Aber wo wir einmal dabei sind …« Schon machte er sich an Käthchens Wangen zu schaffen.
Fasziniert schaute Mimi zu, wie die Gesichtszüge der Nachbarsfrau immer feiner wurden.
»Die Menschen wollen schön sein! Also mache ich sie schön«, erklärte der Onkel. »So, und jetzt muss ich mich auf meine Arbeit konzentrieren. Am besten setzt du dich so lange draußen auf die Stufe vom Wagen.«
5. Kapitel
Langweiliger ging es ja wohl nicht, dachte Mimi mürrisch, nachdem sie eine halbe Ewigkeit auf der Treppenstufe des Sonnenwagens gesessen hatte. Die Herbstsonne schien nun direkt in diesen Teil des Gartens, ihr war warm und der Raupe ebenfalls! Es war höchste Zeit, dass sie ihr ein gemütliches Zuhause bereitete, beschloss Mimi, ganz gleich was die Mutter sagte. Sie lauschte ein letztes Mal in den Wagen, wo der Onkel leise vor sich hin pfiff, wie immer, wenn er konzentriert bei der Arbeit war. Das konnte noch Stunden so gehen wusste Mimi aus Erfahrung. Er würde sie so schnell bestimmt nicht vermissen! Rasch schlüpfte Mimi durchs hintere Gartentor hinaus in Richtung Wald. Einen Karton oder ein Kistchen würde sie schon noch auftreiben – jetzt wollte sie erst einmal für die Inneneinrichtung sorgen. Die Raupe sollte es genauso schön haben wie Onkels Kunden. Eigentlich hatte die Mutter ihr ja verboten, in den Wald zu gehen, weil es dort Wilderer und andere böse Menschen gab. Mimi kniff die Augen zusammen. Auch so ein unsinniges Verbot, hier war doch niemand! Dafür entdeckte sie am Wegesrand ein leeres Schneckenhaus. Wenn sie jetzt noch etwas Moos und ein paar schöne Blätter fand, würde die Raupe sich wohl fühlen und sicher noch viel schneller zu einem schönen Schmetterling werden.
Froh stapfte Mimi weiter.
Dunkelbraune Eicheln, Kastanien, eine lustig geformte Wurzel … Mimi schaute auf die Schätze in ihrer Schürze. Das würde für das Raupen-Zuhause reichen! Sie hatte den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, als sie spürte, wie der Boden unter ihr nachgab und ihr rechter Fuß immer tiefer einsank. Sie stieß einen Schrei aus, doch da öffnete sich der Boden schon vollends unter ihr, und sie stürzte in die Tiefe.
Ihr Arm tat weh. Und schlecht war ihr auch. Schlecht im Kopf. Beides – Arm und Kopf – hatte sie sich gestoßen bei dem Sturz.
Blinzelnd versuchte Mimi, sich zu orientieren. Um sie herum war nur Erde. Es war kalt und dunkel. Und es roch seltsam.
Sie hatte das Erdloch beim Laufen nicht gesehen, Blätter hatten den Boden bedeckt. Wie kam solch ein Loch mitten in den Weg? Dann fiel ihr ein, dass sie vom Weg abgegangen war, auf der Suche nach einer schönen Wurzel. Unwillkürlich tastete sie in ihrer rechten Rocktasche nach der Made. Sie war noch da, und sie bewegte sich noch.
Mimi holte tief Luft. Sie musste zusehen, dass sie beide schleunigst wieder herauskamen aus diesem Loch! Nur – wie sollte sie das anfangen? Die Wände bestanden aus verschiedenen Schichten, erkannte sie, nachdem sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Ganz oben, von wo sie gestürzt war, war die Erde tief braun. Mutterboden nannte man diese Schicht, hatte Köchin Elke ihr einmal erklärt, als sie im Garten zusammen gewerkelt hatten. Mit Mühe unterdrückte Mimi einen Schluchzer. Sie wollte nach Hause …
Nach unten hin wurden die Erdschichten immer heller. Hier und da konnte Mimi ein paar Steine im Erdreich erkennen. Wie Augen, die sie aus der Erdwand heraus anstarrten. Keine Farben, nur Braun – hier unten war es hässlich!, befand Mimi. Beherzt versuchte sie, an der Erdwand Halt zu finden, doch immer wieder rutschte ihr rechter Fuß ab. Prüfend schaute sie sich um. Gab es irgendwo etwas, worauf sie ihren Fuß stellen konnte? Sie versuchte es auf einem der aus der Erde ragenden Steine, doch er purzelte heraus und fiel auf ihren Fuß. Mimi biss sich auf die Unterlippe. Allein kam sie hier nicht heraus.
Hilfe! Sie musste um Hilfe rufen!
»Hilfe! Hilfe …«
»So langsam weiß ich nicht mehr, wo wir noch suchen sollen«, sagte der Hauptmann der Esslinger Gendarmerie zu dem guten Dutzend Leute, das im Garten der Pfarrei zusammenstand. »Jeden Keller, jede Scheune haben wir durchgekämmt. Nicht nur in der ganzen Nachbarschaft, sondern im halben Ort!« Seine Worte bildeten in der kalten Luft des Oktobermorgens kleine Wölkchen, bevor sie sich verflüchtigten.
Die Versammelten hörten bedrückt zu. Keiner wusste etwas zu sagen. Es war Montagfrüh, seit gestern war die Pfarrerstochter nun schon fort, verschwunden wie die sprichwörtliche Stecknadel im Heuhaufen.
»Und wenn wir einfach alles nochmal überprüfen?«, sagte ein junger Gendarm, der von der ersten Stunde an bei der Suche dabei gewesen war. Wie seine Kollegen hatte er seitdem nicht geschlafen, seine Augen waren gerötet und winzig klein. Doch außer der Erschöpfung stand auch der ungebrochene Wille, das Kind zu finden, in ihnen geschrieben.
»Nein, eine neuerliche Suche an denselben Stellen macht keinen Sinn.« Kopfschüttelnd schaute der Hauptmann in die Ferne.
Dutzende von Freiwilligen hatten sich an der Suche nach der vermissten Pfarrerstochter beteiligt. Die Eltern selbst, der Onkel, die Bediensteten und fast die ganze Kirchengemeinde hatten nach ihr gesucht. Wann genau das Kind verschwunden war, hatte keiner aus der Familie sagen können. Amelie Reventlow hatte ihre Tochter beim Bruder gut aufgehoben gewähnt, während Josef geglaubt hatte, das Kind sei zum Haus zurückgegangen.
»Keiner von uns kennt Gottes Plan. Aber was uns bleibt, ist unser Gottvertrauen«, sagte Pfarrer Franziskus, doch seine sorgenvolle Miene strafte seine Worte Lüge.
»Gottes Plan?«, wiederholte Amelie Reventlow aufgelöst. »Gott kann doch nicht wollen, dass ein Kind einfach so verlorengeht!« Aufschluchzend verbarg die Pfarrersfrau ihr Gesicht in beiden Händen. »Eins schwör ich dir«, sagte sie unter Tränen, »wenn Mimi gefunden wird, werde ich alles daransetzen, dass es ihr nie mehr an irgendetwas mangelt – Gottes Plan hin oder her!«
Betroffenes Schweigen stellte sich ein. Was, wenn die Mutter nicht mehr dazu kam, ihren Schwur auszuführen?
Der junge Gendarm räusperte sich verlegen. »Ich kenne jemanden, dessen Hund hat die beste Spürnase weit und breit. Vielleicht würde der das Kind aufspüren?«
»Jemand?«, sagte der Hauptmann der Garde spöttisch. »Sag doch gleich, dass du einen dieser gemeinen Wilderer meinst! Als ob diese Lumpen mit uns zusammenarbeiten würden! Denen geht es doch nur um ihre reiche Beute.« Der Hauptmann schnaubte verächtlich.
»Lasst uns besser in die Kirche gehen und Gott um seine Hilfe bitten«, sagte Pfarrer Franziskus Reventlow mit auffordernder Miene.
Während sich der Hauptmann und sein Gefolge wieder auf den Weg machten, folgten die Gemeindemitglieder dem Pfarrer in die Kirche. Nur der junge Gendarm blieb nachdenklich zurück.
Mimi wusste nicht, wie lange sie schon in der Grube saß, sie hatte jegliches Zeitgefühl verloren. War es ein Tag? Ein Monat? Ein Jahr? Angst, Verzweiflung, aber auch immer noch die Zuversicht, dass alles gut werden würde, rüttelten an ihr wie ein Herbststurm an den Fensterläden eines Hauses. Ein Wunder. Etwas anderes würde ihr nicht helfen.
Dunkel war es hier drinnen. Fast so dunkel wie in Josefs winziger Dunkelkammer im Sonnenwagen. Hunger und Durst hatte sie. Und kalt war es! Eine Jacke trug sie nicht, die Sonne hatte doch geschienen, als sie losgegangen war! Die Kälte war unangenehm, aber noch schlimmer war der Durst. Ein Glas Limonade. Oder ein heißer Pfefferminztee – Mimi hätte alles dafür gegeben. Stattdessen fuhr sie mit dem Zeigefinger der rechten Hand an der Erde entlang, um einen Hauch von Feuchtigkeit aufzusammeln. Die wenigen Spuren von Wasser schleckte sie gierig ab. Irgendwann musste sie pieseln, doch sie hielt so lange zurück, bis ihr die Nieren wehtaten. Erst dann hockte sie sich in eine Ecke der Grube und ließ Wasser. Was, wenn sie groß musste?
Was, wenn nicht ein Wunder geschah? Die Mutter hatte immer so viel zu tun, wahrscheinlich würde ihr gar nicht auffallen, dass sie fehlte. Oder?
Mimi kam ein Gedanke. Dem lieben Gott – dem würde es auffallen! Er war immer für sie da, ganz gleich ob sie wach war oder schlief. Also war er auch hier im Wald bei ihr. Sie war nicht allein.
Die Erkenntnis machte Mimi froh und ruhig. Und mit der Ruhe überkam sie noch etwas anderes: das plötzliche Gefühl, von etwas sanft gehalten zu werden. Etwas ganz Leichtem, Zartem. War es ein Engelsflügel, der sie vom kalten Erdboden hob und wärmte? War es Gottes Hand, die sie einhüllte wie in den wärmsten Wintermantel?
Die Arme gegen die Kälte um ihren Leib geschlungen, lächelte Mimi. Weder dem lieben Gott noch seinen Engeln machte so ein kleiner Umweg, wie sie ihn im Wald genommen hatte, etwas aus! Das Wunder würde geschehen. Mit diesem Gedanken schlief Mimi ein.
Es war kein Engelsgesang, der Mimi weckte, sondern das schrille Kläffen eines Hundes. Etwas scharrte oben an ihrem Gefängnis, Erde rieselte auf sie herab, aufgeregtes Japsen und Fiepen war zu hören. Im nächsten Moment schaute Mimi in die bernsteinfarbenen Augen eines mageren Hundes. Sein Speichel tropfte auf sie herab.
»Der Hund hat das Kind gefunden!«, hörte sie einen Mann rufen. Im nächsten Moment sprang er zu ihr nach unten in die Grube, hob sie hinauf, wo Onkel Josef sie in seine Arme schloss.
»Kind, ich bin fast gestorben vor Angst um dich!« Mimi, verwirrt und müde, sah über Josefs Schulter hinweg, wie ein weiterer Mann und der Hund eilig im Wald verschwanden.
Lachend und weinend zugleich trug Onkel Josef sie nach Hause, wo Elke sofort eine heiße Suppe auf den Herd stellte. Vater und Mutter schlossen sie in die Arme. »Gott sei Dank, ich hatte solche Angst um dich«, flüsterte der Vater in ihr Ohr.
Mimi, hungrig und verfroren wie sie war, schaute ihn erstaunt an. »Wieso hattest du Angst? Der liebe Gott war doch bei mir. Er begleitet uns auf allen Wegen, das sagst du selbst immer.«
Vaters Augen glänzten, als er sie anschaute. »Mein liebes Kind, an dir können wir uns ein Beispiel nehmen, du bist mutiger und gottestreuer als wir alle zusammen!«
Mimi runzelte die Stirn. »Was habe ich denn Mutiges getan? Zu sterben wäre doch dumm gewesen. Ich will den Menschen Schönheit schenken, so wie Onkel Josef es tut! Und dafür muss ich doch irgendwann mal Fotografin werden.«
Ihre Mutter schaute den Vater kopfschüttelnd an. »Hörst du das? Mimi fühlt sich von Gott berufen, den Menschen Schönheit zu schenken!« Tränen liefen ihr über die Wangen, sie nahm Mimi erneut in den Arm und schluchzte: »Wenn das später immer noch dein großer Traum ist, dann sorge ich dafür, dass er wahr wird. Und wenn ich eigenhändig sämtliche Fotoateliers der Gegend abklappern muss, um einen Lehrherrn für dich zu finden!«
Mimi lächelte in die Stille ihres Schlafzimmers hinein. Selbst nach all den Jahren konnte sie immer noch kaum glauben, welche Wandlung ihre Mutter von einem Tag auf den andern vollzogen hatte. Amelies hehre Reden davon, dass Mimi als privilegierte Pfarrerstochter dazu verpflichtet war, ein wohltätiges Leben im Dienste der Armen zu führen, waren vorbei gewesen. Fortan hatte sie Blumen pflücken dürfen, malen, basteln und träumen, ohne dass die Mutter sie wegen ihres »Müßiggangs« rügte.
Mimi hatte damals etwas erkannt: dass ihre Mutter sie liebte. Was für ein schönes Gefühl. Ja, manchmal musste Schlimmes geschehen, um Gutes nach sich zu ziehen. Längst war Mitternacht vorbei. Sie hatte noch nie eine ganze Nacht durchwacht, dachte Mimi. Irgendwie war dies etwas ganz Besonderes … Sie kuschelte sich unter ihre Bettdecke. Am Abend hatte sie die Vorhänge nicht vorgezogen, und so konnte ihr Blick ungestört aus dem Fenster in die dunkle Winternacht hinauswandern. Das matte Schwarz tat ihrem aufgewühlten Geist gut. Zum ersten Mal seit Heinrichs Antrag verspürte sie eine innere Ruhe. Vielleicht war es jetzt wie damals?
Als kleines Kind hatte sie Angst im Dunkeln gehabt. Doch Onkel Josef hatte sie gelehrt, dass es rabenschwarz sein musste, wenn ein Fotograf die Glasplatte in der Kamera austauschte. Deshalb warf er sich bei diesem Vorgang stets ein tiefschwarzes Tuch über. Würde auch nur ein Fünkchen Licht die Glasplatte treffen, wäre sie für immer unbrauchbar! Probeweise war auch Mimi einmal unter ein solches Tuch gekrochen. »Wenn man nichts sieht, muss man umso besser fühlen«, hatte der Onkel ihr erklärt. Mit diesem Wissen hatte Mimi die Dunkelheit zu schätzen gelernt.
Ihr Blick wanderte zurück ins Zimmer. Als Onkel Josef ihr eine ausrangierte, weil zerschlissene Leinwand schenkte, hatte sie sich damit hier in ihrem früheren Kinderzimmer ihr eigenes »Fotoatelier« eingerichtet. Ihre Puppen waren fortan die Kunden gewesen, ihr Kindertisch und das kleine Stühlchen hatten ihr als Requisiten gedient. Aus abgebrochenen, zusammengebundenen Besenstielen und einem großen Karton, in den sie vorn und hinten Gucklöcher schnitt, hatte sie sich eine Kamera gebastelt. Als ihre Mutter Mimis »Kamera« zum ersten Mal sah, war sie mit wehenden Röcken davongerannt. Mimi erinnerte sich genau, welche Angst sie gehabt hatte, dass die Mutter ihr das Lieblingsspiel wieder verbot! Doch kurz darauf war Amelie Reventlow zurückgekommen. Triumphierend hatte sie ein schwarzes Tuch in die Höhe gehalten. »Das brauchst du doch, damit du deine Trockenplatten austauschen kannst!«, sagte sie augenzwinkernd und befestigte das Tuch am hinteren Ende von Mimis Kamera. Mimi war im siebten Himmel gewesen. Dass aus dem Unglück im Wald so viel Gutes erwachsen würde, hätte sie nie geglaubt.
Halb wach, halb im Schlaf, gab sich Mimi wieder ihren Erinnerungen hin …
»Ganz gleich welchen Berufswunsch du verfolgst – mit dem Abitur in der Tasche wird dir alles leichter fallen«, hatte die Mutter verkündet, als Mimi 1896 mit dem Abschluss der Höheren Töchterschule nach Hause gekommen war. »Heutzutage haben Frauen so viele Möglichkeiten, es wäre eine Schande, wenn du sie dir nicht zumindest offenhältst.« Amelie Reventlow wedelte mit einem Zugticket nach Berlin in den Fingern. »Leider ist unser schönes Württemberg in dieser Beziehung noch immer sehr rückständig. Aber in Berlin gibt es das Luisengymnasium, auf dem auch junge Frauen das Abitur machen dürfen. Was hätte ich als junges Mädchen für so eine Chance gegeben!«
»Aber Mutter! Ich dachte, es war ausgemacht, dass ich nach der Schule eine Fotografenlehre beginne«, hatte Mimi entsetzt erwidert. »Du wolltest mir sogar helfen, einen Lehrherrn zu finden!«
»Dabei bleibt es auch, versprochen ist versprochen. Aber zuerst machst du Abitur«, hatte Amelie Reventlow eisern entgegnet. »Deine Tante Josefina in Berlin hat schon ein Zimmer für dich hergerichtet. Sie erwartet dich Ende des Monats. Und wir sehen in drei Jahren weiter!«
Mimi war fassungslos gewesen. Wie beiläufig Mutter das sagte! Als handele es sich um einen Wochenendbesuch bei der Tante.
»Vater, jetzt sag doch auch mal was!«, hatte sie ihren Vater angefleht. »Willst du mich wirklich in die Verbannung schicken?«
»Meine Schwester freut sich so auf dich, Kind. Und dem lieben Gott gefällt es, wenn Menschenkinder ihren Geist zum Lernen benutzen. Ein bisschen Aufschub wird dein großer Traum doch noch vertragen.« Er hatte sie so wohlwollend angeschaut, als sei sie eins seiner verirrten Gemeindeschäfchen.
Verzweifelt hatte Mimi sich Onkel Josef, der zufällig zu Besuch gewesen war, zugewandt. »Aber zum Fotografieren ist ein Abitur doch völlig unnötig, oder?«
Doch statt sie zu unterstützen, hatte der Onkel ihr lediglich augenzwinkernd zugeraunt: »In Berlin gibt es viele Fotoateliers. Wenn du freie Zeit hast und einmal nicht lernen musst, kannst du dir anschauen, was die Konkurrenz so treibt. Und ganz bestimmt lernst du, wie man eine feine Dame wird! Ich wette mit dir, die Berliner Jahre werden dir nur guttun.«
Aufs Wetten hatte sie damals wahrlich keine Lust gehabt, dachte Mimi nun. Und mit seiner ersten Prophezeiung hatte Josef auch nicht richtiggelegen. Denn viele Möglichkeiten, die Stadt zu erkunden, ergaben sich nicht, dazu waren die Regeln im Gymnasium und die von Tante Josefina zu streng gewesen. Aber Mimi hatte sich in ihr Schicksal gefügt. Berlin war ihr sowieso zu groß, zu laut, zu unüberschaubar. So konzentrierte sie sich ganz aufs Lernen und hoffte darauf, dass die Jahre schnell vergingen.
Mit der Bemerkung, dass sie in Berlin eine »feine Dame« werden würde, hatte Josef allerdings recht behalten. Vaters Schwester war entsetzt gewesen, als sie Mimis vernachlässigte Garderobe sah. Hier ein Mottenloch, da eine aufgerissene Naht. Und die Unterwäsche – verblichen anstatt blütenweiß! Als die Tante mitbekam, dass Mimi es gewöhnt war, ihre Haare nur einmal in der Woche zu waschen, war ihr Entsetzen noch größer gewesen, von einem Lotterhaushalt in der Pfarrei hatte sie gesprochen. Mimi schämte sich zutiefst und vergoss deswegen nachts im Bett viele Tränen. Es war ja nicht so, dass ihr ein gepflegtes Erscheinen gleichgültig gewesen wäre, sie kannte es nur nicht anders! Ihre Mutter musste sich so viel um die armen Menschen irgendwo auf der Welt kümmern, da konnte sie nicht auch noch nach ihrer, Mimis, Garderobe schauen. Die Tante, die ihre Schwägerin kannte, hörte zu, nickte wissend und widmete sich danach mit Eifer der Aufgabe, aus Mimi eine elegante junge Dame zu machen. Und Mimi dankte es ihr, indem sie alles, was Josefina sie lehrte, wie ein Schwamm aufsaugte.
Als sie im Jahr 1899 mit eleganter Hochsteckfrisur, in ein blitzsauberes Kostüm gekleidet und mit einem guten Zeugnis nach Esslingen zurückgekehrt war, hatte ihr Herz jubiliert. Endlich wieder zu Hause! Ihr hatten die schwäbischen Fachwerkhäuser gefehlt, der melodisch-weiche schwäbische Akzent und der Blick auf die Schwäbische Alb, den man bei gutem Wetter von der Esslinger Oberstadt aus genießen konnte.
Nun würde ihr Leben beginnen!, hatte sie geglaubt. Endlich würde ihr großer Traum von einer Fotografenlehre Wirklichkeit werden.
Damals – noch nicht volljährig – auf dem Weg nach Berlin hatte sie sich den Wünschen ihrer Eltern beugen müssen. Aber wie sah es heute aus?, fragte sich Mimi, während vor ihrem Fenster die Nacht einem blassen Morgen wich. Sie war sechsundzwanzig Jahre alt, eine erwachsene Frau. War es nicht an der Zeit, endlich das zu tun, wonach sie sich sehnte?
Wie hatte es Bernadette am Nachmittag ausgedrückt? »Das Einzige, was zählt, ist die Liebe!«
Es war höchste Zeit, dass sie sich wieder an ihre große Liebe erinnerte!
6. Kapitel
»Heinrich hat mir gestern einen Heiratsantrag gemacht«, sagte Mimi, als sie am Mittag bei Sonntagsbraten, Spätzle und viel Soße zusammensaßen. Gott sei Dank war Heinrich nicht hier, dachte sie inbrünstig. Mit ihm würde sie zwar auch noch reden müssen, aber eins nach dem andern.
Zum ersten Mal, seit sie denken konnte, hatte sie den sonntäglichen Kirchgang unter dem Vorwand, ihr Kopfweh weiter auskurieren zu wollen, geschwänzt und einfach weitergeschlafen. Als sie nun am Esstisch saß, fühlte sie sich gut. Dafür verantwortlich waren weniger ihre frisch gewaschenen Haare und die Tatsache, dass sie doch noch geschlafen hatte, als vielmehr die Klarheit in ihrem Kopf, zu der sie gelangt war. Ja, sie stand an einer Weggabel – einer der beiden Wege war glasklar vorgezeichnet, den anderen konnte sie nur schemenhaft erkennen. Trotzdem wusste sie genau, welchen Weg sie gehen würde.
Ihre Eltern tauschten einen wissenden Blick.
»Das haben wir uns schon gedacht«, sagte Amelie Reventlow. »Ach Kind, ich freue mich so! Einen besseren Ehemann kannst du nicht bekommen.« Sie drückte Mimis linke Hand, dann runzelte sie die Stirn. »Wo ist Heinrich eigentlich, normalerweise isst er doch sonntags immer bei uns mit?«
»Ich habe unseren Vikar gebeten, uns heute ausnahmsweise einmal allein zu lassen«, sagte Mimis Vater.
Mimi fiel vor Erstaunen fast die Gabel aus der Hand. »Du hast was? Aber warum …?«
Auch ihre Mutter schaute ihn verständnislos an.
Franziskus Reventlow lachte auf. »Ach Kind! Ich wäre ein schlechter Seelsorger, wenn mir entgangen wäre, in welch aufgewühltem Zustand du gestern nach Hause gekommen bist. Ich wollte dir die Möglichkeit geben, in Ruhe und vertrauensvoll mit uns zu sprechen. Heinrich hat mir gegenüber vor ein paar Tagen eine Bemerkung fallen lassen, die mich ahnen ließ, was er vorhatte.«
»Franziskus! Wie redest du denn? Fast könnte man meinen, du wärst nicht glücklich darüber, dass Mimi Heinrichs Frau wird. Wer schwärmt mir denn seit Ewigkeiten von seinem Vikar vor?«
»Es stimmt, ich schätze Heinrich sehr. Aber hier geht es nicht darum, ob ich glücklich bin, sondern darum, ob unsere Tochter es ist.« Mit fragend hochgezogenen Brauen schaute ihr Vater Mimi an.
»Aber … ich verstehe nicht …« Hektisch schaute Amelie Reventlow von einem zum andern.
Mimi, zutiefst gerührt über die Feinfühligkeit ihres Vaters, legte ihr Besteck aus der Hand und sagte leise, aber bestimmt: »Ich schätze Heinrich ebenfalls sehr. Aber ich kann ihn nicht heiraten.«
»Wie bitte?« Als habe sie ins Feuer gelangt, ließ Amelie Reventlow die Hand ihrer Tochter los. »Das erklär mir mal bitte genauer!«
Mimi seufzte. Wie sollte sie all die Gedanken, die sie sich in den vergangenen Jahren immer wieder gemacht hatte, jetzt in kurze Worte fassen?
»Was ich euch jetzt sagen werde, kommt vielleicht ein wenig überraschend für euch. Aber das ist es in Wahrheit nicht, im Gegenteil, ich hatte genügend Zeit, über alles nachzudenken. Ihr wisst ja, dass es mein größter Traum war, Fotografin zu werden«, hob sie an.
»Ja und? Das bist du doch auch geworden. Was willst du denn noch?«, kam es sogleich von ihrer Mutter. »Undank ist der Welten Lohn, sag ich da nur«, zischte sie ihrem Mann vorwurfsvoll zu. »Der Heinrich ist so ein guter Mann. Wie kann sie auch nur eine Minute zaudern, ihn zu heiraten?«
»Jetzt lass das Kind aussprechen, dann sind wir vielleicht ein bisschen schlauer.«
Mimi lächelte ihren Vater traurig, aber dankbar an. »Ich arbeite