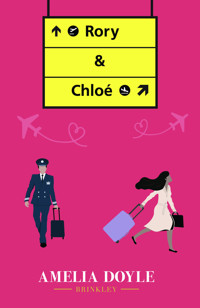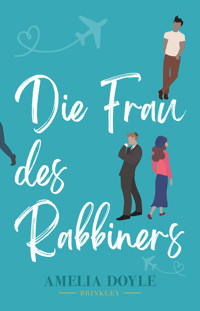
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BRINKLEY Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Emily Horowitz ist als Künstlerin, Frau eines modern-orthodoxen Rabbiners und Mutter zweier Söhne einiges an Chaos gewohnt. Ein spontaner Umzug nach Dublin bringt sie jedoch völlig aus dem Gleichgewicht. Was hatte sich ihr Mann nur dabei gedacht, ausgerechnet in Dublin eine neue Stelle anzunehmen? Und das ohne sich vorher mit ihr abzusprechen! In Irland angekommen, ignoriert sie Andrew, der viel lieber als Mordechai durch die Welt geht, mehr denn je. Emily vermisst ihre Freunde und Familie ungemein. Dann lernt sie plötzlich Joshua kennen, mit dem sie mehr gemeinsam hat, als ihr lieb ist... Als dann auch noch lang gehütete Familiengeheimnisse ans Licht kommen, ist das Schlamassel perfekt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Amelia Doyle
Die Frau des Rabbiners
Roman
Amelia Doyle, geborene Cohen, ist eine irisch-österreichische Autorin und Politologin mit Wohnsitz in Irland. Gemeinsam mit ihrem Mann James und ihren Hunden Angus und Barnaby, lebt sie in einem wunderschönen Vorort Dublins.
Die Frau des Rabbiners
© 2023 Amelia Doyle
E-Book © 2023 BRINKLEY Verlag
Ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers darf kein Teil dieser Publikation in irgendeiner Form vervielfältigt, übertragen oder gespeichert werden.
Sowohl die im Buch vorkommenden Personen als auch die Handlungen sind vom Autor frei erfunden. Namen und Ähnlichkeiten mit Personen oder tatsächlichen Handlungen sind zufällig und nicht gewollt.
Satz: Constanze Kramer, coverboutique.de
Lektorat: Nora PreußKorrektorat: Manuela Tengler
©Umschlaggestaltung: Steph Buncherwww.stephbuncherdesign.co.uk
ISBN 978-3-903392-07-6
www.brinkley-verlag.at
Die Frau des Rabbiners
.רבד לכל ןמז שי דימתו ,ידמ לודג אוהש ץמאמ ןיא ,םיבהואשכ
(‘Abdu‘l-Bahá)
.ישפנ הבהאש תא יתאצמ
(Shir HaShirim 3:4)
Glossar
Aba: Papa/Vater
Aschkenasisch: zentral-, osteuropäisch
Baal Shem Tov: eigentlich Rabbi Israel ben Eliezer (1698 – 1760). Jüdischer Mystiker, Heiler und der Begründer des Chassidismus; des frommen Judentums.
Baalei Teshuwa: Juden, die nicht religiös erzogen worden sind und sich später dazu entscheiden, ein jüdisch orthodoxes Leben zu führen.
Bar Mitzwah (Pl. Bnei Mitzwah): Feier der religiösen Mündigkeit eines Jungen (mit 13 Jahren).
Bat Mitzwah (Pl. Bnot Mitzwah): Feier der religiösen Mündigkeit eines Mädchens (mit 12 Jahren).
Chag Sameach: Hebräischer Festtagsgruß
Challah: Geflochtener briocheartiger Hefezopf, der traditionell vor allem von zentral- und osteuropäischen Juden am Schabbat und an den meisten Feiertagen gegessen wird.
Challahbrett/Challahteller: Brett oder Teller, auf dem die Challah gelegt wird.
Challahdecke: Traditionelles Tuch, mit dem die Challah vor dem Segensspruch abgedeckt wird.
Chanukkah: Das achttägige Lichterfest, das an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem (164 v. d. Z.) erinnert.
Chuppah: Hochzeitsbaldachin
Get (Pl. Gittin): Scheidebrief, den ein orthodoxer Jude seiner Frau als Zeichen der Trennung übergibt.
Haggadah: Anleitung für den Sederabend zu Pessach, die die Geschichte des Exodus aus Ägypten wiedergibt.
Halacha: religiös-rechtliche Grundlage des jüdischen Lebens.
Hamantaschen: Traditionelle Kekse, die an Purim gebacken werden.
Havdalah: Ein jüdisches Ritual, das am Samstagabend das Ende des Schabbats und den Beginn der neuen Woche kennzeichnet.
Ima: Mama/Mutter
Jom Kippur: Jom Kippur ist der jüdische Versöhnungstag und zugleich der höchste Feiertag im jüdischen Kalender. Er wird als Fasten-, Buß- und Bettag begangen.
Kantor: Vorbeter in der Synagoge
Ketubah: Jüdischer Ehevertrag, der auf Aramäisch geschrieben ist und die Verpflichtungen eines Mannes seiner Ehefrau gegenüber auflistet und festhält.
Kiddusch: der Segen über den Wein am Schabbat oder einem Feiertag.
Kidduschbecher/Kidduschglas: Becher oder Glas, der für den Wein verwendet wird.
Kippa (Pl. Kippot): Kopfbedeckung eines religiösen jüdischen Mannes.
Kaschrut/Koscher: rituelle Reinheitsgesetze. Umfasst hauptsächlich Speisegesetze.
Laschon Hara: Der halachische Begriff für »üble Nachrede«
Latkes: Kartoffelpuffer
MaHaRal von Prag (Abkürzung für Moreinu ha-Rav Loew – unser Lehrer Rabbi Löw): eigentlich Judah Löw oder Jehuda ben Bezel’el Löw (zwischen 1512 und 1526 – 1609). Der MaHaRal war ein jüdischer Rabbiner, Talmudist und Philosoph.
Mamser: Nach jüdischem Gesetz ein Nachkomme einer verbotenen Beziehung.
Matzenknödelsuppe: Eine traditionelle Suppe, die vor allem von zentral– und osteuropäisch stämmigen Juden zu Pessach gegessen wird.
Mazel Tov: Jiddischer Ausdruck der »Viel Glück« bedeutet, aber auch »Herzlichen Glückwunsch«.
Mesusa: Eine mit einem Pergament gefüllte Schriftkapsel, die im oberen Drittel des rechten Türpfostens angebracht wird.
Pessach: Pessach ist einer der wichtigsten jüdischen Feiertage, der an den Auszug aus Ägypten erinnert. Pessach ist neben Schawuot und Sukkot eines der drei Wallfahrtsfeste.
Pessach Seder: das zeremonielle Pessach-Essen.
Purim: Religiöses Losfest, an dem es Brauch ist, sich zu verkleiden, fröhlich zu sein und sich zu betrinken. Erinnert an die Rettung persischer Juden durch Esther.
Rabbi/Rabbiner: Jüdischer Geistlicher
Rebbetzin: Frau des Rabbiners
Rosh Hashanah: Jüdisches Neujahr
Rosh Hashanah Seder: Das zeremonielle Rosh Hashanah-Essen
Schabbat: der 7. Tag der Schöpfung und absoluter Ruhetag. Beginnt Freitagabend und endet Samstagabend.
Schabbatbegleiter: Begleitbuch, um dem zeremoniellen Teil eines Schabbat-Essens besser folgen zu können.
Schawuot: Wochenfest. Erinnert an die Übergabe der Zehn Gebote an Moses. Schawuot ist neben Sukkot und Pessach eines der drei Wallfahrtsfeste.
Seder/Sederabend: das zeremonielle Pessach-Essen. In manchen Gemeinden wird auch der zeremonielle Teil des Rosh Hashanah-Essens als Seder bezeichnet.
Shiva: Die Shiva ist eine einwöchige Trauerzeit, bei dem sich die Familienmitglieder traditionell im Haus des Verstorbenen treffen, um Besuch zu empfangen.
Sukkot: Laubhüttenfest. Auch als Erntedankfest bekannt. Sukkot ist neben Schawuot und Pessach eines der drei Wallfahrtsfeste.
Sofer STaM: Unter dem Begriff Sofer StaM versteht man im Judentum einen professionellen Schreiber, der sich mit dem kunstvollen Schreiben religiöser Texte wie z. B. Torahrollen, Mesusot, Teffilin, Ketubot und anderen religiösen Texten befasst.
Tallit: Gebetsschal, der von jüdischen Männern während des Morgengebets getragen wird.
Tehilim: Psalmen
Tefillin: Lederne Gebetsriemen, die aus zwei Teilen bestehen und werktags als Kapseln auf der Stirn und dem linken Oberarm getragen werden. In den Kapseln befinden sich mit Torahversen beschriebene Pergamentrollen.
Torah: Die Torah umfasst die fünf Bücher Mose und dient als Hauptquelle jüdischen Rechts, Bräuche, Traditionen und der Ethik. Sie ist in Abschnitte unterteilt, die über den Zeitraum eines Jahres hinweg wöchentlich in der Synagoge gelesen werden.
Tzizit/Tziziot: Fransen mit Knoten, die sich an den vier Ecken des Gebetsschals befinden. Die Fäden und Knoten erinnern an die 613 Gebote, die gläubige Juden befolgen.
Tzniut: Verhaltens- und Kleidungsregeln.
Yenta: Jiddischer Ausdruck für Tratschtante.
Yeshiva: Eine jüdische Hochschule, an der sich männliche Schüler dem Torah- und Talmudstudium widmen.
Prolog
Damals
Emily Goldblum wartete am Fuße des Karmelgebirges in Haifa, nicht unweit des Hagana Denkmals ungeduldig auf ihre beste und älteste Freundin Dvorah Kanarfogel. Seitdem sich die beiden Frauen vor ein paar Jahren an der lokalen Kunstakademie kennengelernt hatten, waren sie unzertrennlich und trafen sich jeden Freitag, um an den wöchentlichen, von einer unabhängigen Organisation für religiöse nordamerikanische Einwanderer organisierten, gut besuchten Single-Wanderungen teilzunehmen.
Sowohl Emily als auch die melancholische Dvorah stammten aus New York und waren als Jugendliche mit ihren Familien nach Israel ausgewandert. Es kam beiden Frauen wie eine gefühlte Ewigkeit vor, dass sie ihre alte Heimat hinter sich gelassen hatten. Heute konnten sich beide ein Leben außerhalb des Nahen Ostens kaum noch vorstellen.
Während Dvorahs Familie schon immer in Israel leben wollte, hatten Samuel und Eliza Goldblum nie geplant, mit ihren drei Töchtern vom sogenannten Rückkehrgesetz Gebrauch zu machen, das es jeder jüdischen Person und jeder Person mit einem jüdischen Großelternteil erlaubte, sich in Israel niederzulassen. Die Familie war nicht sonderlich religiös und ging, wenn überhaupt, nur zu den hohen Feiertagen in eine der vielen liberalen Synagogen, die man in den Straßen New Yorks finden konnte. Die Goldblums schickten ihre Töchter nach deren Bnot Mitzwah auch nie in den Hebräisch-Unterricht, der von ihrer Synagoge für Jugendliche angeboten wurde, und auch in keine der unzähligen jüdischen Privatschulen. Sie waren Humanisten und wollten, dass ihre Töchter eine nicht-religiöse Schulbildung genossen. Ihre Töchter hatten auch selbst entscheiden dürfen, ob sie eine Bat Mitzwah überhaupt haben wollten. Weder Eliza noch Samuel hatten sie je zu irgendetwas gezwungen. Der einzige Grund, warum sie an den hohen Feiertagen in die Synagoge gingen, war, um Elizas Großeltern einen Gefallen zu tun. Es hatte mehr mit Tradition und Respekt als mit dem Glauben selbst zu tun.
Emilys Vater Samuel hatte schon immer eine Passion für Mathematik gehabt und studierte erst an der Columbia University, bevor er nach Yale wechselte, um dort seinen Doktortitel zu machen. Als Sohn eines Mathematiklehrers hatte er sich im Land der Zahlen immer am wohlsten gefühlt. Gerne dachte er an die Zeit zurück, als er als Kind und Jugendlicher mit seinem Vater spaßeshalber kompliziertere Mathematikaufgaben gelöst hatte. Samuel besaß ein Talent, das während seiner Universitätszeit nicht unentdeckt blieb. Sein Doktorvater, der aus London stammende Professor Thornton, war so begeistert von Samuel, dass er ihm zu seiner ersten Stelle als Wirtschaftsmathematiker in einem der größten und erfolgreichsten Unternehmen des Landes verhalf. Samuel war auf seinem Gebiet sehr erfolgreich. Doch so richtig glücklich machte ihn sein Leben nicht. Er arbeitete viel zu viel und bekam seine Familie kaum zu Gesicht. Wenn er nicht in seinem Büro in New York war, befand er sich in einem Flugzeug nach London, Paris, Frankfurt, Toronto oder San Francisco. Jedes Mal, wenn er das Haus verließ, zerbrach etwas in ihm.
Es schmerzte Samuel zutiefst, dass er die ersten Lebensjahre seiner Töchter Molly und Lucy verpasst hatte. Mit Emilys Geburt wurde alles anders. Samuel wollte mehr Zeit zu Hause verbringen und für seine Familie da sein. Mit etwas Glück und sehr guten Kontakten, die er über die Jahre hinweg gepflegt hatte, gelang es ihm, eine Professur an der New York University zu erlangen. Samuel war von dem Punkt an, obwohl sich sein Gehalt halbiert hatte, viel zufriedener als je zuvor mit seinem Leben. Er arbeitete noch immer mit Zahlen und konnte sein Wissen an die nächste Generation weitergeben. Samuel war ein leidenschaftlicher Lehrer. Für ihn ging es nicht um Prestige oder Anerkennung, er wollte die wissbegierigen Studenten in seinem Hörsaal einfach nur für sein Feld begeistern.
Auch die Goldblum-Schwestern und ihre Mutter Eliza merkten schnell, wie glücklich Samuel mit seiner Arbeit an der Universität war. Es verging kein Tag, ohne dass er ihnen vom Campusleben vorschwärmte. Vor allem Molly war froh darüber, dass ihr Vater nicht mehr alle zwei Wochen weg musste. Die ganze Familie genoss ihr Leben in New York und hatte nie daran gedacht, ihre wunderschöne Wohnung mit Blick auf den Botanischen Garten, in dem vor allem Emily als junges Mädchen unzählige Stunden verbracht hatte, um Zeichnungen von Blumen anzufertigen, zu verlassen. Es gab für sie keinen schöneren Ort in der ganzen Stadt. Nicht einmal das MoMa.
Eliza und ihre an Kunst interessierten Töchter Lucy und Emily gingen jede Woche ins Museum, um an unterschiedlichen Veranstaltungen teilzunehmen oder durch die lieb gewonnenen Ausstellungen zu schlendern. Eliza hatte sehr früh erkannt, dass ihre beiden jüngeren Töchter früher oder später selbst professionelle Künstlerinnen sein würden, und unterstützte sie von klein auf mit vollem Herzen in ihrem Vorhaben.
Als Emily fünfzehn Jahre alt war, bekam ihr Vater die Möglichkeit, für ein Jahr an der renommierten Hebrew University in Jerusalem zu lehren. Samuel sagte spontan zu, ohne es vorher mit seiner Familie zu besprechen. Eliza war von der Idee begeistert. Zu Beginn zögerte Emily ein wenig und wollte ihre Eltern nicht nach Israel begleiten. Sie sprach kaum Hebräisch, kannte dort niemanden und wollte in ihrer Heimatstadt bleiben. Molly, die sieben Jahre älter als Emily war und bereits in Chicago Medizin studierte, bot ihren Eltern an, ihre kleine Schwester zu sich zu holen und sich um sie zu kümmern. Für Eliza kam es nicht infrage, ihre jüngste Tochter in Amerika zurückzulassen. Sie wollte von alledem nichts hören. Auch Samuel weigerte sich, dem zuzustimmen. Ihm war es wichtig, dass Molly sich voll und ganz auf ihr Studium konzentrierte.
Die damals achtzehnjährige Lucy war von dem bevorstehenden Umzug genauso begeistert wie ihre Mutter. Sie liebte Israel und sah sogar den zweijährigen Armeedienst, den jede israelische Frau absolvieren musste, als eine Chance, um sich so schnell wie möglich zu integrieren und neue Freunde zu finden. Es verblüffte Eliza als Anthropologin immer wieder, wie unterschiedlich ihre Töchter doch waren, auch wenn sie ähnliche Interessen hatten. Ihre älteste Tochter Molly schien ihr am ähnlichsten zu sein. Zuverlässig, strebsam, analytisch. Sie war die perfekte Mischung aus ihr und Samuel. Lucy war schon immer ein Freigeist gewesen. Das komplette Gegenteil ihrer Eltern. Samuel war fasziniert von seiner mittleren Tochter. Obwohl sie sich mit jeder Faser voneinander unterschieden, hatten sie ein außerordentlich gutes Verhältnis. Wenn die beiden in ein Gespräch miteinander vertieft waren, traute sich nicht einmal Eliza, sie dabei zu stören.
Emily wiederum verblüffte ihre Eltern. Strukturelles Denken? Fehlanzeige. Logik? Kaum nachvollziehbar. Es hat in der Familie Goldblum selten ein kreativeres Kind gegeben. Eliza verstand oft nicht, wie ihre jüngste Tochter letztendlich all ihre Ziele erreichte. Als Emily noch jünger war, hatte Eliza das Verlangen, sie als Forschungsobjekt zu verwenden, wogegen sich Samuel vehement sträubte. Er wollte nicht, dass Emilys ganzes Leben zu einer Forschungsarbeit mutierte, nur weil seine Frau neugierig war, warum sich ihre Tochter verhielt, wie sie sich verhielt. Ihm war bewusst, dass Eliza mehrere Bücher über das Verhalten ihrer gemeinsamen Tochter hätte schreiben können, doch sah er den Sinn darin nicht.
Sowohl Eliza als auch Samuel waren mehr als verblüfft, als Emily ihnen mit fünfundzwanzig Jahren offenbarte, dass sie sich dazu entschlossen hatte, ein jüdisch-orthodoxes Leben zu führen. Zu Beginn hatten ihre Eltern sie nicht ernst genommen und waren felsenfest davon überzeugt gewesen, dass es sich um einen Scherz handelte. Sie konnten sich einfach nicht vorstellen, dass Emily in der Lage war, sich an strikte Regeln zu halten, religiös oder nicht, oder sämtliche Riten und Praktiken bis ins kleinste Detail zu befolgen, so wie es im orthodoxen Judentum üblich war.
Eliza vermutete, dass es sich um eine Phase der Rebellion handelte oder dass sich ihre Tochter während ihrer Zeit auf der Kunstakademie in Haifa in einen religiösen Juden verliebt hatte. Samuel war etwas pragmatischer als seine Frau, was seine jüngste Tochter betraf. Er nahm an, dass Emily sich während ihrer Studienzeit mit ein paar religiösen Kommilitoninnen angefreundet und in deren Lebensstil verliebt hatte. Sie war schon immer etwas ruhiger und zurückhaltender, auch konservativer als ihre beiden älteren Schwestern. Es hätte ihn nicht gewundert.
Weder ihre Mutter noch ihr Vater hatten recht mit ihren Vermutungen. Was wirklich geschehen war, war, dass Emily eine tiefe Bewunderung für eine in Haifa lebende Künstlerin hegte, die sie in einer Galerie kennengelernt hatte, in der sie regelmäßig nach ihren Vorlesungen und Workshops aushalf.
Orly Sarfati war damals bereits über achtzig Jahre alt, hatte zehn Kinder, fünfundachtzig Enkelkinder und siebenunddreißig Urenkel. Ihr Vater Yusuf und ihre Mutter Ruchama stammten aus angesehenen ägyptischen Künstlerfamilien und hatten Orly das Talent in die Wiege gelegt.
In Haifa geboren, spezialisierte sie sich im zarten Alter von einundzwanzig Jahren auf biblische Kunst. Orly hatte nie aufgehört, Kunstwerke zu kreieren. Nicht während ihrer Schwangerschaften, nicht nach den Geburten ihrer Kinder, Enkel oder Urenkel. Sie arbeitete vorwiegend mit Tusche. Ihre Schwarz-Weiß-Gemälde waren nicht nur in unzähligen jüdischen Museen auf der ganzen Welt verstreut, sondern auch in zahlreichen Häusern, Wohnungen und Unternehmen. Emily war von der ersten Sekunde an fasziniert von dieser Frau, die all das verkörperte, wonach sich Emily so sehr sehnte: künstlerischen Erfolg und ein erfülltes Familienleben.
Seitdem die Goldblums nach Jerusalem gezogen waren, wo Emily tagtäglich auf gläubige Frauen traf, sehnte sie sich nach einem religiösen Leben. Sie konnte sich selbst nicht so genau erklären, warum. Bereits nach ihrer Zeit im Militär hatte sie versucht, sich ihrer Schwester Lucy anzuvertrauen. Die warf ihr lediglich vor, dass sie sich während ihres Wehrdienstes einer Gehirnwäsche unterzogen hatte. Von dem Moment an erwähnte Emily ihren Wunsch, ein religiöses Leben zu führen, nicht mehr und versuchte, dieses Verlangen zu unterdrücken. Auch Lucy schnitt dieses Thema nie wieder an.
Ausgerechnet in Haifa und nicht in Jerusalem, verliebte sich Emily nicht nur in jüdische Kunst, sondern auch in einen religiösen Lebensstil. Nach ihrer Ausbildung arbeitete Emily einige Jahre als Englischlehrerin, um sich ein kleines Atelier nicht unweit von Orlys zu mieten. Fünf Jahre später gelang es ihr noch immer nicht, diese multikulturelle Stadt zu verlassen, was nicht nur mit Orly zu tun hatte, die über Jahre hinweg zu einer guten Freundin und Vertrauten geworden war, sondern auch mit dem wunderschönen Karmelgebirge, das Emily tagtäglich aufs Neue inspirierte. Ihr Gefühl sagte ihr, dass es noch nicht an der Zeit war, nach Jerusalem zurückzukehren.
»Dvorah! Da bist du ja endlich!« Emily umarmte ihre Freundin zur Begrüßung.
»Es tut mir so leid, dass ich zu spät bin, Emily. Aber meine Schwester Mushky fliegt nach dem Schabbat ins Ferienlager nach Amerika und ich habe meiner Mutter mit den Vorbereitungen für heute Abend geholfen. Wir bekommen von ein paar Freunden und Verwandten Besuch. Ima hat dich übrigens auch eingeladen und freut sich schon darauf, dich zu sehen.« Dvorah wischte sich mit der Hand den Schweiß von der Stirn. Obwohl Dvorah aus einem modern-orthodoxen Haus kam, bestand sie darauf, nur dunkle Farben zu tragen, Leggings oder Strumpfhosen unter ihren Röcken und Kleidern anzuziehen und nur Oberteile zu tragen, die sowohl ihre Ellbogen als auch ihr Schlüsselbein bedeckten. Seitdem Emily Dvorah kannte, wollte diese von einer modernen Interpretation des orthodoxen Judentums nichts wissen. Anders als ihre Geschwister wollte sie ein noch konservativeres Leben führen, als es ihre Familie ihr in den Vereinigten Staaten und in Israel vorgelebt hatte.
Emily hatte auch von Dvorahs älteren Schwester Hadar bereits mehrfach gehört, dass ihre Eltern sich mehr und mehr um sie sorgten, da sie mit jedem Geburtstag religiöser wurde. Ihrer Vermutung nach, weil die Heiratsvermittlerin für sie noch immer keinen potenziellen Bräutigam gefunden hatte. Ein Gedanke, der auch Emily mehrfach gekommen war. Vor allem, als sie das letzte Mal mit Dvorah in der Stadt einen Kaffee getrunken hatte, beschlich sie das Gefühl, dass ihre Freundin einen Weg einschlug, der ihr auf Dauer nicht guttun würde.
Emily wollte ihre Freundin nicht verlieren und ihr zeigen, wie schön ein Leben sein konnte, das sowohl die moderne als auch die spirituelle Welt in sich vereinbarte. Dvorah konnte Emily gerade deswegen dazu überreden, sie auf diese wöchentlichen Single-Wanderungen im Karmelgebirge zu begleiten. Zu Beginn hatte sich Emily geweigert, mitzukommen, da sie nicht das Verlangen hatte, ihre Freitag Nachmittage bei über dreißig Grad im Schatten wandernd zu verbringen.
Emily und Dvorah waren beide auf der Suche nach der großen Liebe, nach ihren Seelenverwandten und empfanden es als wichtig, einen Partner zu finden, der nicht nur zu ihnen passte, sondern auch einen ähnlichen kulturellen Hintergrund hatte. Sowohl Emily als auch Dvorah sehnten sich nach einer Ehe mit einem Amerikaner oder einem Kanadier, der mit ihnen in Israel leben wollte. Emily und Dvorah befanden sich schon so lange im Nahen Osten, dass sie es sich nicht mehr vorstellen konnten, ganz nach Nordamerika zurückzukehren. Beide liebten es, in einem jüdischen Staat zu leben, einem Land, in dem sie nicht die Minderheit waren und sich nicht für religiöse Feiertage freinehmen mussten. Einem Land, in dem fast das ganze Jahr über die Sonne schien, mit dem Meer direkt vor der Haustür, und so viel Geschichte und Kultur, wie man sie an kaum einem anderen Ort auf dieser Welt finden konnte.
Da Emily weder religiös aufgewachsen war, noch aus einer religiösen Familie stammte, wollte sie mit keiner der vielen Heiratsvermittlerinnen zusammenarbeiten und auch ihre Eltern so gut es ging aus der Partnersuche heraushalten. Ihr war bewusst, dass sie dieser Art von Partnersuche nie zustimmen würden und es auch nicht verstehen oder nachvollziehen konnten, warum man diesen Weg heutzutage noch einschlug. Viele der Heiratsvermittlerinnen hatten außerdem immer noch Vorurteile gegenüber Frauen und Männern, die ein gläubiges Leben erst spät für sich entdeckt hatten. Was nichts damit zu tun hatte, ob es sich um einen orthodoxen oder modern-orthodoxen Lebensweg handelte. Das Hauptproblem lag vor allem darin, dass eine große Anzahl von Familien in den jeweiligen Karteien der Heiratsvermittlerinnen genauso stur war wie die Vermittlerin selbst. Sie waren felsenfest davon überzeugt, dass Baalei Teshuva, wie die sogenannten Rückkehrer genannt wurden, nichts Gutes ins Haus brachten. Viele gingen bedauerlicherweise von Anfang an davon aus, dass sie dem potenziellen Ehepartner sowie den zukünftigen Kindern und Enkelkindern mehr Schaden als Gutes zufügen würden. Emily wollte sich diesem Stress nicht aussetzen. Sie fand es kompliziert genug, einen modern-orthodoxen Mann zu treffen. Dennoch wollte sie es auf natürliche Weise tun und nicht, weil jemand meinte, dass sie auf dem Papier gut zusammenpassen würden.
»Sind die anderen schon da?«, wollte eine müde Dvorah von ihrer Freundin wissen. Emily verneinte und schüttelte den Kopf. Sie war selbst erst vor wenigen Minuten angekommen und hatte noch niemanden aus ihrer Wandergruppe entdecken können. Gerade als Emily sich umdrehen wollte, hörte sie zwei ihr bekannte Stimmen. Es waren die Organisatoren dieser wöchentlichen Wanderungen: die aus Toronto stammende Iris und ihr israelischer, in Montréal aufgewachsener Ehemann Yitzhack Feinstein. Yitzhack hatte seine gesamte Kindheit und Jugend in Kanada verbracht und war lediglich in Haifa auf die Welt gekommen. Er war keine zwei Jahre alt gewesen, als seine Eltern Israel mit ihm und seinen Geschwistern verlassen hatten. Gemeinsam mit seiner Frau lebte Yitzhack seit drei Jahren in einem Vorort der Stadt. Emily winkte dem Paar zu und ging gemeinsam mit Dvorah zu ihnen hinüber. Bis die anderen Teilnehmer eintrudelten, unterhielten sich die vier über das bevorstehende Wochenende, das in Israel bereits donnerstagabends begann.
Wie schon die Wochen zuvor befanden sich abermals mehr Männer als Frauen auf der Wanderung. Die Freundinnen begrüßten die ihnen bekannten Gesichter und plauderten mit ihnen. Emily konnte nicht einmal mehr an zwei Händen abzählen, wie viele Nachmittage sie schon mit Menachem, Zalman, Ezra, Akiva, Baruch, Eli, Miles, Tobias, Chana, Batsheva und Miriam verbracht hatte. Für sie war es mittlerweile zu einer kleinen Tradition geworden, sich mit dieser Gruppe zu treffen.
In der Ferne erkannte Emily die Brüder Joseph und Abraham Cohen, die wie immer die Schwestern Rachel und Rebecca Weizmann im Schlepptau hatten. Über die letzten Wochen hinweg war Emily bereits aufgefallen, dass die vier sich blendend miteinander verstanden und unzertrennbar geworden waren. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis sie von einer oder gar zwei Verlobungen hören würde. Da war sie sich sicher. Sie mochte die Vier und konnte es kaum erwarten, mit ihnen zu feiern. Anders als Dvorah freute sich Emily darüber, wenn Freunde oder Bekannte ihre Verlobungen verkündeten. Dvorah hingegen schien mit jedem Mal mehr und mehr zu verbittern. Als sich eine ihrer ehemaligen Kommilitoninnen verlobt hatte, konnte Emily Dvorah kaum beruhigen. Sie hatte stundenlang geweint und Emily gefragt, was mit ihr nicht stimmte, weil sie noch immer niemanden kennengelernt hatte.
Dvorah stupste Emily mit ihrem Ellbogen in die Seite und deutete mit dem Kopf in die entgegengesetzte Richtung, wo ihnen Asher Levi aus der Ferne aufgeregt zuwinkte. Diesmal war er jedoch nicht alleine.
Asher stellte Emily und Dvorah seinen aus New York stammenden Freund Andrew Horowitz vor.
»Mordechai. Ich verwende seit Jahren den Namen Mordechai. Asher kann es sich nur nicht merken.« Ein nervöses Lächeln huschte über das Gesicht des Mannes, der mindestens zehn bis fünfzehn Jahre älter als sie zu sein schien, was weder Emily noch ihre Freundin störte.
»Es freut mich, dich kennenzulernen, Mordechai.« Emily lächelte ihn freundlich an. Sie gaben sich nicht die Hand, da es in ihren Kreisen für Männer und Frauen außerhalb der Familie nicht üblich war, sich zu berühren.
»Mich auch, Emily. Asher hat mir schon viel von dir, Dvorah und den anderen erzählt.«
Emily war überrascht, wie selbstbewusst Mordechai war und nicht wie viele andere Männer, die sie auf diesen Wanderungen kennengelernt hatte, permanent auf den Boden starrte, wann auch immer sie mit ihnen sprach. Auch war sie es gar nicht mehr gewohnt, mit einem Mann zu sprechen, der größer war als sie oder wie in Mordechais Fall sie sogar einen Kopf überragte. Mordechais blaue Augen machten einen freundlichen Eindruck. Sie konnte es kaum erwarten, ihn näher kennenzulernen. Es passierte in letzter Zeit nicht allzu oft, dass jemand Neues an den Wanderungen teilnahm und schon gar nicht jemand, bei dem sie erst hinaufblicken musste, um ihm in die Augen sehen zu können. Emily kam sich in Israel mit ihren eins-vierundsiebzig immer wie ein Baum vor, da die meisten Frauen wesentlich kleiner waren. Sie wollte gar nicht an die ganzen Männer denken, die sie bereits kennengelernt hatte und oft überragte.
»Jetzt, wo ihr alle da seid, kann es endlich losgehen!« Iris erklärte der Gruppe, dass sie heute eine kleine Wanderung durch die felsige Landschaft der sogenannten Kleinen Schweiz machen würden. Sie versicherte sich, dass alle etwas zu trinken und genug Proviant bei sich hatten, um die Wanderung zu beginnen. Es war in der Vergangenheit zu häufig vorgekommen, dass jemand meinte, er hätte genug zu trinken dabei und dann zusammengebrochen war. Iris ließ mittlerweile keinen mehr mitkommen, der nicht mindestens eineinhalb Liter Wasser dabei hatte.
Es dauerte nicht allzu lange, bis sich Emily und Mordechai am Ende der Gruppe befanden. Emily erzählte ihm, wie sie Dvorah kennengelernt hatte, von ihrem gemeinsamen Kunststudium und ihrer Arbeit, während Mordechai voller Stolz erklärte, dass seine größten Leidenschaften das Singen und das Schauspielern waren. Sie war überrascht, dass er, bevor er zum orthodoxen Rabbinerseminar zugelassen wurde, eine Ausbildung zum Kantor gemacht hatte.
»Bist du nun Kantor einer Synagoge oder arbeitest du als Rabbiner?«
Mordechai erklärte Emily, dass er als freischaffender Rabbiner tätig war, da er noch keine Gemeinde gefunden hatte, die ihn permanent einstellen wollte. »Nebenbei stehe ich immer wieder auf der Bühne eines kleinen englischsprachigen Theaters, das ich mit einer Bekannten und ihrem Mann gegründet habe.«
Emily war von Mordechai und seiner Liebe zu den Künsten fasziniert. Sie hatte noch nie jemanden wie ihn kennengelernt.
»Wir haben immer mal wieder Aufführungen in Haifa. Wenn du möchtest, kann ich dir und Dvorah Bescheid geben, wenn wir wieder mit einem Stück in der Stadt sind.« Mordechai lächelte sie freundlich an, als sie begeistert zusagte. Es blieb ihm nicht unbemerkt, wie viel Energie Emily plötzlich hatte und wie begeistert sie selbst von Theatern und Musicals war.
»Jetzt bin ich dann doch neugierig, Mordechai. Was muss ich mir unter einem freischaffenden Rabbiner vorstellen?« Emily konnte es kaum erwarten, mehr über Mordechai zu erfahren. Man konnte es ihr im Gesicht ansehen, wie sehr sie seine Gesellschaft genoss. Sie versuchte gar nicht erst, ihr Interesse zu verbergen. Immerhin war sie hier, um den Mann fürs Leben zu finden und nicht, um unzählige Freundschaften zu schließen.
Auch Mordechai entspannte sich zunehmend in ihrer Gegenwart. »Ich bin ein modern-orthodoxer Rabbiner mit einem amerikanischen Abschluss, den das hiesige Rabbinat leider nicht vollständig anerkennt. Im Moment arbeite ich vor allem mit nordamerikanischen Familien, deren Kinder ihre Bar- oder Bat Mitzwah in Israel feiern wollen.«
»Unser Rabbinat schafft es mit diesen Geschichten immer wieder in die Schlagzeilen«, seufzte Emily. »Wie finden dich die Familien? Hast du eine Webseite?«
»Ja. Die meisten Anfragen bekomme ich über meine Webseite oder weil mich Familien weiterempfehlen. Ich schalte auch immer mal wieder Online-Werbungen in diversen Suchmaschinen. Wenn die Eltern möchten, bereite ich ihre Kinder ein ganzes Jahr lang im amerikanischen Stil auf ihre Bar- oder Bat Mitzwah vor.«
»Ich bin überrascht, dass du überhaupt Bnot Mitzwah anbietest.«
»Ich habe lange darüber nachgedacht. Wie du weißt, teilen sich die Meinungen bei diesem Thema.« Mordechai seufzte.
Emily merkte, dass er nicht darüber sprechen wollte. »Und wo finden die Zeremonien statt, wenn du keine Synagoge hast?«
»Wo auch immer die Familien feiern wollen. Vermehrt jedoch unter freiem Himmel.« Mordechai drehte sich für einen Moment um und blickte ins Tal hinunter.
»Wunderschön hier, nicht wahr?«
Emily konnte ihm nur zustimmen. Das satte Grün des Gebietes vor ihnen mit dem azurblauen Meer am Horizont lud zum Träumen ein. Der Norden Israels war einfach nur atemberaubend. Er ließ viele Menschen vergessen, wie trocken der Süden des Landes war.
Mit jeder Minute verstanden sich Emily und Mordechai besser und besser. Sie wurde immer nervöser und begann, ohne Punkt und Komma von ihrer ersten Kollektion zu erzählen, an der sie damals kurz nach ihrem Abschluss gearbeitet hatte.
Emily hatte die Idee, jüdische Chuppot aus Seide herzustellen. Die Nachfrage hielt sich zu Beginn in Grenzen und als mehr und mehr interkonfessionelle und homosexuelle Paare ihre Hochzeitsbaldachine kaufen wollten, bot Emily sie nicht mehr an. Für ihren damaligen Rabbiner war es ein gewaltiges Problem, dass vor allem so viele homosexuelle Paare den Weg in ihr Atelier fanden. Insgeheim hätte sie ihre Chuppot gerne weiterhin an sie verkauft, wollte jedoch nicht gegen die Normen ihrer Synagoge verstoßen. Es brach ihr das Herz und Emily konnte nicht anders, als Pinsel und Seide eine Weile komplett auf die Seite zu legen. Sie wollte nicht nur den ganzen Tag über Seidentücher bemalen und hatte sich daraufhin dazu entschlossen, sich auf eine komplett andere Kunstform zu spezialisieren. Emily würde lügen, würde sie nicht zugeben, dass sie sich manchmal fragte, wie weit sie es als Judaika-Designerin gebracht hätte, hätten ihre Prinzipien und vor allem die ihrer Gemeinde ihr damals nicht im Weg gestanden.
Ganz hatte Emily die Seidenmalerei jedoch nicht hinter sich gelassen. Wann auch immer sie zu einer Hochzeit von Freunden, Bekannten oder Verwandten eingeladen war, nahm sie sich die Zeit, um für das jeweilige Paar eine handgemachte, handbemalte, seidene Challahdecke als Hochzeitsgeschenk zu designen, die am Schabbat und an Feiertagen verwendet werden konnte. Diese Unikate gab sie gerne jederzeit aus der Hand. Sie hatte große Freude an dem Gedanken, dass eines ihrer Werke so Teil des religiösen Lebens eines frischverheirateten Paares und deren zukünftiger Familie oder gar zu einem Erbstück werden würde. Emily versuchte für gewöhnlich, ihre Challahdecken-Designs an den Hochzeitseinladungen zu orientieren, um den Geschmack des Paares bestmöglich zu treffen.
»Und worauf hast du dich seitdem spezialisiert?«, wollte ein interessierter Mordechai wissen.
»Auf das Nadelfilzen. Wenn ich mal eine Pause davon brauche, setze ich mich auch gerne mit meinen Wasserfarben auf den Balkon oder in die freie Natur. Ich habe mich schon immer mit Aquarellmalerei beschäftigt und verkaufe auch regelmäßig meine religiöseren Werke. Mit ihnen bin ich jedoch nicht so erfolgreich wie mit dem Nadelfilzen.« Emily erzählte ihm, wie sie sich langsam einen Markennamen als Filzkünstlerin aufbaute und dass sie sich über die Jahre primär auf florale Motive und Landschaften spezialisiert hatte. »Vor ein paar Monaten habe ich damit angefangen, Tiere zu filzen. Es ist nicht sonderlich kompliziert und Familien kaufen sie gerne als Dekoration für das Kinderzimmer.«
Hätte Emily in ihrer Eile nicht ihren Fotoapparat zu Hause liegen gelassen, würde sie bereits Bilder von all den Blumen, an denen sie vorbei spazierten, knipsen. Die wöchentlichen Wanderungen inspirierten sie immer wieder aufs Neue. Mordechai hörte ihr geduldig zu und versuchte, ihr ein paar Ideen für eine neue Kollektion zu geben. Emily war sichtlich gerührt.
Für gewöhnlich langweilte sie Männer, wenn sie ihnen von ihrer Arbeit erzählte, oder sie gaben ihr relativ schnell zu verstehen, dass eine Künstlerin als Ehefrau für sie nicht infrage kam. Mordechai schien anders zu sein. Er stellte ihr gezielte Fragen zu ihrer Arbeit. Sie fühlte sich sehr wohl dabei, mit ihm über ihre Kunst zu sprechen und sich ein wenig öffnen zu können, ohne mit Vorurteilen überrollt zu werden. Es geschah nicht alle Tage, dass sie eine Künstlerseele traf, die ähnlich wie sie aufgewachsen war und die Liebe zum religiösen Judentum erst spät entdeckt hatte. Oftmals war es eher umgekehrt. Während ihrer Zeit auf der Kunstakademie hatte sie mehrere Künstler kennengelernt, die der Religion den Rücken gekehrt hatten, um ihrer Kunst nachzugehen und ein säkulares Leben zu führen. Während Emily ihm so zuhörte, malte sie sich bereits aus, wie das Leben als Frau an der Seite eines Rabbiners wohl wäre.
Auf dem Weg zurück zu ihrem Treffpunkt erzählte Mordechai Emily von seiner Kindheit auf Long Island und das er in einer ultra-liberalen Familie aufgewachsen war, die nicht einmal koschere Essensregeln einhielt, geschweige denn in die Synagoge ging. Mordechai erwähnte, dass er das religiöse Judentum schon immer bewundert hatte. Während alle seine Freunde in die Synagoge gingen, musste er mit seinem Vater und seinem eineiigen Zwillingsbruder Elliot sämtliche Samstage auf dem Golfplatz verbringen. Seine Mutter traf sich in der Zwischenzeit mit ihren Freundinnen im Spa-Bereich ihres Country Clubs.
Mordechai betonte mehrfach, dass er sich schon als Kind und auch als Jugendlicher innerlich leer gefühlt hatte. Ein Gefühl, das Emily nur allzu gut kannte. Auf die Frage, zu welchem Zeitpunkt er die Entscheidung getroffen hatte, sein Leben zu ändern, antwortete er, dass es wie bei vielen anderen New Yorkern auch während seiner Zeit an der Uni geschehen war.
Als Mordechai ihr erzählte, dass er während seines Studiums von einem Kommilitonen, mit dem er ursprünglich Betriebswirtschaftslehre studiert hatte, zu einem jüdischen Neujahrsessen, einem Rosh Hashanah Seder, einer orthodox-jüdischen Studentenorganisation eingeladen wurde und dort seine wahre Berufung gefunden hatte, kamen Emily die Tränen. Es stellte sich heraus, dass sein Tischnachbar ein junger Rabbiner war, der selbst in einem säkularen Umfeld aufgewachsen war und seit wenigen Jahren seinen Traum lebte. Die beiden unterhielten sich sehr lange miteinander und Mordechai verstand, dass es auch mit seinem säkularen Hintergrund möglich war, Rabbiner zu werden, eine Gemeinde zu leiten und ein erfülltes jüdisch-orthodoxes Leben zu führen. Er begann, orthodox-jüdischen Hochschulorganisationen beizutreten, zu Vorträgen zu gehen und an Diskussionen teilzunehmen, die ihn einerseits mit mehr Fragen nach Hause schickten, andererseits jedoch in der Lage waren, die Leere, die er in seinem tiefsten Inneren verspürte, zu füllen. Mordechai erklärte Emily, dass er sich ab diesem Moment plötzlich nicht mehr so verloren und alleine vorgekommen war. Er fühlte sich besonders zu einer modern-orthodoxen Interpretation des Judentums hingezogen.
Es dauerte nicht lange, bis Mordechai, damals noch Andrew, die Entscheidung traf, sein Studium von einem Tag auf den anderen abzubrechen und Rabbiner zu werden. Seine Eltern waren alles andere als begeistert und erleichtert, als Mordechai zu Beginn nicht aufgenommen wurde. Sein Vater versuchte ihn dazu zu bewegen, sich wieder für Betriebswirtschaft einzuschreiben, doch Mordechai blieb stur. Als er die Möglichkeit hatte, eine Kantorenausbildung zu machen, während er auf der Warteliste für das Rabbinerseminar stand, ergriff er die Chance, ohne einen weiteren Gedanken daran zu verlieren.
Sein Zwillingsbruder Elliot, mit dem er seit Kindheitstagen bei allem konkurrierte, war der Einzige, der sich darüber freute, dass sein Bruder diesen Pfad einschlug. Er hatte die Hoffnung, dass sein Bruder als Kantor oder Rabbiner endlich mit diesem permanenten Konkurrenzkampf aufhören würde. Schon seit seiner Jugend hatte Elliot die Nase voll davon. Wann auch immer Mordechai eine bessere Note hatte oder mit einem Ferienjob mehr Geld verdiente, rieb er es Elliot permanent unter die Nase. Elliot hatte dies zwar, so gut es ging, ignoriert, was Mordechai jedoch nicht von seinem Verhalten abhielt.
Nachdem Elliot von den Plänen seines Zwillingsbruders erfahren hatte, unterstützte er diese. Er hatte die Hoffnung, dass sein Bruder endlich aufhören würde, ihn zu terrorisieren, und war sich durchaus bewusst, dass Mordechai finanziell nie mit ihm mithalten könnte. Eine Komponente, so hoffte Elliot, die Mordechai den Wind aus den Segeln nehmen würde.
Sofern Mordechai für keine der großen Synagogen mit über tausend Familien als Mitglieder arbeiten würde, machte sich Elliot keine Sorgen, als Steuerberater je weniger zu verdienen als sein um zwölf Minuten älterer Bruder. Elliot war klar, dass Mordechai nicht in der Lage war, so einen Posten zu bekommen. Sein schauspielerisches Talent reichte schlicht und einfach nicht aus, um ein Leben lang einen charismatischen Rabbiner zu geben.
Emily bemerkte vor lauter Aufregung nicht, wie schnell sich der Nachmittag dem Ende zuneigte. Als sich die beiden voneinander verabschiedeten, war sie von ihrem Gesprächspartner regelrecht verzaubert. Auf diesen Wanderungen hatte ihr noch nie ein Mann so viel Zeit gewidmet wie Mordechai. Auch er schien den Nachmittag genossen zu haben und versprach ihr, bald wieder nach Haifa zu kommen. Dvorah versuchte auf dem Weg nach Hause von Emily so viele Details wie möglich über deren neuen Bekannten zu erfahren.
Über die nächsten drei Monate hinweg trafen sich Emily und Mordechai im Rahmen dieser wöchentlichen Wanderungen, um sich besser kennenzulernen. Ihre Gespräche wurden von Woche zu Woche tiefsinniger und so geschah es, dass sie sich jeden Freitag mit schweren Herzen voneinander verabschiedeten. Unter der Woche befand sich Mordechai weiterhin in Jerusalem, wo er seit ein paar Jahren lebte, während Emily noch immer in Haifa wohnte. An ihrem letzten gemeinsamen Freitag Nachmittag hatte sie Mordechai davon erzählt, dass sie sich dazu entschlossen hatte, Ende des Monats, wenn der Mietvertrag für ihr Atelier auslief, wieder zu ihren Eltern nach Jerusalem zu ziehen. Mordechai hatte eine kleine Wohnung im Jerusalemer Stadtteil Baka angemietet. Emilys Eltern lebten nicht allzu weit entfernt in dem Stadtteil HaGiv‘a HaTzarfatit, der sich nördlich der Hebrew University befand, wo sie sich bereits nach ihrer Ankunft in Israel mit ihren Töchtern niedergelassen hatten.
Emily kannte die Gegend, in der Mordechai lebte, ziemlich gut, da ihre Schwester Lucy dort nach ihrem Militärdienst mit ihrem jetzigen Mann gewohnt hatte, bevor sie zurück in seine Heimatstadt Tel Aviv gezogen waren. Itamar hatte sich in Jerusalem nie so wohl gefühlt wie an der Küste. Er vermisste das Meer und die Atmosphäre der Stadt viel zu sehr, um dauerhaft in Jerusalem zu bleiben und dort eine Familie großzuziehen.
Seitdem sich Emily in Haifa befand, besuchte sie ihre Eltern in Jerusalem kaum, da Eliza und Samuel es vorzogen, nach Haifa zu kommen, um ein wenig Zeit am Meer mit ihrer Tochter zu verbringen. Emily ließ es sich jedoch nicht nehmen, zu den Feiertagen nach Jerusalem zu fahren, oder auch wenn im berühmten Stadtteil Yemin Moshe Kunstmärkte stattfanden, an denen sie und Dvorah regelmäßig teilnahmen. Emily liebte diesen Ort und besuchte ihn immer wieder gerne. Ihre Schwestern hatten beide dort geheiratet und wunderschöne Hochzeitsfotos bei der Montefiore Windmühle gemacht, die Emily in ihrem Wohnzimmer aufgestellt hatte. Sie träumte schon seit ihrer Jugend von einer Jerusalemer Hochzeit und konnte es kaum erwarten, bis sie an der Reihe war.
»Ich kann es noch immer nicht glauben, dass sich unsere Emily verlobt hat und zurück nach Jerusalem kommt!« Eliza Goldblum stand die Freude ins Gesicht geschrieben, als sie ihre jüngste Tochter umarmte. Gemeinsam warteten sie auf Samuel, der mit Mordechai in den Baumarkt gefahren war, um Umzugskartons zu besorgen. Emily hatte sich komplett verkalkuliert. Über die Jahre hinweg hatten sich nicht nur viele Kunstutensilien in ihrem kleinen Atelier angesammelt, sondern auch eine nicht allzu geringe Anzahl unterschiedlicher Werke, von denen sie sich nicht trennen wollte. Viele von ihnen Geschenke ehemaliger Kommilitonen und anderer Künstler.
Emily konnte es nicht erwarten, Mordechai Orly Sarfati vorzustellen, von der sie sich noch verabschieden musste. Sie würde sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge von ihrer Mentorin trennen. Natürlich freute sich Emily, mit Mordechai ein neues Leben zu beginnen, die regelmäßigen Gespräche mit der Künstlerin würden ihr hingegen fehlen. Die Stadt selbst würde Emily nicht vermissen. Haifa war ihr mittlerweile nicht mehr religiös genug, um dort auf Dauer zu leben. Sie hatte sich immer vorgestellt, nach ihrem Studium zurück nach Jerusalem zu gehen, eine Familie zu gründen und ihre Kinder dort aufwachsen zu sehen.
Die Gründe, warum sie doch so lange in Haifa geblieben war, konnte sie an einer Hand abzählen. Orly lebte und arbeitete dort, ihre beste Freundin Dvorah wohnte nur zehn Minuten von ihr entfernt, ein Großteil ihres Freundeskreises befand sich dort und natürlich war da das Gefühl, für die wöchentlichen Single-Wanderungen bleiben zu müssen, die sie so zu schätzen gelernt hatte.
Emily war dankbar, ihrer Intuition vertraut zu haben und nach ihrem Abschluss etwas länger geblieben zu sein, auch wenn sie nahe daran gewesen war, die Hoffnung aufzugeben und zurück nach Hause zu gehen. Sie hatte damals die Möglichkeit gehabt, nach Jerusalem zu ziehen, doch es hatte sich falsch angefühlt. Sie war glücklich, auf ihr Bauchgefühl gehört zu haben und in Haifa geblieben zu sein, da sie davon überzeugt war, Mordechai sonst nie kennengelernt zu haben.
Um das Leben am Meer richtig genießen zu können, hatte Emily nie genug Zeit gefunden. Für die wunderschönen Bahá’í Gärten hingegen schon.
Die Organisatoren der Wanderungen, Iris und Yitzhack, hatten, nachdem sie sich mit einem Rabbiner beraten hatten, da sich die Gruppe nicht im Klaren darüber war, ob sie sich diese religiöse Stätte ansehen konnten, vor gut zwei Jahren eine private Führung arrangiert. Emily würde die hitzige Diskussion nie vergessen. Ihr war durchaus bewusst, dass es im Judentum eine Vielzahl verschiedener Strömungen gab und dass jede die religiösen Gesetze anders auslegte, aber auf so ein Drama war sie nicht gefasst gewesen. Sie war sprachlos, als Dvorah und ein paar andere ihrer Bekannten verkündet hatten, nicht mitzukommen.
Obwohl sich Emily selbst unsicher war, stand für sie von Anfang an fest, dass sie mehr über diese wunderschönen Gärten erfahren musste. Sie ging jeden Tag an ihnen vorbei, um zu ihrem Atelier zu gelangen. Die symmetrische Perfektion dieser Prachtgärten inspirierte sie häufig. Die wundervollen Farben dieses Ortes fanden immer wieder ihren Weg in Emilys Werke. Vor allem in ihre floralen Filzlandschaften.
Bevor Emily Haifa verließ, machte sie mit Mordechai und ihren Eltern einen Spaziergang, um sich ein letztes Mal von dieser Stadt, die sie so lange ihr Zuhause genannt hatte, zu verabschieden. Sie wusste, dass sie irgendwann einmal wieder zu Besuch kommen würde. Immerhin war Jerusalem nicht aus der Welt.
Nach einer kurzen Verlobung heiratete Emily Mordechai an einem warmen Frühlingstag im März. Die Zeremonie fand unter freiem Himmel in den Botanischen Gärten Jerusalems statt, einem besonderen Ort für Emily. Das frischvermählte Ehepaar strahlte bis über beide Ohren. Mordechais Eltern Marvin und Ruth Horowitz konnten, wie auch sein Bruder Elliot und dessen Frau Naomi, die lange Reise nach Israel aufgrund einer anderen Reise, die seit Monaten geplant war und nicht umgebucht werden konnte, nicht antreten.
Elliot und Naomi befanden sich zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit ihren Kindern Sarah und David in Neuseeland, um Davids Abschluss zu feiern. Mordechais Eltern hatten Elliot und die Enkel nach Neuseeland begleitet, um ein wenig mit ihnen zu feiern und an einer Kreuzfahrt teilzunehmen, die ihnen Elliot und Naomi zum Hochzeitstag geschenkt hatten.
Emily hatte die Familie ihres Mannes bis dato nicht kennengelernt, wunderte sich aber nicht weiter darüber. Ihr war bewusst, dass nicht jeder seine Pläne einfach so über den Haufen werfen konnte, wenn sich jemand spontan verlobte und bereits nach nicht einmal sechs Wochen heiratete.
Es dauerte keine zwei Monate, bis Emily schwanger wurde. Gabriel erblickte im darauffolgenden Januar das Licht der Welt. Nathan folgte zwei Jahre später im Februar. Zu diesem Zeitpunkt wohnte die kleine Familie bereits in einem Neubauviertel im Jerusalemer Vorort Mevaseret Zion. Als Hochzeitsgeschenk hatten Mordechais Eltern ihnen dort eine kleine Wohnung gekauft, worüber Emily zu Beginn etwas irritiert war, was sie jedoch letztendlich nicht mehr überraschte, als Mordechai ihr nach ihrer Hochzeit davon erzählte, dass seine Eltern auch seinem Bruder und seiner Schwägerin nach deren Hochzeit auf die Füße geholfen hatten. Er selbst erwartete, dass es bei ihnen auch so sein würde. Emilys Mutter Eliza war überhaupt nicht davon begeistert, dass die Schwiegereltern dem Paar so ein teures Geschenk machten. Sie war regelrecht schockiert, dass weder ihre Tochter noch Mordechai einen Moment zögerten, dieses Geschenk anzunehmen. So hatten die Goldblums keine ihrer Töchter erzogen. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich Eliza noch zurück und auch Samuel sagte nichts weiter dazu. Sie wollten es vermeiden, einen unnötigen Streit heraufzubeschwören. Dafür war ihnen ihre Tochter viel zu wichtig.
Außerdem kannten sie Mordechai damals noch nicht so gut wie heute und waren bemüht, ein gutes Verhältnis zu ihm aufbauen. Eliza und Samuel hatten mit ihren ersten beiden Schwiegersöhnen großes Glück und hofften, dass sich Mordechai trotz des großen Altersunterschieds zu Emily, aber auch zu ihrer ältesten Tochter wunderbar integrieren würde. Was sie bis dato von ihm gesehen hatten, gefiel ihnen größtenteils, auch wenn sie selbst nicht religiös waren.
Über die nächsten vier Jahre hinweg fand Emily Inspiration in dem atemberaubenden Ausblick über die grüne Hügellandschaft, den sie von ihrer kleinen Terrasse aus hatte. Nie in ihrem Leben hätte sie gedacht, dass sie in einer so schönen Gegend leben und nahezu täglich diese atemberaubenden Sonnenuntergänge genießen würde. Emily kreierte in diesen Jahren Hunderte von Filzlandschaften, die sie immer wieder in kleineren Kunstgalerien in und um Jerusalem ausstellte und auf verschiedenen Kunstmärkten in der Region an Touristen verkaufte. Für ihre Aquarellmalerei hatte sie nur früh morgens Zeit, wenn ihre Söhne noch schliefen.
Mordechai arbeitete weiterhin als freischaffender Rabbiner und dachte mit Freunden und Bekannten darüber nach, eine kleine modern-orthodoxe Synagoge zu gründen.
Gabriel ging bereits in die einzige religiöse Privatschule der Stadt, die sich das Paar mit der Hilfe von Emilys Eltern leisten konnte, als Mordechai von einem Bekannten aus Amerika ein lukratives Angebot bekam.
Als Mordechai sich dazu entschlossen hatte, Rabbiner zu werden, träumte er davon, eine der großen modern-orthodoxen Synagogen in Amerika zu leiten. Er bewarb sich voller Hoffnung von Los Angeles bis New York auf diese heiß begehrten Stellen und versuchte sein Glück sogar in Kanada, bedauerlicherweise ohne Erfolg. Anstatt als freischaffender Rabbiner von New York aus zu arbeiten, stieg er, als er direkt nach der Universität eine Absage nach der anderen bekam, in den ersten Flieger nach Tel Aviv, um in Jerusalem einen Freund zu besuchen und den Kopf freizubekommen. Seitdem hatte er nie zurückgeblickt. Bis jetzt.
– 1 –
Heute
»Ich habe heute Vormittag einen Anruf von Max Greenberg aus Philadelphia bekommen.« Mordechai stand noch in der Tür, als Emily ihm bereits eine Tasse Kaffee einschenkte und sie neben einem Stück Zitronenkuchen auf dem Esstisch stellte.
»Max Greenberg? Kenne ich ihn?« Sie konnte sich bei bestem Willen an keine Greenbergs aus Philadelphia erinnern.
Mordechai schüttelte den Kopf. »Nein. Max und ich kennen uns von früher. Wir waren in derselben Theatergruppe, als wir studiert haben. Nach der Uni hat er über irgendeinen Verwandten oder Bekannten ein Angebot in Texas bekommen. Er war lange Zeit in Dallas Rabbiner und ist jetzt zurück in seiner Heimatstadt.«
»Und was wollte er von dir?« Emily räumte ein paar Spielzeuge aus dem Weg, die Nathan liegen gelassen hatte, um sich zu ihrem Mann an den Tisch zu setzen.
»Er hat mir von einer Synagoge erzählt, die nach einem Rabbiner sucht und den Kontakt für mich hergestellt. Ich habe bereits mit dem Vorstand gesprochen und es klingt alles sehr vielversprechend. Die Stelle ist vorerst befristet, damit sie sehen können, ob ich in ihre Gemeinde passe, aber das ist ganz normal.« Mordechai zog einen Stuhl heraus und setzte sich an seinen gewohnten Platz neben seine Frau.
»Und wo ist diese Synagoge?« Emily gefiel der Blick in seinen Augen überhaupt nicht.
Mordechai lehnte sich zurück, um die Reaktion seiner Frau besser beobachten zu können. »In Irland.«
»Nein! Das kommt gar nicht infrage. Wie sollen wir dort als Juden koscher leben? Außerdem ist es viel zu weit weg. Die Kinder haben hier ihre Freunde und meine Eltern sind auch hier.« Emily schüttelte den Kopf.
»Koschere Lebensmittel sind überhaupt kein Problem. Es gibt einen Supermarkt, der koscheres Fleisch aus Großbritannien verkauft, und sie liefern sogar nach Hause, wenn du in der Nähe wohnst. Fisch gibt es auch wie Sand am Meer, Emily. Es ist schließlich eine Insel. Du musst dir wirklich keine Sorgen machen.«
»Bis wann musst du ihnen Bescheid geben?«
»Ich habe die Stelle bereits angenommen. In drei Wochen fliegen wir.«
Die Wut stand Emily ins Gesicht geschrieben. Sie konnte nicht fassen, was ihr Mann sagte. Er hat eine Stelle im Ausland angenommen, ohne vorher mit ihr zu sprechen. Wie konnte er so etwas nur über ihren Kopf hinweg entscheiden? Gerade als sie etwas sagen wollte, läutete es an der Haustür und sie sprang auf, um ihre Söhne hereinzulassen, die mit den Nachbarskindern im Hof des Wohnhauses gespielt hatten.
– 2 –
Die letzten Wochen in Israel vergingen wie im Flug. Emily hätte es ohne die Hilfe ihrer Eltern nicht geschafft, alles so schnell zu erledigen. Jeden Morgen kam ihre Mutter Eliza vorbei, um Emily die Kinder abzunehmen und mit ihnen in den Park zu gehen, ans Meer zu fahren oder eines der vielen kinderfreundlichen Museen zu besuchen, die Jerusalem zu bieten hatte. Samuel, der noch immer an der Universität unterrichtete, traf seine Frau und seine Enkelkinder täglich zum Mittagessen, um ein wenig Zeit mit ihnen zu verbringen. Er war von dem bevorstehenden Umzug begeistert und konnte es kaum erwarten, seine Tochter und ihre Familie in Irland zu besuchen. Bevor Samuel mit seinem Studium begonnen hatte, hatte er sich gemeinsam mit seinen Freunden dazu entschlossen, den Sommer in Europa zu verbringen. Er konnte sich noch sehr gut an Irland erinnern. Dublin war die erste Station auf ihrer Reise, bevor es nach London und Paris ging.
Während die Kinder unterwegs waren, misteten Emily und Mordechai ordentlich aus und packten die Sachen, die sie mit nach Europa nehmen würden. Den Rest würden sie bei Emilys Eltern unterstellen.
In dem ganzen Chaos zeigten sie ihre Wohnung potenziellen Mietern, die sie möbliert übernehmen wollten. Es dauerte eine ganze Weile, bis sie ein vertrauenswürdiges religiöses Paar fanden, bei dem Mordechai ein gutes Gefühl hatte. Weder er noch Emily wollten ihre Wohnung einer nicht-religiösen Familie überlassen. Dabei waren sie sich von Anfang an einig.
Zu Beginn wollten sie ihre Wohnung überhaupt nicht vermieten, doch Mordechais Vater pochte darauf, da so jemand anderer und nicht er die Kreditraten eine Weile zurückzahlen würde. Emily war nicht bewusst gewesen, wie viel ihr Schwiegervater in diese Wohnung investierte, und hatte sich auch nie dafür interessiert. Sie dachte, Mordechai wüsste es. Als sie ihren Eltern davon erzählte, übten auch sie Druck aus, einen Mieter zu finden. Eliza konnte sich diesmal nicht zurückhalten und erklärte Emily, dass sie und Mordechai nicht erwarten konnten, dass ihre jeweiligen Elternpaare sie ein Leben lang finanzierten, so gerne sie die Schulkosten der Kinder auch übernahmen, konnte das so nicht auf Dauer weitergehen. Emily verstand das Problem ihrer Mutter nicht und erklärte ihr, wie unfair Mordechai es fand, dass sein Bruder bei seiner Hochzeit eine Wohnung bekommen hatte und sie ihre jetzt faktisch selbst mit den zukünftigen Mieteinnahmen abbezahlen mussten. Eliza konnte nicht glauben, was sie da aus dem Mund ihrer Tochter hörte. Auch Samuel, der sich alles hatte selbst erarbeiten müssen und nie auf die Idee gekommen wäre, von irgendjemandem finanziert zu werden, schüttelte nur den Kopf. Um keinen Streit mit seiner Tochter anzufangen, bevor sie das Land verließ, bat er Eliza, sich nicht einzumischen. Es handelte sich immerhin um ein Problem innerhalb der Familie Horowitz und nicht um eines zwischen ihnen und ihrer Tochter.
Während sie noch in Israel waren, versuchte Emily, sich mit so vielen Nachbarn und Freunden wie möglich zu treffen. Tagtäglich ging sie mit ihren Kindern auf den Spielplatz, damit sie mit ihren Freunden aus der Nachbarschaft spielen konnten. Zu Emilys großer Überraschung freuten sich die Kinder auf den bevorstehenden Umzug. Viele ihrer Freunde gingen mit ihren Eltern zurück in deren jeweilige Heimatländer, oftmals die Staaten oder Kanada, oder wanderten mit ihren Familien aus, sodass Gabriel und Nathan ihre bevorstehende Reise als ein großes Abenteuer sahen.
Emily schloss sich in diesen letzten Wochen in Israel sogar einer Frauengruppe an, die sich regelmäßig zum Basketball spielen traf, nachdem eine Nachbarin gesehen hatte, wie gestresst sie war, und sie überzeugt hatte, sie zu begleiten, um den Kopf freizubekommen und ein wenig Abstand von dem Ganzen zu gewinnen.
Emily tat alles, um nicht allzu oft mit ihren Gedanken oder Mordechai alleine zu sein. Sie war noch immer wütend darüber, dass er sie bei der Entscheidung, nach Dublin zu gehen, nicht miteinbezogen hatte. Dies würde sie ihm nicht so schnell verzeihen. Er wusste, dass sie Israel nicht verlassen wollte, und hatte diesen Wunsch dennoch ignoriert. Emily kam sich bis zu einem gewissen Grad betrogen vor, was ihr nicht dabei half, ihre Sachen zu packen. Am liebsten hätte sie jedes einzelne Stück zum Fenster hinausgeschmissen.
Mordechai war ein anderer Typ Mensch. Kaum war alles erledigt, setzte er sich in sein kleines Arbeitszimmer, das mehr einer Abstellkammer als einem Büro glich, und fing an, die erste Predigt für seine neue Synagoge zu schreiben. Entweder fiel es ihm nicht auf oder er ignorierte, dass seine Frau versuchte, die bevorstehende Flugreise zu verdrängen. Er war so in seiner Arbeit vertieft, dass er nicht merkte, wie Emily ständig mit den Kindern unterwegs war und seine Söhne permanent erschöpft waren und sich auf gar nichts mehr konzentrieren konnten.
– 3 –
Ihren letzten Abend im Nahen Osten verbrachte die Familie Horowitz ganz zu Mordechais Missfallen bei den Goldblums, wo sie auch übernachten würden. Emilys Schwester Lucy und ihr Mann Itamar waren mit den gemeinsamen Töchtern Maya und Noa aus Tel Aviv zum Abendessen gekommen, um sich von ihrer Schwester und ihren Neffen zu verabschieden. Lucys Tochter Ilana befand sich mit Freunden außer Landes, sodass sie an dem Abendessen nicht teilnehmen konnte. Sie versprach ihrer Mutter jedoch, ihre Tante vor dem Schlafengehen anzurufen, um ihr einen guten Flug zu wünschen.
»Freust du dich schon auf Irland?«, riss Lucy ihre kleine Schwester aus den Gedanken.
Emily, die vor wenigen Minuten ihre Söhne ins Bett gebracht hatte und gerade dabei war, sich ein weiteres Glas Wein einzuschenken, seufzte nur. »Es ist Gottes Wille.«
»Ich habe nicht gefragt, wessen Wille es ist, dass ihr umzieht, sondern ob du dich darauf freust.« Lucy verdrehte die Augen.
»Wir werden sehen, wie es wird.« Ohne ein weiteres Wort zu sagen, leerte Emily ihr Glas in einem Zug.
Itamar, der seiner Frau gegenübersaß, blickte seine Schwägerin verwundert an, sagte jedoch nichts. Ihm war es lieber, den Frauen zuzuhören und immer mal wieder etwas zu sagen, anstatt sich mit Mordechai unterhalten zu müssen, der zu Itamars Erleichterung in ein Gespräch mit ihrem Schwiegervater vertieft war. Seine eigenen Töchter saßen wie immer auf dem geräumigen Sofa im Wohnzimmer ihrer Großeltern und spielten mit ihren Smartphones. Beide waren Anfang zwanzig und wollten ihre Eltern eigentlich nicht nach Jerusalem begleiten, um sich von der Familie Horowitz zu verabschieden. Sie wären viel lieber zum Flughafen gefahren, um sicherzugehen, dass Mordechai wirklich ins Flugzeug stieg. Hätte ihr Großvater sie nicht beide im Laufe des Nachmittags zwischen seinen Vorlesungen angerufen, säßen sie jetzt am Strand in Tel Aviv und würden Cocktails mit ihren Freunden schlürfen. Itamar musste schmunzeln, als er daran dachte, wie erleichtert vor allem Maya war, dass ihre Wohnung in Tel Aviv nicht koscher genug für Mordechai war, um bei ihnen zu übernachten. Obwohl beide Mädchen viel Zeit in den Wohnungen ihrer Freunde verbrachten, waren sie noch nicht offiziell aus ihrem Elternhaus ausgezogen. Lucy hatte kein Problem damit, dass ihre Töchter mehr Zeit bei ihren Freunden verbrachten als bei ihr und Itamar. Sie sah alles etwas lockerer als er und verstand, dass ihre Töchter nicht für immer bei ihnen wohnen würden.
Es war für Eliza und Samuel mehr als offensichtlich, dass sowohl Lucy als auch Itamar an diesem Abend versuchten, so wenig wie möglich mit ihrem Schwager zu sprechen. Jedes Mal, wenn vor allem die Männer aufeinandertrafen, endete eine relative ruhige Diskussion in einem heftigen Streit darüber, warum es so schrecklich für Mordechai war, dass so viele Israelis als Atheisten oder Agnostiker durchs Leben gingen und die Synagoge komplett ignorierten. Beim letzten gemeinsamen Essen waren sie sich fast an die Kehle gegangen, weil Itamar es gewagt hatte zu sagen, dass er froh war, nur Töchter zu haben, weil er ein gewaltiges Problem mit Beschneidungen hatte und so etwas einem Sohn nie antun würde. Die Goldblums hatten Mordechai noch nie so wütend erlebt wie in dem Moment, in dem Itamar ihm mitgeteilt hatte, dass es für ihn einfach keinen Sinn machte. Nach seiner Logik brauchte man Jungen nicht mehr beschneiden, da man Frauen auch nicht mehr steinigte, wenn sie ihre Männer betrogen. Lucy war durchaus bewusst, dass ihr Mann gewisse Dinge nur sagte, um Mordechai auf die Palme zu bringen. Hätten sie einen Sohn gehabt, war sie sich zu neunzig Prozent sicher, dass er ihn hätte beschneiden lassen. Ihm machte es jedoch viel mehr Spaß, seinen Schwager in diesen Situationen zur Weißglut zu bringen. Samuel würde lügen, wenn er behaupten würde, das Verhalten seiner beiden Schwiegersöhne amüsiere ihn nicht. Er hielt sich für gewöhnlich aus diesen Diskussionen heraus, weil es keinen Sinn machte, sich wegen den beiden aufzuregen und womöglich noch einen Herzinfarkt zu riskieren.
Itamar stammte aus einer laizistischen Familie und verbrachte fast sein ganzes Leben im Norden Tel Avivs. Er hatte zwar in Jerusalem studiert, konnte sich jedoch nie so richtig mit der Stadt anfreunden. Sie war ihm zu religiös und das Meer viel zu weit weg. Seine Familie war schon immer im Nahen Osten ansässig und hatte sich bereits mit der Gründung Tel Avivs 1909 dort niedergelassen. Itamar stammte von jüdischen Palästinensern ab und mochte Menschen wie Mordechai nicht, die nicht nur den Konflikt zwischen beiden Parteien ignorierten, sondern auch meinten, es sei ihr Land. Amerikaner, wie sein Schwager einer war, waren ihm schon immer ein Dorn im Auge gewesen. Er verstand nicht, warum Menschen wie Mordechai besessen davon waren, die Vereinigten Staaten zu verlassen, um sich in irgendwelchen Siedlungen im Westjordanland niederzulassen. Als er davon gehört hatte, dass Emily und Mordechai sich ein paar Wohnungen in Siedlungsgebieten in der Nähe von Jerusalem angeschaut hatten, war er schockiert. Genauso wie Emilys Eltern war auch Itamar erleichtert, als ihre Schwiegereltern ein Machtwort gesprochen hatten.
Als Lucy ihm von Emilys Vorhaben erzählt hatte, hatte er seiner Frau klar gemacht, dass er Emily und Mordechai nie im Leben in einer Siedlung besuchen würde. Er wollte es vermeiden, sich in einem Feuergefecht zwischen fanatischen Siedlern und Palästinensern wiederzufinden. Mordechai war die letzte Person auf Erden, für die er sein Leben und das seiner Familie riskieren würde.
Ginge es nach Itamar, würde das Rückkehrgesetz gestrichen werden. Seiner Meinung nach sollten die Einwanderungsgesetze modernisiert und angeglichen werden. Die Tatsache, dass jeder so mir nichts, dir nichts sofort die Staatsbürgerschaft und eine Arbeitserlaubnis bekommen konnte, ohne auch nur einen Elternteil oder Großelternteil mit israelischer Staatsbürgerschaft zu haben, missfiel ihm sehr. Er konnte schließlich auch nicht einfach so in den Staaten landen und so da bin ich sagen. Genau darüber hatte Itamar bei einem der letzten Familienessen mit Mordechai gestritten. Er war auch heute nahe dran gewesen, mit seinen Töchtern zu Hause zu bleiben. Emily hatte ihm damals an den Kopf geworfen, dass er seine Frau ohne dieses Gesetz nie kennengelernt hätte. Itamar erklärte seiner Schwägerin daraufhin das jüdische Konzept der Seelenverwandtschaft und dass er felsenfest davon überzeugt war, dass er Lucy so oder so kennengelernt hätte. Wenn nicht in der Armee, dann auf einer Reise oder über Freunde.
Emily und Mordechai vergaßen gerne, dass Itamar sich, obwohl er nicht religiös war, sein ganzes Leben lang für jüdische Geschichte, Religion und Kultur interessiert hatte. Sein Interesse hatte unter anderem dazu geführt, dass er nach seinem Wehrdienst Geschichte als Nebenfach studiert hatte. Er arbeitete zwar nicht auf diesem Gebiet, las aber jedes Jahr unzählige Bücher zu diesen Themen. Itamar liebte es, Mordechai zu korrigieren und seine biblischen Zitate mit wissenschaftlichen und historischen Fakten zu widerlegen, was Eliza wiederum regelmäßig zum Schmunzeln brachte, nachdem ihre Kinder und Enkelkinder nach Hause gegangen waren.
»Ich kann nicht glauben, dass es schon Zeit ist zu gehen. Gib den Jungs morgen früh einen Kuss von mir und melde dich, wenn ihr angekommen seid.« Lucy umarmte ihre kleine Schwester ein letztes Mal, bevor sie ihrer Familie zum Auto folgte.
Für Emily war es immer noch befremdlich, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben nicht im selben Land wie ihre Schwester oder ihre Eltern leben würde. Sie vermisste auch Molly an diesem Abend mehr als sonst. Obwohl sie ihre Abreise bis jetzt hatte verdrängen können, hatte Emily das Gefühl, dass es jetzt richtig ernst wurde. Sie wusste, dass ihre Auswanderung nicht von Dauer sein würde, aber irgendwie fühlte es sich doch eigenartig an dem Land, das sie so sehr liebte, den Rücken zu kehren. Um sich abzulenken, kümmerte sie sich um die Küche ihrer Mutter, nachdem alle ins Bett gegangen waren. Sie konnte ohnehin nicht schlafen und machte sich lieber nützlich, als die ganze Nacht über die bevorstehende Reise und ihren Neuanfang in Europa nachzudenken.
Als Emily auf Zehenspitzen ins Wohnzimmer schlich, um sich zu ihrem Mann auf das ausgezogene Sofa zu legen, wurde sie von Panik überwältigt. Ihr wurde abwechselnd heiß und kalt. Sie begann zu zittern und das Atmen fiel ihr immer schwerer. Mordechai schlief wie ein Stein und merkte nichts davon, wie seine Frau sich über alles Mögliche Sorgen machte. Von der bevorstehenden Reise bis hin zu ihrem neuen Zuhause, das ihnen von der Synagoge zur Verfügung gestellt wurde, und der neuen Schule ihrer Söhne. Es machte ihr vor allem zu schaffen, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben die Frau des Rabbiners einer aktiven Synagoge sein würde.
Emily konnte noch immer nicht glauben, dass sie für ein paar Jahre nach Irland ziehen würden. Es wurde ihr erst jetzt richtig bewusst, dass sie morgen zwar in Israel aufwachen, aber in einer ganz neuen Umgebung schlafen gehen würde – und das für eine sehr lange Zeit.
Emily war bisher nur einmal in Europa gewesen. Nach ihrer Zeit in der Armee wollten ihre Eltern ihr unbedingt Frankreich zeigen, das Land, in dem sie sich verlobt und später auch ihre Flitterwochen verbracht hatten.