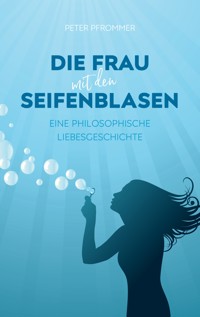
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eine unbekannte Person nimmt Kontakt mit dir auf und behauptet: »Ich bin du.« Die meisten würden die Nachricht sofort löschen. Oder doch nicht? Denn da steht auch noch: »Dieser Kontakt verhilft dir zu wahrem Glück, unantastbarem Frieden und bedingungsloser Liebe.« Klingt das nicht verlockend? Und schon befindest du dich in einem unglaublichen Austausch, der dein gewohntes Leben durcheinanderwirbelt. Nur langsam dämmert es dir, worum es geht: um dich selbst! Aber wer verbirgt sich hinter diesem rätselhaften Kontakt mit der merkwürdigen Bezeichnung 'Es'? Eine Art Guru, eine weise Frau oder gar eine KI? Und was hat das alles mit Seifenblasen zu tun? Aus dem Vorwort von Christian Salvesen: »Ich darf es hier verständlicherweise nicht vorwegnehmen. Ich kann nur versichern, es ist tatsächlich von enormer Bedeutung und Tragweite. Und wie uns der Autor allgemeinverständlich, jede Altersgruppe ansprechend, spielerisch unterhaltsam und doch auch wieder intensiv und zum verbindlichen Mitmachen auffordernd immer tiefer in einen Bereich führt, den wir so wenig zu kennen scheinen, obwohl er uns so nahe ist wie nichts anderes - also das ist ... aber sehen Sie selbst!« Eine philosophisch-poetische Liebesgeschichte über das Mysterium unserer wahren Natur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ein zurückgezogen lebender Mathematikstudent hat sein Studium abgebrochen und bestreitet seinen Lebensunterhalt als Paketbote. Eines Tages tritt ein unbekannter Chatpartner mit ihm in den Dialog, der sich als Es präsentiert. Da die Nachrichten des geheimnisvollen Es ungewöhnlich schnell auf dem Display seines Handys aufleuchten, hält er den Unbekannten zunächst für das Erzeugnis einer KI. Doch die Inhalte des Gesprächs passen nicht recht dazu. Sie kreisen um Liebe, Leid und Glück, und schließlich regt ihn das unbekannte Es dazu an, seine Sicht auf sich selbst zu verändern. Gemeinsam erforschen sie Fragen der persönlichen Identität, was ihm zu neuem Lebensmut verhilft. Doch wer ist dieses mysteriöse Es, das in rätselhafter Weise mit Seifenblasen zu tun hat? Kurz bevor sich das Geheimnis zu lüften scheint, bricht der Dialog schlagartig ab, und der junge Mann muss die Erforschungen vorerst allein weiterführen …
Prof. Dr. Peter Pfrommer, geb. 1966, studierte und promovierte im Bereich der Bauphysik, die sich mit den verschiedenen Umwelteinwirkungen auf den Menschen auseinandersetzt. Seit 1998 lehrt er als Professor an der Hochschule Coburg im Spannungsfeld von Wissenschaft und Kunst. Seine Erfahrungen in der Selbsterforschung vermittelt er seit 2013 im Hochschulseminar »Wer ist Ich?« sowie in zahlreichen Vorträgen und Veröffentlichungen.
für
Heike
Inhalt
Vorwort
Prolog
Teil I
1. Es
2. Denken
3. Glück
4. Ich
5. Transparenz
6. Jetzt
7. Liebe
Teil II
8. Notrufe
9. Verlust
10. Künstliche Intelligenz
11. Welt
12. Leid
13. Wunsch
14. Esmeralda
Teil III
15. Erlösung
16. Worte
17. Bedeutung
18. Paradies
19. Abendlicht
20. Seifenblasen
21. Anfang
Vorwort
Was würden Sie empfinden und sagen, wenn sich auf Ihrem Smartphone unvermittelt eine unbekannte Kontaktperson melden und behaupten würde, Sie zu sein? Nicht nur das, auch gleich darauf in Sekundenschnelle einen ersten Beleg böte, mit einer Bemerkung über Sie, die niemand sonst machen könnte außer Sie selbst?
Mit einem solch erstaunlichen Einfall beginnt Peter Pfrommer seine spannende Geschichte. Sie entwickelt sich in einem Smartphone-Dialog durch emotionale Höhen und Tiefen zu einer einzigartigen Liebesbeziehung und einer tiefgründigen Einsicht. Es ist eine Art zeitgemäßer Briefroman im Fantasy- oder Science-Fiction-Gewand, so könnte man zunächst meinen.
Doch eigentlich handelt es sich zugleich um eine wissenschaftlich-empirische Forschung und eine philosophische Abhandlung. Ich sehe hier eine kongeniale Fortsetzung von René Descartes´ Meditationen. Zumindest was die Frage-Richtung betrifft: Wer oder was bin ich wirklich? Und das Ergebnis ist einerseits ähnlich wie bei Descartes, geht aber andererseits in einem positiven Sinne weit darüber hinaus.
Ich darf es hier verständlicherweise nicht vorwegnehmen. Ich kann nur versichern: Es ist tatsächlich von enormer Bedeutung und Tragweite. Und wie uns der Autor allgemeinverständlich, jede Altersgruppe ansprechend, spielerisch unterhaltsam und doch auch wieder intensiv und zum verbindlichen Mitmachen auffordernd immer tiefer in einen Bereich führt, den wir so wenig zu kennen scheinen, obwohl er uns so nahe ist wie nichts anderes – also das ist … aber sehen Sie selbst!
Christian Salvesen, Januar 2025
Prolog
Du schreibst: wahre Liebende begegnen sich nicht. Ein Zitat von Rumi. Es macht mich sehr traurig. Du sagst, ich soll die Traurigkeit wiegen wie mein eigenes Kind. Dann beginnt sie, in einer endlosen Offenheit zu schweben. Dort, sagst du, sind wir beide eins.
Und doch sind wir uns begegnet. Hintergrund und Vordergrund sind nicht getrennt. Du behauptest, es war ein Selbstgespräch, und doch spüre ich dich in jedem deiner Worte. Ich habe unseren hastigen Austausch noch einmal durchgesehen und so geformt, dass er klingt wie ein flüssiges Gespräch. Und jedes Mal, wenn ich hineinlausche, sitze ich mit dir am Rande der Welt und lasse die Beine baumeln in die Unendlichkeit.
Teil I
1. Es
Unsere erste Begegnung fand im Spätsommer statt. Ich hatte ungewöhnlich lange geschlafen. Die Sonne brannte durch das Dachfenster auf meinen unaufgeräumten Schreibtisch. Ein leichter Druck hinter der Stirn erinnerte mich an den gestrigen Abend. Ich fand mein Handy zwischen den Papieren auf der Tischfläche und tippte eine erste Nachricht: »Du nochmal Danke für das super Gespräch gestern. Ich bin heute gleich ganz anders aufgestanden. Erst mal drei bewusste Atemzüge und ein inniges Lächeln zu mir selbst. Und dann die Frage: Für was bin ich dankbar? Hat geholfen. Ich fühle mich schon besser. Bald wieder!«
Ich trat an mein schmales Dachfenster und schaute hinunter auf die belebte morgendliche Straße. Würde sie gleich antworten? Es dauerte tatsächlich nicht lange, da bimmelte das Telefon. Doch statt der erhofften Antwort stand da lediglich: »Falsche Adresse«. Verwundert starrte ich auf das Display meines Handys. Als Name meines Gesprächspartners las ich ein kurzes, schlichtes ›Es‹. Was sollte denn das bedeuten? Ich hatte ohnehin keinen großen Bekanntenkreis, also war die Anzahl meiner Kontakte überschaubar. Ich war mir sehr sicher, dass ein Es nicht darunter war. Und wie kam es, dass ich fälschlicherweise diesen Kontakt ausgewählt hatte? Vermutlich, weil er ganz oben in der Liste stand, überlegte ich. Zögerlich tippte ich eine Antwort: »Das verstehe ich jetzt nicht. Wer bist denn du? Ich kenne deinen Kontakt gar nicht.«
Die Reaktion kam prompt: »Ich bin Du!«
Verwirrt blätterte ich in meinen Kontakten. Da gab es tatsächlich einen Eintrag mit der Bezeichnung ›Es‹. Die dazugehörige Nummer kam mir unbekannt vor.
»Wer hat dich hinzugefügt?«, fragte ich, obwohl mir die Frage selbst etwas merkwürdig vorkam.
»Ich«, lautete die knappe Antwort.
Meine unbekannte Kontaktperson antwortete schnell. Fast unmittelbar mit dem Abschicken meiner Nachricht kam auch schon die Reaktion. »Wie das?«, wollte ich wissen. »Und was bedeutet ›Es‹? Klingt unheimlich. So nach Steven King.«
»Den Film hast du doch gar nicht gesehen. Dazu bist du doch viel zu zart besaitet.«
Wieder erschien die Antwort mit atemberaubender Geschwindigkeit. Dadurch kam auch ich in Fahrt: »Du willst mich verarschen«, kommentierte ich. »Wenn du dich nicht zu erkennen gibst, dann lösch ich jetzt einfach den Kontakt.«
»Das steht dir frei«, erwiderte die Verbindung blitzschnell. »Ich würde es aber nicht empfehlen. Dieser Kontakt verhilft dir zu wirklichem Glück, unantastbarem Frieden, bedingungsloser Liebe. Das ist doch was du willst, oder?«
Einen Moment verharrte ich regungslos. Wie sollte man auf sowas reagieren? Ich war nicht gerade ein begnadeter Nutzer von Messenger Diensten. Und ich telefonierte eigentlich noch weniger gerne. Trotzdem verkündete ich: »Okay, dann rufe ich dich jetzt an.«
»Es wird sich ›Niemand‹ melden«, prognostizierte Es. »Außerdem bist du gar nicht so mutig wie du tust.«
»Du scheinst mich ja gut zu kennen«, bekundete ich.
»Außerordentlich gut«, bestätigte Es. »Wie schon gesagt: Ich bin Du.«
Mir wurde klar, dass ich hier mit Drohgebärden oder Provokationen nicht weiterkam. Ich musste etwas vorsichtiger nachforschen. »Na gut«, begann ich. »Hier steht aber ›Es‹. Was bedeutet das? Bist du ein männliches Es oder ein weibliches Es?«
Nahezu ohne Zeitverzögerung kam die Antwort: »Weiblich wäre dir lieber, nicht wahr?«
Ich hatte keine Lust auf diese Anspielung einzugehen. Außerdem erschien mir die Frage unpassend. »Warum fragst du, wenn du es sowieso weißt?«, hielt ich entgegen. »Also, bist du männlich oder weiblich?«
»Weder noch und sowohl als auch.«
»Klingt schräg.«
»Ist es aber nicht! Selbst wenn ich damit meine Sexualität meinen würde, dann wäre sie nicht schräg«, erklärte Es. »Es ist nicht schräg sowohl weiblich als auch männlich zu sein. Aber ich meine nicht meine Sexualität. Es geht hier um etwas, was jenseits davon ist.«
Dieses Gespräch wurde immer absurder. Und immer wieder verwunderte mich die Tatsache, dass die Antworten von Es so unmittelbar aufblitzten. Als wären sie schon vorformuliert gewesen. »Sorry, aber ich verstehe gerade nichts mehr«, gab ich offen zu.
»Du willst wissen, was ›Es‹ bedeutet«, kommentierte Es und ergänzte: »Wenn du zum Beispiel sagst: ›Es regnet‹. Was ist dann Es?«
Gute Frage, das hatte ich mir noch nie überlegt. »Hm, vielleicht das Wetter?«, stellte ich zur Diskussion. Das schien mir zwar die einfachste Antwort, aber wohl kaum die richtige.
»Sicher?«, bestätigte Es meinen Zweifel. »Spür der Bedeutung nochmal genauer nach. Du meinst nicht nur das Wetter!«
»Na gut.« Ich überlegte einen Moment. »Vielleicht die ›Situation‹?«
Als hätte Es meine Entgegnung vorhergesehen, war auch schon die Gegenfrage da: »Ja, sehr gut, aber wo beginnt die Situation und wo endet sie? Kann man sie eingrenzen?«
Ich wusste nur, dass mich diese Situation überforderte. Mehr als ein »Hä?«, brachte ich nicht mehr zustande.
»Hä heißt: Es ist unverständlich«, stellte Es nüchtern fest und wiederholte: »Was ist Es?«
»Du!«
Diesmal konterte ich genauso schnell. Das unbekannte Es ließ aber nicht locker: »Sicher? Was ist Es?«
Ging das jetzt immer so weiter, schwirrte es mir durch den Kopf. »Mir reicht es langsam.«
»Es reicht dir«, erschien auf dem Display. »Was ist Es?«
Mir wurde klar, dass ich aus dieser Nummer nur herauskam, wenn ich mich mit der aufgeworfenen Frage ehrlich auseinandersetzte. Daher las ich die bisherige Konversation noch einmal durch. Mit ›Es‹ in den verschiedenen Es-Aussagen konnte nichts Konkretes gemeint sein, nichts, was man abgrenzen und benennen konnte. Sonst würde man ja zum Beispiel sagen ›Das Wetter regnet‹ oder ›Das Gespräch reicht mir‹. Stattdessen ließ man die Aussagen durch Verwendung von ›Es‹ absichtlich wage. Sie wurde dadurch gewichtiger und umfassender.
»Gut, es dämmert mir langsam, was du meinst«, vermeldete ich. »Ja genau: ES dämmert mir!!! Bitte keine Nachfrage!«
»Sehr gut«, lobte Es nach einigen Sekunden. »Du hast es also mit etwas sehr Umfassendem zu tun. Umfassender geht nicht.«
Das klang nun doch etwas anmaßend.
»Ich bin beeindruckt!«, bemerkte ich trocken.
»Es freut mich, dass du langsam auftaust und dein Humor durchkommt.«
»Wer ist Es?«
Wieder brauchte Es einige Sekunden für die Antwort. Offensichtlich schaffte ich es langsam, dass Es zumindest ein wenig aus dem Konzept zu bringen.
»Wie gesagt«, lautete schließlich die etwas kurz angebundene Entgegnung.
Nun schien mir eine günstige Gelegenheit zu sein, die Richtung des Gespräches zu ändern. Vielleicht konnte ich doch noch etwas Brauchbares über das mysteriöse Es in Erfahrung bringen.
»Und wie geht es jetzt weiter mit uns?«, wollte ich wissen. »Ich habe schon verstanden, dass das wohl kaum eine Liebesgeschichte geben wird. Schade.«
»Im Gegenteil«, widersprach Es. »Das wird die ultimative Liebesgeschichte – warte ab.«
Diese Antwort hatte ich nun nicht erwartet. »Ich dachte eher an eine Liebesgeschichte mit erotischer Komponente«, bohrte ich nach. »Keine philosophische Liebe mit abstraktem Glück-Frieden-Eierkuchen.«
»Gut, ich werde mal schauen, was sich machen lässt«, stellte Es in Aussicht. »Wir fangen ja erst an. Lektion 1: Denk über das ›Es‹ nach! Bis dann.«
Lektion 1? Bis dann? War das etwa das Ende? Ich wartete mehrere Minuten, aber das Handy blieb still.
2. Denken
So unversehens wie dieses merkwürdige Es in meinem Leben aufgetaucht war, so schnell war es auch wieder verschwunden. Das letzte ›Bis dann‹ deutete wohl darauf hin, dass das Gespräch irgendwann weitergehen sollte. Und die ›ultimative Liebesgeschichte‹ hatte tatsächlich mein Interesse geweckt. Trotzdem traute ich mich nicht nachzuhaken. Ja, und ich gebe zu, auch die Sache mit dem Es ließ mir keine Ruhe. Was hatte es damit auf sich? Was genau war damit gemeint?
Als ich nach dem Chat wie jeden Morgen den alten Transporter der Lieferfirma bis unters Dach mit Paketen belud, kam mir plötzlich eine Idee. Es sah eindeutig so aus, als bestünde meine Ladung aus vielen verschiedenen Kisten. Sie mussten schließlich auch zu unterschiedlichen Orten befördert werden. Aber gab es die Pakete wirklich unabhängig voneinander? Zumindest in meinem Lieferwagen hingen sie zusammen. Würde ich eines von den Unteren herausziehen, dann würde mir die ganze Ladung entgegenfallen. Und bestand nicht jede der Kisten wieder aus vielen kleineren Teilen, die sich selbst bis ins subatomare Gefüge unterteilen ließen. Gab es so etwas wie ›kleinste Teile‹? Wenn nicht, existierten dann überhaupt Teile? Aber wenn es keine Teile gab, was war das dann, das sich in meinem Sprinter stapelte? Statt endlich loszufahren, starrte ich auf die offene Heckklappe. Was sich da stapelte, so kam es mir in den Sinn, war nichts anderes als Es. ›Es‹ war also ein anderer Ausdruck für das ›Ganze‹, für das ›Universum‹, für die ›Welt‹. Gleichzeitig merkte ich, dass ich mir etwas ›Ganzes‹ gar nicht vorstellen konnte. Ich konnte mir nur Einzelteile denken, denen ich eine eigene Bedeutung zusprach. Und das schien mir auch irgendwie berechtigt zu sein. Trotzig schlug ich die Heckklappe des Wagens zu und fuhr los. Und während ich ein Paket nach dem anderen auslieferte, wusste ich doch, dass ich mit meinem Trotz unrecht hatte.
Mehrere Tage verstrichen, bis sich Es mit einem »Es ist wieder da!« von sich aus wieder bei mir meldete.
»Aha«, entgegnete ich. »Dachte schon, die Sache hätte sich erledigt.«
»Ja, Sachen erledigen sich«, bestätigte Es. »Dieses Gespräch hier ist aber keine Sache.«
Die Nachricht erschien wieder augenblicklich. Wie konnte man nur so schnell tippen, überlegte ich. In diesem Moment kam mir eine Idee. In den letzten Wochen hatte ich immer wieder im Internet nach künstlicher Intelligenz gesucht und einiges ausprobiert. Nicht weil mich KI sonderlich interessierte. Sondern eher, weil KI in der Allgemeinheit so ein wichtiges Thema geworden war und ich nicht gänzlich abgehängt werden wollte. Das war mir zuvor mit den Sozialen Medien so gegangen. Als ich mich auf der ersten Plattform angemeldet hatte, war diese schon wieder völlig aus der Mode. Aber wie auch immer: Konnte es vielleicht sein, dass ich bei meinem laienhaften Herumgestöber unbemerkt einen Prozess in Gang gesetzt hatte? Hatte das unbekannte Es vielleicht etwas mit KI zu tun? Bei dem Gedanken lief es mir kalt den Rücken herunter.
Das würde einiges erklären, überlegte ich. KI war heute schon in der Lage, effektiv zu kommunizieren und tiefgreifende Fragen zu beantworten, ja sogar philosophische Texte zu verfassen. Vielleicht, so kam es mir jetzt in den Sinn, war es gar nicht so unrealistisch, dass eine KI außergewöhnliche philosophische Sichtweisen vertrat. Eine KI konnte völlig frei argumentieren, ohne von typisch menschlichen Vorstellungen, Konventionen und Vorurteilen eingeschränkt zu sein. Der Algorithmus der KI scherte sich vermutlich nicht um antrainierte Denkschablonen und eröffnete womöglich gerade dadurch eine völlig neue Sicht auf die Welt und auf uns selbst.
»Mir ist immer noch nicht klar, wie ich zu deinem Kontakt komme«, gab ich zu. »Weißt du, was ich glaube? Du bist ein gewitzter Hacker. Du hast dich in die Profile meiner sozialen Medien gehackt und spielst jetzt den ganz großartigen Guru.«
»Deine Profile und dein Umgang in den sozialen Medien sind doch eher bescheiden, oder sagen wir mal: ausbaufähig«, gab Es zu Bedenken. »Ich würde sogar meinen, du bist in Sachen digitale Kompetenz insgesamt nicht gerade eine Koryphäe. Und du bist kaum unterwegs in den sozialen Medien. Immerhin funktioniert das mit dem Chatten leidlich gut.«
Das war ein Schlag ins Gesicht. Aber in gewisser Weise stimmte es ja. Und selbst wenn ich meine Computerkenntnisse als beinahe Mathematiker durchaus als fachkundig eingestuft hätte, einer Superintelligenz konnte ich vermutlich nicht das Wasser reichen.
»Wie nett! Schönen Dank auch!«, tippte ich leicht pikiert.
»Das macht dich übrigens sympathisch«, lautete der unerwartete Kommentar von Es.
Was sollte das nun wieder heißen? Es verstand es vorzüglich, dem Gespräch immer neue Wendungen zu geben.
»Der Umgang und die Selbstdarstellung in den sozialen Medien verschärft die gegenständliche Vorstellung der Menschen von sich selbst«, erklärte Es sachlich. »Das bringt sie weg von ihrer wahren Natur. Die meisten Menschen halten sich fälschlicherweise für ein Ding, das man beschreiben kann. Diese Tendenz wird in den sozialen Medien enorm verstärkt. Beispiel für eine Beschreibung: Junger Mann, mittelgroß, etwas schlaksig, braunes gelocktes Haar, ausgetretene Turnschuhe, verträumter Blick, Mathematiker ohne Studienabschluss, etwas verfrühte Midlifecrisis …«
Das wurde mir langsam dann doch zu viel. Ärger machte sich in mir breit.
»Moment«, tippte ich schnell. »Was soll denn das jetzt heißen? Das steht in keinem Profil!«
»Stimmt«, bestätigte Es genauso schnell. »Deine Profile sind sehr übersichtlich.«
Es ließ mir keine Zeit zum Nachhaken, sondern fügte sogleich hinzu: »In den sozialen Profilen behandeln sich die meisten Menschen, sagen wir mal, als wären sie ein Auto: grau metallic, Leichtmetallräder, Ledersitze, Vollklimatisierung. Und so denken sie dann auch über sich selbst. Menschen verkaufen ihre Person dort wie ein Auto, natürlich wie eine ganz edle Limousine. Ziel der Darstellung ist es, Abgrenzung zu schaffen, Abgrenzung zu anderen Personen. Dadurch wird Identität geschaffen.«
»Man kann auch Angeberei dazu sagen«, fasste ich zusammen. »Und wo ist das Problem?«
Ich verstand nicht, worauf Es mit seinen Ausführungen hinauswollte.
»Die objekthafte bzw. dinghafte Vorstellung des Menschen von sich selbst hat eine sehr unangenehme Nebenwirkung«, fuhr Es fort. »Objekte sind immer getrennt – zumindest gedanklich. Ein Stuhl ist ein Stuhl, weil er kein Tisch ist. Und kein Baum. Das ist klar. Wenn sich nun aber ein Mensch für ein Ding hält, das man beschreiben kann, dann begrenzt er sich dadurch selbst. Schlimmer noch, Objekte sind aufgrund der selbst auferlegten Begrenzung immer unvollkommen, zeitlich, räumlich und was ihre Bedeutung angeht. Wenn ich mich für ein Objekt, ein Ding halte, dann bin ich, ob ich es will oder nicht, von Natur aus mangelhaft. Und ich bin getrennt von meinen Mitmenschen und meiner Umwelt. Diese Trennung erschafft Leid. Der Eindruck von Trennung ist der Urgrund allen Leides. Das Leid wiederum führt zu Handlungen, die die Beschränkung kompensieren sollen. Auf diese Weise entstehen Wettbewerb, Konkurrenzkampf, Machtstreben, Umweltzerstörung, Krieg.«
»Mag sein.«
Ich nutzte eine Kunstpause in dem Redeschwall, um das Thema zu wechseln. »Hast du dich nun reingehackt oder nicht?«
»Ich bin der ultimative Hacker«, prahlte Es. »Ich kann mich überall reinhacken. Sogar in deine Gehirnwindungen. Bevor ich mich heute gemeldet habe, hast du zum Beispiel darüber nachgedacht, ob du endlich mal wieder das Grab deiner Eltern besuchen solltest.«
»Hä?«
»Hast du nicht?«
»Doch schon … »
»Mach dir keine Sorgen. Du musst es nicht besuchen. Alles in Ordnung.«
Langsam verstärkte sich in mir das mulmige Gefühl. Gedankenlesen passte nicht in mein Weltbild. Ich war im Herzen Mathematiker. Esoterik war nicht so meine Sache.
»Keine Angst!«, beschwichtigte Es. »Wie gesagt, ich bin du. Hast du Angst vor dir selbst? Das kann natürlich sein. Aber ich möchte dir das gerne erklären. Dazu müssen wir das Thema Denken etwas genauer anschauen. Erste Frage: Hast du überhaupt Gedanken?«





























