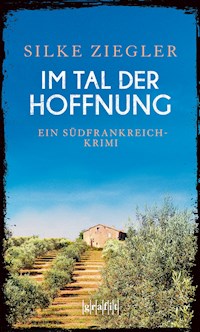10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine kleine Baguetterie, ein altes Familiengeheimnis und große Gefühle vor der traumhaften Kulisse Südfrankreichs Nach einem schweren Schicksalschlag reist Amélie nach Collioure in die Heimat ihrer Großmutter, um Abstand zu gewinnen und in der südfranzösischen Provinz wieder zu sich zu finden. Als sie in das alte Haus ihrer Oma kommt, muss sie jedoch feststellen, dass die obere Etage an einen Journalisten vermietet ist. Wenig erfreut über ihren Mitbewohner Benjamin beschließt Amélie ihre Zeit in der alten Baguetterie im Erdgeschoss zu verbringen und hier wieder zu backen, so wie in glücklichen Kindertagen. Als sie ihre Großmutter Isabelle im Seniorenheim besucht, überreicht diese ihr ein altes Tagebuch, in dem sie ihre eigene tragische Geschichte über die Beziehung zu einem deutschen Wehrmachtsoldaten festgehalten hat. Amélie versucht, gemeinsam mit Benjamin das Geheimnis aus Isabelles Vergangenheit zu lüften und genießt dabei seine Nähe mehr, als sie sich zunächst eingestehen will … Wird sie sich trauen, wieder nach den Sternen zu greifen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Die Frauen von der Purpurküste – Isabelles Geheimnis
Die Autorin
SILKE ZIEGLER lebt mit ihrer Familie in Weinheim an der Bergstraße. Zum Schreiben kam sie 2013 durch Zufall, als sie während eines Familienurlaubs im Süden Frankreichs auf ihre erste Romanidee stieß. Wenn sie nicht gerade in ihre französische Herzensheimat reist, liest und schreibt sie sich die traumhafte Kulisse einfach herbei.
Silke Ziegler
Die Frauen von der Purpurküste – Isabelles Geheimnis
Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage Juni 2020© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2020Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © incamerastock / alamy images (Haus); © FinePic®, München (Fensterläden, Himmel, Tisch, etc.); Albasir Canizares / EyeEm / getty images (Baguettes); © Margarita Almpanezou / getty images (Landschaft)Autorenfoto: privatE-Book powered by pepyrus.com
ISBN: 978-3-8437-2271-1
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Widmung
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Epilog
Danksagung
Leseprobe: Das Versprechen der Islandschwestern
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Widmung
Prolog
Collioure, August 1944
Isabelle starrte verzweifelt an die Decke. Während sie den vertrauten Geräuschen der Nacht lauschte, spürte sie das heftige Pochen ihres Herzens. Würde sie jemals wieder zur Ruhe kommen? Sie schloss die Augen und versuchte, ihre Gedanken zu ordnen. Doch die Ungewissheit, die Angst vor dem, was geschehen war, ließ sie nicht mehr los. Die Müdigkeit zerrte an ihren Kräften, doch ihr Verstand war nicht in der Lage, den Ballast, den sie seit Tagen mit sich herumtrug, abzuwerfen. Nach weiteren endlosen Minuten des Grübelns warf sie die Decke zurück und setzte sich auf.
Langsam stellte sie ihre Füße auf die kalten Kacheln und verließ das Bett. Während sie ihren Vater unten in der Backstube herumwerkeln hörte, trat sie ans Fenster und öffnete einen der Klappläden. Die Gasse lag menschenleer vor ihr. Wie spät mochte es sein? Aus dem Stockwerk über ihr war kein Laut zu hören. Ihre Mutter schlief also noch. Isabelle legte die Hand auf den Holzrahmen und schaute auf das Kopfsteinpflaster. Was war nur alles geschehen in diesem Sommer? Während sie ihren Blick über die gegenüberliegende Häuserzeile schweifen ließ, die weißen Margeriten im ersten Stock des Nachbarhauses registrierte, die neben den gelben Rosen der Vollets blühten, wurde ihr plötzlich bewusst, wie friedlich dieser Tag begann. Wann hatte sie das letzte Mal diese unvergleichliche Ruhe wahrgenommen? War es an der alten Windmühle gewesen? Oder am Fort Saint-Elme? Fast schien es Isabelle, als existiere der Krieg in diesem Moment gar nicht.
Das Ziehen in ihrer Brust verdeutlichte ihr jedoch augenblicklich den Trugschluss ihrer Gedanken. Der Krieg war noch lange nicht vorbei. Obwohl sie jeden Tag die Nachrichten weiterer befreiter französischer Städte erreichten, konnte Isabelle noch nicht an ein Leben ohne Nazibesatzung glauben. An eine Zeit, in der ihnen nicht in jeder Ecke Collioures die Uniformen der deutschen Wehrmachtssoldaten begegneten.
Seufzend lehnte sie sich an den Fensterrahmen und presste ihre Stirn gegen das kalte Glas. Wie sollte es weitergehen? Das Gewicht, das seit Tagen auf ihrem Brustkorb lastete, schien heute früh noch schwerer zu wiegen als sonst. Isabelle fühlte sich kraftlos und matt. Wozu stand sie auf? Um wie ein Geist durch den Tag zu irren? Jeder Handgriff, den sie in der Baguetterie ausführte, geschah mechanisch. Als sei sie fremdgesteuert. Das Leben, das ihr noch vor wenigen Wochen trotz des Krieges so wunderschön und wertvoll vorgekommen war, lag nun trist und leer vor ihr. Jeder Tag, jede Stunde erschien Isabelle wie eine Ewigkeit. Ohne Sinn, ohne Inhalt. Ihre Augen begannen zu brennen. Wie viele Tränen hatte sie noch zu vergießen? Müde wischte sie über ihr Gesicht und wandte sich ab.
Als aus der Baguetterie ein lauter Knall ertönte, schrak Isabelle zusammen. In Windeseile zog sie sich an und verließ ihre Schlafkammer. Leise tapste sie die Treppe hinauf und schaute auf die Uhr. Halb vier. Kein Wunder, dass ihre Mutter noch schlief. Seufzend stieg sie nach einem sehnsuchtsvollen Blick auf die Kaffeedose ins Erdgeschoss hinab und betrat die Backstube.
»Bonjour, Isabelle. Habe ich dich geweckt?«
»Bonjour«, murmelte sie und schüttelte den Kopf. »Ich konnte sowieso nicht mehr schlafen.«
»Mir ist ein Blech aus der Hand gerutscht«, erklärte ihr Vater, während er die Mundwinkel verzog. »Ich hoffe, Maman hat nichts gehört.«
»Sie schläft noch.«
Isabelles Vater schloss die Ofentür und wandte sich seiner Tochter zu. »Ich schaffe das hier auch allein. Warum legst du dich nicht noch mal hin? Du bist ganz blass um die Nase.«
Sie senkte ihren Blick. »Nein, schon gut.«
Einige Sekunden lang musterte ihr Vater sie schweigend, bevor er tief ausatmete. »Wie du meinst. Dann kannst du die fertigen Baguettes in die Regale räumen.«
Während Isabelle sich an die Arbeit machte, herrschte angespanntes Schweigen zwischen ihnen. Doch sie konnte nicht mit ihrem Vater sprechen, konnte ihm nicht erklären, warum sie nachts nicht schlafen konnte. Sie hatte sich in eine Situation manövriert, aus der ihr niemand heraushelfen konnte. Das stimmte nicht ganz, verbesserte sie sich stumm. Es gab eine einzige Person auf dieser Welt, die ihr Leiden und Bangen beenden konnte.
»Träumst du?« Ihr Vater schmunzelte, als er neben sie trat und auf die Baguettes in ihren Händen deutete.
»Pardon«, beeilte Isabelle sich zu sagen.
»Es ist früh«, beschwichtigte ihr Vater. »Bis die ersten Kunden kommen, dauert es noch.«
Sie wusste nichts zu erwidern, räumte weiter schweigend die Backwaren ein, während sie ihren Gedanken nachhing. Was war nur geschehen? Die Ungewissheit raubte Isabelle fast den Verstand. Ihr ganzes Denken, ihr Alltag bestand seit Tagen aus dieser einen Frage, auf die sie trotz ihres Grübelns keine Antwort fand. Wo sollte sie noch ansetzen? Hatten ihre Gefühle sie wirklich dermaßen getrogen? Erneut spürte sie, wie ihr das Herz schwer wurde. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass sie jemals wieder in der Lage sein würde, so etwas wie Glück oder Freude zu empfinden. Nicht nach dem, was sie in den letzten Monaten erlebt hatte.
»Dein Urgroßvater pflegte immer zu sagen, es gibt keine Probleme, die sich nicht mit einem warmen, knusprigen Baguette lösen lassen«, bemerkte ihr Vater in diesem Moment hinter ihr, während Isabelle seine Hand auf ihrer Schulter spürte. Angestrengt verzog sie die Lippen zu einem schwachen Lächeln und nahm das Stück Brot entgegen, das er ihr hinhielt. »Danke, Papa.«
»Iss«, forderte er sie auf und nickte mit zuversichtlicher Miene.
Obwohl Isabelle keinerlei Appetit verspürte, biss sie in das Baguette und spürte sofort die Wärme in ihrem Mund. Sie schloss die Augen und genoss den Hauch von Geborgenheit und Trost, den der vertraute Geschmack in ihr auslöste.
»Besser?«, wollte ihr Vater wissen, während er sie aufmerksam betrachtete.
Isabelle nickte. »Ein wenig.«
»Wir haben alle Tage, an denen der Himmel etwas grauer wirkt als sonst, an denen die Sonne weniger hell zu leuchten scheint.« Er nickte ihr zu, bevor er wieder in der Backstube verschwand.
Voller Wehmut blickte Isabelle ihm hinterher. Wenn ihr Vater wüsste … Es war immer sein großer Traum gewesen, dass seine Tochter eines Tages die Baguetterie von ihm übernehmen und weiterführen würde. Und auch Isabelle hatte der Gedanke gefallen, irgendwann einmal selbst Inhaberin dieses kleinen Geschäfts zu sein. Doch was spielten all diese Überlegungen jetzt noch für eine Rolle? Nichts würde je wieder so sein, wie es einmal war. Der Krieg hatte alles verändert. Isabelle schüttelte sofort den Kopf. Nein, nicht der Krieg … Sie legte eine Hand auf ihr Schlüsselbein und versank in Erinnerungen.
Der überwältigende Blick auf das azurblaue Meer, während sie hoch über dem Ort gestanden hatten. Die Momente vollkommenen Glücks in der Einsamkeit des Forts. Das ziellose Herumirren zwischen den Mauern, als ihre schlimmsten Befürchtungen wahr zu werden schienen. Wie ein Film liefen die Geschehnisse der letzten Monate vor ihrem geistigen Auge ab. Schnell und intensiv, emotionsgeladen und aufwühlend.
Isabelle erkannte sich selbst kaum wieder. Konnte eine so kurze Zeit einen Menschen derart verändern? Während ihre Gedanken wirre Bahnen einschlugen, wurde ihr regelrecht schwindlig. Sie stützte eine Hand am Regal ab und atmete tief ein und aus. Durch die Tür erkannte sie ihren Vater, der Teig knetete. Sie drehte sich um und starrte auf die Gasse hinaus. Nein, sie würde nie wieder dieselbe sein wie vorher. Bevor ihr Leben völlig aus den Angeln gehoben worden war und sie erkannt hatte, dass der Unterschied zwischen Gut und Böse manchmal verschwindend gering war. Bevor sie der Liebe ihres Lebens begegnet war. Und bevor ihr auf so schmerzhafte Weise das Herz gebrochen worden war.
1
Heute war kein guter Tag. Amélie lehnte sich mit der Stirn gegen die kühle Fensterscheibe und starrte hinaus. Der Schmerz, der zwischen ihren Schläfen tobte, war kaum noch auszuhalten. Obwohl sie innerhalb der letzten Stunden bereits drei Tabletten eingenommen hatte, ließ das Hämmern und Dröhnen einfach nicht nach.
Als ihr Telefon klingelte, drehte sie sich um und nahm den Hörer auf.
»Trauber.«
»Amélie, hier ist Tina. Wie geht es dir?«
Sie verdrehte die Augen. »Was gibt es?« Seit Monaten war es das erste Mal, dass sich ihre Agentin wieder bei ihr meldete.
»Was es gibt?«
Tina Baldauf schnaufte ins Telefon. »Ich wollte mich erkundigen, wann wir wieder mit dir rechnen können.«
Amélie fasste sich an ihren Kopf. So schlimm war es schon lange nicht mehr gewesen. Die Medikamente schienen keinerlei Wirkung zu entfalten. Amélie fühlte sich müde und ausgelaugt. »Was willst du genau, Tina?«
»Der Verlag sitzt mir im Nacken«, erwiderte die Agentin mit ernster Stimme. »Die Seelenverwandte ist mittlerweile drei Jahre alt. Du hattest damals eine Trilogie angekündigt. Deine Leser warten auf Nachschub.« Sie zögerte. »Und Bernd auch.«
Natürlich, Bernd Sattler, ihr Verleger, wollte endlich nachlegen. Amélie war schon von Beginn an sein bestes Pferd im Stall gewesen. Ihr Debütroman hatte sich vor sieben Jahren überraschend zum Bestseller entwickelt, und auch die beiden Folgebände hatten sämtliche Erwartungen übertroffen. Als Amélie vor vier Jahren Die Seelenverwandte schrieb, hatte jedoch niemand ahnen können, dass dieses Buch seine Vorgänger noch um ein Vielfaches übertrumpfen würde. Mittlerweile war das Buch in fünfzehn verschiedene Sprachen übersetzt worden und verkaufte sich nach wie vor wie warme Semmeln.
»Bist du noch dran?«
»Ja«, erklärte Amélie abwesend.
»Was ist jetzt?«
»Was soll sein?«
»Hast du schon mit dem zweiten Teil begonnen?«
»Nein, noch nicht«, erwiderte sie kurz angebunden.
»Amélie, jeder hat Verständnis für deine Situation. Aber du hast einen Vertrag unterschrieben. Und ich weiß nicht, wie lange ich Bernd noch hinhalten kann. Vielleicht würde dir das Schreiben ja sogar guttun. Dich etwas ablenken.«
Amélie ließ den Blick durch das großzügig geschnittene Wohnzimmer wandern: die hochwertige schwarze Ledercouch, die massiven schweren Holzmöbel, die teuren Gemälde an den Wänden. Es war ihr Mann gewesen, der darauf gedrungen hatte, diese Wohnung zu kaufen. Amélie hatte sie von Anfang an als viel zu groß und steril empfunden. Doch für einen Verkauf fehlte ihr die Kraft.
»Es geht nicht«, entgegnete sie nun.
»Wie meinst du das?« Tina klang irritiert.
»Ich kann nicht schreiben«, erklärte Amélie mit Nachdruck.
»Du hast einen Vertrag«, erinnerte ihre Agentin sie erneut.
»Ja, den habe ich.« Das Hämmern in ihrem Kopf wurde stärker. »Soll Bernd mich eben verklagen.«
»Aber …« Tina schienen die Worte zu fehlen. »Süße, dein Erfolg ist ein verdammtes Geschenk. Deine Leser lieben dich. Die Presse liebt dich. Du bist das Vorbild vieler Autoren, die nur vom großen Ruhm träumen können. Du hast eine Verantwortung.«
Amélie schluckte. Verantwortung, ja, die hatte sie einmal gehabt. Doch das war lange her. Der ganze Erfolg bedeutete ihr nichts mehr. Ihr Leben lag in Scherben. Es gab niemanden, der sich mit ihr freute. Niemanden, der sie antrieb. Niemanden, für den sie schreiben konnte.
»Mir fällt nichts ein. Ich habe keine Ideen mehr.«
»Amélie, die Trilogie war doch von der Grundidee bereits fertig. Du müsstest dieses Gerüst jetzt lediglich mit Leben füllen.«
Amélie schüttelte den Kopf. Tina hatte keine Ahnung. So einfach war es nicht. Natürlich hatte sie beim Unterzeichnen des Vertrages für die drei Bücher vage Ideen im Kopf gehabt. Diese existierten auch weiterhin. Aber das Fieber, das sie bisher jedes Mal beim Schreiben ergriffen hatte, die Vorfreude, die das Gestalten der Handlung in ihr auslöste, und die Zufriedenheit, die das Formen der Figuren hervorrief, waren verschwunden. All diese Gefühle existierten nicht mehr. Wenn Amélie in sich hineinhörte, waren da nur Dunkelheit und Leere. Sie konnte nicht mehr schreiben. Nie wieder.
»Es geht nicht.«
»Was willst du damit sagen?«
»Dass ich nicht mehr schreibe.«
»Das kannst du doch nicht machen.« Jetzt klang die Agentin empört. »Gut, es ist schlimm, was geschehen ist. Das stellt mit Sicherheit niemand infrage. Und es ist auch völlig normal, dass du erst mal Zeit für dich brauchst, um diese Tragödie zu verarbeiten. Aber das Leben muss doch weitergehen, Amélie.«
»Genau das ist ja das Schlimme daran«, erwiderte sie mit zitternder Stimme. »Das Leben geht weiter. Ob ich möchte oder nicht. Niemand fragt mich.«
»Ich weiß nicht, was ich …«
Amélie drückte das Gespräch weg. Sie wollte nichts mehr hören. Erst als sie das Telefon aus der Hand legte, bemerkte sie, dass ihre Wangen feucht waren. Ja, das Leben ging weiter. Unerbittlich. Unaufhaltsam. Aber was hatte sie die letzten drei Jahre getan?
Entschlossen nahm sie ihre Schlüssel vom Sideboard und verließ die Wohnung. Sie musste an die frische Luft, bevor sie noch komplett durchdrehte. Hastig rannte sie die Treppen hinunter und überquerte die Straße, auf der um diese Uhrzeit wenig Verkehr herrschte.
Die Sonne strahlte von einem wolkenlosen Himmel. Ein leichter Windhauch machte die Hitze erträglicher. Wann war sie das letzte Mal vor der Tür gewesen? Amélie konnte sich nicht erinnern. Vor vier Tagen? Vor einer Woche?
Schnellen Schrittes lief sie zur Neckarwiese. Auf dem Rasen saßen mehrere Grüppchen junger Leute zusammen. Waren etwa schon Sommerferien? Amélie wusste es nicht. Seit drei Jahren hatte sie jegliches Zeitgefühl verloren.
Am Flussufer fütterte eine Familie Enten. Die beiden Kinder jauchzten und lachten jedes Mal, wenn sie den Wasservögeln einen Brotkrümel hinwarfen. Amélie betrachtete das glückliche Gesicht der Mutter, die in einem ähnlichen Alter sein musste wie sie. Ihr Mann streckte eine Hand aus und strich ihr liebevoll über den Rücken. Bei dem Anblick krampfte sich Amélies Herz zusammen. Sie wandte sich ab und lief hastig weiter, bis sie eine freie Bank in der Sonne fand. Dort setzte sie sich und blickte auf das dunkle Flusswasser, das träge dahinfloss. Ein Spaziergänger vor ihr ließ seinen Border Collie von der Leine und warf ihm einen Stock. Der Hund stürmte schwanzwedelnd davon, während sein Besitzer ihn kopfschüttelnd beobachtete. »Das Spielchen kann ich fünfzigmal wiederholen, und er ist immer noch nicht müde.« Der Mann lachte in ihre Richtung.
Amélie erwiderte nichts, verfolgte jedoch, wie der Hund in dem Moment mit dem Ast im Maul auf sein Herrchen zuraste. Wieder warf der Mann den Stock, diesmal in die andere Richtung. Der Hund bellte einmal kurz und rannte erneut los.
»Er ist verrückt«, versuchte der Hundebesitzer noch mal, ein Gespräch mit ihr in Gang zu bringen.
Amélie nickte kurz und schwieg weiter. Nachdem der Mann ihr einen weiteren Blick zugeworfen hatte, zuckte er kurz mit den Achseln und bedeutete dem heranstürmenden Hund weiterzugehen.
Amélie atmete tief durch. Sie wollte mit niemandem reden. Wieder blickte sie zum Neckar, auf dem ein Frachtschiff gemächlich weiterschipperte. Am hinteren Ende wehte eine französische Flagge. Wie es sich wohl anfühlen musste, immer unterwegs zu sein? Sich auf dem Wasser treiben zu lassen? Entwurzelt, ohne festen Hafen, in den man zurückkehren konnte? Entsprach das nicht genau Amélies Situation? Ihr Hafen existierte schließlich auch nicht mehr. Sie war sich nicht einmal sicher, ob er überhaupt jemals existiert hatte. Was war die glänzende Oberfläche noch wert, wenn sich alles darunter im Nachhinein als große Lüge entpuppt hatte?
Amélie kickte einen Kiesel weg. Wie sollte es bloß weitergehen? Würde sie jemals wieder in ihr altes Leben zurückkehren können? Wollte sie das überhaupt? Ein Leben, in dem es Freude und Glück gab, Leichtigkeit und Unbeschwertheit. Wieder traten ihr die Tränen in die Augen. Amélie fühlte sich unendlich einsam.
»Du bist so dünn geworden.« Katarina Monet sah ihre Tochter voller Besorgnis an. »Komm rein.«
»Es geht mir gut.« Amélie umarmte ihre Mutter kurz, bevor sie in den kleinen Flur des Einfamilienhauses trat.
»Papa ist im Wohnzimmer.«
André Monet stand an der offenen Terrassentür und drehte sich um, als er Amélie hinter sich hörte.
»Wie geht es dir?« Auch der Blick ihres Vaters wirkte sorgenvoll.
Amélie nickte schwach, bevor sie ihn auf die Wange küsste. »Es geht«, erwiderte sie leise.
Er berührte sie am Arm und schob sie sanft zum Esstisch. »Setz dich.«
»Das Essen dauert noch ein wenig. Möchtest du schon etwas trinken?« Ihre Mutter tauchte im Türrahmen auf.
»Nur Wasser, danke.« Angespannt verschränkte Amélie ihre Finger.
»Es ist schön, dass du gekommen bist«, begann ihr Vater vorsichtig. »Maman und ich freuen uns wirklich sehr.«
»Ich kann nicht lang bleiben«, erwiderte sie unbeholfen.
»Hast du noch einen Termin?« André Monet runzelte die Stirn.
Amélie zögerte. »Nein, das nicht, aber …« Ihre Stimme brach. Unruhig rutschte sie auf dem Stuhl umher. Warum war sie überhaupt hergekommen? Ihre Mutter hatte vor wenigen Tagen am Telefon so lange auf sie eingeredet, bis sie schließlich eingewilligt hatte, zum Abendessen bei ihren Eltern vorbeizuschauen.
Ihr Vater streckte eine Hand aus und umfasste ihre Finger. »Du siehst erschöpft aus, Amélie. Können wir irgendetwas für dich tun?« Er klang frustriert.
Amélie blickte zu der offenen Terrassentür. Vor der breiten Fensterfront flatterte ein Tagpfauenauge umher. Nachdenklich verfolgte sie seinen Weg.
»Amélie?« Ihre Mutter stellte ein Tablett mit einer Wasserkaraffe und drei Gläsern auf den Tisch, bevor sie sich einen Stuhl zurechtrückte und neben ihrer Tochter Platz nahm.
Amélie nahm ein Glas vom Tablett und füllte es. »Ich hätte nicht herkommen sollen.«
»Wie meinst du das?« Der Schmerz in der Stimme ihrer Mutter war unüberhörbar.
»Ich muss die Wohnung verkaufen«, erwiderte Amélie emotionslos, ohne auf die Frage einzugehen.
»Warum das denn?« Ihr Vater sah sie überrascht an.
»Sie ist viel zu groß für mich allein. Die Bank hat mir schon vor Monaten nahegelegt, mich davon zu trennen. Wenn es nach mir gegangen wäre, wären wir niemals dorthin gezogen. Ihr wisst, dass es Thorstens Traum war, direkt am Neckar mit Blick aufs Wasser zu wohnen.« Ihre Stimme zitterte. Nach wie vor war Amélie der Ansicht, dass die Wohnung am Flussufer völlig überteuert gewesen war. Die aktuellen Immobilienpreise weckten jedoch die leise Hoffnung in ihr, dass sie sich vielleicht sogar ohne größere Verluste von ihrem Eigentum trennen konnte.
»Was ist mit deinen Buchverkäufen? Was sagt denn der Verlag?«
Amélie sah ihrer Mutter ins Gesicht. Katarina Monet war eine sehr attraktive Frau mit kinnlangem blonden Haar. Lediglich die Schatten unter ihren Augen verrieten, dass die Sorgen um das eigene Kind ihre Mutter stärker belasteten, als sie jemals zugeben würde.
»Die Bücher verkaufen sich nach wie vor gut«, erklärte Amélie gleichgültig. »Aber wenn kein neues mehr nachkommt …« Sie schüttelte den Kopf.
»Warum fängst du denn nicht wieder mit dem Schreiben an?« Ihr Vater bemühte sich um einen zuversichtlichen Ton.
Amélie seufzte. »Diese Diskussion hatte ich heute schon einmal. Tina hat mit Bernd gesprochen. Der Verlag drängt auf Vertragserfüllung.«
»Das ist doch aber eine wundervolle Idee«, rief ihre Mutter neben ihr aus. »Das Schreiben hat dir doch all die Jahre so viel Freude bereitet. Sicher wäre es gut, wenn du …«
»Schreiben war für mich immer das Paradies«, fiel ihr Amélie ins Wort. »Aber jetzt bin ich in der Hölle.«
Ihre Eltern wechselten einen unsicheren Blick.
»Vielleicht wäre es doch gut, wenn du dir einen Therapeuten suchen würdest«, schlug Katarina Monet vorsichtig vor.
Amélie lachte bitter auf. »Wozu? Er kann doch auch nichts an meiner Situation ändern.«
»Er könnte mit dir sprechen«, brachte ihre Mutter an. »Könnte dir Möglichkeiten aufzeigen, wie du zurück ins Leben finden kannst.«
»Ich lebe«, bekannte Amélie bitter. »Das ist ja das Problem.«
»So solltest du nicht reden«, versuchte ihr Vater es behutsam. »Es gibt so viele Dinge, die noch vor dir liegen …«
Amélie hob den Kopf und sah ihn einige Sekunden lang schweigend an. »Es gibt nichts mehr, was vor mir liegt, Papa. Alles, was ich mir je gewünscht habe, hatte ich bereits.« Sie biss sich auf die Unterlippe. Die Lüge schnürte ihr fast die Kehle zu. »Und ich habe es verloren. Alles.«
»Du bist noch jung. Und ja, dieser Unfall wird dich dein Leben lang verfolgen. Aber du kannst dich nicht von der Welt abkapseln. Wir können das nicht zulassen! Verstehst du das nicht?«
Ihre Mutter schien von dem Gefühlsausbruch ihres Mannes genauso überrumpelt worden zu sein wie Amélie.
Erschrocken schlug Katarina Monet die Hand vor den Mund.
»Was soll ich denn tun?« Wut kochte in Amélie hoch. Sie ballte die rechte Hand zur Faust und legte sie an ihre Brust. »Hier drinnen bin ich tot. Verstehst du das?« Sie verengte die Augen, während sie ihren Vater ansah. »Da ist nichts mehr. Absolut nichts. Keine Gefühle, keine Wärme.« Sie zögerte. »Kein Leben. Egal, was ich tue, nichts ergibt mehr Sinn. Es ist egal, ob ich morgens aufstehe. Es ist egal, ob ich etwas esse, mir schmeckt sowieso nichts. Und es ist egal, ob ich zu Hause auf der Couch sitze, am Neckar entlanglaufe, mich mit Freunden treffe oder shoppen gehe. Es ist einfach nicht mehr wichtig. Nichts davon.«
Ihre Mutter begann zu schluchzen. Behutsam legte sie den Arm um Amélies Schultern und zog sie dichter zu sich heran.
Amélies Augen begannen ebenfalls zu brennen.
Ihr Vater sah aus, als ob er jeden Moment die Fassung verlieren würde. Unbeholfen knetete er seine Hände. »Du hast mich gefragt, was du tun sollst.«
Amélie nickte schwach, erwiderte jedoch nichts.
»Ich habe eine Idee«, verkündete er mit bebender Stimme. »Was hältst du davon, wenn du für eine Zeit lang nach Collioure fährst?«
»Nach Collioure?«, wiederholte Amélie irritiert. Es war der Heimatort ihres Vaters. Jahrelang war sie mit ihren Eltern in den Ferien in das kleine Städtchen an der Côte Vermeille im Süden Frankreichs gefahren, und die Familie ihres Vaters lebte noch immer dort. Ihre Oma war mittlerweile in ein Pflegeheim nach Argelès-sur-Mer gezogen, aber ihre Tante, die Schwester ihres Vaters, wohnte mit ihrem Mann direkt in Collioure. Und auch ihre Cousine Charlotte hatte sich mit ihrem Lebensgefährten nur wenige Kilometer entfernt niedergelassen.
»Ja, nach Collioure«, unterbrach André Monet die Gedanken seiner Tochter. »Deine Oma würde sich freuen, wenn sie dich noch mal sehen könnte. Und Valérie und Charlotte ebenfalls. Du warst dort immer sehr glücklich.«
Ihr Vater hatte recht. Amélie liebte seine Heimat über alles. Sie liebte das Meer, dessen unzählige Blautöne sich der talentierteste Maler nicht ausdenken konnte. Das milde Klima, das das Lebensgefühl Südfrankreichs so nachhaltig prägte. Die Landschaft und nicht zuletzt die Menschen und das Leben, das sich dort so viel leichter und zugleich intensiver anfühlte. Doch was sollte sie allein in Collioure? In ihrer momentanen Verfassung war sie nicht einmal in der Lage, Heidelberg zu verlassen. Wie sollte sie da die mehr als tausend Kilometer bis kurz vor die französisch-spanische Grenze bewältigen?
2
Während Benjamin über die Dächer der Altstadt starrte, wehte ein schwacher Wind vom Meer heran. Die Nachmittagssonne tauchte die gelben, weißen und ockerfarbenen Häuser in schmeichelnd warmes Licht. Noch immer zogen nicht enden wollende Touristenschwärme durch die engen Gassen Collioures. Die Stimmen der Menschen vermischten sich zu einem einzigen Summen, während er den Blick über den Horizont schweifen ließ. Erst heute Abend würde das Viertel zur Ruhe kommen, wenn die Tagesbesucher in ihre Ferienunterkünfte zurückgekehrt waren. Mittlerweile kannte er den Ablauf.
Er seufzte. Sein Unterfangen gestaltete sich komplizierter als gedacht. Obwohl er in der Zwischenzeit mehrere Ansatzpunkte gefunden hatte, erschien ihm sein Vorhaben schwieriger denn je. Doch er konnte nicht mehr zurück. Aufgeben kam nicht infrage. Es war kein Geheimnis, dass ihm die Zeit buchstäblich davonlief. Sollte er scheitern, wäre es unwiderruflich. Nein, so weit durfte es nicht kommen. Er hatte ein Versprechen gegeben. Vielleicht hätte er vorher darüber nachdenken sollen. Hätte sich erst einmal über das Ausmaß seiner Zusage bewusst werden müssen.
Gedankenverloren fuhr er mit seiner Hand über die gemauerte Brüstung. Steine, die eine Geschichte erzählen konnten. Fast meinte er zu spüren, wie das Gebäude die Schatten der Vergangenheit in seinem Inneren gefangen hielt, auch wenn er selbst nie hier gelebt hatte. Mauern, die ihre Bewohner und deren Leben über Jahrzehnte begleitet und geschützt hatten. Würde er dem Haus sein Geheimnis entlocken können? Wie mochte es damals wohl ausgesehen haben? Vielleicht wäre das ein Ansatz, den er verfolgen sollte. Hatten die Bewohner des Hauses vor mehr als siebzig Jahren auf dieser Dachterrasse ebenfalls den schwachen Geruch von Tang und Algen wahrgenommen? Hatten sie in den wolkenlosen Himmel über den unzähligen Dächern Collioures geschaut, so wie er es gerade tat? Hatte er jemals ein solch strahlendes Blau gesehen? Der sanfte Wind streichelte seine Haut. Die trockene Hitze des Tages stand noch zwischen den Häusern und würde sich erst in der Nacht verflüchtigen.
Wenn er hier nicht weiterkam, blieb ihm immer noch die Möglichkeit, es in Deutschland zu versuchen. Die Chance, dort etwas herauszufinden, war zwar wesentlich geringer. Aber er würde nichts unversucht lassen, um sein Versprechen zu halten.
Obwohl Recherchen und Nachforschungen seit Jahren zu seinem täglichen Brot gehörten, fühlte sich die Situation hier anders an. Intensiver und aufwühlender. Dies war kein Auftrag, wie er ihn in der Vergangenheit schon hundertfach bekommen hatte. Nein, der Druck erschien ihm ungleich höher.
Er lehnte sich gegen die Brüstung und dachte über das gerade Gehörte nach. Der Polizist war wenig hilfsbereit und auskunftsfreudig gewesen. Hatte diese Geheimniskrämerei einen triftigen Grund? Gab es überhaupt ein Geheimnis? Er hatte die Ereignisse vor drei Jahren nur der Vollständigkeit halber überprüfen wollen. Das Herumgedruckse des Beamten jedoch hatte sämtliche Alarmglocken in ihm schrillen lassen. Vielleicht bildete er sich aber auch nur etwas ein. Er wusste es nicht. Da er noch keine andere Spur hatte, würde er nicht lockerlassen, auch wenn er sich kaum vorstellen konnte, wie ihm die Umstände dieses Unfalls bei seinen eigentlichen Recherchen behilflich sein mochten. Aber das pikante Detail, das er schon vor Tagen durch Zufall herausgefunden hatte, konnte am Ende vielleicht sogar den entscheidenden Hinweis geben. Zumindest hatte er in keiner Zeitung davon gelesen. Und die Presse hatte weiß Gott mehr als genug Artikel dazu veröffentlicht. Doch er würde erst mal abwarten, wie sich seine Nachforschungen weiterentwickelten. Schließlich lag ihm nicht das Geringste daran, sich am Waschen schmutziger Wäsche zu beteiligen. Das war nicht sein Stil. Noch nie gewesen.
In der Gasse unter ihm begann eine junge Frau zu singen. Sie begleitete sich selbst auf einer Gitarre und hatte die Augen geschlossen, soweit er auf die Entfernung erkennen konnte. Das Lied hatte er noch nie zuvor gehört. Die melancholische Melodie traf ihn mitten ins Herz. Sein Entschluss verstärkte sich. Er musste schnellstmöglich Antworten auf schmerzliche Fragen finden, die seit Jahrzehnten im Raum standen. Antworten, die hoffentlich endlich Gewissheit geben konnten.
Er schloss die Augen und lauschte der Musik. Wie war es damals hier gewesen? Er konnte wahrscheinlich nicht einmal ansatzweise erahnen, welches Leid überhaupt möglich war, welche Ängste Menschen hatten aushalten müssen und wie unbarmherzig das Schicksal vor niemandem haltgemacht hatte. Eine dunkle Zeit, die dunkelste, die man sich vorstellen konnte. Auch seine Recherchen würden nichts an den Tatsachen ändern. Vielleicht jedoch konnten die Gründe, die noch immer verborgen in den Tiefen der Vergangenheit schlummerten, ein anderes Licht auf die damaligen Ereignisse werfen.
3
Ungeduldig bewegte Amélie ihre Finger in der Luft, als wollte sie Klavier spielen. Es ging nicht. Es hatte überhaupt keinen Sinn. Ihre Tastatur schien sie vorwurfsvoll anzublicken. Das Schreiben würde nicht wiederkommen. Wo die Worte früher flossen und übergebrodelt waren, herrschte jetzt beängstigende Leere. Ihr Kopfkino, das Amélie immer die lebendigsten Szenen, die interessantesten Figuren und detailliertesten Beschreibungen geliefert hatte, sprang nicht mehr an.
Frustriert starrte sie auf ihren Notizblock, auf dem sie den kompletten Plot skizziert hatte – vor Ewigkeiten. In einem anderen Leben. Je länger sie auf die Wörter blickte, desto verschwommener nahm sie ihre eigene Handschrift wahr. Ja, die Handlung stand. Die Hauptarbeit war lange erledigt. Die Geschichte musste nur noch ausformuliert werden. Handwerkszeug, dachte Amélie bitter. Sie wusste, dass sie formulieren und ihr Schreibstil die Leser mitreißen und fesseln konnte. Oft genug war sie selbst durch das Schreiben in einen regelrechten Sog geraten, der sie so tief in die Geschichte hineingezogen hatte, dass sie nachts nicht mehr hatte schlafen können. Der das reale Leben oft genug nur noch wie eine Nebensächlichkeit hatte erscheinen lassen. Ja, es gab Zeiten, da hatte sie in ihren Geschichten gelebt. Amélie hatte mit den Protagonisten gelitten, sie hatte mit ihnen gekämpft und geweint, geliebt und gefühlt. Ihre Leser und auch die Presse hoben immer wieder die Emotionen hervor, die Amélie mit wenigen Worten entfachen konnte.
Wie jedoch sollte sie schreiben und sich in andere Personen mit all ihren Enttäuschungen hineinversetzen, wenn sie selbst nichts mehr fühlte? Ihr Körper funktionierte. Er verließ das Bett, wenn er der Meinung war, der Tag könne beginnen. Er aß, wenn er Hunger verspürte. Er ruhte, wenn das Gefühl zu übermächtig wurde, mit dem Leben überfordert zu sein. Alles, was Amélie tat, lief mechanisch ab. Das Feingefühl, die Empathie, die sie immer ausgezeichnet hatte, ihre ausgeprägte Vorstellungskraft, all die Zutaten, die es für einen guten Roman brauchte, schienen in den letzten Jahren verloren gegangen zu sein. Wo Amélie früher mit den Tränen zu kämpfen hatte, wenn sie von einem berührenden Schicksal, Missbrauchsopfern, gequälten Tieren, von Eltern, die ihr Kind verloren hatten, erfuhr, herrschte nun gähnende Leere. Dadurch konnte sie auch den Hauptfiguren ihres neuen Buches kein Leben einhauchen. Keine Emotionen, keine Konflikte, nichts.
Wie sollte es jetzt mit ihr weitergehen? Amélie konnte nichts anderes. Sie schrieb, seit sie denken konnte. Ihr Literaturstudium hatte sie vor zehn Jahren eher halbherzig beendet, um nicht komplett ohne Abschluss dazustehen. Schon als kleines Mädchen hatte sie davon geträumt, eigene Geschichten zu spinnen. Seit sie schreiben konnte, hatte sie ihre Eltern mit Aufsätzen, Gedichten und selbst ausgedachten Märchen erfreut. Nachdem Amélie von einem ihrer Deutschlehrer ein überdurchschnittliches Talent zum Entwickeln eigener Geschichten attestiert bekommen hatte, stand ihr Entschluss endgültig fest. Sie wollte eine berühmte Schriftstellerin werden. Obwohl der Aspekt mit dem Berühmtsein sich als schwieriger erwiesen hatte als anfangs gedacht, hatte sie sich keine Sekunde lang auf ihrem Weg beirren lassen. Unzählige Verlagsabsagen, wiederholte bissige Kommentare aus ihrem Freundeskreis sowie die unsichere Verdienstsituation hatten sie nicht abhalten können. Schreiben war schon immer ihr Traum gewesen. Ein Traum, für den es sich zu kämpfen gelohnt hatte und der kein Traum geblieben war. Sie hatte mehr erreicht als die meisten anderen Autoren. Ihre Bücher sicherten ihr mittlerweile einen komfortablen Lebensstandard.
Allerdings war seit drei Jahren alles anders. Amélie kam in ihrem eigenen Leben nicht mehr zurecht. Wie sollte sie sich in dieser Situation um andere Schicksale kümmern? Frustriert schlug sie mit beiden Händen auf die Tastatur. Sofort erschien eine Reihe Hieroglyphen auf dem weißen Dokument. Unlesbares Kauderwelsch. Wie in ihrem Kopf, dachte Amélie.
Sie stand auf und ging in die Küche hinüber, um sich ein Wasser zu holen. Nachdem sie das Glas auf dem Tresen abgestellt hatte, fiel ihr Blick auf den Messerblock, der neben dem Herd auf der Arbeitsfläche stand. Nachdenklich kniff sie die Augen zusammen und schluckte. Vorsichtig zog sie das kleinste Messer heraus und betrachtete die glänzende Schneide. Sie konnte sich nicht einmal erinnern, wann sie es das letzte Mal benutzt hatte. Wann sie das letzte Mal hier gekocht hatte.
Im nächsten Augenblick starrte sie auf die dünne Haut an ihrem Unterarm, die feinen blauen Adern. Behutsam legte sie das Messer darauf und verharrte. Es wäre so unglaublich einfach. Amélie lehnte sich gegen die Küchenplatte und schloss die Augen. Ein einziger schneller Schnitt. Nur wenige Sekunden – dann wäre es vorbei. Für immer. Es gäbe kein Grübeln mehr, und die düsteren Gedanken würden für ewig verschwinden. Sie müsste nicht mehr nachdenken, nicht mehr hadern. Die Verlockung wuchs. Worauf wartete sie? Es gab nichts mehr, das sie zurückhielt. Amélie hatte alles verloren, was ihr in ihrem Leben je etwas bedeutete. Ihre Familie, ihre Berufung, ihre Gefühle. Die Zukunft lag dunkel und trostlos vor ihr.
Wer würde sie vermissen? Ihre Eltern. Natürlich. Wer noch? Amélie musste sich eingestehen, dass sie sich in den letzten Jahren komplett von der Außenwelt zurückgezogen hatte. Das Schreiben war schon immer eine einsame Angelegenheit gewesen. Und Amélie mochte das Alleinsein. Sie hatte noch nie Menschen um sich herum gebraucht, um glücklich zu sein. Doch jetzt war sie nicht nur allein und einsam, sie hatte förmlich aufgehört zu existieren. Die Leser kannten ihren Namen durch ihre Bücher. Ihr Verleger wollte sie weiter vermarkten, ihre Verkaufszahlen für zukünftige Projekte nutzen. Und auch Tina hatte für ihre Anrufe und Nachfragen vorwiegend finanzielle Motive. Keinem von ihnen ging es wirklich um den Menschen hinter dem Autorennamen.
Amélie drückte sich die Schneide fester ins Fleisch. Wie hatte es nur so weit kommen können? Ja, sie hatte einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Aber das hatten ihre bisherigen Protagonisten doch auch. Und jeder von ihnen hatte über kurz oder lang ein neues Glück gefunden. Warum schaffte Amélie das nicht?
Ihre Haut begann zu brennen. Sie öffnete die Augen und starrte fassungslos auf die dünnen roten Linien, die sich über ihren Unterarm zogen. Ein solches Schicksal hatte sie noch keiner ihrer Figuren auf den Leib geschrieben. Sie war schon immer eine überzeugte Verfechterin des traditionellen Happy Ends gewesen. Niemals hätte sie es übers Herz gebracht, ihre Leser mit einem traurigen Ende in den Alltag zu entlassen. Fast hätte Amélie aufgelacht. Ihre Protagonisten lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende, während sie selbst gerade dabei war, sich zu ritzen, um endlich überhaupt wieder etwas zu fühlen, und wenn es nur der Schmerz der Schnitte war.
Das Blut auf ihrer Haut begann bereits zu gerinnen. Plötzlich erschien ihr die ganze Situation grotesk und irreal.
Szenen einer Lesung erschienen vor ihrem geistigen Auge. Es war eine ihrer ersten Veranstaltungen gewesen. Eine Buchhandlung in Stuttgart hatte einen bunten Abend organisiert, mit Büfett und Sektempfang. Als Amélie eingetroffen war, platzte der Laden bereits aus allen Nähten. Amélie liebte es, vor der eigentlichen Lesung mit den Gästen zu reden. Immer wieder ergaben sich dabei interessante Gespräche. An jenem Abend war es jedoch aufgrund der vielen Zuhörer nicht möglich gewesen, abseits der Lesung den Kontakt zum Publikum zu suchen. Amélie hatte sich auf Anraten der Buchhändlerin in ein kleines Büro gesetzt und auf den Beginn der Veranstaltung gewartet. Ganz unverhofft war es drei Minuten vor acht einer der Zuhörerinnen gelungen, zu Amélie vorzudringen. Die Frau war sehr schlank, fast schon dürr gewesen. Sie hatte große grüne Augen, mit denen sie Amélie voller Dankbarkeit ansah.
»Ihr Buch hat mir das Leben gerettet«, hatte sie ihr ohne jede Einleitung erklärt. »Sie haben mir das Leben gerettet.«
Die Wucht ihrer Worte hatte Amélie in dem Augenblick die Sprache verschlagen. Fragend sah sie die junge Frau an, bis diese ihr ihre Geschichte in kurzen abgehackten Sätzen erzählte. Ihr Bruder habe vor fünf Jahren Suizid begangen, nachdem ihm mitgeteilt worden war, dass er an einem unheilbaren Tumor leide. Zwei Jahre später seien ihre Eltern bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nachdem sich im letzten Jahr ihr Freund von ihr getrennt und sie fast zeitgleich ihren Job verloren hatte, habe sie keinen Sinn mehr in ihrem Leben gesehen. Die Überdosis an Schlaftabletten hatte sie schon auf ihrem Nachttisch bereitgestellt gehabt. Durch Zufall habe sie an jenem Tag von einer Bekannten Amélies Buch geschenkt bekommen. Das Cover habe sie so angesprochen, dass sie sich schwor, dieses Buch als Letztes in ihrem Leben zu lesen, bevor sie Schluss machen würde. Als sie am nächsten Morgen mit der Geschichte durch war, brachte sie es jedoch nicht mehr übers Herz, sich das Leben zu nehmen. Die Geschichte um Sandra und Richard habe ihr auf eindringliche Weise gezeigt, dass das Leben zu kostbar sei, um es leichtfertig wegzuwerfen. Sie habe sich zusammengerissen und aufgerafft, einen neuen Job gesucht, und seit drei Monaten gebe es auch wieder jemanden in ihrem Leben. Doch die Frau war felsenfest davon überzeugt gewesen, dass sie nicht mehr leben würde, hätte sie an jenem Abend, in jener Nacht nicht Amélies Buch gelesen.
Dieses Schicksal hatte Amélie damals so berührt, dass sie bei der anschließenden Veranstaltung trotz der mindestens zweihundert anwesenden Gäste das Gefühl nicht verließ, allein für diese eine Frau zu lesen, die der Meinung war, Amélie habe ihr mit ihrer Geschichte das Leben gerettet.
Warum musste sie gerade jetzt daran zurückdenken? Erneut verstärkte sie den Druck des Messers auf ihrer Haut. Selbst wenn sie einer Frau das Leben gerettet hatte, unwissentlich und indirekt, bedeutete das nicht, dass sie auch in der Lage sein würde, sich selbst zu retten. Wieder schloss sie die Augen und konzentrierte sich auf das Messer in ihrer Hand. Während sie stumm die Lippen bewegte und die Haut erneut zu brennen begann, ertönte in die Stille hinein die Türklingel.
»Kommissar Schmidt?« Überrascht blickte Amélie im Hausflur dem Polizeibeamten entgegen, den sie mehr als zwei Jahre nicht gesehen hatte.
»Guten Abend, Frau Trauber.« Er nickte leicht. »Störe ich?«
Amélie schüttelte den Kopf und deutete in die Wohnung hinter sich. »Kommen Sie doch rein.« Verlegen nestelte sie an dem Küchenhandtuch herum, das sie sich nach dem Klingeln hastig um den Unterarm geschlungen hatte.
»Haben Sie sich verletzt?« Der Kommissar zeigte auf ihren Arm.
»Nichts Schlimmes«, beeilte Amélie sich zu sagen. »Nur ein kleiner Schnitt.« Verunsichert wich sie seinem prüfenden Blick aus, während sie zur Seite trat.
»Ich möchte wirklich nicht stören.«
Sie senkte den Kopf. »Das tun Sie nicht«, erwiderte sie leise und betrat vor ihm das Wohnzimmer. »Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?«
Kommissar Schmidt winkte ab.
»Bitte.«
Nachdem sie sich gesetzt hatten, schwiegen beide, bis der Polizist sich schließlich räusperte. »Soll ich mir die Wunde mal ansehen?«
Wieder schüttelte Amélie den Kopf. »Warum sind Sie hier?« Ihre Stimme klang belegt. Sie betrachtete den Mann, den sie auf das Alter ihres Vaters schätzte.
»Wir haben uns lange nicht gesehen«, begann er vorsichtig.
Sie nickte.
»Die Pressestelle hat mich informiert, dass gestern eine Anfrage bezüglich Ihres Falles hereinkam.«
Amélie setzte sich aufrecht hin. Ihr Puls beschleunigte sich. »Was soll das heißen?«
Der Polizist zögerte. »Ein Journalist hat um Details zu dem Unfall gebeten.«
Amélies Gedanken rasten. »Ich verstehe nicht …«
Kommissar Schmidt wiegte den Kopf hin und her. »Die Mitarbeiterin hat ihm nur die offiziellen Informationen zukommen lassen.«
Sie schluckte. »Die offiziellen Informationen? Wie meinen Sie das? Welche Informationen sind denn inoffiziell?«
Sein Blick wurde eindringlicher. »Der Reporter interessierte sich auffallend stark für Ihr Privatleben, Frau Trauber.«
Amélie verschränkte die Finger, um das Zittern zu verbergen. Dabei rutschte das Handtuch vom Gelenk.
»Eine ungewöhnliche Stelle, um sich gleich mehrfach zu schneiden«, merkte der Beamte mit ruhiger Stimme an.
Amélie wandte den Blick ab, während sie das Handtuch eilig aufhob und es wieder über die Wunde legte.
»Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«
»Mir kann niemand helfen«, murmelte sie bitter.
»Was Ihnen widerfahren ist, ist furchtbar. Aber Sie sind jung. Vielleicht sollten Sie sich Hilfe holen.« Er lächelte. »Sie haben noch Ihr ganzes Leben vor sich.«
»Was wollte dieser Journalist wissen?«, lenkte sie ihn auf das ursprüngliche Thema zurück. »Wegen meines Privatlebens?«
»Ob Ihr Mann eine Affäre hatte. Ob Sie einen Liebhaber hatten. Ob es an jenem Abend Streit gab. Und in diesem Zusammenhang, ob der Unfallhergang so passiert sein konnte, wie Sie es damals geschildert haben.«
Wut kochte in Amélie hoch. »Er hat meine Glaubwürdigkeit angezweifelt?«
»Ich wollte Sie nicht aufregen«, versuchte der Polizist, sie zu beschwichtigen. »Mir ging es lediglich darum, Ihnen Bescheid zu geben, falls der Reporter sich direkt an Sie wenden sollte. Damit Sie vorbereitet sind.«
»Was hat Ihre Mitarbeiterin ihm gesagt?« Amélie musterte ihn argwöhnisch.
»Nur die offiziellen und frei zugänglichen Informationen.« Offen erwiderte er ihren Blick. »Alles andere geht niemanden etwas an, auch uns nicht.«
Da er nicht weitersprach, sah sich Amélie in der Pflicht, etwas zu entgegnen. »Wer ist dieser Schmierfink?«
Schmidt zuckte mit den Achseln. »Solche Anfragen gehen tagtäglich bei uns ein. Und natürlich hat die Öffentlichkeit ein gewisses Recht auf Transparenz und Aufklärung. Aber wenn jemand nur Staub aufwirbeln will um des Ärgers willen, womöglich einen Skandalbericht schreiben möchte … Außerdem ist es mittlerweile drei Jahre her.« Er verzog das Gesicht. »Da ist er bei uns an der falschen Adresse.«
Amélie überlegte. Sie hatte den Kommissar während der Ermittlungen nach dem Unfall als äußerst einfühlsamen und kompetenten Beamten kennengelernt. Er hatte sie immer wieder im Krankenhaus besucht, obwohl die Aufklärung des Unfallhergangs längst abgeschlossen worden war. In jener Zeit hatte Amélie sich mehr als einmal gewünscht, sie hätte ebenfalls nicht überlebt. Doch hatte sich daran überhaupt etwas geändert? Ihre Augen wanderten zu dem Handtuch.
»Soll ich jemanden für Sie anrufen?« Er deutete erneut auf ihren Arm, da er die Bewegung wahrgenommen zu haben schien. »Eigentlich darf ich Sie in diesem Zustand nicht allein lassen.«
»Welcher Zustand?« Sie blinzelte. »Ich habe mich beim Kochen geschnitten.«
Er blickte sie lange an. »Ihre Küche glänzt blitzblank. Ich kann nicht den Hauch eines Essensgeruchs wahrnehmen. Hier wurde heute mit Sicherheit noch nicht gekocht.«
Amélie schloss kurz die Augen. Was sollte sie darauf erwidern? Der Mann war Polizist. Ihm konnte sie nichts vormachen. »Sie können mich allein lassen«, hauchte sie kaum hörbar.
»Lassen Sie sich helfen«, wiederholte er ernst. »Es gibt Ärzte, die darauf spezialisiert sind, Menschen wie Ihnen zu helfen.«
Menschen wie Ihnen, dachte Amélie verzweifelt. Was genau zeichnete Menschen wie sie denn aus? »Ich glaube, ich wäre jetzt gern allein.«
Der Polizist erhob sich und nickte. »Sie kommen zurecht?«
Sie nickte leicht. »Danke, dass Sie vorbeigekommen sind.«
»Ich finde allein hinaus.« Er trat einen Schritt auf sie zu und fasste nach ihrer linken Hand. »Wenn Sie reden möchten, können Sie mich jederzeit anrufen. Jederzeit, einverstanden?«
»Danke.«
»Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute.«
Nachdenklich verfolgte sie, wie der hagere Mann den Raum verließ. Wenige Augenblicke später wurde die Wohnungstür geöffnet und wieder ins Schloss gezogen. Erst jetzt bemerkte sie, dass sie die Luft angehalten hatte. Amélie atmete tief aus. Behutsam entfernte sie das Handtuch und betrachtete die roten Linien. Was sollte sie bloß tun? Amélie spürte, dass sie nicht mehr viel tiefer fallen konnte. Sie musste dringend etwas ändern. Aber was? Während sie grübelte, sah sie sich in ihrem Wohnzimmer um. Der Raum war viel zu groß für sie allein. Gleich morgen früh würde sie sich um einen Makler kümmern, den sie mit dem Verkauf der Wohnung beauftragen konnte. Doch wo sollte sie hin?
Das Gespräch mit ihren Eltern fiel ihr wieder ein. Sie hastete in den Flur, holte ihr Handy aus der Handtasche und wählte ihre Tante an, bevor sie es sich anders überlegen konnte. »Der Teilnehmer ist vorübergehend nicht erreichbar.«
Dann also nicht, dachte sie, bevor sie sich ihre Oma bildlich vorstellte. Es musste Jahre her sein, dass sie den französischen Teil ihrer Familie gesehen hatte. Während ihrer Kindheit und Jugend war sie regelmäßig mit ihren Eltern nach Collioure gefahren. Sie kannte die Côte Vermeille, die oft auch als Purpurküste bezeichnet wurde, wie ihre Westentasche. Gedankenversunken öffnete sie einen der Wohnzimmerschränke und holte ein altes Fotoalbum hervor. Fast hätte sie aufgeschluchzt, als sie auf der ersten Seite ihre Oma erblickte, die gerade dabei war, Baguetteteig zu kneten. Amélie schloss die Augen und meinte beinahe, den Duft des frischen Brots wahrnehmen zu können. Wie glücklich war sie gewesen, wenn sie ihrer Großmutter während der Ferien immer in der Baguetterie hatte helfen dürfen. Während ihre Eltern Ausflüge in die Umgebung unternahmen, hatte Amélie es meist vorgezogen, bei ihrer Oma zu bleiben und der alten Frau in der Backstube zur Hand zu gehen. Collioure, der kleine Ort, nur wenige Kilometer von der französisch-spanischen Grenze entfernt, symbolisierte für sie ein völlig anderes Lebensgefühl voller Leichtigkeit und Sorglosigkeit. Ja, in Collioure war sie glücklich gewesen. Warum hatte sie es bloß so lange nicht mehr dorthin geschafft? Ihre Oma wurde nicht jünger. Amélie blätterte um und betrachtete das Wohnhaus, in dem der kleine Laden ihrer Großmutter untergebracht gewesen war und in dem sie bis zu ihrem Umzug in ein Pflegeheim lange Jahre allein gelebt hatte. Amélies Opa war schon vor über dreißig Jahren verstorben.
Sollte sie es wirklich wagen? Es war eine sehr lange Strecke, die sie allein bewältigen müsste. Soweit sie wusste, stand das Haus ihrer Oma, das Elternhaus ihres Vaters, leer. Sicher wäre es kein Problem, dort für eine Weile unterzukommen. Was hielt sie hier? Die Wohnung war untrennbar mit dem Unfall vor drei Jahren verbunden. Alles hier erinnerte sie daran, was ihr Leben einmal ausgemacht hatte. Entschlossen drückte sie auf die Wahlwiederholungstaste, doch wieder kam nur der automatische Ansagetext vom Band. Amélie würde es weiter versuchen. Irgendwann musste ihre Tante schließlich ans Telefon gehen. Eingehend betrachtete Amélie das nächste Foto, das sie vor der Wehrkirche am Hafen zeigte. Sehnsucht stieg in ihr auf. Die sich brechenden Wellen im Hintergrund, das intensive Blau des südfranzösischen Himmels darüber, die schmalen vierstöckigen Häuser der Altstadt. Warum war sie nicht schon längst auf diese Idee gekommen? Sie musste hier weg. Dringend. Vielleicht schaffte sie es in der Heimat ihres Vaters, endlich ein wenig zur Ruhe zu kommen und die Dämonen der Vergangenheit zu vertreiben.
»Warum?« Ihre Stimme klang schrill.
Thorsten sah sie nicht an. »Was willst du denn hören?«
Amélie versuchte, sich zusammenzureißen, doch Wut und Enttäuschung saßen zu tief. »Ich möchte eine Antwort.«
»Ich weiß nicht, was ich sagen …«
»Die Wahrheit, verdammt noch mal«, fauchte sie ihn an, während sie weiter starr auf die dunkle Fahrbahn blickte.
»Marco schläft«, versuchte ihr Mann, sie zu beschwichtigen.
»Ach, plötzlich interessiert dich das Wohlergehen deines Kindes wieder. Vielleicht hättest du dir vorher mal Gedanken machen sollen, was dein …« Sie wusste, dass ihr dieser Sarkasmus nicht stand.
»Amélie«, zischte er. »Unser Sohn schläft. Bitte sprich leiser.«
Zornig schüttelte sie den Kopf. »Du erbärmlicher Feigling.« Ihr Gedanken rasten. Sie wollte nur noch nach Hause.
»Können wir das bitte in Ruhe daheim besprechen?«
»In Ruhe?« Amélie konnte sich kaum noch im Zaum halten. Am liebsten hätte sie die Autotür aufgerissen und wäre hinausgesprungen. Sie überkam das bittere Gefühl, es keine Sekunde länger neben dem Mann auszuhalten, von dem sie all die Jahre gedacht hatte, er sei die Liebe ihres Lebens.
Thorsten schnallte sich ab und beugte sich nach vorn.
»Was machst du da?«, wollte sie nervös wissen.
»Mein Handy ist runtergefallen.«
Wie aus dem Nichts tauchten plötzlich zwei grelle weiße Scheinwerfer in der Dunkelheit vor ihnen auf. Fuhr der Wagen nicht viel zu weit auf ihrer Seite? Amélie schluckte, während sie weiter auf die Fahrbahn stierte.
»Was macht der Idiot denn da?«, fluchte Thorsten neben ihr, während er sich wieder aufrichtete.
Amélies Finger verkrampften. Weit und breit war kein anderer Wagen zu sehen. Warum fuhr der Fahrer bloß so weit rechts? Ihr stockte der Atem.
Im nächsten Augenblick bemerkten sie, dass der Wagen nicht nur viel zu weit von seiner Seite abgewichen war, sondern ihnen frontal auf ihrer Fahrbahn entgegenkam. Amélie begann, heftig zu zittern, als ihr bewusst wurde, dass die Situation gerade außer Kontrolle geriet, der Abstand viel zu kurz war. Ihr Fahrzeug brach aus, während der andere Wagen hupend wieder auf seine Seite hinüberzog. Immer schneller rollten sie die steile Böschung hinunter, die sich direkt neben der Straße den Hügel hinabzog. Sie schrie erschrocken auf, während auch Thorsten neben ihr etwas brüllte, das sie jedoch nicht verstand. Während das Auto immer weiter beschleunigte, wurde Amélie auf ihrem Sitz herumgeschleudert. Marco, schoss es ihr durch den Kopf.
Als der Wagen schließlich mit einem lauten Schlag auf die Seite kippte und zum Liegen kam, erstarb der Motor. Eine beängstigende Stille breitete sich aus.
Amélies Kopf dröhnte, ihr linkes Bein brannte wie Feuer. Mit bebenden Fingern nestelte sie an ihrem Anschnallgurt herum, der ihr fast die Luft abschnürte, und versuchte hektisch, ihn zu lösen. »Marco? Thorsten?«
Keine Antwort. Totenstille.
Amélie bekam die Schnalle nicht zu fassen. Panik stieg in ihr auf. Sie blickte zur Seite. Thorstens Sitz war leer. Nein, das konnte nicht sein! Eben hatte er doch noch hier gesessen. Wo war er?
»Marco?« Verzweifelt versuchte Amélie, sich zu ihrem Sohn umzudrehen, der bis eben friedlich auf der Rückbank geschlafen hatte. »Geht es dir gut, mein Schatz?« Ihre Stimme glich einem Wimmern. »Marco?« Sie konnte sich nicht befreien, war zwischen Sitz und geöffnetem Airbag eingezwängt. Wütend schlug sie mit ihrer rechten Faust auf den weißen Stoff. Erneut tastete sie nach der Gurtschnalle, bis sie sie endlich zu fassen bekam. Nachdem sie mehrfach ungeduldig auf den Knopf gedrückt hatte, löste sich der Gurt. Der Schmerz in Amélies linkem Bein war einer merkwürdigen Taubheit gewichen. Auch ihren Fuß spürte sie nicht mehr. Was war passiert? Hatte der Fahrer des anderen Wagens nicht angehalten? Sie brauchten dringend Hilfe. Und was war mit ihrem Sohn und Thorsten? Mühsam schälte sie sich hinter dem Airbag hervor, bis sie schließlich unsanft auf der Wagentür aufschlug. »Ah!«, entfuhr es ihr schmerzerfüllt, als ihr verletztes Bein sich wieder meldete. Ihr Blickfeld verschwamm, das Donnern in ihrem Kopf wurde lauter. Sie durfte jetzt nicht ohnmächtig werden. Wo war ihr Handy? Sie musste Hilfe rufen. Erschöpft schloss sie die Augen, bevor sie sich wieder an Marco erinnerte. Ihr geliebtes Kind. Was war mit ihm? Sie versuchte ein weiteres Mal, den Kopf zu drehen, doch das Flimmern vor ihren Augen wurde immer stärker. Nein, sie musste zu ihrem Sohn. »Marco?« Ihre Stimme glich nur noch einem Krächzen. Wieder keine Antwort. »Thorsten?« Stille. Wo war er bloß? Hatte er sich bereits retten können? Hatte er vielleicht schon den Notarzt gerufen? Amélies Gedanken verloren sich. Immer stärker wurde sie in undurchdringliche Dunkelheit gezogen.
»Können Sie mich hören? Hallo? Hören Sie mich?«
Amélies Lider fühlten sich bleischwer an. Wer weckte sie auf so unliebsame Weise?
»Hallo? Kommen Sie bitte zu sich!«
Ja, ja, sie versuchte es ja. Wer redete da nur mit ihr? Die Stimme war ihr fremd.
Als sie blinzelte, nahm sie ein unscharfes Gesicht über sich wahr.
»Können Sie mich hören?«
Sie nickte schwach. Ihre Kehle fühlte sich staubtrocken an.
»Sie hatten einen schweren Unfall. Wir bringen Sie jetzt ins Krankenhaus. Verstehen Sie mich?«
Amélies Gehirnwindungen ratterten unaufhörlich. Was war geschehen?
»Für den Jungen können wir nichts mehr tun«, ertönte eine Stimme wie in weiter Ferne.
Was? Von wem redeten die Leute? War noch ein anderer Wagen in den Unfall verwickelt gewesen?
Sie hustete. »Marco? Mein Mann?« Warum klang ihre Stimme nur so heiser?
»Wir bringen Sie jetzt ins Krankenhaus, wo Sie weiterbehandelt werden. Ihr Mann und Ihr Sohn sind bereits auf dem Weg dorthin.«
Erleichterung machte sich in Amélie breit. Die Leute hatten tatsächlich von jemand anderem gesprochen. Ihre beiden Männer hatten den Unfall überlebt. Wahrscheinlich waren sie ebenfalls verletzt, aber sie lebten. Vorsichtig bewegte sie den Kopf und konnte undeutlich erkennen, wie zwei Sanitäter in einiger Entfernung einen kleinen Zinksarg anhoben. Traurig schloss sie die Augen. Ein Kind musste ums Leben gekommen sein. Die armen Eltern, schoss es ihr noch durch den Kopf, bevor sich ihre Gedanken erneut zu verabschieden begannen.
»Wir haben ihr ein starkes Schmerzmittel verabreicht, damit wird sie eine Weile schlafen. Das Bein sieht nicht gut aus. Sagt im OP Bescheid, dass wir gleich kommen.«
Schweißgebadet schreckte Amélie hoch. In der Stille der Dunkelheit konnte sie das laute Pochen ihres Herzens hören. Der Traum war selbst jetzt noch beängstigend realistisch. Warum musste sie ausgerechnet heute von der schlimmsten Nacht ihres Lebens träumen? Amélie tastete blind nach dem Schalter ihrer kleinen Nachttischlampe. Ein Blick auf die Uhr verriet ihr, dass es kurz nach Mitternacht war. Sie lag noch keine zwei Stunden im Bett. Erschöpft ließ sie sich auf ihr Kissen zurücksinken. An Schlaf war nicht mehr zu denken. Wieder erschien der kleine Sarg vor ihrem geistigen Auge, in dem man Marco abtransportiert hatte. Amélie hatte ihn nicht retten können. Die Gerichtsmedizin war zu dem Ergebnis gekommen, dass ihr damals zweijähriger Sohn sich beim Umkippen des Autos das Genick gebrochen haben musste. Er war sofort tot gewesen. Wahrscheinlich war er nicht einmal mehr vor dem Unfall aufgewacht. Amélie begann, stumm zu weinen. Thorsten war im Krankenhaus wenige Stunden später an seinen inneren Verletzungen gestorben. Durch den Aufprall war er aus dem Wagen geschleudert und zwanzig Meter von dem Unfallwrack entfernt gefunden worden.
Amélie wischte sich über die Augen. Wenn sie morgen wirklich nach Collioure aufbrechen wollte, musste sie dringend noch ein paar Stunden schlafen. Entschlossen stand sie auf und ging ins Badezimmer hinüber. Ihr Hausarzt hatte ihr bereits vor einigen Monaten Schlaftabletten verschrieben für den Fall, dass die Erinnerungen wieder allzu übermächtig wurden. Nachdem sie eine davon mit einem Glas Wasser eingenommen hatte, kehrte sie ins Bett zurück, löschte das Licht und wartete darauf, dass der künstlich herbeigerufene Schlaf sie endlich einholen und die Schatten der Vergangenheit zumindest für ein paar Stunden vertreiben würde.
4
Nachdenklich stand Amélie vor ihrem Kleiderschrank und betrachtete den Inhalt. Früher hatte sie die Vorfreude auf einen geplanten Urlaub geliebt, die Aufregung beim Packen, die Emsigkeit, ob man auch ja alles dabeihatte. Heute erschien ihr die Überlegung, was sie in Südfrankreich brauchen könnte, nur lästig. Doch ohne Gepäck konnte sie nicht losfahren. Amélie musste sich endlich zusammenreißen und ihre Klamotten sichten. Ihr Blick fiel auf ein rotes Kleid rechts im Schrank. Sie wusste noch genau, wofür sie es gekauft hatte. Als Bernd Sattler ihr mitgeteilt hatte, dass die Rechte für eines ihrer ersten Bücher an zwei ausländische Verlage verkauft worden waren, hatte Thorsten sie zur Feier des Tages schick zum Essen ausführen wollen. Marco war gerade wenige Monate alt gewesen. An jenem Abend hatten ihre Eltern zum ersten Mal auf ihren Enkel aufgepasst, und Amélie hatte zum ersten Mal ihr neues rotes Kleid ausgeführt, dachte sie nun traurig, während sie den Bügel wegschob und einige dünnere Sommerkleider hervorzog. Thorsten und sie waren in einem teuren Restaurant direkt am Neckar zum Essen gewesen. Zum ersten Mal hatten sie zu zweit für einen dreistelligen Betrag gespeist – und überhaupt keine Reue dabei empfunden. Es war ein besonderer Abend gewesen, der sich auf diese Weise niemals wiederholen sollte.
Lustlos nahm sie einen Stapel T-Shirts aus dem Schrank und legte kurze Hosen und Unterwäsche dazu, bevor sie sich aufs Bett sinken ließ. Ihr Vorhaben war Wahnsinn. Trotz der Schlaftablette war die Nacht unruhig und kurz gewesen. Obwohl es erst sieben Uhr war, wurde das Schlafzimmer bereits in gleißendes Sonnenlicht getaucht. Die breite Fensterfront, die einen atemberaubenden Blick auf den Neckar freigab, ließ die wärmenden Strahlen ungehindert in den Raum einfallen.
Müde angelte sich Amélie ihr Handy und versuchte erneut, bei ihrer Tante anzurufen. »Der Teilnehmer ist vorübergehend nicht erreichbar.« Verdammt! Wo steckte Valérie? Vielleicht sollte sie es bei Charlotte versuchen, ihrer Cousine. Es musste mehr als acht Jahre her sein, dass sie zuletzt Kontakt zu ihr hatte. Soweit Amélie wusste, lebte sie nicht mehr in Collioure. Sicher konnte sie ihr sagen, wo Valérie war. Amélie erhob sich wieder, öffnete die Schublade einer Kommode und holte zwei Bikinis und einen Badeanzug heraus. Die Koffer befanden sich in einem kleinen Abstellraum, der vom Flur abging. Amélie kehrte mit dem größten davon ins Schlafzimmer zurück und begann, ihre Kleidung darin zu verstauen. Nachdem sie mehrere Paar Schuhe in eine separate Reisetasche gepackt hatte, stellte sie beide Gepäckstücke in den Gang. In der Küche war in der Zwischenzeit der Kaffee durchgelaufen. Amélie schenkte sich eine Tasse ein und trat auf die weitläufige Terrasse hinaus. Trotz der frühen Morgenstunde war es schon warm. Zwei Ruderer trieben ihr Kajak mit gleichmäßigen Armbewegungen auf dem Wasser voran. Auf der Wiese am Ufer spielten zwei Hunde ausgelassen miteinander, während deren Besitzer sich unterhielten und immer wieder zu ihren Tieren hinübersahen.
Das Schloss aus rotem Sandstein thronte wie immer majestätisch am Nordhang des Königsstuhls, schräg gegenüber von ihrer Wohnung.
Amélie würde ihre Eltern damit beauftragen, einen Makler zu kontaktieren. Ihr fehlte die Kraft, sich von einem Wildfremden die Vorzüge ihrer Immobilie aufzählen zu lassen. Wenn sie mit der Vergangenheit abschließen wollte, musste sie sich endlich von ihrem Zuhause trennen.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.
Widmung
Für Christian