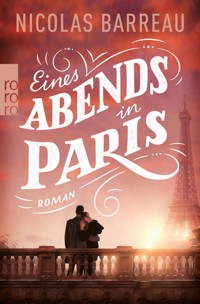19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Einladung, zwei Hochzeiten und vierundzwanzig Stunden, die alles verändern An einem regnerischen Tag im April erhält Jean-Pierre Morel eine Einladung, die sein Leben verändern wird. Zu seiner Überraschung lädt ihn Paul, sein ehemals bester Freund, zu seiner Hochzeit auf einem Schloss in Südfrankreich ein. Doch am Tag des Festes läuft alles schief. Seine Ex-Freundin taucht plötzlich auf und macht ihm eine Szene, seine Mutter verstaucht sich den Fuß und muss zum Arzt gefahren werden. In all der Aufregung vergisst er bei seinem Aufbruch die Einladung. Den Namen des Chateaus hat er so halbwegs im Kopf. Als er unterwegs eine Panne hat, würde Jean-Pierre am liebsten aufgeben. Doch nach seiner Ankunft auf dem malerischen Anwesen lernt er schon bald Juliette kennen, eine junge rothaarige Frau, die ihm zuvor an der Tankstelle waghalsig die Vorfahrt genommen hatte. Juliette, die stets zu sagen scheint, was ihr durch den Kopf schießt, erweist sich als eine ganz bezaubernde Gesellschaft. Und als Jean-Pierre am Ende des Tages schwant, dass er sich auf dem falschen Fest befindet, hat schon eine neue Liebesgeschichte begonnen – nämlich seine eigene. In seinem neuen Roman erzählt SPIEGEL-Bestsellerautor Nicolas Barreau von den sonderbaren Wendungen, die das Leben manchmal nimmt, und vom Zauber der Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Nicolas Barreau
Die Freundin der Braut
Roman
Über dieses Buch
Manchmal ist die Freundin der Braut die wichtigste Person auf der Hochzeit ...
Jean-Pierre Morel betreibt sein kleines Literaturcafé in Paris mit viel Herzblut und Erfolg – in der Liebe hat der junge Mann allerdings weniger Glück. Das ändert sich, als er von seinem ehemals besten Freund Paul eine Einladung zur Hochzeit erhält, die auf einem Schloss in Südfrankreich stattfinden soll. Doch am Tag des großen Festes läuft alles schief, und in der Aufregung vergisst Jean-Pierre bei der Abfahrt die Einladungskarte. Das merkt er aber erst kurz vor Bordeaux. Nach einer abenteuerlichen Irrfahrt durch die aquitanischen Weinberge trifft er Stunden zu spät auf dem malerischen Anwesen ein, wo die Feier bereits in vollem Gange ist – vom Brautpaar keine Spur. Missmutig stellt Jean-Pierre fest, dass er offenbar keinen hier kennt. Doch dann trifft er zu seinem Leidwesen jene unverschämte rothaarige Frau wieder, die ihm kurz zuvor an der Tankstelle so dreist die Vorfahrt genommen hat. Juliette stellt sich als die Freundin der Braut vor – und erweist sich überraschend als ganz bezaubernde Gesellschaft auf diesem höchst sonderbaren Fest. Der Mond steht hoch über dem alten Château, Juliettes grüne Augen schimmern verwirrend ... Und wo steckt eigentlich Paul? Bevor Jean-Pierre noch begreift, dass an dieser Hochzeit etwas ganz und gar nicht stimmt, hat schon eine neue Liebesgeschichte begonnen – nämlich seine eigene.
Spiegel-Bestsellerautor Nicolas Barreau mit einem zauberhaften Roman über die Irrwege der Liebe und unerwartetes Glück.
Vita
Nicolas Barreau ist der Künstlername der Autorin und Verlegerin Daniela Thiele. Sie ist in Köln zu Hause, liebt Paris und das französische Savoir-vivre und betreibt zusammen mit ihrem Mann einen Verlag. Mit ihren charmanten Paris-Romanen eroberte sie sich ein begeistertes Publikum. Der Roman «Das Lächeln der Frauen» brachte den internationalen Durchbruch. Er erschien in 36 Ländern, war in Deutschland mit weit über einer Million verkauften Exemplaren «Jahresbestseller» und wurde anschließend verfilmt sowie in unterschiedlichen Inszenierungen an deutschen Bühnen gespielt. In «Die Zeit der Kirschen» erzählt die Autorin die Geschichte ihrer unvergesslichen Helden fort. Auch «Tausend Lichter über der Seine» bezauberte ihre Leserinnen und Leser.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung Ilina Simeonova/Trevillion Images
ISBN 978-3-644-00720-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für meine Familie.
Für die, die da sind, und für die, die nicht mehr da sind.
Ihr seid in meinem Herzen.
Die besten Dinge im Leben
verdanken wir dem Zufall.
Giacomo Casanova
1
Es regnete in Strömen. Das weiß ich noch genau. An dem Tag, als ich die Einladung zu Pauls Hochzeit bekam, versank Paris nahezu im Wasser. Von meinem Platz hinter der Theke aus sah ich die vorüberhastenden Passanten, die draußen mit ihren Regenschirmen kämpften. Diejenigen, die sich ins Café des Poètes flüchteten, das kleine Café an der Place du Marché Sainte-Cathérine, das seit einigen Jahren mir gehörte, taten dies mit einem Stoßseufzer oder einem Fluch über das «verdammte Wetter» und hinterließen kleine Pfützen auf dem alten Steinboden. Ich erinnere mich an einen gescheckten Hund mit lustigen braunen Knopfaugen, der ausgiebig sein Fell schüttelte, und an den Geruch von feuchten Wollpullovern, nassen Haaren und triefendem Hundefell, der sich mit dem Duft von frisch geröstetem Kaffee vermischte.
Der April hatte Einzug gehalten in Paris, und wie so oft in diesem Monat gab es Wolkenbrüche, bei denen man den Eindruck hatte, die Welt ginge gleich unter, dann wieder strahlend helle Tage, an denen die Sonne von einem zartblauen Himmel schien, sich in den Pfützen spiegelte und der Frühling sich unmerklich in alle Herzen stahl, die Verliebten in den Jardin du Luxembourg lockte und selbst den griesgrämigsten Misanthropen zum Lächeln brachte.
Doch an jenem schicksalhaften Tag ließ die Sonne sich nicht blicken.
Ich weiß noch, dass ich früh am Morgen im Regen durch das stille Marais ging, um mein Café aufzuschließen, und dass es am frühen Abend, als ich die Außengitter herunterließ, um mich auf den Weg nach Hause zu machen, immer noch regnete.
Als ich in der Rue Roger Verlomme ankam, stand Océane vor der Tür, um sich wieder einmal von mir zu trennen. Océane war meine Freundin, die sich im Laufe unserer dreijährigen On-off-Beziehung sehr rasch von einer sanftmütigen Blondine zu einer streitsüchtigen Xanthippe entwickelt hatte, der man es einfach nicht recht machen konnte. Besser gesagt, ich konnte es ihr nicht recht machen. Wir stritten oft, und ihr liebstes Hobby war es, Türen schlagend meine Wohnung zu verlassen.
Océane liebte den großen Auftritt, und obwohl sie selbst es gewesen war, die mich – zu meiner Erleichterung, wie ich gestehen muss – nach zahlreichen unschönen Auseinandersetzungen verlassen hatte, konnte sie einfach keine Ruhe geben und erfand immer einen neuen Vorwand, um unvermittelt bei mir aufzutauchen. Einmal ging es um ihre Lieblingstasse, die angeblich noch in meinem Küchenschrank war, ein anderes Mal wollte sie mir mit großer Geste die Wohnungsschlüssel zurückgeben, die ich ihr hatte nachmachen lassen. Und dann sagte sie mir noch einmal, was für ein Idiot ich sei, was für ein unsäglicher Träumer, dass keine Frau es auf Dauer mit mir aushalten würde und ich es noch einmal sehr bereuen würde, dass ich sie hätte gehen lassen. Sehr!
Auch an diesem Abend löste sie sich mit einem Mal aus dem Schatten des Hauseingangs und behauptete, ich hätte noch Weinflaschen von ihr im Keller.
«Weinflaschen? Was für Weinflaschen?», seufzte ich, während der Regen unaufhörlich auf das Pflaster prasselte.
«Den Châteauneuf-du-Pape, den ich damals auf unserer Reise nach Avignon gekauft habe. Den hätte ich gern zurück.»
Mit einem kleinen Schauder, der nicht von der regennassen Luft herrührte, erinnerte ich mich an unsere einzige gemeinsame Reise in die Provence vor zwei Jahren. Es war sehr heiß gewesen in jenem Sommer, und statt des blühenden Lavendels, auf den wir uns gefreut hatten, erwarteten uns abgeerntete Stoppelfelder. Das war natürlich mein Fehler. Das war schlechtes Timing. Ich hätte es besser wissen müssen. Warum waren wir überhaupt erst im Juli gefahren? Doch ich war kein Meteorologe, und auf das Klima in Westeuropa hatte auch ich keinen Einfluss. Dann war das Hotel, das ich in Villeneuve-lès-Avignon gebucht hatte, nicht gut genug, das Zimmer, von dem man einen wunderbaren Blick auf die Rhône und das gegenüberliegende Städtchen Avignon hatte, zu klein, die Matratze durchgelegen, der Orangensaft, den es zum Frühstück gab, nicht frisch gepresst.
Avignon war voll von englischen Touristen, die sich auf der berühmten Brücke drängten, wo alle «rundherum tanzen». In Les Baux fanden wir keinen Parkplatz und mussten zu Fuß den steilen Anstieg in die Altstadt machen, in Roussillon, wo die ockerfarbenen Felsen uns von Weitem in voller Pracht entgegenleuchteten, war das Essen nicht wirklich gut, und in Arles war an dem Tag, als wir hinfuhren, kein Markt. Die Stimmung war gereizt, ich war an allem schuld.
Océane saß mit beleidigter Miene auf dem Beifahrersitz, wedelte sich ostentativ mit einem Fächer Luft zu, den sie sich an den Straßenständen in Fontaine-de-Vaucluse gekauft hatte, wo wir bis zur Quelle der Sorgue gegangen waren (die immerhin so türkisblau und unergründlich gewesen war wie eh und je), und beschwerte sich darüber, dass mein alter Citroën keine Klimaanlage hatte. In ihrer Höhere-Töchter-Manier, die mir stets das Gefühl gab, nicht zu genügen, streckte sie seufzend ihre langen filigranen Glieder, schob den goldenen Armreif, den ihr Vater ihr zum achtzehnten Geburtstag geschenkt hatte, hin und her und schwärmte von den großartigen Reisen, die sie als Jugendliche mit ihren Eltern gemacht hatte – nach Biarritz, Honfleur oder Saint-Tropez.
Océane stammte aus einem Professoren-Haushalt, ihr Vater war ein berühmter Fledermausforscher, der seiner hübschen Tochter jeden Wunsch von den Augen ablas, ihre Mutter eine geistesabwesende Botanikerin, die überwiegend für ihre Pflanzen lebte, der Großvater hatte als Schiffbauingenieur und Erfinder ein Vermögen verdient. Geld spielte keine Rolle in der Familie de Rochenais. Océane hatte die besten Schulen besucht, mehrere Studien angefangen, weil sie sich nicht entscheiden konnte, sie war sprunghaft und verwöhnt, wenn sie wollte, konnte sie bezaubernd sein, aber auf dieser Reise war sie vor allem eines: unausstehlich. Als wir nach zwei Wochen Provence die Silhouette von Paris am Horizont auftauchen sahen, war ich einigermaßen erleichtert, dass dieser missglückte Urlaub endlich ein Ende hatte und sich jeder von uns erst einmal in seine eigene Wohnung zurückziehen konnte.
Mag sein, dass wir damals auch in dem kleinen Ort Châteauneuf-du-Pape ein paar Flaschen Rotwein gekauft hatten, ich wusste es nicht mehr.
«Hör zu, Océane», sagte ich. «Ich schaue gern im Keller nach, und wenn da wirklich noch Weinflaschen von dir sind, bringe ich sie dir mit dem Auto vorbei, in Ordnung?»
«Nein, ich will selber nachschauen», beharrte sie. «Jetzt. Ich nehme sie dann gleich mit. Es sind meine Weinflaschen.»
«Willst du im Ernst mit einem Karton Châteauneuf-du-Pape durch diesen Regen marschieren?», fragte ich. «Brauchst du die Flaschen denn so dringend?» Ich lächelte versöhnlich. Es kam nicht gut an.
«Deine blöden Sprüche kannst du dir sparen. Lässt du mich jetzt rein, oder nicht?»
Ich schwieg. Ehrlich gesagt, sehnte ich mich nach einem friedlichen Abend und hatte das ungute Gefühl, dass das Gezeter drinnen nur weitergehen würde.
«Du willst mich also nicht reinlassen? Du bist echt das Letzte, Jean-Pierre, weißt du das?»
«Ja, ich weiß. Das hast du mir nun schon oft genug gesagt. Und deswegen sind wir ja auch nicht mehr zusammen. Können wir die ganze Sache nicht endlich auf sich beruhen lassen?»
Ich versuchte wirklich, freundlich zu bleiben, was Océane offenbar noch mehr erboste.
«Die Sache! So nennst du unsere Beziehung? Hast du überhaupt Gefühle? Du unsensibler Klotz», fauchte sie mich dann an, und ihre schönen Augen funkelten und waren immer noch schön.
Ich musste kurz daran denken, wie Océane vor drei Jahren das erste Mal ins Café des Poètes gekommen war und eine Weile staunend die Gedichtzeilen von Guillaume Apollinaire, Paul Éluard und Jacques Prévert studiert hatte, die auf den petrolfarbenen Wänden des Cafés aufgemalt waren. Dann hatte sie sich lächelnd zu mir umgedreht.
«Oh, Sie mögen Gedichte?»
Ihre Augen schimmerten. Sie waren von einem sanften dunklen Blau, und als sie mir später ihren Namen nannte, war ich hingerissen. Océane – das klang wie ein Gedicht.
«Und Sie? Mögen Sie Gedichte?», hatte ich gefragt, und sie hatte verlegen den Kopf geschüttelt.
«Ich fürchte, ich verstehe ich nicht viel von Poesie.»
«Man muss nichts von Poesie verstehen, um Gedichte zu mögen», hatte ich geantwortet, und sie hatte mich bewundernd angesehen.
Damals hatte sie mich für einen Feingeist gehalten. Jetzt war ich ein grober Klotz. Aus dem stillen Ozean war ein tosendes Meer geworden.
«Dir scheint ja alles egal zu sein», tobte sie da auch schon weiter. «Ein Glück, dass ich mich von dir getrennt habe, ein Glück!»
Ich nickte. Das fand ich auch. Drei Jahre Unzufriedenheit waren genug, egal, wie schön ihre Augen waren.
Eigentlich trenne ich mich nur schwer von Menschen, die mir einmal etwas bedeutet haben. Auch wider besseres Wissen hoffe ich bis zum Schluss, dass auf irgendeine wundersame Weise bald wieder bessere Zeiten anbrechen. Vielleicht scheue ich aber auch nur den Konflikt, die Tränen und das ganze Gezeter darüber, wer was gesagt und getan hat. Oder ich möchte nicht schuld daran sein, dass etwas zerbricht. Im Grunde meines Herzens will ich nicht, dass überhaupt etwas zu Ende geht: eine Freundschaft, eine Liebe oder überhaupt das ganze Leben. Und auch, wenn mir klar ist, dass eine Sache manchmal zu Ende gehen muss, damit eine neue anfangen kann, macht mich der Gedanke traurig, dass etwas, das einmal so schön und vertraut war, plötzlich nicht mehr da sein soll.
Wenn man so will, bin ich eher ein Bewahrer als jemand, der freudig alle Brücken hinter sich abbricht. Ich halte an Menschen fest, suche erst einmal nach Erklärungen. Ich verzeihe viel, ich sage mir immer, dass, wenn die- oder derjenige es anders machen könnte, er oder sie es sicher auch tun würde.
Jeder Mensch ist ein eigener Kosmos, und wir haben alle unsere ganz persönliche Geschichte.
Gut, das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit, ich will niemanden mit meinen Überlegungen langweiligen. Was ich eigentlich nur sagen will: Es muss schon viel passieren, bis ich jemand unwiderruflich fallen lasse, und eigentlich hatte es in meinem Leben bisher nur eine tiefgreifende Trennung gegeben, die ich durchgezogen hatte, und das war die von Paul. Natürlich hatte ich Camille gleich mit aus meinem Leben geworfen, aber dazu später mehr.
Was Océane anging, war ich jedenfalls froh, dass sie es gewesen war, die mich mit großem Getöse verlassen hatte. Ich vermutete, dass sie damals jemand anderen kennengelernt hatte und dass die Sache dann wieder in die Brüche ging.
«Sei froh», sagte ich, als sie ihre Tirade jetzt kurz unterbrach, um Luft zu holen. «Sei froh, dass du dich von mir getrennt hast. Das war eine gute Entscheidung.» Ich nickte ihr versöhnlich zu. «Du wirst sicherlich bald jemanden finden, der besser zu dir passt.»
«Du nicht», sagte sie verächtlich. Dann spannte sie ihren Regenschirm auf und stolzierte davon. «Und vergiss nur nicht, mir die Weinflaschen vorbeizubringen.»
Ich weiß noch, wie erleichtert ich war, als ich Océane im Regen verschwinden sah. Wie ich die Haustür aufschloss, die Post aus dem Briefkasten zog und wenig später das Licht in meiner Wohnung anmachte, weil es draußen schon dunkel war. Ich weiß auch noch, wie überrascht ich war, als ich zwischen ein paar Rechnungen ein edles Kuvert entdeckte.
Ich zog mir die Schuhe aus, holte mir aus der Küche ein Glas Wein und ließ mich in meinen alten braunen Ledersessel fallen, den ich seit der Zeit des Studiums von einer Wohnung in die nächste mitgeschleppt hatte. Das Leder knarzte leise, als ich neugierig den Umschlag öffnete und die auf Büttenpapier gedruckte Karte herauszog, die mich zur Hochzeit von Paul und Marie einlud.
Paul Gérard war früher mal mein bester Freund gewesen. Ich hatte ihn seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen, und das nicht etwa, weil wir uns aus den Augen verloren hätten, sondern weil ich ihn aus meinem Leben verbannt hatte. Und nun lud Paul mich zu seiner Hochzeit ein, die im Juni auf irgendeinem Angeberschloss in Aquitanien im Entre Deux Mers stattfinden sollte.
Einigermaßen verblüfft starrte ich auf die Einladung. Der hatte vielleicht Nerven. Ich runzelte die Stirn und nahm einen Schluck Wein, während der Regen gegen die Fenster klatschte und mein alter Groll wieder aufstieg.
Es war April, es regnete immerzu, und es gab an diesem Tag wirklich nichts, was ich weniger gern getan hätte, als für ein Wochenende zu einer Hochzeit auf ein Schloss ins Entre Deux Mers zu fahren. Ich war nicht in der Stimmung für romantische Hochzeiten oder das Glück anderer Leute. Und schon gar nicht für das Liebesglück von Paul Gérard.
Ich weiß noch, wie ich die Einladung noch einmal kurz überflog und dann kopfschüttelnd beiseitelegte. Was ich nicht wusste, war, dass diese Einladung nur wenige Wochen später mein ganzes Leben auf den Kopf stellen sollte.
2
Solange ich denken kann, waren Paul und ich Freunde gewesen. Wir hatten schon zusammen die Grundschule besucht, und da unsere beiden Familien am Stadtrand von Bordeaux wohnten, nahmen wir morgens denselben Bus. Paul kam immer zu spät. Oft genug hatte ich mich in die hintere Tür des Busses gestellt, um zu verhindern, dass sie sich zischend schloss, während der Busfahrer lauthals schimpfte und schrie, ich solle sofort den Eingang freigeben, und Paul mit wippendem Schultornister um die Ecke schoss, auf die Haltestelle zurannte und im letzten Moment auf das Trittbrett sprang.
«Danke», keuchte er, während der Bus ruckelnd anfuhr. «Das war knapp.» Er rollte vergnügt mit seinen braunen Augen und schob sich die dunklen Haare aus der Stirn. «Du hast mir das Leben gerettet. Madame Bonvin hat gesagt, wenn ich noch mal zu spät zum Unterricht erscheine, muss ich nachsitzen.» Dann grinste er mich an. «Wie heißt du eigentlich?»
«Jean-Pierre.»
«Ich bin Paul», sagte er und streckte mir die Hand hin. «Hast du Lust, nach der Schule mit mir ins Freibad zu gehen, Jean-Pierre?»
Ich nickte, und seit diesem Tag waren wir Freunde.
Wir streiften zusammen durch die Straßen unseres Viertels und später durch die Gassen der Altstadt von Bordeaux, erlebten die kleinen und großen Abenteuer, die man als Kind erlebt, wenn die Welt noch magisch und voller Geheimnisse ist. Wir machten Nachtwanderungen, versuchten uns recht erfolglos im Angeln und schlossen, inspiriert durch ein paar alte Western, die wir im ausgebauten Kinokeller von Pauls Eltern angeschaut hatten, Blutsbrüderschaft. Am Wochenende übernachtete ich manchmal bei Paul, dessen Eltern eine Möbelmanufaktur außerhalb von Bordeaux hatten und ein riesiges, wunderbar eingerichtetes Haus mit glänzenden Tischen und Kommoden aus Kirschholz, die dazu einluden, mit der Hand darüberzustreichen. Und dann schliefen wir, ausgestattet mit Limonade, Chipstüten und Schlafsäcken, unten im Keller und schauten Filme, bis uns die Augen zufielen.
Mit dreizehn rauchten wir hinter dem Gartenhäuschen bei uns zu Hause unsere erste Zigarette und husteten und würgten so fürchterlich, dass mein Vater, der Studienrat war und am Wochenende seine pädagogischen Fachbücher schrieb, es bis in sein Arbeitszimmer hörte und besorgt in den Garten kam und fragte, ob alles in Ordnung sei. Als er unsere bleichen Gesichter sah, musste er lachen. «Ach, ihr habt geraucht», meinte er nur. So war mein Vater. Er schimpfte eigentlich nie. Olivier Morel war der Meinung, dass Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen mussten.
Im Collège ärgerten wir die Mädchen, die uns wie Wesen aus einer anderen Galaxie erschienen, deren Sprache wir nicht verstanden, die uns gleichzeitig verunsicherten und auf seltsame Weise neugierig machten. Wir fuhren zusammen ins Zeltlager in einen Naturpark am Trichter der Gironde, lagen nachts draußen unter dem Sternenhimmel und stellten Überlegungen zur Unendlichkeit des Universums an.
«Glaubst du, dass da oben jetzt auch zwei Freunde liegen und in den Himmel starren?», fragte ich und deutete auf einen Stern, der genau über uns stand und besonders hell strahlte. Es roch nach Kiefernnadeln und würziger Erde und auch ein bisschen nach Meer, und ich fühlte mich winzig wie ein Sandkorn unter diesem gigantischen, funkelnden, tiefblauen Zelt, das uns überspannte. Und gleichzeitig geborgen, weil Paul neben mir lag. Für einen Moment hatte ich das Gefühl, dass es nur noch uns beide gäbe, so still und weit war alles.
«Möglich», sagte Paul nach einer Weile. «Aber wenn da oben zwei Doppelgänger von uns liegen und jetzt auf die Erde starren, sehen sie auf jeden Fall einen blauen Stern. Oder besser gesagt, einen Planeten. Die Erde ist ein Planet.»
«Prévert sagt, die Erde ist ein Stern», meinte ich gedankenverloren.
Zu dieser Zeit hatte ich die Gedichte von Jacques Prévert im Bücherregal bei uns zu Hause entdeckt. Erstaunt und beseelt blätterte ich in dem dunkelgrünen Gedichtband, der meinem Vater gehörte. Ich hatte nicht gewusst, dass es etwas so Schönes gibt.
«Wer ist Prévert?», entgegnete Paul.
«Ein Dichter.»
«Aha. Na, jedenfalls hat er keine Ahnung», stellte Paul ungerührt fest. «Die Erde ist ein Planet und kein Stern, denn sie leuchtet nicht von selbst. Nur Sterne strahlen Licht aus, kapiert?» Er boxte mich freundschaftlich in die Rippen. «Sag das deinem Prévert.»
«Ich werd’s ihm ausrichten.» Wir mussten beide lachen, und dann lagen wir noch eine Weile da, während die Sterne sich um uns drehten, während wir in den Schlaf glitten und die Feuchtigkeit der frühen Morgenstunden sich allmählich auf uns senkte.
Damals wussten wir noch nicht, dass Jacques Prévert auf seine Weise recht hatte. Unter bestimmten Umständen, die mit den Wesen aus den anderen Galaxien zu tun hatten, konnte auch die Erde strahlen wie ein Stern.
Im Lycée pfuschten wir uns durch die Klausuren und schoben uns gegenseitig unsere Blätter zum Abschreiben zu. Paul war immer schon ein Ass in Mathematik, vor allem Geometrie war seine Stärke, und sein Talent zum Zeichnen zeigte sich schon früh, während ich gut in Sprachen war und viel und gerne las. Wir waren sehr verschieden, aber wir ergänzten uns großartig – er, der kleine, agile, findige, dunkelhaarige Paul, und ich, der große, blonde, fantasievolle und leicht verträumte Jean-Pierre. Wir waren wie Jules und Jim, wir waren unzertrennlich, zwischen uns passte kein Blatt, wie man so schön sagt. Wir steckten unsere Köpfe zusammen, bauten Luftschlösser, und unsere Träume wuchsen in den Himmel. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass unsere Freundschaft jemals enden könnte.
Und dann, nach den Sommerferien, die Paul zusammen mit mir, meiner älteren Schwester Laurence und meinen Eltern an der Côte d’Argent verbracht hatte, wo wir uns mit unseren Surfbrettern immer wieder in die schäumenden Wellen stürzten und zusammen mit der ganzen Familie die Dune de Pilat bestiegen, die höchste Düne Europas, und uns oben zur Erinnerung ein bisschen von dem feinen Sand in ein Säckchen füllten, wurde die Erde wirklich ein Stern.
In der vorletzten Klasse des Lycées betrat ein Mädchen unser Universum, von dem wir beide gleichermaßen hingerissen waren. Wie hypnotisiert starrten wir das zarte Geschöpf mit den langen hellblonden Haaren an, das uns von unserem Lehrer als neue Mitschülerin vorgestellt wurde. Delphine de la Tour war das schönste Mädchen, das wir je gesehen hatten, oder jedenfalls kam es uns damals so vor. Sie stand da in ihrem ärmellosen hellblauen Kleid, das über und über mit kleinen Margeriten bedruckt war, und ihre hellen Augen, in denen sich die Côte d’Argent zu spiegeln schien, brachten das ganze Klassenzimmer zum Leuchten. Als der Lehrer zu Ende gesprochen hatte, setzte Delphine sich mit geröteten Wangen auf den ihr zugewiesenen Platz am Rand der hufeisenförmig angeordneten Tische. Ihre Wimpern waren unglaublich lang, und als sie aufblickte, sah sie direkt in ein braunes und ein blaues Augenpaar und lächelte.
«Wow! Die schnappen wir uns», flüsterte Paul mir zu und stieß mich in die Seite. Ein aufgeregtes Kichern stieg in mir auf, das ich kaum unterdrücken konnte.
«Was ist denn so komisch, Jean-Pierre?», fragte der Lehrer mit einem strengen Blick in meine Richtung. «Dürfen wir auch mitlachen?»
«Nein, ich … äh … habe nur Schluckauf», erklärte ich und presste mir die Hand vor den Mund, um das verdammte Lachen irgendwie unter Kontrolle zu bringen.
Nach dem Unterricht fassten wir einen Plan, wie wir Delphine, die Wunderschöne, für uns gewinnen konnten. Es war klar, dass am Ende nur einer von uns den Sieg davontragen konnte, aber zunächst wollten wir gemeinsam vorgehen, denn die neue Schülerin, die aus Paris stammte, hatte natürlich auch das Interesse der anderen Mitschüler geweckt. In der großen Pause scharten sich alle auf dem Schulhof um das Mädchen in dem Margeritenkleid und versuchten, seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
«Wir müssen sie erst mal von den anderen loseisen», beschloss Paul. «Und dann sehen wir weiter.»
Ich nickte. Selbst mir war klar, dass man sich bei solch einem Mädchen nicht alle Zeit der Welt lassen konnte.
«Wir sollten sie einladen», überlegte ich. «Lass uns fragen, ob sie nach der Schule mit uns in die Eisdiele geht.»
«Gute Idee», sagte Paul, und gemeinsam überprüften wir unsere Barschaft, die gerade so für drei große Paradiesbecher reichte.
Kaum hatte die Schulglocke zur letzten Stunde geläutet, passten wir Delphine am Tor des Schulhofs ab. Sie zog überrascht die Augenbrauen hoch, als sie Paul und mich so zielstrebig auf sich zukommen sah, aber als Paul ihr unseren Vorschlag unterbreitete und ich, betäubt von so viel Schönheit, hinterherstammelte, dass der Coup de Paradis in der Maison du Glacier de Bordeaux wirklich ein Traum sei, lächelte sie.
«Tut mir leid, ich kann heute nicht», sagte sie dann und ließ sich einen Moment Zeit, um unsere enttäuschten Gesichter zu betrachten. «Aber vielleicht morgen.» Sie strich kokett ihre Haare zurück, nahm ihre Schultasche und ließ uns stehen.
Wir sahen ihr nach, während sie sich mit anmutigen Schritten von uns entfernte, ein ätherisches Wesen, von der Septembersonne in ein goldenes Licht getaucht, das fast durch sie hindurchzufallen schien, bis sich ihre Gestalt im flirrenden Schattenspiel der Bäume auflöste.
«Eine echte Sahneschnitte», sagte Paul und pfiff anerkennend.
«Ja. Sie ist wundervoll», sagte ich und starrte immer noch ganz verzaubert auf die Stelle, wo Delphine aus unserem Blickfeld verschwunden war.
Und damit fing vielleicht schon das Verhängnis an. Zumindest wurde an diesem Nachmittag der Grundstein gelegt für das nahezu ikonische Faible, das Paul und ich für blonde Frauen entwickelten und das einige Jahre später zu unserem Zerwürfnis führen sollte.
Doch das alles ahnten wir noch nicht, als wir an diesem sonnigen Septembertag herumalberten und uns freuten, dass unser Plan aufgegangen war.
«Das war doch gar nicht schlecht», meinte Paul mit einem zufriedenen Grinsen, als wir uns auf den Heimweg machten. «Glaub mir, die hat angebissen. Ich hab ein Gespür für so was.»
«Wenn du meinst», gab ich lachend zurück und wünschte mir nichts mehr als das. «Aber sie hat nur Vielleicht gesagt. Vergiss das nicht.»
«Du hast keine Ahnung von Frauen, mein Freund», sagte Paul. «Sie hat gesagt Morgen vielleicht. Wenn sie nicht gewollt hätte, hätte sie gesagt Vielleicht ein anderes Mal.»
Er sollte recht behalten. Am nächsten Nachmittag saßen wir zu dritt in der Maison du Glacier, und Delphine löffelte verzückt ihr Eis aus ihrem großen Becher und schenkte mal dem einen und mal dem anderen ihre Aufmerksamkeit. Ich muss sagen, sie teilte ihre Gunst sehr gerecht zwischen uns auf. Paul machte ihr unentwegt Komplimente, die sie mit schelmischem Lächeln entgegennahm, während ich sie mit meinen kleinen Geschichten zum Lachen brachte und ihr ansonsten verschwörerische Blicke zuwarf.
Der nächste Schritt des großen Plans war ein gemeinsamer Kinobesuch. «Gehen wir ins Utopia», sagte Paul, und ich sah ihn misstrauisch an.
Das Cinéma Utopia war ein altes, plüschiges Programmkino in der Vieux Ville von Bordeaux, das alte Klassiker und Filme abseits des Mainstreams zeigte, also das Gegenteil von dem, was sich Paul normalerweise anschaute. Das Kino befand sich in einer alten Kirche, der Église Saint-Siméon, was sehr ungewöhnlich war, und wenn man durch das gotische Portal schritt, hatte man das Gefühl, dass jeder Film, der hier gezeigt wurde, schon allein deswegen etwas Erhabenes und Bedeutungsvolles bekam.
Ich war bereits einige Male im Utopia gewesen, vor allem, weil meine Mutter eine begeisterte Kinogängerin war und mich schon früh in Filme schleppte, die meinen kindlichen Verstand manchmal überforderten.
«Die Spaziergängerin von Sans-Souci? Meinst du, dieser Film ist was für den Jungen?», fragte Papa, wenn meine Mutter und ich zusammen loszogen, doch Maman blieb von solchen Einwänden völlig unbeeindruckt. «Ein guter Film hat noch niemandem geschadet», war ihre Devise. Eigentlich arbeitete meine Mutter als Klavierlehrerin an der Musikschule, aber das Kino war ihre Antwort auf alle Fragen des Lebens. Wenn das Wetter deprimierend war, ging es ins Kino. Wenn es ein Problem gab, ging es ins Kino. Wenn Papa sonntags arbeiten musste, ging es ins Kino. Sobald der rote Vorhang aufschwang und der Saal sich verdunkelte, bekam Maman glänzende Augen. «Jetzt geht’s los», flüsterte sie mir zu und drückte mir fest die Hand.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: