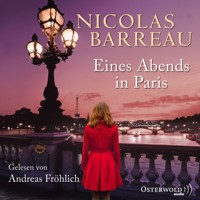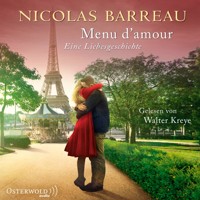8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Romane von Bestsellerautor Nicolas Barreau in einem Band zum attraktiven Preis! Sie kommt immer zu spät. Sie ist das strahlendste Mädchen des Seminars. Und sie ist unerreichbar. Die Liebe des zurückhaltenden Literaturstudenten Henri Bredin scheint aussichtslos, auch wenn er und die schöne Valérie Castel dasselbe Lieblingsbuch haben. Denn Valérie sieht in Henri nur einen guten Freund, für Henri jedoch ist das Mädchen mit den aquamarinblauen Augen und dem spöttischen Lächeln diejenige, die er lieben könnte wie keine andere. Jeden Mittwoch kommt eine junge Frau im roten Mantel in Alain Bonnards kleines Pariser Programmkino, und immer sitzt sie auf demselben Platz in Reihe 17. Eines Abends fasst sich Alain ein Herz und spricht sie an. Sie verbringen den Abend miteinander, doch in der Woche darauf taucht sie nicht mehr auf. Obwohl er von ihr kaum mehr als ihren Vornamen weiß, begibt sich Alain auf die Suche nach ihr und erlebt eine Geschichte, wie sie kein Film schöner erzählen könnte...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
© dieser Ausgabe Piper Verlag GmbH, München 2019
Dieses ebook enthält die Einzelbände »Menu d'Amour« & »Eines Abends in Paris«
Menu d'Amour
Übersetzung aus dem Französischen von Sophie Scherrer © 2013 Nicolas Barreau© der deutschsprachigen Ausgabe: 2013 Thiele Verlag in der Thiele & Brandstätter Verlag GmbH, München Wien
Eines Abends in Paris
Übersetzung aus dem Französischen von Sophie Scherrer © 2012 Nicolas Barreau© der deutschsprachigen Ausgabe: 2012 Thiele Verlag in der Thiele & Brandstätter Verlag GmbH, München Wien
Covergestaltung: Umschlaggestaltung Semper Smile auf der Grundlage des Hardcoverumschlags von Christina Krutz Covermotiv: Menu d'Amour: Mark Owen / Trevillion Images; Iakov Kalinin / 123RF | Eines Abends in Paris: arcangel images; mauritius images
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Bist du einst alt und grau und voller Schlaf
Und nickst am Feuer ein, dann nimm dies Buch,
Lies langsam, träume dich zurück und such
Wie mich dein Aug mit seinem Schatten traf …
WILLIAM BUTLER YEATS
À TABLE, LES AMOUREUX!
Nach dem überwältigenden Erfolg meines Romans Das Lächeln der Frauen, in dem die schöne Aurélie ihr Menu d'amour kocht, um den Mann ihrer Träume für sich zu gewinnen, bin ich oft gefragt worden, ob es zwischen dem Essen und der Liebe einen speziellen Zusammenhang gibt. Natürlich gibt es den – beides kann sehr verführerisch sein. Viele meiner Leserinnen und Leser wollten wissen, ob ich selbst gern koche und ob ich noch weitere Rezepte habe. Beide Fragen kann ich mit Ja beantworten. Die besten Rezepte aus meinem persönlichen Kochbuch sind Klassiker der französischen Küche, vor allem aber sind sie eines: Erinnerungen an wunderbare, romantische, nicht enden wollende Abende, an die ich sehr gerne zurückdenke.
In diesem Buch verrate ich Ihnen also meine zehn Lieblingsmenüs. Es sind Rezepte für Verliebte, Rezepte zum Verlieben, köstliche Speisen für ganz besondere Anlässe – und als besonderen Gruß aus der Küche habe ich eine Geschichte vorangestellt, die das Geheimnis des Menü d'amour enthüllt – jenes Menüs, das Aurélies Vater seiner Tochter einst vermachte.
Lesen Sie, staunen Sie, lächeln Sie, kochen Sie und genießen Sie das Essen und die Liebe!
Herzlichst, Nicolas Barreau
1
Wenn man Georges Berechnungen glauben durfte, war es einer der dunkelsten Winter seit dem Krieg gewesen. Die Schatten spazierten in den Straßen von Paris und die Menschen sehnten sich nach dem Licht, wie ein junger Mann sich in die Arme seiner Liebsten sehnt. Im Kino spielte man Die Regenschirme von Cherbourg, die Beatles hatten im Olympia She loves you gesungen und ich hatte mich rettungslos in ein Mädchen verliebt, das so unerreichbar für mich war wie der Mond.
Ich studierte damals Literatur im zweiten Semester und hatte gerade beschlossen, aus Enttäuschung so etwas wie ein zweiter William Butler Yeats zu werden, der in glühenden Gedichten seine Angebetete pries und auf diese Weise seine unerfüllte Liebe zu der schönen Maud Gonne unsterblich machte, als ich an einem regnerischen Nachmittag bei den Bouquinisten am Ufer der Seine einen Fund machte, der meine glanzvolle literarische Karriere verhindern sollte. Denn daraufhin passierte etwas Seltsames und Wunderbares. Etwas, das mich trunken vor Glück über den Mond taumeln ließ, noch bevor der erste Astronaut jemals seinen Fuß darauf setzte. Ich habe nie jemandem erzählt, was sich an jenem Abend wirklich ereignete. An jenem denkwürdigen Abend, als ich das Menu d'amour zum ersten Mal kochte, und der nun schon so viele Jahre zurückliegt. Die Einzige, die die ganze Wahrheit kannte, war die Katze meines Mitbewohners Georges. Doch diese konnte naturgemäß nicht sprechen, und so blieb das köstliche Geheimnis im Besitz meines Herzens. Am Ende bin ich doch kein William Butler Yeats geworden. Gott sei Dank.
Meine Maud Gonne hieß Valérie Castel. Sie hatte blondes Haar und leuchtend blaue Augen, und wenn sie hereinkam, begann sich der Raum mit Licht zu füllen. Ihr Mund schien stets zu einem Lachen bereit, sie war voller Einfälle und spottete gern, und sie war gewiss kein Mädchen, das man einfach so übersehen hätte. Aber auch aus einem anderen Grund war es nahezu unmöglich, sie nicht zu bemerken. Valérie Castel war die unpünktlichste Person, die ich jemals kennengelernt habe. Sie kam immer zu spät. Zu jeder Vorlesung. In jedes Seminar. Und so ist sie mir damals auch aufgefallen. Weil sie zu spät kam.
2
Professor Jean-Louis Caspari war in seinem Element. Seit zwanzig Minuten versuchte er mit eindringlichen Gesten und wortgewaltigen Sätzen seinen Zuhörern die französische Literatur zwischen Romantik und Realismus näherzubringen und erwartete doch nicht mehr, als dass jeder Student sich drei Sätze aus seiner Vorlesung merken sollte. »Wenn Sie drei Sätze mit nach Hause nehmen, bin ich schon zufrieden«, pflegte er zu sagen. Gerade war er bei einem seiner Lieblingsgedichte von Baudelaire angelangt, da wurde mit einer hastigen Bewegung die Tür zum Hörsaal aufgerissen. Atemlos und mit geröteten Wangen schlüpfte eine Studentin in einem hellblauen Wollmantel mit passender Kappe herein. Sie lächelte entschuldigend und wollte sich schon durch den Seitengang schieben, um sich in eine der Stuhlreihen zu setzen, als Jean-Louis Caspari seine Vorlesung unterbrach und von seinem kleinen Podest herunterstieg. Der alte Professor war dafür bekannt, dass er unpünktliche Studenten gern vorführte. Mit einer Behändigkeit, die seine Leibesfülle Lügen strafte, sprang er durch den Raum und baute sich vor der Nachzüglerin auf.
»Wie schön, dass Sie meine Vorlesung besuchen, Mademoiselle…?« Er zog fragend die Augenbrauen hoch.
»Castel. Valérie Castel«, sagte sie, und auf diese Weise erfuhr ich wie alle anderen im Saal ihren Namen.
»Nun, Mademoiselle Castel«, Professor Caspari streckte ihr seine Hand entgegen, die sie zögernd ergriff, »ich begrüße Sie sehr herzlich hier bei uns.« Er machte eine ausholende Handbewegung, welche die etwa einhundertfünfzig Studenten mit einbezog, die den Dialog, der sich abseits des Vorlesungspults entspann, grinsend verfolgten. »Dummerweise hat meine Vorlesung schon seit…«, er kramte umständlich eine silberne Taschenuhr aus der Hosentasche hervor, »seit fünfundzwanzig Minuten begonnen. Ich hoffe, das stört Sie nicht?«
Valérie Castel wurde rot, dann schenkte sie dem Professor ein reizendes Lächeln. »Aber nein«, sagte sie mit ihrer klaren Stimme, die bis in die letzte Reihe zu hören war. »Wenn es Sie nicht stört, Herr Professor, stört es mich auch nicht.« Ich sah das feine Zucken ihrer Mundwinkel.
Die Studenten stießen sich an und tuschelten. Das war ganz schön frech, aber dann doch wieder mit so entwaffnender Unbefangenheit vorgetragen, dass man nicht so recht wusste, was man davon halten sollte.
Professor Caspari verfügte über genügend Humor, um eine schlagfertige Antwort zu schätzen. Und er verfügte trotz seiner altersschwachen Augen, die hinter runden Brillengläsern funkelten, über genügend Sehkraft, um Schönheit zu bemerken, wenn sie ihm begegnete. Sein Blick ruhte einen Moment auf der Delinquentin, die inzwischen ihre blaue Kappe abgenommen hatte und diese unschlüssig in den Händen drehte.
»Abgesehen davon, dass es mich ein wenig irritiert, wenn während meines Vortrags die Tür aufgeht, stört mich das sicherlich weniger als Sie, Mademoiselle. Denn im Gegensatz zu Ihnen kenne ich den Stoff meiner Vorlesung ja bereits.«
3
Ich will nicht behaupten, dass sie es vorsätzlich tat, aber entgegen ihrer Versicherungen war jedem in unserem Semester bereits nach wenigen Wochen klar, dass Valérie Castel einfach nicht pünktlich sein konnte. Seltsamerweise war ihr deswegen niemand wirklich böse. Im Gegenteil – wenn fünf oder zehn oder zwanzig Minuten nach Seminarbeginn die Tür aufflog und das Mädchen im blauen Mantel wie ein Windstoß hereinfegte, warteten alle gespannt auf die Ausrede, mit der sie diesmal wohl aufwarten würde.
Selbst die strengsten Professoren und Dozenten hörten sich mit hochgezogenen Augenbrauen und unterdrückter Heiterkeit die originellen Geschichten an, die Mademoiselle Castel zum Vergnügen aller auftischte, denn abgesehen von ihrer Unpünktlichkeit war Valérie mit ihren klugen und lebhaften Beiträgen eine Bereicherung für jedes Seminar.
Ich jedenfalls hatte mich Hals über Kopf in die notorische Zuspätkommerin verliebt – und mir war klar, dass sie etwas ganz Besonderes war – vielleicht zu besonders für einen so normalen Studenten wie mich. Ich war mir sicher, dass ein Mädchen wie Valérie schon vergeben sein musste, dennoch hatte ich es mir angewöhnt, in den Vorlesungen und Seminaren, die sie regelmäßig besuchte, stets den Stuhl neben mir mit Tasche, Mantel oder Unterlagen zu blockieren, in der verwegenen Hoffnung, dass sie sich auf diese Weise irgendwann neben mich setzen würde.
Beim fünften Mal hatte ich Glück. Valérie kam zu spät, erzählte ihre Geschichte und sah sich suchend um. Ich hob die Hand und deutete auf den Platz neben mir, und sie ließ sich glücklich seufzend nieder und nickte mir freundlich zu. Ihre plötzliche Nähe brachte mein Herz zum Klopfen und ich sah gebannt zu, wie sie sich vorbeugte und ein Sonnenstrahl sich in ihrem Haar verfing. Für wenige Sekunden geriet ich in einen Bannkreis aus kleinsten Goldpartikelchen, die in der Luft tanzten, und es gab nur sie und mich. Doch schon im nächsten Augenblick holte mich die Wirklichkeit in Form eines gut aussehenden Studenten namens Christian ein, der Valérie von der Seite etwas ins Ohr flüsterte, was sie zum Lachen brachte. Immerhin fragte sie mich nach dem Seminar, ob ich zusammen mit ihr und ein paar Kommilitonen noch einen Kaffee trinken gehen wollte.
Natürlich sagte ich ja.
Seither war es zur Gewohnheit geworden, dass ich ihr immer einen Platz freihielt und sie sich ganz selbstverständlich neben mich setzte.
In diesen kostbaren Stunden, in denen die anderen über Zolas Romane und Baudelaires Blumen des Bösen diskutierten, studierte ich verstohlen ihr zartes Profil mit den ausgeprägten Augenbrauen. Ich entdeckte den kleinen Leberfleck an ihrem Halsansatz und kam mir vor wie ein Dieb. Ich betrachtete ihre schmalen weißen Hände und bemerkte mit einigem Missfallen den alten Rubin, den sie stets am Ringfinger trug. Doch als ich einmal nach dem Seminar so beiläufig wie möglich sagte: »Ein schöner Ring – ist der von deiner Großmutter?«, lächelte sie nur versonnen und entgegnete: »Ja, nicht wahr? Den hat mir die Mutter von Paul geschenkt.«
»Und wer ist Paul?«, rutschte es mir heraus und meine Stimme klang nicht mehr ganz so beiläufig, wie ich es mir gewünscht hätte.
Valérie steckte die Unterlagen in ihre Ledermappe und warf mir einen spöttischen Blick zu. »Oh! Höre ich da etwa die Eifersucht? Sei nicht so neugierig, Henri Bredin. Lass uns lieber gehen, die anderen warten schon. Wir wollen noch ins Procope.«
Ich packte meine Tasche und lief hinter ihr her. »Wer ist Paul?«, insistierte ich und bemühte mich, den scherzhaften Ton aufzugreifen, den sie angeschlagen hatte. »Oder ist das etwa ein süßes Geheimnis?«
Sie verdrehte die Augen in gespielter Verzweiflung, hakte sich bei mir unter und lachte. »Mein Lieblingscousin, zufrieden? Und jetzt komm.«
Ich glaubte ihr kein Wort, doch gleichzeitig genoss ich die ungeduldige, fast selbstverständliche Geste, mit der sie mich zum Ausgang zerrte, wo die anderen schon auf uns warteten.
4
In den nächsten Wochen sah ich Valérie Castel immer wieder. Wir hatten einige Vorlesungen und Seminare zusammen, wir begegneten uns in der Mensa oder in einem der kleinen Cafés in der Nähe der Sorbonne, wo wir stundenlang zusammen mit den anderen saßen, tranken, rauchten, lachten, redeten, diskutierten. Ich sage »wir«, aber dieses »wir« war wohl eher in meinem Kopf. In Wirklichkeit war es schwierig, ja, nahezu unmöglich, mit Valérie Castel allein zu sein, stets war sie umringt von einem ganzen Hofstaat von Freundinnen oder Kommilitonen, denen sie ihre Gunst gleichermaßen schenkte. Doch auch wenn ich sie mit den anderen teilen musste, blieb ich beharrlich in ihrer Nähe. Ich hatte herausgefunden, dass Valérie oft ganze Nachmittage in der alten Bibliothek der Universität verbrachte. Und hier, in der Stille des Lesesaals mit den vielen Tischlampen, fand ich sie oft genug allein. Sie saß an einem Tisch in der Nähe der hohen alten Fenster, hinter denen sich graue Märzwolken auftürmten, und war ganz versunken in ihr Buch. Wenn sie dann kurz aufschaute und mir mit geröteten Wangen ein wenig geistesabwesend zunickte, war jede Spottlust aus ihren Augen verschwunden. Ich setzte mich ihr gegenüber und gab vor, auch zu lesen. So saßen wir da, in perfekter Zweisamkeit.
Einmal ertappte sie mich, als meine Augen auf ihrem nachdenklich gespitzten Mund ruhten und ich den Blick nicht schnell genug abwenden konnte.
»Was?!«, sagte sie und klappte das Buch mit einem Ruck zu.
»Nichts!«, erwiderte ich aufgeschreckt. Ein paar Studenten sahen von ihren Büchern auf und die Bibliothekarin zischte uns ein »Psst« herüber.
Valérie errötete und kritzelte etwas auf einen Zettel, den sie mir über den Tisch zuschob.
Was starrst du mich so an, Idiot?, las ich. Hör sofort auf damit!
Ich wurde rot. Wie hätte ich jemals damit aufhören können, Valérie Castel anzuschauen? Ich konnte nicht damit aufhören.
Ich hab gar nicht dich angestarrt, sondern dein Buch, schrieb ich zurück. Ich wollte herausfinden, was du liest. Ist es gut?
Sie lehnte sich lächelnd zurück und zog ihre hübschen Augenbrauen zweifelnd hoch.
Sehr gut. Wollen wir einen Kaffee trinken gehen, dann kann ich dir mehr davon erzählen.
Wir schlichen uns aus dem Lesesaal und liefen wenige Minuten später ausgelassen die Treppen des alten Universitätsgebäudes hinunter, dessen imposante Kuppel in den grauen Himmel aufragte. Ein ernsthafter junger Mann mit dunklen Locken und einer verwaschenen braunen Cordjacke und ein Mädchen mit großem lachendem Mund und keck aufgesetzter Baskenmütze, unter der die goldenen Haare ungestüm hervorquollen. Auf einem Photo hätten wir ausgesehen wie ein beneidenswert glückliches Paar. Doch es war kein Photograph zur Stelle, der den Moment einfing. Und dann ging er vorüber…
5
An diesem Nachmittag sollte es Madame Bovary sein, die uns hartnäckig Gesellschaft leistete. Und Monsieur Flaubert in allen Ehren, aber ich muss gestehen, dass er mir – nachdem Valérie etwa zwei Stunden ihrer Begeisterung über diesen absolut genialen Roman (absolut war damals eines ihrer Lieblingswörter) Ausdruck verliehen hatte – ziemlich auf die Nerven ging. Seltsam betäubt lauschte ich Valéries nahezu besessenem Monolog, nickte ab und zu und fühlte mich irgendwie nicht mehr in der Lage, angesichts solch großer Weltliteratur meine eigenen unbedeutenden Gefühle zu erklären.
Als sie endlich schwieg und ich das Gespräch behutsam in eine Richtung lenken wollte, die etwas weniger mit unglücklich-überspannten Ehebrecherinnen und etwas mehr mit uns zu tun haben sollte, tauchte Christian auf, der immer seine blöden Witze machte, und riss mit den Worten »Aah, hier habt ihr euch versteckt! Ich hoffe, Henri langweilt dich nicht zu sehr« das Gespräch an sich. Mit größter Selbstverständlichkeit ließ er sich direkt neben Valérie auf die Bank fallen. Später kamen die schüchterne Camille und die rothaarige Marie-Claire dazu, und am Ende quetschte sich auch noch Georges, mein bärtiger Mitbewohner, mit dem ich mir die heruntergekommene Mansardenwohnung in der Rue Mouffetard teilte, zu uns an den dunklen Tisch mit seiner blankgescheuerten Holzplatte, und die ganze Bande war wieder beieinander.
Georges Bresson, Student der Meteorologie im fünften Semester, war ein liebenswerter Kerl und mit seinen knapp neunzig Kilo ein echter Fels in der Brandung. Er hatte eine Verlobte in der Haute-Normandie, die er manchmal übers Wochenende besuchte, und eine schwarze Katze namens Coquine, die zwischen unseren beiden Zimmern hin und her tigerte. Manchmal kochte ich abends für Georges und mich, dann saß Coquine stets interessiert auf der Anrichte und sah mir zu. Die winzige Küche war vollgestopft mit Regalen und zusammengewürfelten Schränken und bot für einen Tisch beim besten Willen keinen Platz mehr. Einen Kühlschrank gab es nicht, und im Winter hängten wir die verderblichen Speisen zum Kühlen in einer Tüte nach draußen an den Griff des kleinen Dachfensters. Zu meiner großen Freude hatte die Küche jedoch einen alten Gasherd, an dessen unkontrolliert hochschießender Flamme ich mir oft genug die Finger verbrannte. Kochen war schon immer meine Leidenschaft gewesen, und an einem jener gemütlichen Abende, an dem ich einen köstlich duftenden Lammbraten mit Lavendel und schwarzen Oliven aus dem Ofen gezogen hatte, den wir an dem Tisch in meinem Zimmer verspeisten, klopfte sich Georges zufrieden auf den Bauch und bot an, diesem vorlauten Christian eins auf die Nase zu geben, falls der meine Kreise störe.
»Nicht nötig«, versicherte ich und goss mir noch etwas von dem billigen Rotwein ein, den Georges bei dem Traîteur unten im Haus besorgt hatte.
»Was ist mit dir und Valérie?«
Ich nahm einen Schluck und merkte, dass ich keine Lust hatte, mit irgendwem über Valérie zu reden, nicht mal mit Georges. »Was soll sein?«, meinte ich ausweichend. »Sie ist mit mir im gleichen Semester. Ich finde sie nett. Wir sind gute Freunde.«
Georges sah mich schweigend an.
»Du findest sie nett«, sagte er schließlich und grinste unter seinem Bart. »Warum lädst du sie nicht mal zum Essen ein? Sie wäre begeistert von deinen Kochkünsten.«
»In diese Bruchbude? Auf keinen Fall«, sagte ich und fing an, die Teller zusammenzuräumen. »Da wäre sie wohl weniger begeistert. Außerdem hat sie schon einen anderen … glaub ich.«
»Es gibt immer einen anderen«, erklärte Georges. »Bleib dran.«
6
In der Hoffnung, dass meine Stunde noch kommen würde, machte ich mich also zu Valérie Castels treuem Ritter – so wie die kühnen Helden des Chrétien de Troyes, von denen wir in der Vorlesung gehört hatten. Das Jahr 1964 bot sich nicht sonderlich an für Aventiure-Fahrten, und es gab auch keine Turniere, die ich für Valérie hätte bestreiten können, gleichwohl leistete ich unermüdlich meine Minnedienste. Ich lud Valérie ins Kino ein und nahm in Kauf, dass sie ihre Freundin Camille mit in die Vorstellung brachte. Ich half ihr bei Referaten, ich war zur Stelle, als die Studentenbude im Quartier Latin, in die sie umzog, weil ihr altes Zimmer Teil einer Zahnarztpraxis wurde, gestrichen werden musste. Ich schleppte Bücher, Möbel und Farbeimer in den fünften Stock und bekam das erste Mal in meinem Leben einen Hexenschuss. Ich durchsuchte einen Nachmittag lang die Mülltonnen im Hinterhof der Rue Dauphine, weil Valérie sich todsicher war, aus Versehen einen Hundert-Franc-Schein weggeworfen zu haben. Er fand sich später hinter dem Brotkasten, und wir ließen uns erschöpft und lachend auf ihr altes Sofa fallen, und Valérie schnupperte an mir und meinte, ich röche wie ein Clochard. Und ich war auch zur Stelle, als sie völlig aufgelöst und mit Tränen in den Augen aus der Telefonzelle trat, weil Foufou, ihr alter Hund, der zu Hause bei den Eltern in Bordeaux lebte, vor ein Auto gelaufen war.
An diesem regnerischen Mainachmittag gingen wir nicht, wie es eigentlich ausgemacht war, zusammen mit den anderen ins Kino. Valérie war zu traurig und zu durcheinander, sie weinte, und ich zog sie rasch in ein kleines Café unweit des Boulevard Saint-Germain, glücklich, sie trösten zu können. Geduldig hörte ich mir die stockenden Erzählungen über einen sandfarbenen Spaniel an, den ich gar nicht kannte, reichte der Unglücklichen mein Taschentuch und drückte immer wieder mitfühlend ihre Hand.
»Ach, Henri«, sagte sie schließlich und sah mich aus ihren verweinten Augen an, die vor Kummer die dunkelste Schattierung eines Aquamarins angenommen hatten. »Weißt du … du bist wirklich nett.«
»Ach, Valérie«, sagte ich leise. Ich wusste nicht, was dieses nett bedeutete, ob es wirklich nur nett meinte oder doch so viel mehr als nett, aber es war auch nicht wichtig, denn mein Herz quoll über vor Liebe.
Draußen war es dunkel geworden, und vielleicht hätte dies der alles entscheidende Moment sein können, doch ich ließ ihn verstreichen, so wie man oft im Leben eine Gelegenheit verstreichen lässt, ohne es sofort zu bemerken.
Die Intimität jenes Nachmittags, die in erster Linie einem toten Cockerspaniel geschuldet war, sollte sich nur noch einmal wiederholen. Nach einem viel zu kalten Frühling, der sich mit einem letzten heftigen Regenschauer verabschiedet hatte, war es mit einem Mal doch noch Sommer geworden in Paris. An einem der letzten Semestertage saß ich auf einer Bank im Jardin du Luxembourg, und neben mir saß Valérie in einem ärmellosen blauen Kleid und las mir aus einem Buch vor. Sie hatte es bei den Bouquinisten entdeckt. Es war Alain-Fourniers Der große Meaulnes, und Valérie war hingerissen von der Schönheit der Sprache und der Geschichte des ungestümen Augustin, der sich mit seinem Kameraden aufmacht, um das »verlorene Land« zu finden, jenen geheimnisvollen Ort, an dem Augustin unter seltsamen Umständen der bezaubernden Yvonne de Galais begegnet ist, und den die beiden Freunde doch auf keiner Karte finden.
»Es ist mein absolutes Lieblingsbuch«, versicherte sie mir, und ihre Augen waren wie zwei Teiche, in denen sich der Himmel spiegelt. »Du musst es unbedingt lesen«, sagte sie, als wir uns verabschiedeten, und drückte mir in einer spontanen Geste das Buch in die Hand. »Versprich mir das.«
Ich versprach es, und dann zog ich sie plötzlich in meine Arme. Ich vergrub mein Gesicht in ihr duftendes Haar und hielt sie ein wenig zu lang und ein wenig zu fest, und als wir uns verwirrt voneinander lösten und sie mich mit großen Augen ansah, sagte ich noch einmal: »Ich verspreche es.« Und es klang so, als ob ich etwas ganz anderes versprechen würde.
Wenige Tage später begannen die Semesterferien und Valérie Castel fuhr mit ihren Eltern an die italienische Riviera. Ich las das Buch, verschlang es in zwei Tagen und war fest entschlossen, es besser zu machen als der unglückliche Meaulnes.
7
Schon als sie aus dem Zug stieg, hatte ich es gespürt. Etwas hatte sich verändert. Die Befangenheit, mit der sie mich begrüßte und den kleinen Blumenstrauß entgegennahm, den ich ihr gekauft hatte, passte ebenso wenig zu Valérie Castel wie dieses lächerliche Halstuch, das sie sich umgebunden hatte. Ich nahm die große lederne Reisetasche und ging mit klopfendem Herzen neben ihr den Bahnsteig des Gare de Lyon entlang, jenes Bahnhofs, in dem alle Züge aus dem Süden ankommen. Die Sonne spiegelte sich auf den Gleisen, die Luft war immer noch sommerlich warm, und doch war meine übergroße Freude, Valérie endlich, endlich nach drei langen Monaten wiederzusehen, einer eigenartigen Angst gewichen.
»Stell dir vor, dein Lieblingsbuch ist übrigens auch mein Lieblingsbuch«, sagte ich und lachte, um die Verlegenheit zu überspielen, die sich zwischen uns gesenkt hatte.
»Tja. Na so was«, entgegnete sie unbestimmt. »Danke auch für die schönen Blumen.«
Ihre Haare waren heller geworden und über ihre Haut hatte sich eine zarte sommerliche Bräune gelegt.
»War's schön an der Riviera?«, fragte ich. »Du siehst toll aus.«
Sie nickte. Dann blieb sie plötzlich stehen. »Wollen wir etwas trinken? Ich hab fürchterlichen Durst.«
»Klar.« Gemeinsam stiegen wir die Treppe zum Train Bleu hinauf. Das alte Bahnhofsrestaurant schwebte mit seinen gemalten Palmen und den südlichen Küstenbildern wie ein Versprechen über den Gleisen.
Valérie setzte sich in eine Nische am Fenster. Hinter ihr an der Wand ragte, umrankt von goldenen Jugendstilblüten, eine Dame der Jahrhundertwende auf, die ein langes weißes Kleid trug und eine runde Hutschachtel in den Händen hielt. Als der Kellner uns die Getränke gebracht hatte, umklammerte Valérie ihr Glas mit der Zitronenlimonade so fest, dass mir ganz schlecht wurde.
»Valérie«, sagte ich. »Was ist los?«
Sie sah mich an und ihre Augen schimmerten wieder in diesem dunklen Aquamarinblau.
»Ich muss dir etwas sagen«, sagte sie.
»Ja?« Mein Mund war plötzlich ganz trocken.
»Ich habe jemanden kennengelernt.« Etwas blinkte in ihren Augen und sie wischte es rasch weg, bevor sie nach meiner Hand griff. »Ach, Henri! Es … es tut mir so leid. Bitte lass uns Freunde bleiben.«
Ich saß da wie vom Donner gerührt und versuchte vergeblich, den Sinn ihrer Worte zu erfassen, während das Herz mir mit einem dumpfen Schlag in die Magengrube fuhr.
Valérie senkte den Kopf und schaute unglücklich zur Seite. Ihr Halstuch war verrutscht, und jetzt sah ich es – diesen verräterischen blauen Fleck an ihrem Hals, den sie gnädigerweise vor mir hatte verbergen wollen.
»Aber … was ist mit Paul? Ich dachte…«, stammelte ich hilflos.
»Paul ist mein Cousin. Das sagte ich doch.«
»Und wer…« Ich sah sie an und machte den Mund wieder zu. Ich brachte keinen vollständigen Satz mehr zustande, weil eine Stimme in meinem Kopf übermächtig wurde, die immerzu »Idiot!« schrie.
8
Die nächsten Wochen waren die Hölle, Sartre war ein Witz dagegen. Ich taumelte zwischen unerbittlichen Selbstvorwürfen und rasender Eifersucht durch den Tag. Ich war zu spät. Zu spät – das Wort klatschte mir ins Gesicht wie eine Ohrfeige. Mit masochistischer Grausamkeit ließ ich mir alles von Valérie erzählen und gab vor, mich für sie zu freuen, während mein Herz verblutete.
Er hieß Alessandro di Forza, war Italiener, zehn Jahre älter als ich, mit einem schneeweißen Boot und einem verwegenen Grinsen. Eines der angesagten Grandhotels an der Riviera gehörte seiner Familie. Er war ein cleverer Geschäftsmann, er war der geborene Verführer, er war eine gute Partie – mit einem Wort, er war alles, was ich nicht war.
Ich hatte nicht den Hauch einer Chance, und diese Erkenntnis machte mich wahnsinnig. Stundenlang lief ich am Ufer der Seine entlang, um einen Weg zu finden, wie ich mit der Tatsache umgehen sollte, dass ich das Mädchen, das ich hätte lieben können wie keine andere, verloren hatte.
Ich beschloss, Valérie Castel aus meinem Leben zu streichen. Ich wollte, ich konnte sie nicht mehr sehen. In den folgenden Wochen ging ich ihr aus dem Weg. Ich schaute zur Seite, wenn sie zu spät ins Seminar kam. Ich stürzte aus der Vorlesung, sobald Professor Caspari seinen letzten Satz gesprochen hatte, ich bog in eine andere Richtung ab, wenn ich sie kommen sah, und hielt mich von den Cafés fern, in denen sie gern mit den anderen saß. Ich redete mir ein, dass das alles zu meinem Besten war. Und ich vermisste das Mädchen mit den aquamarinfarbenen Augen so sehr, dass ich kaum noch in der Lage war, irgendetwas zu tun.
Ausgerechnet die schüchterne Camille war es, die sich mir eines Tages am Ausgang der Universität in der Rue Victor Cousin in den Weg stellte. Sie schüttelte ihren schwarzen Pagenkopf und sah mich aus ihren dunklen Augen vorwurfsvoll an. »Was soll das, Henri? Warum ziehst du dich so zurück? Wir finden es alle sehr schade, dass du überhaupt nichts mehr mit uns machst.«
»Tja«, sagte ich knapp und fasste an den Riemen meiner Umhängetasche. »Ich find's auch schade.«
Camille legte ihre Hand auf meinen Arm. »Valérie findet es auch schade«, sagte sie bedeutungsvoll.
»So?«, entgegnete ich und presste die Kiefer gegeneinander. »Und warum sagt sie mir das nicht selbst?«
Camille überging meine Frage. »Ihr wart doch immer so gute Freunde«, meinte sie dann.
»Die Dinge ändern sich eben. So einfach ist das.« Ich zog meinen Arm weg, doch die zarte Camille ließ sich nicht abschütteln.
»Nein, so einfach ist das nicht«, sagte sie, während sie ein paar Schritte neben mir herlief. »Du machst einen Fehler, Henri.«
9
Machte ich einen Fehler? Camilles Worte klangen in mir nach, und nachdem ich ein paar Tage mit mir gerungen hatte, gab ich zu, dass es so war. Ich führte mich auf wie ein beleidigtes Kind. Und war es – trotz allem – nicht besser, Valérie zu sehen, als sie nicht zu sehen? Sie war doch so viel mehr für mich als ein begehrenswerter Körper und ein paar schöne Augen. Ich liebte sie wegen ihrer unmöglichen Ausreden, die ihr keiner glaubte. Ich liebte die unerträgliche Detailversessenheit, mit der sie über Bücher sprach, selbst dann noch, wenn alle anderen schon schrien: »Bitte nicht alles verraten, Valérie, wir wollen es doch selbst noch lesen!« Ich liebte es, wie sie ihre Baskenmütze mit jener gewissen kleinen Eitelkeit zurechtzog, die mich rührte, oder wie sie drei Löffel Zucker in ihren café crème häufte und dann jedes Mal vergaß, umzurühren. Ich liebte ihre unbekümmerte Art, Milord zu singen, auch wenn es sich grauenvoll anhörte, weil sie keinen einzigen Ton traf. Und ich liebte diesen kleinen braunen Sprenksel in ihrem linken Auge, der nur mir gehörte und den dieser selbstherrliche Alessandro niemals im Leben bemerken würde. Valérie und ich waren es doch, die dasselbe Lieblingsbuch teilten, und uns verband so viel mehr als nur Liebe oder nur Freundschaft.
Ich lag auf dem Bett, starrte an die Decke und erfand sogar ein Wort, um meine besondere Beziehung zu Valérie zu beschreiben – es war die l'amourté, eine Mischung aus l'amour und l'amitié – für mich das wertvollste aller Gefühle. Doch nun, wurde mir plötzlich bewusst, stand ich da mit meiner tollen amourté und hatte mich selbst ins Abseits katapultiert.
»Wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen«, hatte mein Vater, der in den letzten Tagen des Algerienkriegs durch einen Schuss, der sich versehentlich aus dem Gewehr eines Kameraden löste, ums Leben gekommen war, mir immer hinterhergerufen, wenn ich als zorniger Dreizehnjähriger die Tür hinter mir zuknallte. Ich musste an seine Worte denken, die so wahr waren. Wie kam ich wieder herein nach all den Wochen? Ich wollte doch nichts lieber, als die Tür wieder öffnen, die ich hinter mir zugeschlagen hatte.
Es war noch früh am Morgen, als ich ans Fenster trat und eine Weile ratlos die Bäume betrachtete, deren Blätter wie buntes Löschpapier an den Ästen hingen. Dann ging ich zu meinem Bücherregal, zog den Großen Meaulnes heraus und machte mich entschlossen auf den Weg.
Die Vorlesung hatte gerade angefangen, als ich ihre eiligen Schritte hörte. Valérie flog die Treppen herauf und blieb überrascht stehen, als sie mich an der Tür des Hörsaals lehnen sah.
»Salut, Henri! Warum gehst du nicht rein?«, stieß sie atemlos hervor.
»Salut, Valérie. Ich hab auf dich gewartet«, sagte ich, mindestens ebenso atemlos. Es tat so gut, ihren Namen endlich wieder auszusprechen. »Hier«, ich zog das Buch aus meiner Tasche. »Das wollte ich dir noch zurückgeben.«
Sie sah mich mit zögerndem Blick an und ich suchte nach dem kleinen braunen Fleck in ihrem Auge. »Du kannst es behalten, wenn du magst.«
»Ich dachte, es wäre dein Lieblingsbuch.« Der Zweifel begann sofort in mir zu nagen. »Oder bedeutet es dir nichts mehr?«
»Doch«, sagte sie. »Es bedeutet mir was. Deswegen möchte ich ja, dass du es behältst, Idiot.«
»Danke«, sagte ich beschämt.
Wir sahen uns eine Weile schweigend an, dann lächelte sie plötzlich und streckte mir die Hand hin. »Sind wir wieder Freunde?«
Ich nahm ihre Hand, atmete tief durch und spürte die grenzenlose Erleichterung, die mich ergriff.
An diesem Vormittag kam Valérie Castel nicht zu spät in die Vorlesung von Professor Caspari. Sie kam gar nicht. Sie spazierte mit einem dummen Studenten, der einfach nur froh war, neben ihr zu gehen, durch den Jardin du Luxembourg.
10
Vielleicht wird besonderer Edelmut im Himmel belohnt, vielleicht war es aber einfach auch nur einer jener Zufälle, die erst im Nachhinein einen Sinn ergeben – jedenfalls machte ich etwa eine Woche später einen Fund, der mich all meine hehren Gedanken zum neuen Stand der amourté schnell vergessen ließ. Ich durchstöberte gerade die Holzkästen am Ufer der Seine, in denen die Bouquinisten ihre Schätze ausgebreitet hatten, als mir ein abgegriffenes, in ochsenblutrotes Leder gebundenes Büchlein ins Auge fiel. Les Elixirs de la Mort et de l'Amour. Die verblichenen Goldlettern auf dem Einband waren schwer zu entziffern. Neugierig blätterte ich durch die vergilbten Seiten des Büchleins, in denen es ganz offensichtlich um todsichere Rezepturen ging, mit denen man sich unliebsame Zeitgenossen vom Hals schaffte. Es war die Abschrift eines berühmten italienischen Giftmischers, der am Hofe Henris IV. offenbar ein gefragter Mann gewesen war, wenn es darum ging, blütenweiße Spitzennachthemden mit unsichtbarem Pulver zu bestäuben, um einflussreiche Mätressen für immer zu entstellen, oder machthungrige Fürsten mit einem wohlschmeckenden Trunk in ein hohes Fieber zu treiben, das in ewiger Umnachtung endete.
Es gab sogar eine Rezeptur, wie man die potentia coeundi eines lästigen Nebenbuhlers für immer ausschalten konnte. Ich grinste diabolisch und dachte an Valéries Gigolo von der Riviera, der in unseren Gesprächen zwar ausgeklammert wurde, doch stets wie ein Schatten im Hintergrund lauerte. Es wäre mir ein Vergnügen gewesen, Alessandro di Forza mithilfe von ein paar zusammengemischten Kräutern dessen zu berauben, was er mir voraushatte.
»Gefällt Ihnen das Buch, Monsieur?« Der alte Bouquinist beugte sich hinter seinem Stand vor und warf mir einen listigen Blick aus seinen braunen Äuglein zu.
»Oh ja!«, erwiderte ich aus vollem Herzen. »Ein äußerst nützliches Buch. Doch leider sind die Zeiten vorbei, wo man seine Feinde einfach so vergiften kann.«
Der Alte stieß ein meckerndes Lachen aus und sprang neben mich. Er ragte mir gerade mal bis zur Schulter. »Ich überlasse Ihnen diese Rarität für dreißig Franc.« Er griff nach dem Büchlein und schlug es an einer bestimmten Stelle auf. »Sehen Sie … hier! Es gibt sogar einen Liebestrank.« Er kicherte.
Ich folgte seinem langen Finger mit dem gelblichen Nagel, der auf eine fleckige Seite klopfte. L'elixir d'amour éternel.
»Das Elixir der ewigen Liebe«, wiederholte ich verblüfft.
»Ich kenne jemanden, der es ausprobiert hat«, krächzte mir das Männlein ins Ohr. Von Sekunde zu Sekunde erschien er mir mehr wie eine der sonderbaren Gestalten, die in E. T. A. Hoffmanns Novellen vorkamen. »Es hat gewirkt«, raunte er jetzt verschwörerisch.
Ich lachte ungläubig. »Das wäre ja das erste Mal seit Tristan und Isolde, dass so etwas funktioniert.«
»Kaufen Sie das Buch, junger Mann. Kaufen Sie es, und das Täubchen gehört Ihnen!« Er klappte das kleine rote Buch zu, drückte es mir in die Hand und legte seine runzlige Hand auf die meine. »Zwanzig Franc, mein letztes Wort. Sie werden es nicht bereuen, Monsieur, glauben Sie mir. Dieses Buch hat auf Sie gewartet.« Seine dunklen Augen bohrten sich in meine, und ich trat unwillkürlich einen Schritt zurück.
»Sie werden es nicht bereuen«, rief er mir noch einmal hinterher, als er einen Augenblick später die zwanzig Franc einsteckte, die gegen jede Vernunft den Besitzer gewechselt hatten.
11
Wer jemals im Leben hoffnungslos verliebt war, weiß, dass man auf die seltsamsten Ideen kommt, wenn man glaubt, damit seine Ziele zu erreichen. Es gibt Leute, die essen Photos der geliebten Person oder vergraben bei Vollmond an einer Wegkreuzung eine Haarlocke, die sie heimlich erbeutet haben. Gemessen daran war die Idee, es mit einem Menu d'amour zu versuchen, gar nicht so abwegig. Schließlich gab es nachweislich aphrodisische Lebensmittel und Gewürze wie zum Beispiel Granatapfelkerne, Spargel, Safran oder Curry. Dennoch muss ich gestehen, dass ich anfangs mit widerstrebenden Gefühlen die Rezeptur für das Liebeselixir beäugte, das aus mir unbekannten Zutaten wie Rumex Acetosa, Mandragora officinarum oder Myristica fragrans bestand. Wenn man den Worten des italienischen Verfassers glauben durfte, sollte die geheime Mixtur – in destilliertem Rosenwasser und Rotwein aufgelöst und dem Hauptgang kurz vor dem Essen beigemischt – für dauerhafte Liebe zwischen den Menschen sorgen, die das Mahl gemeinsam verspeisten.
»Haha! Das glaubst du doch nicht im Ernst, Henri Bredin«, sagte ich zu mir selbst. »Was für ein Unfug!« Dann musste ich wieder an das sonderbare Männlein denken, das mir am Quai de Conti diese »Rarität« aufgenötigt hatte. Prophetisch, ja schicksalhaft klangen seine Worte, dass das Buch auf mich gewartet habe. Am Ende beschloss ich, einen Versuch zu wagen. Das Schlimmste, was passieren konnte, war doch nur, dass mein Gericht etwas seltsam schmeckte. Und das Beste … das Beste wagte ich mir gar nicht vorzustellen!
Es kostete mich mehr als eine Woche, die seltenen Kräuter und Gewürze aufzutreiben, die das Liebeselixir erforderte. Ich zupfte und zerkleinerte, ich brühte auf und kochte ein und goss den Sud vorsichtig durch ein Küchenhandtuch.
Und dann hielt ich das kleine Fläschchen in den Händen, das mein Leben grundstürzend verändern sollte.
12
»Endlich wirst du vernünftig«, sagte Georges. Er stand vor mir, in der Hand seine Reisetasche, und füllte den schmalen dunklen Flur unserer Wohnung fast völlig aus. Ich wischte mir die Hände an der Schürze ab und lächelte bei dem Gedanken, dass ich mich noch nie so weit weg von jeder Vernunft befunden hatte wie gerade jetzt. Doch das konnte Georges natürlich nicht ahnen. Der Geruch von wildem Thymian, Knoblauch und angebratenem Speck drang aus der Küche, wo das Lammragout mit den Granatapfelkernen im Backofen schmorte.
»Habe ich nicht immer gesagt, du sollst sie zum Essen einladen? Liebe geht durch den Magen – also, bei mir jedenfalls. Hmmm – wie das riecht! Vielleicht sollte ich doch hierbleiben, anstatt Cathérine zu besuchen.« Er grinste und versetzte mir dann einen freundschaftlichen Schlag auf die Schulter. »Keine Angst, mich siehst du vor Sonntagabend nicht wieder. Salut, Henri, bonne chance!«
Ich nickte und schob ihn ungeduldig in Richtung Tür, wo er erneut stehen blieb.
»Und denk daran, die Katze zu füttern.«
»Ja, mach ich, keine Sorge.«
Er legte die Hand an die Klinke, als ihm noch etwas einfiel.
»Ach, und Henri – vergiss nicht, später das Eis hochzuholen. Ich wette, den Nachtisch werdet ihr doch vergessen! Wär schade drum.«
Ich schüttelte den Kopf und lächelte. »Nein, Georges, den vergesse ich bestimmt nicht.«
Endlich war er weg. Ich schloss erleichtert die Wohnungstür hinter ihm, lehnte mich für einen Moment mit klopfendem Herzen gegen den Türrahmen und atmete tief durch. Dann warf ich einen Blick auf die Uhr. Noch eine Stunde. Als ich an der Kommode vorbeikam, sah ich, dass Georges seinen Wohnungsschlüssel dort liegen gelassen hatte. Ich zuckte die Achseln. An diesem Wochenende würde er ihn nicht benötigen. Ich zog Georges' Zimmertür zu und ging dann in mein Zimmer, wo der Tisch für zwei Personen gedeckt war. Ein paar Blumen standen in einer Vase und zwei Leuchter mit Haushaltskerzen sollten für die nötige Stimmung sorgen. Ich schloss das Fenster. Ein Wind war aufgekommen, der das Herbstlaub über die Straßen fegte, und ein leichter Regen fiel. Draußen wurde es dunkel. Ich begutachtete den Holztisch mit seinen schlichten weißen Tellern und den Rotweingläsern. Nach einigem Überlegen stellte ich die Leuchter wieder weg. Zu offensichtlich! Schließlich kam Valérie als gute Freundin zu mir. Noch hatte sie das Liebeselixir ja nicht geschluckt, geschweige denn, dass sie etwas von meinen dunklen Plänen ahnte.
»Oh, du willst kochen!«, hatte sie gewitzelt, als ich sie für Freitag zum Abendessen einlud, und mit einem kleinen spöttischen Lächeln hatte sie hinzugefügt: »Kannst du denn überhaupt kochen?«
»Lass dich einfach überraschen«, hatte ich geantwortet und eine geheimnisvolle Miene aufgesetzt.
Ich schaltete das Deckenlicht aus und knipste die Stehlampe an, die neben dem zerschlissenen Sessel vor dem Bücherregal stand. Sofort verbreitete sich ein warmes, gemütliches Licht im Zimmer, an dessen hinterer Wand ein alter Kleiderschrank und mein schmales Bett standen. Ich starrte auf die verblichenen Blumentapeten und den alten Ölofen in der Ecke, ging zum Bett hinüber und zog die Tagesdecke noch einmal glatt. Dann eilte ich in die Küche zurück, wo ich schon seit dem frühen Morgen meine Vorbereitungen getroffen hatte. Zufrieden und aufgeregt ließ ich meinen Blick über das appetitliche Chaos schweifen, das hier herrschte. Die Steingutschüssel mit der sämigen Kartoffelvinaigrette stand auf der Anrichte, bereit für den Feldsalat, dessen glänzende, fein geputzte Blätter gewaschen und mit einem Handtuch trocken geschüttelt neben den hellen Champignons im Sieb lagen. Die angebratenen Speckwürfel warteten in der Pfanne.
In der Spüle stand noch der kleine Topf mit der Metallschale, in dem ich die Schokolade für die Gâteaux au chocolat geschmolzen hatte. Die Förmchen mit dem Teig hatte ich, abgedeckt mit Zeitungspapier, draußen vor das Küchenfenster auf einen verrutschten Dachziegel gestellt, der eine Art Vorsprung bot. Die kleinen Schokoladenkuchen wurden warm serviert und würden erst später in den Ofen kommen, wo jetzt noch Lammfleisch und Kartoffelgratin in schönster Eintracht nebeneinander schmorten.
Ich räumte die Reste der Granatäpfel und die Orangenschalen von der Anrichte und tat alles in den Mülleimer unter der Spüle. Das Blutorangenparfait hatte ich morgens gleich als Erstes zubereitet – eigentlich ein einfaches Dessert, das immer gelang – in dieser Küche jedoch eine echte Herausforderung! Erst nachdem ich die sahnige Masse in die längliche Kuchenform gefüllt hatte, war mir wieder eingefallen, dass wir leider keinen Kühlschrank hatten, geschweige denn ein Gefrierfach. »Mon Dieu, was mach ich nur … was mach ich nur?«, hatte ich gemurmelt und unglücklich auf die Form gestarrt.
»Findest du nicht, dass du ein bisschen übertreibst?«, hatte Georges gefragt, als er meine Verzweiflung sah. »Ein Nachtisch hätte doch auch gereicht.«
Natürlich hätte ein Dessert gereicht, aber wusste Georges, wie unwiderstehlich das halbgefrorene, leicht bittere Blutorangenparfait zu dem warmen duftenden Schokoladenküchlein schmecken würde? Und kannte die Liebe überhaupt das Wort Übertreibung? Ich hatte fast die Hälfte meines kärglichen Monatssalärs für dieses Festmahl ausgegeben. Auch wenn ich im Besitz des Elixirs war – von dem ich, einem verrückten Aberglauben gehorchend, nicht einmal Georges etwas erzählt hatte–, so wollte ich dennoch für Valérie Castel das beste, das raffinierteste, das köstlichste Menü zubereiten, das jemals ein Mensch gegessen hatte.
Georges hatte mir schließlich die Form aus der Hand gerissen und sie kurzentschlossen zu Madame Bezier gebracht. Das war eine feine alte Dame, die unter uns wohnte und manchmal in ohrenbetäubender Lautstärke ihre alten Beethoven-Platten hörte. Sie war alleinstehend, aber mit Eisschrank.
Ich hatte Valérie für acht Uhr bestellt. Und weil mir klar war, dass sie wie stets nicht pünktlich sein würde, hatte ich ein Gericht gewählt, bei dem es nicht auf Pünktlichkeit ankam. Im Gegenteil – je länger das Lammfleisch bei kleiner Flamme im Rotwein schmorte, desto zarter würde es sein.
Als ich die Backofentür öffnete, schlug mir ein heißer, nach Kräutern duftender Schwall Luft entgegen. Ich nahm die Topflappen, packte die schwere Casserole und stellte sie auf dem gusseisernen Herd ab. Dann öffnete ich den Topf, rührte noch einmal mit dem Holzlöffel in dem Ragout und kostete. Das zartherbe Aroma eines zerplatzenden Granatapfelkerns legte sich auf meine Zunge, bevor ich das Fleisch zerkaute, das weich wie Butter war. So musste das Paradies schmecken!
Schließlich trat ich ans Regal, langte nach oben, schob die Blechdosen mit Mehl, Zucker und Salz beiseite und holte das Fläschchen hervor, das ich dort versteckt hatte. Mit klopfendem Herzen betrachtete ich den kostbaren Inhalt, der grünlich schimmerte und ein bisschen gefährlich aussah.
Coquine, die von ihrem Lieblingsplatz auf dem Besenschrank den ganzen Tag über aufmerksam das geschäftige Treiben beäugt hatte, sprang mit einem Satz herunter und strich mir auffordernd um die Beine. »Jetzt nicht, Coquine«, sagte ich nervös.
Es war halb acht, als ich vorsichtig den Verschluss der kleinen Flasche aufdrehte und zum Herd trat, wo das Lammragout köchelte. Nun würde das Menu d'amour seine letzte und wichtigste Zutat bekommen.
In diesem Moment klingelte es an der Tür.
13
An diesem Freitag kam Valérie Castel zum ersten Mal nicht zu spät. Sie kam eine halbe Stunde zu früh und setzte damit eine Kette von Ereignissen in Gang, die ich erst später mühsam rekonstruierte. Ich wischte mir die Hände an der Schürze ab, stolperte fast über die Katze und trat ungehalten in den Flur, überzeugt davon, dass es der vergessliche Georges sein musste, der das Fehlen seines Schlüssels nun doch noch bemerkt hatte und zurückgekehrt war.
Mit einem leisen Fluch riss ich die Wohnungstür auf und sah in zwei blaue Augen, die mich erstaunt anschauten.
»Komme ich zu früh?« Valérie stand da, mit geröteten Wangen, in ihrem blauen Mantel und ihrer Kappe und lächelte etwas zaghaft. Sie roch nach Regen und in der Hand hielt sie ein Körbchen mit Kirschen.
»Nein … äh … nein«, stammelte ich und riss mir die Schürze herunter. »Du kommst keine Sekunde zu früh – ich meine, du kommst genau richtig.« Ich trat einen Schritt zurück, um sie hereinzulassen. »Es ist alles fertig.«
»Ja. Es duftet schon im ganzen Treppenhaus«, sagte sie und hielt mir die Kirschen entgegen. »Hier, das habe ich uns zum Nachtisch mitgebracht.«
»Oh! Wunderbar! Danke!« Ich nahm ihr das Körbchen ab und dachte flüchtig an mein Blutorangenparfait im Eisfach von Madame Bezier. »Komm, gib mir deinen Mantel.« Ich machte die Zimmertür von Georges kurz auf und warf Valéries Mantel hinein.
Sie blickte sich interessiert um. »Hier wohnt ihr also. Sehr nett«, meinte sie.
»Na ja, wir hausen eher hier«, entgegnete ich. »So unter dem Dach. Aber ich mag das Quartier.«
»Ja, das Viertel ist sehr schön«, wiederholte sie. »Ist Georges gar nicht da?«
»Georges konnte nicht … er ist zu seiner Verlobten gefahren«, sagte ich schnell. »Möchtest du ein Glas Wein? Setz dich schon mal, ich komme sofort.«
Das war knapp, dachte ich, als ich den Salat mit der Vinaigrette vermischte und die Casserole wieder in den Backofen schob. Eine Minute später lehnte Valérie in der Küchentür.
»Oh là là«, sagte sie, als sie die überquellenden Regale und das Durcheinander an Töpfen, Schüsseln, Dosen und Küchengeräten sah. »Hat hier eine Bombe eingeschlagen?« Coquine sprang auf die Spüle und spielte mit einer Kartoffelschale.
»Nein, hier hat nur ein Mann gekocht«, sagte ich und verscheuchte die Katze. »Außerdem siehst du ja selbst, wie winzig diese Küche ist.«