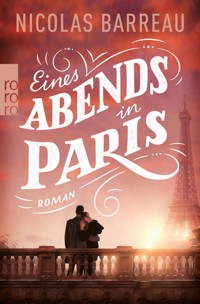9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Stadt der Liebe und der Lichter im malerischen Schneegestöber Nicolas Barreau entführt uns auf ein altes Hausboot, mitten hinein in die Stadt der Liebe, in eine romantische Komödie mit turbulenten Verwicklungen und magischen Momenten, an deren Ende ein ganz besonderes Weihnachtsfest steht. An einem regnerischen Novembertag erfährt Joséphine Beauregard, dass sie von ihrem Onkel ein Hausboot auf der Seine geerbt hat. Die Neuigkeit erscheint ihr wie eine glückliche Fügung. Gerade hat die junge Übersetzerin ihren Job bei einem kleinen Pariser Verlag verloren. Schweren Herzens beschließt Joséphine, das alte Hausboot zu verkaufen – sehr gut erinnert sie sich noch an die unvergessliche Flussfahrt auf der Seine, die sie als Kind mit ihrem Lieblingsonkel gemacht hat. Doch auf dem Boot erwartet die junge Frau nicht nur ein verschlossener Schrank, zu dem es keinen Schlüssel zu geben scheint, sondern auch ein Mann, der behauptet, einen Mietvertrag für das Boot zu haben. Und natürlich sieht er überhaupt nicht ein, warum er ausziehen sollte …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Nicolas Barreau
Tausend Lichter über der Seine
Roman
Über dieses Buch
Die Stadt der Liebe und der Lichter im malerischen Schneegestöber
Als Joséphine an einem regnerischen Novembertag erfährt, dass sie ein altes Hausboot auf der Seine geerbt hat, kommt es ihr wie eine glückliche Fügung vor. Denn die junge Frau hat gerade ihren Job bei einem kleinen Pariser Verlag verloren. Und obwohl das Boot mit vielen lieb gewonnenen Erinnerungen verknüpft ist, beschließt sie schweren Herzens, es zu verkaufen. Doch auf dem Boot erwartet sie nicht nur ein verschlossener Schrank, zu dem es keinen Schlüssel zu geben scheint, sondern auch ein Mann, der über einen gültigen Mietvertrag verfügt und über einen Auszug noch nicht einmal nachdenken möchte … Eine zauberhafte Wintergeschichte mit Witz und Herz.
«Nicolas Barreau zeigt uns ein Paris en rose und bringt die Stadt der Lichter zum Träumen.» LA STAMPA
Vita
NICOLAS BARREAU hat sich mit seinen charmanten Paris-Romanen «Die Frau meines Lebens» sowie «Du findest mich am Ende der Welt» ein begeistertes Publikum erobert. Sein Buch «Das Lächeln der Frauen» brachte ihm den internationalen Durchbruch. Es erschien in 36 Ländern, war in Deutschland mit weit über einer Million verkauften Exemplaren «Jahresbestseller» und wurde anschließend verfilmt sowie in unterschiedlichen Inszenierungen an deutschen Bühnen gespielt. In «Die Zeit der Kirschen» erzählt der Autor die Geschichte von Aurélie und André fort.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Liedtext Seite 222: Françoise Hardy – Mon amie la rose, Text: Cecile Caulier
Liedtext Seite 222/223: Françoise Hardy – Tous les garçons et les filles, Text: Françoise M. Hardy
Liedtext Seite 223: Françoise Hardy – Le temps de l’amour, Text: Lucien J. Morisse, André M.C. Salvet
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung Chris Campe, Kavalenkaya Volha/Alamy; iStock
ISBN 978-3-644-00719-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Ruth
1
Der November ist bekannt als ein trister Monat, in dem in der Regel nicht viel passiert. Jedenfalls nicht viel Erfreuliches. Es regnet oft, ein ungemütlicher Wind fegt um die Häuser, über die Brücken und Boulevards, Regenschirme schlagen um, man bekommt nasse Füße und oft genug einen Schnupfen. Die Menschen sitzen mit müden Gesichtern in der Metro, und alte Leute sterben öfter als in anderen Monaten – das ist in Paris auch nicht anders als in anderen Städten. Man versucht, irgendwie durchzuhalten, sich von einem dunklen Tag zum nächsten zu hangeln, bis der Dezember naht – und mit ihm die Vorfreude auf Weihnachten, dieses wunderbare Fest der Liebe und der Lichter, das ganz Paris in ein Märchen aus Zuckerwatte und Silberglanz verwandelt.
Lange Zeit habe ich Weihnachten geliebt. Unser Baum, den Papa wie jedes Jahr hinter der verschlossenen Tür des Salons schmückte, konnte mir nicht groß genug sein, und bereits im Laufe des Novembers strich ich durch die von Lichterketten erhellte Stadt, die geschmückten Straßen und Geschäfte, und fing an, Ausschau nach Geschenken zu halten.
Doch seit drei Jahren ist das Fest aller Feste, dieser friedliche Endpunkt des Jahres, auf den alles zuzulaufen scheint, der Familien zusammenführt und Verstrittene versöhnt, weniger schön und verheißungsvoll für mich. Ehrlich gesagt, hasse ich Weihnachten, und das hat seinen Grund.
Aber dieses Jahr im November passierte etwas, das meinem Leben – buchstäblich – eine neue Richtung gab.
Ich bekam zwei Briefe. Der eine enthielt eine schlechte Nachricht, der andere eine traurige. Und doch bescherten mir diese beiden Briefe auf den seltsam verschlungenen Wegen, die das Leben manchmal nimmt, am Ende und völlig unerwartet das schönste Weihnachtsfest meines Lebens.
Ich erinnere mich noch genau an jenen verregneten Montagmorgen, als ich fröstelnd die vier Stockwerke zu den Briefkästen hinunterlief, um wie jeden Vormittag gegen zehn nach der Post zu schauen. Ein kleines Ritual, eine willkommene Unterbrechung meiner einsamen Arbeit – wie das Zubereiten des morgendlichen Kaffees oder der nächtliche Blick aus dem Fenster meiner Mansardenwohnung, die an der Place Sainte-Marthe liegt, einem verträumten Platz in der Nähe des Canal Saint-Martin.
Sobald es wärmer wird, erwacht dieser kleine, etwas abseits gelegene Platz zum Leben. Dann sitzen die Gäste im Restaurant Galopine mit seiner taubenblauen Fassade, vor dem La Sardine stehen bunte Tische und Stühle und das Bistro Sainte-Marthe mit seiner roten Markise ist von jungen Leuten bevölkert, die bis spät in die Nacht draußen schwatzen. Das Stimmengewirr, in das sich ab und zu ein helles Lachen mischt, steigt zu mir hoch in den vierten Stock, wo ich bei offenem Fenster am Schreibtisch sitze und arbeite. Es stört mich nicht. Im Gegenteil. Es ist ein angenehmes Hintergrundgeräusch, das mich irgendwie beruhigt und mir das Gefühl gibt, ins Leben eingebettet zu sein, während ich da oben in meinem Rapunzelturm hocke, mich auf meine Übersetzung konzentriere und nach Worten und Sätzen suche, die dem Originaltext gerecht werden.
In der kalten Jahreszeit, wenn es stiller wird und der Platz mit seinen alten Laternen, den Bänken und der einsamen Litfaßsäule allmählich im Winterschlaf versinkt, bringt mich der nächtliche Blick aus dem Fenster zum Träumen. Die Bäume unter meinem Fenster rascheln leise, ein letzter Passant geht über das im goldenen Licht verschwimmende Pflaster, die Schritte verhallen, und dann gehört der kleine Platz ganz mir.
Mein alter Freund Cedric Bonnieux, ein Kolumnist, der mit seinem Lebensgefährten Augustin direkt am Canal Saint-Martin wohnt und jedem als Erstes auf die Nase bindet, dass er von seiner Wohnung am Quai de Valmy aus direkt auf die Brücke von Amélie Poulain schauen kann, sagt immer, dass die Place Sainte-Marthe «überhaupt nicht schick sei» und so «fuuurchtbar aus der Zeit gefallen». Dabei schaut er mich dann immer etwas vorwurfsvoll an, als wolle er sagen: «Wie kannst du nur dort leben?», und zupft an seinem bunt gemusterten Etro-Schal.
Und er hat wohl recht. Die Place Sainte-Marthe ist eine Welt für sich. Nur eine knappe Viertelstunde vom Canal entfernt, der mit seinen malerischen Eisenbrücken und den vielen Cafés und Bistros schon längst eine sehr angesagte Gegend ist, wo die Leute gern bis spät in der Nacht ausgehen und am Wasser sitzen, liegt dieser kleine Platz hinter dem Park des alten Hôpital Saint-Louis verborgen, fast wie aus einem Traum. Besonders abends, wenn die Nacht sich sanft über die Place Sainte-Marthe senkt und die Laternen angehen, ist dieser Platz für mich einer der schönsten von Paris. Er passt zu mir, denn auch ich bin etwas aus der Zeit gefallen und nicht besonders schick. Sonst hätte ich mir wohl einen glanzvolleren Beruf ausgesucht. Einen aus der ersten Reihe, wo man sichtbar ist. Ich meine, wer denkt schon an die Übersetzerin, wenn er ein Buch aus einer anderen Sprache liest? An die Herausforderung, sich fremde Worte zu eigen zu machen und sie dann zu beheimaten in der eigenen Sprache. Neue Bilder zu finden, die am Ende und im besten Fall genau das transportieren, was der Autor sagen will, und dies alles, ohne dass der Leser überhaupt realisiert, dass er eigentlich ein englisches, spanisches, oder gar finnisches Buch liest. Weil es so klingt, als wäre es in seiner Sprache geschrieben.
Übersetzen ist wie Balletttanzen eine hohe Kunst. Wir scheinen mühelos durch die Lüfte zu fliegen mit unseren Sprachgebilden, drehen uns mit einem Lächeln auf der Fußspitze, landen sanft und geräuschlos im nächsten Satz. Einer gelungenen Übersetzung merkt man die Anstrengung nicht an, hat der alte Monsieur Lassalle einmal zu mir gesagt. Er ist der Verleger der Éditions Lassalle, einem kleinen Verlag in Saint-Germain, für den ich mittlerweile fast ausschließlich fremdsprachige Romane übersetze, und ich kann ihm da nur zustimmen. Denn nur durch diese Leichtigkeit, diesen fein abgestimmten Pas de deux zwischen zwei Sprachen, wird ein fremdes Buch erst zum Lesegenuss. Wir Übersetzer sind diejenigen, die die Brücke schlagen zwischen den Sprachen, die Wanderer zwischen den Welten. Und ich bin stolz und glücklich, wenn mir das immer wieder gelingt. Wenn ich eine Übersetzung abgebe, steckt jedes Mal auch ein Teil von mir darin. Auch wenn das in der Regel niemand bemerkt.
Manchmal, bei einem eher bedeutenden Werk der Literatur, macht sich jemand vom Feuilleton vielleicht die Mühe, zu erwähnen, dass die Übersetzung ganz hervorragend sei und die Übersetzerin kongenial. Doch in den meisten Fällen werden unsere Namen schlicht und ergreifend vorne im Buch unter dem Titel genannt und rasch überblättert:
«Aus dem Finnischen übersetzt von Joséphine Beauregard.»
Joséphine, das bin ich, und meinen etwas hochtrabenden Namen verdanke ich dem Umstand, dass meine Mutter immer noch von den glanzvollen Zeiten der Grande Nation träumt und eine glühende Verehrerin von Napoleon Bonaparte ist. Als ehemalige Zahnärztin hat sie nicht nur auf die Zähne ihrer Töchter geachtet (dank täglicher Mundspülungen und der Zahnspangen, die wir als Kinder tragen mussten, sind unsere Zähne tatsächlich makellos), sie hat uns auch alle nach den Heldinnen der napoleonischen Zeit benannt. Doch während meine beiden älteren Schwestern ihren großen Namen gerecht geworden sind – Eugénie ist eine angesehene Herzchirurgin, die ständig zu irgendwelchen wichtigen Mediziner-Kongressen eingeladen wird, und Pauline, die wahrscheinlich nicht mal nachts ihre Perlenkette ablegt, ist nach dem Jurastudium in die Fußstapfen von Papa getreten, dessen gut gehende Anwaltskanzlei sie eines Tages übernehmen wird –, bin ich mit meinem schlecht bezahlten Übersetzerjob wohl die Versagerin in unserer Familie.
Als ich Maman damals erklärte, dass ich Sprachen studieren wolle, um Bücher zu übersetzen, starrte sie mich nur ganz fassungslos an. «Als Beruf?», fragte sie entsetzt. «Du meinst doch nicht als Beruf, oder?»
«Natürlich als Beruf», gab ich gereizt zurück. «Was denkst du denn?»
«Aber davon kann man doch nicht leben, Kind! Warum studierst du nicht etwas Vernünftiges wie deine Schwestern. Du könntest doch wenigstens Apothekerin werden. Oder geh in den diplomatischen Dienst. Papa hat doch gute Verbindungen ins Ministerium. Mit deinen Noten kannst du alles werden.»
«Genau», sagte ich trotzig und verließ den Salon.
Später hörte ich, wie sie Papa im Schlafzimmer ihr Leid klagte.
«Übersetzerin!», stöhnte sie. «Kannst du denn nicht mal mit ihr reden, Antoine?»
«Nun ja, es ist doch ihre Entscheidung, Isabelle», lenkte Papa vorsichtig ein. «Letztlich.» So brillant Papa vor Gericht ist, zu Hause geht er Konflikten lieber aus dem Weg. «Natürlich hätte ich sie auch lieber in der Kanzlei gesehen.» Es klang ein bisschen enttäuscht. «Aber unsere Kleine ist eben anders als Eugénie oder Pauline. Nicht so durchsetzungsstark. Eine Traumtänzerin.»
«Du sagst es. Umso wichtiger ist es, dass sie etwas Vernünftiges macht.»
«Aber wenn es doch ihr Herzenswunsch ist …»
«Was heißt schon Herzenswunsch. Ich bitte dich, chéri! Übersetzen ist eine brotlose Kunst. Das weiß doch jeder…»
«Sie liebt eben die Literatur …»
«Franchement, Antoine. Wir alle lieben die Literatur. Unsere Regale sind voll mit Literatur. Aber muss man gleich einen Beruf daraus machen? Da kann sie ja gleich zum Zirkus gehen und Trapezkünstlerin werden.» Ich konnte geradezu sehen, wie sie ihre blonden Haare, die sie gern wie die Schauspielerin Cathérine Deneuve trägt, missbilligend schüttelte. Anders als Papa, der aus dem Burgund stammt, ist Maman in Paris geboren und damit vielleicht das wichtigste Wesen auf der Welt. Und sie weiß immer alles ganz genau.
«Jetzt übertreibst du aber, Isabelle.»
«Nein, durchaus nicht, Antoine. Ich will einfach nur das Beste für meine Tochter, und das solltest du auch. Warum kann sie sich nicht einen respektablen Beruf aussuchen? Ich mache mir Sorgen. Was soll denn mal aus ihr werden? Ach, Joséphine war schon als Kind so stur …»
So ging es noch eine Weile hin und her, und ich stand mit brennenden Wangen hinter der Tür und lauschte, was meine Eltern über mich redeten. Ich war betroffen, wie wenig sie mir zutrauten. Als Nachzüglerin, die fast zehn Jahre jünger war als meine beiden großen Schwestern, war ich immer die Kleine gewesen und würde das wohl auch für alle Zeiten bleiben.
«Nun, man kann nur hoffen, dass sie wenigstens einen vernünftigen Mann abbekommt, der ihr ihren Herzenswunsch auch finanzieren kann», hörte ich Maman schließlich seufzen. «Hübsch genug ist sie ja. An ihrem Kleidungsstil sollte sie allerdings dringend etwas ändern.»
Nun – nicht nur, was meinen Kleidungsstil angeht, auch bezüglich der Wahl meiner Männer habe ich Mamans Erwartungen wohl schwer enttäuscht. Anders als meine beiden so eleganten und erfolgreichen Schwestern hatte ich auch mit einunddreißig noch keinen respektablen Ehemann vorzuweisen. Nach ein paar Beziehungen zu einigen abgerissenen Möchtegern-Intellektuellen, die sich vor allem durch exzessives Kaffeetrinken, Schwadronieren und Rauchen auszeichneten, gab es seit ein paar Jahren nicht einmal einen festen Freund an meiner Seite, was die Familie zunehmend mit Sorge erfüllte. Ich sah die Blicke, die sie sich zuwarfen, wenn ich auf Familienfeiern wieder einmal alleine aufkreuzte. Diese «Die-Kleine-kriegt-eben-nichts-auf-die-Reihe»-Blicke. Und allmählich fing ich an, die Familienzusammenkünfte zu hassen.
«Warum hat Tante Joséphine eigentlich keinen Mann, Maman?», hatte Camille letztes Jahr beim Weihnachtsessen mit ihrer klaren kindlichen Stimme gefragt und ihre großen blauen Augen dann etwas ratlos auf mich gerichtet. Sie ist die niedliche und für meinen Geschmack etwas anstrengende fünfjährige Tochter von Eugénie und Guy. Guy, Spezialist für plastische Chirurgie und ein Garant dafür, dass seine Frau auch noch in hundert Jahren ganz fabelhaft aussehen wird, hat seine Praxis in einer riesigen Villa in Neuilly, wo die beiden auch wohnen. Und vor zwei Jahren haben sie zur Komplettierung der Familie einen weiteren blond gelockten Engel in die Welt gesetzt – den kleinen César, der sich mit seinen Patschehändchen, die alles verschmieren, was er anfasst, seines kaiserlichen Namens wohl noch nicht allzu bewusst ist.
So wohlgenährt und friedlich, wie er in seinem Hochstuhl saß, glich er eher einem kleinen dicken Brutus. Camille hingegen war sozusagen von Geburt an ein aufgewecktes Mädchen, dessen Wissensdurst unerschöpflich schien.
Nach ihrer Frage herrschte einen Moment lang Schweigen am Tisch. Ich legte mein Silberbesteck an den Tellerrand und spürte, wie mir das Blut in die Wangen stieg. Allmählich kam ich mir vor wie die schwer vermittelbare arme Verwandte aus einem Jane-Austen-Roman. Nur ein Mr. Darcy war leider nicht in Sicht.
«Aber Camille», rügte Eugénie ihre Tochter sanft. «Du darfst nicht so vorlaut sein, Engelchen. Du bringst die arme Joséphine in Verlegenheit.»
«Warum sollte Joséphine denn verlegen sein?», meinte Pauline und spielte an ihrer unvermeidlichen Juristinnen-Perlenkette herum. «Vielleicht lebt sie einfach lieber allein. Ohne Mann, meine ich.»
«Gut erkannt», sagte ich, trank einen Schluck von meinem Rotwein und prostete den anderen zu. «Willkommen im 21. Jahrhundert übrigens.»
Pauline zog vielsagend die Augenbrauen hoch und grinste, und Maman schaute etwas misstrauisch drein. So, als ob ihr gerade ein weiterer beängstigender Gedanke durch den Kopf geschossen wäre, der sich mit ihren großbürgerlichen Vorstellungen von Familie sicher schwer vereinbaren ließ.
«Aber wenn sie keinen Mann hat, bekommt sie auch keine Kinder», folgerte Camille, das kluge Kind, ganz richtig. «Und ich will endlich eine Cousine.»
«Ich möchte, Camille. Ich möchte, heißt das», sagte Eugénie und strich sich leicht genervt ihre blonde Mähne zurück. «Vielleicht möchte Tante Joséphine keine Kinder», meinte sie spitz.
«Dann musst du wohl mit deiner Tante Pauline weiterverhandeln, meine Süße», schaltete sich Papa ein, wie immer bemüht, auszugleichen und Frieden zu stiften. Er lächelte freundlich und sah seine zweitälteste Tochter an, die ihm gegenübersaß. «Wie sieht’s aus, Pauline? Schenkst du Camille eine Cousine?»
«Ich schau mal, was sich machen lässt,», entgegnete Pauline und warf Bertrand von unten einen belustigten Blick durch ihre dichten Wimpern zu. Pauline hat wie ich die dunklen Haare und Augen von Papa. Doch im Gegensatz zu meinen schulterlangen Locken, die immer etwas ungekämmt aussehen, trägt meine Schwester einen kinnlangen Bob, der bei jeder Bewegung ihres Kopfes anmutig und in seiner Perfektion ein wenig furchteinflößend mitschwingt.
Bertrand ist der Mann meiner Schwester. Er sieht ein bisschen studentisch aus mit seiner kleinen Goldrandbrille und dem etwas zu langen Haar, aber zur Freude meiner Eltern ist er natürlich kein «Intello», der den lieben langen Tag in Cafés herumhockt und ansonsten keinen Knopf an der Hose hat, wie man in unserer Familie zu sagen pflegt. Bertrand ist Professor für Geophysik an der Sorbonne, und seit Neuestem berät er auch das Umweltministerium, weswegen ich doppelt aufpassen muss. Es gibt immer Querverbindungen, und auch in den Ministerien wird geredet. Zu Hause hat Bertrand nicht viel zu melden. Meine Schwester ist eine Magnolie aus Stahl, und sie organisiert alles. Aber mein Schwager scheint damit gut umgehen zu können. Mit einem nachsichtigen Lächeln legte er jetzt den Arm um Paulines Schultern und meinte: «Also … Ich hätte nichts dagegen. Aber das muss die Chefin entscheiden.»
«Na, dann wäre das ja geklärt», sagte Papa.
Alle lachten. Selbst Maman, die sich bei der Aussicht auf ein neues Enkelkind wieder gefangen zu haben schien, lachte.
Und dann aßen wir weiter.
Wunderbar, wie sich alle um mich herum so blendend verstanden. Ich war hier die Außenseiterin, ganz klar. Und auch, wenn ich mir trotzig in Erinnerung rief, dass die Helden aller wirklich interessanten Romane meistens Außenseiter sind, war das in der Wirklichkeit doch kein echter Trost.
Lustlos stocherte ich in meinem Confit de Canard herum. Und während die anderen erzählten und lachten, war mir plötzlich der Appetit vergangen. Es war ja gar nicht so, dass ich keinen Mann gewollt hätte. Oder gehabt hätte. Oder lieber allein lebte. Und eine Kinderhasserin war ich auch nicht. Jedenfalls würde ich meine eigenen Kinder niemals hassen, sollte ich jemals welche bekommen, beschloss ich.
Nur konnte ich meiner Familie nichts von Luc erzählen. Aus verschiedenen Gründen musste unsere Verbindung noch geheim bleiben. Zumindest war das vor einem Jahr so gewesen, als ich mich so unfroh durch dieses Weihnachtsessen quälte. Aber all das würde sich nun endlich ändern. Luc hatte es mir versprochen.
«Dieses Jahr Weihnachten bin ich an deiner Seite», hatte er mir am Ende des Sommers versichert. «Ganz offiziell.» Er hatte mich aus seinen unglaublichen Augen angeschaut, die nicht einfach nur blau sind, sondern aus vielen unterschiedlichen Blautönen zusammengesetzt zu sein scheinen. Lucs Augen sind magisch. Magnetisch.
«Glaub mir», hatte er gesagt. «Ich warte nur noch auf den passenden Moment.»
Und ich glaubte ihm. Wieder einmal. Doch nachdem er gegangen war, warfen die Zweifel erneut ihre Netze aus, und der Gedanke an Weihnachten erfüllte mich wie jedes Jahr mit düsterem Unbehagen.
In einem hatte Maman jedenfalls nicht recht gehabt. Natürlich konnte man vom Übersetzen leben. Wenn auch nicht in einer 250-Quadratmeter-Wohnung in der Rue de Bourgogne, wo meine Eltern seit vielen Jahren so überaus feudal residierten. Aber es reichte immerhin für eine charmante Dachwohnung im 10. Arrondissement, in der im Winter die altersschwache Heizung nicht immer zuverlässig funktionierte.
«Mon Dieu, du haust ja immer noch wie eine Studentin!», hatte Maman bekümmert ausgerufen, als sie mich vor ein paar Jahren das erste und einzige Mal hier besuchte. In diesem Augenblick hatte ich die kleine Mansarde mit ihren Augen gesehen – als wäre plötzlich ein greller Scheinwerfer auf alles gerichtet worden: die alten Möbel, die nicht richtig zusammenpassten, die bunte indische Decke über dem Bett, das mit seinen vielen Kissen auch als Sofa diente, der Weichholzschreibtisch vor dem Fenster, die Kochnische unter der Schräge (in der der Kühlschrank manchmal so laut brummte, dass ich ihn nachts abstellen musste), der Korbstuhl in der Ecke, der ein bisschen schief war –, und mit einem Mal hatte ich mich ganz miserabel gefühlt. So als wäre mir mein Leben nicht geglückt. Und vielleicht war das ja auch so, vielleicht belog ich mich selbst und wollte die Wahrheit nicht sehen. Doch nachdem Maman wieder gegangen und die Tür hinter ihr ins Schloss gefallen war, ging es mir schon wieder besser.
Ich hatte mir einen Tee gemacht, den großen roten Iittala-Becher mit den Füchsen und Eulen aus dem Regal über der Spüle genommen – eine Erinnerung an mein Studienjahr in Helsinki, wo die Winter so dunkel und doch so voller Lichter waren und die Sommer endlos und hell –, hatte mich in den Korbsessel gesetzt und mein kleines Reich betrachtet.
Eigentlich mochte ich meine Wohnung. Mein Quartier mit den kleinen Gassen und Geschäften. Meine Vintage-Kleider und bunten Schals. Und auch wenn ich bei Weitem nicht so viel verdiente wie meine großartigen Schwestern, hatte ich doch mein Auskommen. Meine Arbeit machte mir Freude, meine Übersetzungen wurden geschätzt, und mein Terminplan war gut gefüllt mit Aufträgen, die bis weit ins nächste Jahr reichten.
Auch an diesem Montag, der wie ein ganz normaler Tag im November begann, hatte ich bis spät in der Nacht an einer Übersetzung gesessen, die ich bis zum Ende der Woche abgeben wollte.
Alles war wie immer, und als ich noch etwas verschlafen durch das Treppenhaus stapfte und den Briefkasten aufschloss, hatte ich nicht die geringste Ahnung von dem, was sich das Schicksal für mich ausgedacht hatte. Selbst als ich die beiden Kuverts zwischen den üblichen Werbe-Flyern entdeckte und neugierig herauszog, ahnte ich nicht, dass sich mein Leben grundstürzend verändern würde. Im Halbdunkel des Treppenhauses, in dem das Licht nach wenigen Minuten stets erlosch, drehte ich die beiden Umschläge in meiner Hand und versuchte, die Absender zu entziffern.
Der eine Brief kam vom Verlag. Wahrscheinlich eine Abrechnung. Der andere, ein etwas größerer Umschlag aus edlem Büttenpapier mit fein gedruckter grauer Schrift, kam von einer mir unbekannten Kanzlei.
Berger & Fils.
Was mochte das sein?
Während ich die Treppen hochstieg, beschlich mich ein ungutes Gefühl. Obwohl ich die Tochter eines Rechtsanwalts bin, bekomme ich immer einen kleinen Schreck, wenn ich ein Schreiben von offizieller Stelle erhalte. Hatte ich eine Rechnung übersehen? Meine Steuern nicht rechtzeitig bezahlt? Hatte ich mir irgendetwas zuschulden kommen lassen?
Sei nicht albern, Joséphine, schalt ich mich selbst, als ich oben angelangt war und die Tür zu meiner Wohnung aufstieß. Kopfschüttelnd setzte ich mich in den Korbsessel, legte den Umschlag von der Kanzlei Berger auf das rote Marmortischchen und beschloss, erst einmal in die Verlagspost zu schauen.
Ich öffnete den Umschlag und überflog den Brief, der vom Verleger persönlich unterschrieben war. Es war gut, dass ich bereits saß, denn schon nach den ersten Zeilen wurde mir ganz flau.
Sehr geehrte, liebe Mademoiselle Beauregard,
diesen Brief zu schreiben, fällt mir nicht leicht. Sie haben nun schon so viele Jahre so ausgezeichnete Arbeit für uns geleistet, und wir waren immer sehr zufrieden mit Ihren wunderbaren Übersetzungen.
Umso mehr bekümmert es mich, Ihnen heute mitteilen zu müssen, dass ich mich schweren Herzens und nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen habe …
Mit klopfendem Herzen überflog ich die Seite und ließ dann wie betäubt das Blatt sinken.
Robert Lassalle gab seinen Verlag zum Ende des Jahres auf. Seine Gesundheit sei nicht mehr die beste, schrieb er, und Nischenthemen wie die finnische Literatur, für die er sich immer so stark gemacht hatte, seien auf dem französischen Markt immer schwerer durchzusetzen. Von wenigen Ausnahmeerfolgen wie Arto Paasilinna mal abgesehen. Bislang habe er die Verluste durch Zuschüsse aus seinem Privatvermögen aufgefangen, doch nun sei der kleine Verlag so weit in die roten Zahlen gerutscht, dass er nicht mehr zu retten sei. Ein Insolvenzverwalter sei bereits eingeschaltet, der sich um alles Weitere kümmern würde. Selbstverständlich würde ich die Übersetzung, an der ich gerade arbeitete, noch vergütet bekommen. Alle weiteren Aufträge seien leider hinfällig.
Es tut mir wirklich sehr leid, dass ich heute so schlechte Nachrichten für Sie habe. Ich hatte immer gehofft, dass dieser Tag niemals kommen würde, aber nun ist er eben doch gekommen. Man muss wissen, wann es vorbei ist.
Ich hoffe jedoch sehr und bin mir sicher, liebe Mademoiselle Beauregard, dass Sie mit Ihrem exzellenten übersetzerischen Talent schon bald neue Aufträge akquirieren werden.
Und lassen Sie mich Ihnen noch etwas mit auf den Weg geben, das ich auch mir selbst sage: Wir alle haben verständlicherweise Angst davor, dass etwas zu Ende geht. Aber im Grunde geht niemals etwas wirklich zu Ende. Die Dinge verändern sich nur.
In diesem Sinne wünsche ich mir, dass Sie optimistisch nach vorn schauen und dass wir uns vor Weihnachten noch einmal sehen, um uns persönlich voneinander zu verabschieden.
Seien Sie sehr herzlich gegrüßt von Ihrem
Robert Lassalle
Ich fühlte mich wie vor den Kopf gestoßen. Nein, ich fühlte gar nichts mehr. Eine große Taubheit hatte meinen Körper erfasst. Doch dann begannen die Rädchen in meinem Kopf sich zu drehen, und eine Welle der Panik stieg in mir auf. Hatte ich mich nicht noch gerade so sicher gewähnt – mit genügend Aufträgen für das kommende Jahr? Nun blieb mir davon nichts mehr. Eine Übersetzung noch, und dann war Schluss. Fieberhaft überlegte ich, was ich noch an Rücklagen auf dem Konto hatte. Da war nicht viel. Für ein, zwei, drei Monate würde es wohl reichen, wenn ich sparsam war. Ich musste dringend an neue Aufträge kommen, aber wie? Stöhnend schlug ich mir die Hand an die Stirn. Jetzt rächte es sich, dass ich, weil es so komfortabel war, quasi als Hausübersetzerin für die Éditions Lassalle gearbeitet hatte. Wie hatte ich nur so dumm sein können? Jeder weiß doch, dass es immer besser ist, mehrere Eisen im Feuer zu haben.
Ich ließ mich in den Sessel zurücksinken. Ich hatte wirklich gern für diesen Verlag gearbeitet, wo man sogar als Übersetzerin den Verleger noch persönlich kannte. Wo man nicht nur per Mail einen Auftrag bekam und ein paar Monate später seine Übersetzung als Word-Datei zurückschickte. Wehmütig dachte ich an die netten Besprechungen mit den beiden Lektorinnen, die oft genug in dem Rückgebäude der Rue des Canettes stattgefunden hatten. An die ausgelassenen Weihnachtsfeiern im Restaurant Bonaparte, zu denen auch ich als Übersetzerin eingeladen war. An die Handvoll Lesungen mit finnischen Autoren, bei denen ich moderieren durfte. An all die Erfolge, die es im Laufe der Jahre durchaus gegeben hatte und über die wir uns alle zusammen freuten.
Erst jetzt wurde mir bewusst, dass die Éditions Lassalle für einige Jahre ein zweites Zuhause für mich gewesen war. Ein Rückhalt, nicht nur finanzieller Art. Und nun war von jetzt auf gleich alles weggebrochen. Es würde nicht leicht werden, auf die Schnelle neue Verträge an Land zu ziehen. Meine «exzellenten übersetzerischen Talente» halfen mir da erst mal auch nicht weiter. Wieder spürte ich, wie die Angst mich erfasste. Die Angst, die jeder kennt, der selbstständig arbeitet und auf Aufträge angewiesen ist. Die Angst um die Existenz.
Mein Blick fiel auf den anderen Brief, den ich fast vergessen hatte. Mit zitternden Fingern griff ich nach dem Kuvert. Was konnte dieser Berger, von dem ich noch nie etwas gehört hatte, von mir wollen?
Ich riss den Umschlag auf und spürte, wie das Herz mir bis zum Halse schlug. Das Schreiben kam von einem Notar aus Chablis.
Sehr geehrte Mademoiselle Beauregard,
ich bedauere Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Onkel, Monsieur Albert Beauregard, wohnhaft in der Résidence St-Julien-de-Sereine in Chablis …
Auf eigenen Wunsch wurde Ihr Onkel feuerbestattet …
… beauftragte mich, seinen Nachlass zu regeln. Nach dem mir vorliegenden Testament sind Sie die allein Begünstigte …
Onkel Albert war gestorben. Papas älterer Bruder, der schon seit vielen Jahren in einem Seniorenheim im Burgund lebte und lange Zeit davor den Kontakt zur Familie gänzlich abgebrochen hatte, hatte nach Jahren der Demenz seinen letzten Atemzug getan und war friedlich und ohne jede Erinnerung an uns eingeschlafen. Doch bevor die Krankheit ausbrach, hatte Onkel Albert offenbar ein Testament zu meinen Gunsten gemacht. Ich war die Einzige aus der Familie, die er mochte, und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Ich erinnerte mich noch gut an diesen einen unvergesslichen Sommer, als ich aufgrund einer glücklichen Fügung und weil meine Eltern keine Zeit hatten, in den Ferien mit Onkel Albert auf dessen Hausboot gemächlich die Seine herunterschipperte und wir anhielten, wo es uns gefiel. Damals war ich elf gewesen und liebte das Abenteuer. Und was konnte es Aufregenderes geben, als auf einem Boot zu schlafen? Abends saßen wir an Deck unter dem Sternenhimmel, Onkel Albert trank seinen Wein und erzählte Geschichten, während das Wasser sanft gegen die Planken schlug. Bis an den Oberlauf der Loire waren wir gekommen, hatten uns ein Auto gemietet und ein paar von den herrlichen Schlössern erkundet, die inmitten grüner Wälder und Wiesen im idyllischen Loire-Tal lagen. Und so hieß auch das Boot meines Onkels: La Princesse de la Loire. Und die schöne und wagemutige «Prinzessin von der Loire», das war natürlich ich.
Jedenfalls glaubte ich das damals, und Onkel Albert hat es nie bestritten. Auf unserer Flussfahrt vor mehr als zwanzig Jahren hatte er mir schmunzelnd versichert, dass ich, Joséphine, seine kleine Loire-Prinzessin sei, und ich platzte fast vor Stolz, dass jemand ein Boot nach mir benannt hatte.
Nach diesem wunderbaren Sommer hatten wir uns aus den Augen verloren, sei es, weil Onkel Albert, der als Weinvertreter im Burgund lebte, seine eigenen Wege ging, sei es, weil meine Eltern nicht viel von ihm hielten und immer ein bisschen die Nase rümpften, wenn die Sprache auf den Bruder von Papa kam, der – warum auch immer – als schwarzes Schaf der Familie galt. Doch ich hatte nur gute Erinnerungen an meinen Onkel, der mich stets in allem bestärkt hatte.
Während des Studiums hatte ich ihn noch ab und zu besucht, nicht sehr oft, um ehrlich zu sein, aber da lebte er schon in der Seniorenresidenz, und die Krankheit fing an, ihm mit beängstigender Geschwindigkeit seine Erinnerungen zu nehmen.
Beim letzten Mal begrüßte er mich freundlich, erkannte mich aber offensichtlich nicht mehr. Erst als ich noch einmal von unserer Flussfahrt erzählte, glomm für einen Moment ein Licht in seinen leeren Augen auf. Er strich mir übers Haar und sagte mit seiner brüchigen Stimme: «Ah, c’est toi! Ma petite princesse de la Loire. Hast du mich endlich gefunden?» Dann versank er wieder in seiner eigenen Welt, und ich verließ auf Zehenspitzen das Zimmer.
Und nun, viele Jahre später, war ich von Monsieur Isidore Berger nach Chablis einbestellt, um die Asche meines Onkels abzuholen und mein Erbe anzutreten, das aus einem Brief und einem Satz Schlüssel bestand. Und diese Schlüssel gehörten zu seinem alten Hausboot, das schon seit Ewigkeiten ungenutzt und ohne, dass irgendjemand davon gewusst hätte, am Ufer der Seine vor sich hinschaukelte. Mitten in Paris!
Ich merkte, wie mir schwindlig wurde.
Innerhalb von einer Viertelstunde hatte ich alle meine Aufträge verloren, weil Robert Lassalle seinen Verlag zumachte. Mein Lieblingsonkel war gestorben, und wie es aussah, war ich nun die Besitzerin eines Hausboots. Das war eindeutig zu viel für einen ganz normalen Montagvormittag. Das gibt’s doch nicht, dachte ich noch.
Und dann brach ich in Tränen aus.
2
Nachdem ich mich wieder etwas gefangen hatte, versuchte ich, Luc zu erreichen, aber er ging nicht ans Telefon – wie so oft. Ich hinterließ eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und bat ihn, mich zurückzurufen. «Bitte melde dich, ich bin völlig durch den Wind», sagte ich mit zitternder Stimme. Dann wollte ich Papa anrufen. Ich überlegte kurz und ließ den Hörer wieder sinken. Es erschien mir irgendwie angemessener, in die Kanzlei zu fahren, um ihm die Nachricht vom Tod seines Bruders persönlich zu überbringen. Der Tod an sich ist ja doch immer ein einschneidendes Erlebnis und verdient einen gewissen Respekt. Und auch, wenn die beiden sich seit über zwanzig Jahren nicht mehr gesehen hatten und offenbar nicht viel miteinander anfangen konnten, war Albert doch immerhin der einzige Bruder von Papa.
Als ich meine Wohnung verließ und zur Metro-Station Goncourt eilte, um dort im unterirdischen Transportsystem der Stadt zu verschwinden, prasselte der Regen vom Himmel. Onkel Albert hatte sich jedenfalls den richtigen Monat ausgesucht, um diese Welt zu verlassen. Es herrschte Weltuntergangsstimmung, und ich hoffte, dass er dort, wo er jetzt war, zumindest besseres Wetter hatte.
Mit meinem Regenschirm bewaffnet, eilte ich wenig später den Boulevard Saint-Germain entlang, der an diesem trostlosen Novembertag ganz besonders verlassen wirkte.
Die Kanzlei Beauregard lag am oberen Teil des Boulevards, ein gutes Stück weg von den hübschen kleinen Cafés, Patisserien und Mode-Boutiquen, die sich rund um die alte Kirche von Saint-Germain-des-Prés angesiedelt hatten und zu jeder Jahreszeit eine nahezu magnetische Wirkung auf die Touristen haben. Doch in dem Abschnitt, den ich jetzt entlanglief, befanden sich in den herrschaftlichen Gebäuden nur noch elegante Möbelgeschäfte, Küchenstudios, Arztpraxen oder eben Rechtsanwaltskanzleien. Es waren kaum Fußgänger unterwegs, Autos fuhren geräuschvoll an mir vorbei und teilten das Wasser der Pfützen, die sich auf der Straße gebildet hatten. Ein Schwall Regenwasser spritzte plötzlich auf und ergoss sich über den unteren Teil meines Mantels und meine Schuhe.
«He, pass doch auf!» Aufgebracht schwenkte ich meinen Schirm und blickte dem Wagen nach, der ohne jede Rücksicht an mir vorbeigebraust war. Ich strich mir eine nasse Haarsträhne aus dem Gesicht und stolperte leise fluchend vorwärts. Die Hand, mit der ich den Griff meines Schirms hielt, war schon ganz klamm. Ein paar Meter weiter tauchte endlich das dunkelblaue Holzportal der Kanzlei Beauregard auf, und ich drückte meinen Finger auf die Messingklingel.
Papa saß hinter seinem Schreibtisch und blätterte gerade in einer Akte, als ich in sein Büro trat, dicht gefolgt von Madame Martin, die entschuldigend lächelte, weil sie mich nicht hatte aufhalten können.
«Ihr Vater hat gleich einen wichtigen Telefontermin, möchten Sie vielleicht einen Moment warten, Mademoiselle Beauregard?», hatte sie gesagt, als ich die Tür zur Kanzlei aufstieß und mein zugeklappter Schirm auf den Teppichboden tropfte. «Was für ein Wetter! Sie sind ja ganz nass», hatte sie mit Blick auf meinen Mantel hinzugefügt. «Wollen Sie mir vielleicht Ihren Mantel geben? Bitte, nehmen Sie doch Platz.» Sie hatte auf die beiden Sessel im Vorzimmer gedeutet. «Einen Kaffee vielleicht?»
Die Sekretärin meines Vaters war immer von ausgesuchter Höflichkeit. Sie sagte gern «vielleicht», so als ob man eine Wahl gehabt hätte, aber hinter ihrem unerschütterlichen Lächeln steckte eine durchaus entschlossene ältere Dame, die ihren Chef vor jeder Störung abzuschirmen versuchte.
«Nein, danke, Madame Martin», erwiderte ich und marschierte an ihr vorbei. «Tut mir leid, aber es ist wichtig.»
Papa blickte überrascht auf und setzte seine Lesebrille ab, als er mich im Türrahmen auftauchen sah.
«Ihre Tochter, Monsieur Beauregard», meinte Madame Martin nun überflüssigerweise und strich sich über ihren grauen Chignon. «Ich habe ihr gesagt, dass Sie gleich einen Anruf erwarten, aber sie meinte, es sei wichtig …»
«Schon gut, schon gut.» Papa nickte seiner Sekretärin zu und winkte mich herein, während Madame Martin sich diskret zurückzog und die grün gepolsterte Tür hinter sich schloss.
«Bonjour, Joséphine!», sagte Papa und sah mich lächelnd an. «Was führt dich denn hierher?» Er hatte seine Hände auf dem lederbespannten Kirschholzschreibtisch ineinander verschränkt, und seine dunklen Augen ruhten freundlich auf mir. Es kam in der Tat nicht oft vor, dass ich Papa in der Kanzlei besuchte. Ich starrte ihn mit gemischten Gefühlen an und wusste plötzlich nicht, wie ich es am besten sagen sollte. Es war immerhin das erste Mal für mich, dass ich eine Todesbotschaft überbrachte.
«Salut, Papa», entgegnete ich lahm.
«Ist etwas passiert?» Papa runzelte die Stirn. «He, meine Kleine, du bist ja ganz blass, was ist denn los?» Er stand auf und kam hinter seinem Schreibtisch hervor.
«Ach, Papa», sagte ich. «Onkel Albert ist gestorben. Ich habe es gerade erfahren.»
Papa nahm die Nachricht vom Tod seines einzigen Bruders relativ gefasst auf. «Ach, du meine Güte», sagte er nur. «Albert.» Dann verstummte er und wirkte etwas ratlos. Er trat an eine der drei hohen Fenster mit den Eisenbalkonen und starrte eine Weile in den Regen. Ich zog meinen nassen Mantel aus und hängte ihn über den alten Heizkörper neben der Tür. Dann schaute ich wieder zu Papa hinüber, der immer noch schweigend am Fenster stand. Vielleicht dachte er gerade an seine Kindheit im Burgund, an die Tage, als er mit seinem älteren Bruder durch die Weinberge streifte, an die Zeit, bevor ihre Wege sich trennten und sie sich irgendwann überhaupt nicht mehr sahen. Ich wollte ihn nicht in seinen Gedanken stören, aber schließlich trat ich doch zu ihm und legte von hinten meine Hand auf seine Schulter.
«Es tut mir leid, Papa», sagte ich.
Er drehte sich zu mir um und sah mich mit schwer zu deutender Miene an. «Was? Nein, nein, es ist schon gut, Joséphine. Du weißt ja, Albert und ich standen uns nie besonders nahe. Wir hatten sehr … unterschiedliche Vorstellungen vom Leben. Es ist nur so … endgültig. Vielleicht hätte ich ihn doch mal besuchen sollen. Andererseits … Na, wie auch immer. Möge er in Frieden ruhen.»
Er schüttelte seufzend den Kopf. Dann ging er zur Tür, um Madame Martin mitzuteilen, dass sie im Moment keine Gespräche durchstellen sollte. «Wir haben einen Todesfall in der Familie», fügte er erklärend hinzu, und ich hörte einen bedauernden Laut aus dem Vorzimmer.
«Komm, setzen wir uns einen Moment», sagte Papa gefasst und steuerte die beigefarbene Polstergarnitur in der Ecke seines Büros an, in dem jeder Schritt durch den dicken blauen Teppichboden gedämpft wurde. «Woher weißt du … Ich meine, wie hast du es erfahren?»