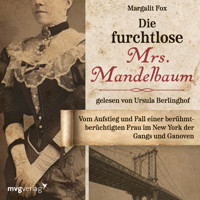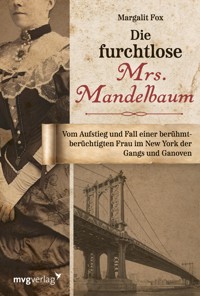
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: mvg Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 1850 erreicht die 25-jährige Fredericka Mandelbaum aus Kassel wie Zigtausende andere bettelarm und nur mit dem Traum von einem besseren Leben im Gepäck das gelobte New York. In den Straßen von Lower Manhattan schlägt sie sich anfangs als Hausiererin durch – 20 Jahre später ist Fredericka »Marm« Mandelbaum geschätztes Mitglied der New Yorker High Society. Wie hat sie es in dieser Zeit zu einer der einflussreichsten Frauen der Stadt gebracht? Margalit Fox zeichnet ein lebendiges Porträt einer außergewöhnlichen Frau, die sich mit Diebstahl, Raub und Hehlerei ein Imperium aufgebaut hat, an dessen Spitze sie als Drahtzieherin stand. Als eine der ersten »Unternehmerinnen« Amerikas führte sie einen Kader der gewieftesten Bankräuber, Einbrecher und Ladendiebe ihrer Zeit, organisierte die Logistik und Lieferketten – und schuf so mit organisierter Kriminalität ein rentables Business. Doch ihre Machenschaften flogen auf und sie wurde festgenommen. Ihre Freilassung gegen Kaution nutzte sie, um nach Kanada zu fliehen. Dieses Buch erzählt die atemberaubende wahre Geschichte vom Aufstieg und Fall einer furchtlosen Frau im New York des Gilded Age. Margalit Fox nimmt uns mit in eine Stadt der Gangs, voller ruchloser Schurken, Gauner und Opportunisten auf der Grenze zwischen der Unterwelt und legalem Business, in der eine junge deutsche Auswandererin zu Reichtum und Berühmtheit fand.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Margalit Fox
Die furchtlose Mrs Mandelbaum
Margalit Fox
Die furchtlose Mrs Mandelbaum
Vom Aufstieg und Fall einer berühmtberüchtigten Frau im New York der Gangs und Ganoven
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
1. Auflage 2025
© 2025 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Die englische Originalausgabe erschien 2024 bei Random House unter dem Titel The Talented Mrs. Mandelbaum. The rise and fall of an American organized-crime boss. © 2024 by Margalit Fox. All rights reserved.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Übersetzung: Elisabeth Liebl
Redaktion: Susanne von Ahn
Umschlaggestaltung: Sonja Stiefel
Umschlagabbildung: Adobe Stock/LiliGraphie/Andrey Kuzmin/Antonel/neirfy
Satz: Daniel Förster
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-7474-0453-9
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96121-845-5
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
wwww.mvg-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Für zwei bemerkenswerte Elizabeths:
Rogers und Lorris Ritter – meine New Yorker Mädels
Und für Teresa Elizabeth Williams
Inhalt
Vorwort: Eine schillernde Schar
I Der Aufstieg
1 »Das bloße Recht zu atmen«
2 Und keine weiteren Fragen
3 Frühstück bei Tiffany
II Hybris
4 Umbauarbeiten
5 Ocean’s Four
6 Büro für die Verhinderung von Verurteilungen
7 Wo das Geld herkam
III Nemesis
8 Streit unter Dieben
9 Der US-Diebesfänger vom Dienst
10 Der Maibaum und das Ei
11 Ein Streifen Seide
12 Richtung Nord-Nordwest
Nachwort: Kaddisch
Danksagung
Eine Anmerkung zu den Quellen
Bildnachweis
Bibliografie
Quellen
Über die Autorin
Vorwort: Eine schillernde Schar
New York, 22. Juli 1884
Diese Detektive hatten ja schon einiges gesehen, aber Diebesgut in einem Umfang wie hier war ihnen noch nie untergekommen.1
Es hatte eine Zeit gedauert, bis der Safe geöffnet war. Nachdem sie das Textilwarengeschäft an der Lower East Side in Manhattan gestürmt hatten, verlangten sie von der Ladenbesitzerin, Fredericka Mandelbaum, die Herausgabe der Safeschlüssel. Aber Mrs Mandelbaum, eine hochgewachsene Frau von 59 Jahren, die elegante Diamant-Ohrhänger trug und ein spitzenbesetztes Gewand mit blauen Tupfen2, dachte nicht im Mindesten daran, dieser Aufforderung nachzukommen: »Nein«, erklärte sie auf Englisch mit schwerem deutschen Akzent.3 »Kommt gar nicht infrage!«4
Angesichts ihrer Weigerung sahen sich die Detektive, Mitarbeiter der legendären Agentur Pinkerton, gezwungen, den Safe aufzubrechen. Sie ließen einen Schmied holen, der mit Hammer und Meißel ans Werk ging.5 Mitten unter den metallisch dröhnenden Schlägen kam ein hübsches Mädchen im Teenageralter gelaufen – Mrs Mandelbaums Tochter Annie.6
»Halt!«, rief Annie.7 Sie händigte den Detektiven die Schlüssel aus, und schon schwang die Safetür auf und gab den Blick frei auf Kostbarkeiten, die Aladins Schatzkammer alle Ehre gemacht hätten.8
Juwelen und Schmuck aller Art lagen hier verwahrt: Ringe, Ketten, Krawattennadeln, Armreifen, glitzernde Manschettenknöpfe und Kragenknöpfe – »beinahe jede Art von Schmuck, die man sich vorstellen kann«, erinnert sich einer der Detektive.9 Daneben »Berge von goldenen Uhren«10 sowie Uhrwerke und -gehäuse, die sorgfältig in Seidenpapier eingeschlagen waren. Und feinstes Tafelsilber, ja sogar lose Diamanten, groß wie Erbsen.11
An den Laden schlossen sich, der Zutritt versperrt durch ein Metallgitter, verborgene Hinterzimmer an, die durch Geheimgänge mit der Außenwelt verbunden waren. In diesen Räumen entdeckten die Detektive unbezahlbare antike Möbel, eine Truhe, randvoll gefüllt mit Tuch aus feinstem Kaschmir, Vorhängen aus exquisiter Spitze und ballenweise Seide. Letztere hatte allein einen Wert von mehreren Tausend Dollar.12 Versteckt unter Zeitungen lagen Goldbarren aus eingeschmolzenem Schmuck.13 Oben, in Mrs Mandelbaums elegantem Schlafzimmer, fanden sich Waagen für Gold und Edelsteine sowie Schmelztiegel.14 Sie und eine Angestellte wurden auf der Stelle verhaftet.
Damit war den Pinkerton-Detektiven, die im Auftrag des Staatsanwalts von New York handelten, auf einen Schlag gelungen, was die Polizeikräfte von New York15 in mehr als 20 Jahren nicht geschafft hatten.16 »Dieses Mal hat man Sie erwischt, und das Beste, was Sie tun können, ist, reinen Tisch zu machen«, riet Gustave Frank, einer der Pinkerton-Detektive, Mrs Mandelbaum, während man sie wegbrachte.17
Fredericka Mandelbaum – eine aufrechte Witwe, Wohltäterin und Synagogenbesucherin, hingebungsvolle Mutter von vier Kindern und Chefin des berüchtigtsten Verbrechersyndikates der USA – drehte sich um und versetzte dem Mann einen Faustschlag ins Gesicht.18
25 Jahre lang dauerte die Herrschaft von Fredericka Mandelbaum, einer der berüchtigtsten Unterweltgestalten Amerikas. Von ihrem Büro in dem unscheinbaren Textilwarenladen leitete sie ein mehrere Millionen Dollar schweres Unternehmen, das sich zunächst auf den Diebstahl von Luxusgütern spezialisierte. Die Diversifikation auf Bankraub erfolgte später. Ihr Imperium gründete sie Mitte des 19. Jahrhunderts – lange bevor man in den USA von organisiertem Verbrechen sprach. Es erstreckte sich über das ganze Land und über seine Grenzen hinaus.19 1884 nannte die New-York Times20 sie »Kern und Mittelpunkt des organisierten Verbrechens in New-York«.21
Eine Bildmontage, die Mrs Mandelbaums unrechtmäßig erworbene Schätze zeigt, die Razzia in ihrem Laden sowie das anschließende Gerichtsdrama. Bildmaterial aus der National Police Gazette von 1884, einem Skandalblatt vom Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts
Marm Mandelbaum, wie sie genannt wurde, wurde in vielen Vierteln der Stadt verehrt ob ihrer bodenständigen, beeindruckenden, diamantenfunkelnden Präsenz: Selfmade-Unternehmerin, gütige Wohltäterin, Mentorin von Dieben und großzügige Gastgeberin für die feine Gesellschaft, die sich kaum die Mühe machte, ihre illegale Geschäftstätigkeit zu verbergen. Ein großer Teil der Öffentlichkeit bewunderte sie. Viele Kriminelle verehrten sie geradezu. Im Laufe ihrer ebenso langen wie einträglichen Karriere verbrachte sie kaum je einen Tag hinter Gittern.22 »Zweifelsohne«, schreibt ein Kriminologe im 20. Jahrhundert, »ist es ›Ma‹ Mandelbaum, die in der Literatur der Kriminologie den Ehrenplatz für Tatkraft, Präsenz und persönliches Charisma einnimmt.«23
Für Mrs Mandelbaum war der Handel mit dem Eigentum anderer Leute einfach nur ein unglaublich lukratives Geschäft: Ihr Netzwerk aus Dieben und Hehlern soll sich über die ganzen Vereinigten Staaten erstreckt haben, bis nach Mexiko hinein und – so hieß es – sogar nach Europa.24 Bei ihrem Tod 1894 hatte sie ein Privatvermögen25 von mindestens einer halben Million Dollar angehäuft. (Manche gehen sogar von einer Million aus.)26 Was in heutiger Kaufkraft einem Betrag zwischen 14 und 28 Millionen Dollar entspricht.27 Der New Yorker Polizeichef Washington Walling28, der sie gut kannte, erinnert sich: »Ihr Geschäft war so weit verzweigt und ihr Instinkt als Helfershelferin von Kriminellen so genial, dass bei einem Seidendiebstahl in St. Louis, bei dem die Diebe zu ›Marm Baum‹ gehörten, sie immer die erste Wahl hatte, was die Beute anging.«29
Während ihrer Glanzzeit und auch noch einige Jahre hinterher war Marm eine sagenumwobene Gestalt, die in Zeitschriften porträtiert wurde, in den Cartoons der Zeitungen und in mehr als einem Bühnenstück.30 Die Welt zollte ihrem kriminellen Talent eine gewisse widerwillige Bewunderung. Die Geschichte ihres Endes wurde dagegen hinterher mit einiger Selbstgefälligkeit erzählt.31 Aber trotz ihres damaligen Ruhmes ist Ma Mandelbaum heute weitgehend in Vergessenheit geraten, ein nur zu häufiges Schicksal geschichtsträchtiger Frauen. In den Büchern über die Geschichte New Yorks wird Mrs Mandelbaum zwar gelegentlich erwähnt32, aber es gibt nur wenige tiefer gehende Untersuchungen zu ihrem Leben und Werk.33
Marm hat uns keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen: Da sie alles andere als dumm war, wusste sie nur zu gut, dass dies professioneller Selbstmord gewesen wäre. Oder wie Polizeichef Walling meint: »Sie war gewitzt und vorsichtig, methodisch von ihrem Naturell her und sehr präzise in ihrer Wortwahl … geradezu furchteinflößend.«34 Allerdings ist ihre Laufbahn durch zahlreiche Quellen dokumentiert, nicht nur durch die Nachrichtenblätter jener Tage, sondern auch durch die Erinnerungen ihrer Zeitgenossen auf beiden Seiten des Gesetzes. Und so lässt sich ihr Bild aus der glitzernden Stadt des 19. Jahrhunderts wieder zum Leben erwecken – der gefürchtete Stern eines urbanen Schelmenromans, in dem Taschendiebe, Gelegenheitsdiebe, Bankräuber und großtönende Rechtsverdreher die Hauptrollen spielen. Und ihre schillernde Präsenz ist zugleich ein Spiegelbild dieses New York: eine offene Stadt, die sich durch das »Flash Age«35 schlug, eine Zeit, in der ein besonders betuchter Politiker das Mantra prägte, das so vielen New Yorkern zum Motto werden sollte: »Ich habe meine Chance gesehen und sie beim Schopf gepackt.«36
Wenn man im 21. Jahrhundert in den USA über das »organisierte Verbrechen« spricht, dann denkt man meist an die Zeit der Prohibition, an das »Knarren-und-Knoblauch«-Gangstertum37 aus Filmen wie Scarface und The Untouchables.38 Tatsächlich aber wurde der Begriff in den Vereinigten Staaten erstmals in den 1890er-Jahren verwendet39, und wie Mrs Mandelbaums Karriere verdeutlicht, war diese Form der Kriminalität schon vorher ein Problem, in Europa sogar noch früher.40
Anders als das organisierte Verbrechen des Maschinenpistolenzeitalters operierte Fredericka Mandelbaums Geschäftszweig kaum mit Gewalt. Sie war von Anfang an Spezialistin für Eigentumsdelikte, denn sie erwarb eine Fülle von gestohlenen Luxusgütern, um sie umzuarbeiten und mit Gewinn weiterzuverkaufen. Ihr Aufstieg begann in den späten 1850ern, aber sie erwarb sich schnell einen guten Ruf als Ankäuferin kriminell erworbener Güter – als »fence«, wie man die Hehler im Allgemeinen nannte. Natürlich hatte es schon vor Marm Mandelbaum Vertreter des Schattenhandels gegeben, und sicher auch unzählige nach ihr. Doch was sie auf die Beine stellte, hatte in den USA bis dato noch niemand geschafft, zumindest nicht so breit gefächert und auf so nachhaltige und methodische Art: Fredericka Mandelbaum verwandelte sich, fast im Alleingang, zu einer »Mogulin des illegitimen Kapitalismus«.41 Sie führte ihren Betrieb wie ein gut geöltes, profitorientiertes Unternehmen. Erstaunlicherweise gelang ihr das mehr als ein halbes Jahrhundert vor den Verbrechersyndikaten der Prohibitionsära, die heute in der Popkultur so gefeiert werden. Ein Milieu, in dem Frauen, wenn sie denn überhaupt vorkommen, selten mehr sind als Gangsterbräute.
»Verbrechen können nicht im Alleingang durchgeführt werden«, schrieb ein langjähriges Mitglied des Mandelbaum-Syndikats 1913. »Dies erfordert vielmehr eine ausgeklügelte und stabile Organisation. Da die einzelnen Akteure wie Taschendiebe oder Bankräuber kommen und gehen, da sie bei ihrer Tätigkeit von einer Küste zur anderen wechseln, müssen sie dauerhaft eine bedeutsame Gestalt an ihrer Seite haben […] So eine konstante Größe war ›Mother‹ Mandelbaum.«42
Die Zeitungen vom ausgehenden 19. Jahrhundert schwelgten nur so in den Schilderungen von Marms’ Geschäftstätigkeiten. Es hieß, sie könne schlicht alles »losschlagen«, in einem Fall war dies sogar eine Herde gestohlener Schafe.43 Unbestritten ist die Tatsache, dass bis zur Mitte der 1880er-Jahre Waren im Wert von mehr als zehn Millionen Dollar44 durch ihren Textilwarenladen an der Lower East Side gegangen waren. Die ganze Geschichte ihres Aufstiegs zum Star der Unterwelt als »unbestrittene Geldgeberin, Chefin, Beraterin und Freundin der Kriminellen in New York«45 – und ihr endgültiger Fall durch die Hände der immer mächtiger werdenden bürgerlichen Elite der Stadt – ist ein Fenster, das uns Einblick erlaubt in eine bisher wenig erforschte Seite des Gilded Age in den USA: in die Welt von Herbert Asburys Gangs of New York aus der Perspektive einer scharfsinnigen und absolut entschlossenen Frau.46
Manche modernen Beobachter haben Mrs Mandelbaum als Protofeministin bezeichnet.47 Vielleicht war sie das auch, obwohl sie ihre Pflichten als Frau und Mutter genauso ernst nahm wie jede Frau ihrer Zeit. Mit Sicherheit kann man sagen, dass sie unter den Ersten – wenn nicht sogar die Erste – war, die die meist planlos begangenen Eigentumsdelikte durchorganisierte, eine Logistik entwickelte, eine Kette von Angebot und Nachfrage schuf und das ganze Unterfangen zuallererst als Geschäft betrachtete. Auf diese Weise verkörperte sie einerseits das Narrativ des viktorianischen Amerika, dass der Schuhputzer es tatsächlich zum Millionär bringen konnte, während sie es gleichzeitig auf den Kopf stellte.48 Sie wurde auf ihre Art zur Heldin eines ganz eigenen Groschenromans nach umgekehrtem Horatio-Alger-Modell: wie man unehrlich zu Reichtum kommen kann.
Als Fredericka Mandelbaum 1850 in New York ankam, hatte sie wenig mehr bei sich als die Kleider, die sie am Leib trug. Ihr Arbeitsleben begann sie als fliegende Händlerin auf den Straßen von Lower Manhattan. Berufliches Vorwärtskommen, geschweige denn Reichtum, schien für jemanden wie sie außer Reichweite. Schließlich war sie gleich dreifach benachteiligt: als Einwanderin, Frau und Jüdin. (Das organisierte Verbrechen ist, wie ein Autor des 20. Jahrhunderts so treffend bemerkt, »kein Arbeitgeber, dem Chancengleichheit ein Anliegen wäre«.)49 Doch noch ehe ein Jahrzehnt verstrichen war, hatte sie sich als eine der umsatzstärksten Aufkäuferinnen gestohlener Waren in New York etabliert. Und gegen Ende der 1860er-Jahre war sie – um eine aktuelle Schlagzeile zu wiederholen – »New Yorks erster weiblicher Unterweltboss«.50
Zwar ging Mrs Mandelbaum selbst kaum einmal auf Diebestour.51 Aber sie schmiedete einen Kader von Gefolgsleuten und zeigte ihnen, wie sie an ausgewählte Beutestücke des Gilded Age herankommen konnten – was natürlich auch ihr zugutekam. Sie orchestrierte jahrzehntelang High-End-Diebstähle, wählte für jede Aufgabe die besten Männer und Frauen aus, kam für deren Kosten auf und lehrte sie, ganz im Geiste einer Best-Practice-Schulung, die Kniffe des Metiers: warum es für einen Dieb das Klügste ist, sich auf Diamanten und Seide zu spezialisieren; warum es sinnvoll ist, einen Kaugummi im Mund zu haben, wenn man in einen Laden wie Tiffany & Company einstieg; was man trug, wenn man erfolgreich sein wollte – wobei Erfolg hieß, Luxusgüter aus Kaufhäusern zu entwenden; und schließlich auch, wie man eine Bank ausraubt.
»Welch große Raubzüge wurden dort geplant, in Madame Mandelbaums Laden!«, schwärmte ein Gauner von den alten Zeiten.52 »Sie kaufte alle gestohlenen Güter, von der Straußenfeder bis hin zu Edelsteinen, die Hunderte, ja Tausende Dollar wert waren. Der gewöhnliche Ladendieb und der große Cracksman53, alle tätigten sie ihre Geschäfte an diesem bekannten Ort.«
Wann immer ihre Eleven festgenommen wurden, bezahlte Mrs Mandelbaum die Kaution. Sie bewirtete sie fürstlich an ihrer langen Tafel, streckte ihnen Geld vor, wenn sie blank waren, und sorgte nötigenfalls für Fluchtpferde oder -kutschen. Aufgrund ihrer mütterlichen Fürsorge für ihre handverlesene Phalanx von Fußsoldaten – ihre chicks (Küken)54, wie sie sie nannte – nannten Kriminelle ebenso wie Journalisten sie »Marm«, »Mother«, »Ma« oder »Mother Baum«.
»Ich glaube, an der Ecke zwischen der Clinton und Rivington Street steht immer noch ein kleines […] Haus, das viele Jahre lang das Hauptquartier einiger der größten Verbrecher unseres Landes war. Ein Haus, in dem viele der kühnsten Raubzüge jener Zeit geplant wurden«, schrieb ein amerikanischer Journalist 1921.55 Und fuhr fort:
Im Erdgeschoss diente der vordere Teil des Hauses als Laden für allerlei Textilwaren, doch schon im Salon fanden sich Möbel und Tafelsilber von einer Qualität, die man in diesem Teil der Stadt nur selten zu sehen bekam. In diesem Raum tätigte »Mother Mandelbaum«, wie sie von mehr als einer Generation von Gaunern liebevoll genannt wurde, ihre Geschäfte […]
Ihr Firmensitz [war] der Markt, wo man Juwelen, Seidenballen, Tafelsilber und andere Luxusgegenstände für die Hälfte ihres Werts erstehen konnte. Dabei nahm die alte Lady alle Risiken der Transaktion auf sich […] Sie sah aus, als wäre sie soeben einem Wiener Witzblatt entstiegen, und doch war sie eher ein weiblicher Moriarty, denn sie konnte Raubzüge planen, die dafür nötigen Mittel vorstrecken und sogar die Leute aussuchen, die sich für diese Aufgabe am besten eigneten.56
Wenn dies keine lehrbuchmäßige Definition für einen Boss des organisierten Verbrechens ist, dann weiß ich auch nicht57 …
Mother Mandelbaum hätte wohl in jedem Zeitalter eine imposante Figur abgegeben, aber zu ihrer Zeit überragte sie das New Yorker Leben förmlich. Sie war mehr als 1,80 Meter groß und besaß eine Leibesfülle, die eines Falstaff würdig gewesen wäre.58 (Man sagt, sie hätte zwischen 250 und 300 Pfund auf die Waage gebracht.)59 Ihr rundes Gesicht mit den Apfelbäckchen, den Tränensäcken und den dichten Brauen sorgte dafür, dass sie daherkam wie ein Mittelding zwischen Knödel und Bergkegel. Sie kleidete sich nüchtern, aber teuer, in weite Gewänder aus schwarzer, brauner oder dunkelblauer Seide.60 Dazu kamen ein Cape aus Seehundfell und ein Kopfschmuck oder eine Haube mit Feder. Was die Diamanten anging, war sie eher für Klotzen statt Kleckern: Ohrringe, Ketten, Broschen, Armreifen, Ringe. Andererseits waren Diamanten dank ihrer Geschäftsverbindungen ja leicht zu haben, ebenso wie die Straußenfedern, die fröhlich wippend ihre Hüte schmückten. »Ihr Aufzug war gleichzeitig prachtvoll und vulgär«, schrieb der Cincinnati Enquirer 1894. »Sie trug mitunter Juwelen für 40 000 Dollar am Leib.«61
Mrs Mandelbaum lebte über dem Laden, aber das Erdgeschoss ihres schindelverkleideten Hauses mit dem unauffälligen öffentlichen Verkaufsraum ließ das Neue-Welt-Versailles im Obergeschoß nicht erahnen.62 Ein Blick auf eine ihrer berühmten Dinnerpartys63 – kein bisschen weniger prunkvoll als die Bälle, die Mrs Astor, die Grande Dame der New Yorker Gesellschaft, im Villenviertel gab – macht deutlich, wieso:
In Mrs Mandelbaums Wohnung bewirtete eine große Dienerschar die Gäste mit Lamm und kredenzte exzellente Weine aus ihrem ausgesucht kostbaren Weinkeller. Marm selbst saß, in Seide und Juwelen gekleidet, am Kopfende des gewaltigen Esstisches aus Mahagoni auf einer bestickten Ottomane und machte Konversation. Auf einer Seite des Tisches saßen im vollen Abendornat einige der vornehmsten Mitglieder der New Yorker Gesellschaft, die führenden Köpfe von Handel und Industrie.64 Auf der anderen Seite, ebenfalls im Black-Tie-Outfit, fand sich die Crème de la Crème des Verbrechens: Adam Worth, ein Meisterdieb, der sein Handwerk an Mrs Mandelbaums Seite erlernte; der Virtuose des Bankraubs George Leonidas Leslie, die hübsche, langfingrige Sophie Lyons, die sich unter Marms Einfluss zur »vermutlich gefährlichsten Trickbetrügerin entwickelte, die Amerika je hervorgebracht hat«; und Sophies Ehemann, der Bankräuber Ned Lyons, der sich auf einer von Marms Partys in Sophie verliebte, nachdem sie ihm eine goldene Uhr und eine schicke Krawattennadel geschenkt hatte, die sie gerade einem anderen Gast abgenommen hatte.65 In einer Ecke saß »Piano Charly« Bullard an Marms weißem Stutzflügel und spielte Beethoven. Er war ausgebildeter Musiker, nutzte seine Fingerfertigkeit aber auch mal zum Safeknacken.
Fredericka Mandelbaum mit zeittypischem Kopfputz in der Illustration eines Wochenblatts
Marms Tafel war über die volle Länge mit goldenen Kerzenleuchtern geschmückt und mit feinstem Porzellan beziehungsweise Kristall gedeckt. Das Silberzeug »wäre eindeutig als ›A plus‹ eingestuft worden66, hätte ein ›Klient‹ der alten Dame sie um den Verkauf gebeten«, erinnert sich ein gut informierter Besucher. Die Fenster waren mit üppigen Seidenvorhängen drapiert, die Mahagonimöbel waren viktorianisch verschnörkelt und hätten sicher »die Habsucht des ein oder anderen Antiquars geweckt«.67 Auf den Böden lagen dicke Teppiche in Rot und Gold. An den Wänden hingen dicht an dicht seltene alte Gemälde und an der Kassettendecke Kristallleuchter.68 »Über den ganzen Raum verteilt«, heißt es in einer Zeitung, »finden sich Bronzen und Nippes, deren Preis weit über das hinausgeht, was sich ein Normalsterblicher würde leisten können.«69 Einige von Marms Möbeln sahen verdächtig aus wie jene, die ihren blaublütigen Gästen aus dem Villenviertel abhandengekommen waren […] aber wer konnte dies im Zeitalter der Massenproduktion schon mit Sicherheit behaupten?70 Und wie einer der Gäste sich erinnert: Der ganze Abend wurde »mit demselben Augenmerk auf die Regeln des gesellschaftlichen Anstands geplant, als fände Mrs Mandelbaums Salon in der Fifth Avenue statt und nicht in einer höchst zweifelhaften Ecke der East Side«71.
Sophie und Ned Lyons, aus einem Verbrecheralbum des 19. Jahrhunderts
Mrs Mandelbaum, ganz rechts außen, führt den Vorsitz über eine ihrer berühmten Dinnerpartys. Die Frau im Vordergrund, zweite von links, stellt mit einiger Sicherheit Marms Schützling Sophie Lyons dar.
Das Bemerkenswerteste an Marms Geschäftstätigkeit aber war, dass sie diese beinahe ungestraft über Jahrzehnte fortsetzen konnte: Bis zu ihrem Sturz im Jahr 1884 hatte sie nicht einen einzigen Tag im Gefängnis verbracht.72 »Der Polizei von New York war es nie gelungen, Mother Mandelbaum festzunehmen«, schrieb der Brooklyn Daily Eagle im selben Jahr. »Jeder beliebige Bürger konnte in ihren Laden gehen und ihr zusehen, wie sie ihren Geschäften nachging. Und doch waren gut 2500 Polizisten, das kostspielige Detective Department und die riesige Maschinerie der Polizeikräfte nicht in der Lage, sie zu verhaften.«73
Dass Ma Mandelbaum sich dem Zugriff des Gesetzes so lange Zeit entziehen konnte, hatte zwei Gründe. Erstens hatte sie zwei der übelsten Winkeladvokaten, die die amerikanische Justiz je hervorgebracht hatte, fest auf ihrer Lohnliste.74 Den zweiten und gewichtigeren Grund aber enthüllt ein Blick auf die Gäste ihrer Abendgesellschaften. Denn da saßen auf Marms geschnitzten Mahagonistühlen, lachend, schmausend und Wein trinkend neben den Wirtschaftsbossen, den Schwindlern und den Ladendieben doch die …
Aber nein, wir wollen doch nicht vorgreifen.
I
Der Aufstieg
1
»Das bloße Recht zu atmen«
Bei ihrer Ankunft in Amerika besaß sie rein gar nichts.
Als eines der sieben Kinder1 von Samuel Abraham Weisner2 und Rahel Lea Weisner, geborene Solling, wurde Fredericka Henriette Auguste Weisner3 am 28. März 18254 in Kassel, in der heutigen Mitte Deutschlands5, geboren. Ihre Familie, in der es vermutlich auch fliegende Händler gab6, gehörte über Generationen zur jüdischen Gemeinde der Region, die damals bei einer Gesamtbevölkerung von knapp über einer halben Million Menschen 14 000 oder 15 000 Mitglieder7 umfasste.
Die Juden hatten dort kein leichtes Leben. Restriktive Gesetze8 in vielen der damaligen deutschen Staaten schrieben vor, welchem Gewerbe sie nachgehen und wo sie leben durften, und folglich auch, wen sie heiraten konnten9. Oft wurden Juden Opfer physischer Gewalt seitens ihrer nichtjüdischen Mitmenschen: Manche von ihnen bezahlten sogar Schutzgeld, um mit ihren Familien in Sicherheit leben zu können.10
»Die Juden hatten einen eigenen, untergeordneten Status«, liest man in einem Geschichtsbuch des 20. Jahrhunderts. Von wenigen, die sich der Unterstützung christlicher Herrscher oder Adliger sicher sein konnten, lebten die Juden in Zentraleuropa demnach weiterhin in den Traditionen ihrer Vorfahren, die über Jahrhunderte hinweg geprägt waren. Sie seien meist fromm gewesen und gehörten oft zu den ärmeren Schichten, oft als ›Dorfjuden‹ bezeichnet. Da ihnen landwirtschaftliche Tätigkeiten, die in Zünften organisierten Handwerke und andere stabilere sowie einträglichere Berufe traditionell verwehrt waren, verdienten sie ihren Lebensunterhalt oft nur mühsam als kleine Händler, unbedeutende Geldverleiher oder als einfache Handwerker in Bereichen wie der Schneiderei.11
Als Mädchen dürfte Fredericka zu Hause oder in einer örtlichen jüdischen Grundschule12 Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt haben. Auch Kinderpflege und häusliche Fertigkeiten wie Nähen, Spinnen, Stricken, Klöppeln, Waschen und Kochen gehörten damals zur Grundausbildung jüdischer Mädchen.13 »Welches auch immer die genauen Lebensumstände waren«, schreibt die Historikerin Rona L. Holub, »sie entwickelte einen scharfen Verstand, eine starke Arbeitsmoral und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.«14
1848 heiratete Fredericka Wolf Israel Mandelbaum15, einen fliegenden Händler, der ein paar Jahre älter16 war als sie. Wolf war jede Woche unterwegs, um auf dem Land von Tür zu Tür zu gehen, wahrscheinlich in Begleitung von Fredericka17. Rechtzeitig für den Beginn des Sabbath kam er am Freitagabend nach Hause zurück. Sei es aus eigener Erfahrung oder einfach, weil sie Einblick in die Tätigkeiten ihres Mannes hatte, erlangte Mrs Mandelbaum ein gründliches Verständnis für die Techniken der Verkaufskunst. Diese würden ihrer Karriere in der Unterwelt später überaus förderlich sein.
Als 1849 das erste Kind der Mandelbaums, Breine (auch Bertha oder Bessy genannt), geboren wurde18, bedeutete das eine zusätzliche Belastung für die ohnehin schon prekäre Finanzlage der Familie. Die Region steckte mitten in einer Wirtschaftskrise19 und wurde von der Kartoffelfäule20 heimgesucht. 1850 schlossen sich die Mandelbaums den Tausenden europäischer Juden21 an, die auf der Suche nach einem finanziell besseren Leben nach Amerika auswanderten22: Manche Deutsche nannten die Vereinigten Staaten »das Dollarland«.23 Zuerst brach Wolf auf24, der auf dem Landweg nach Amsterdam gelangte und sich dort auf der Baltimore einschiffte. Er kam im Juli 1850 in New York an. Fredericka reiste mit der kleinen Bertha nach Bremen und ging dort an Bord des Segelschiffs Erie.25
Die Überquerung des Atlantiks dauerte mindestens sechs Wochen26 und war schon für die Passagiere der ersten Klasse, die ungefähr 140 US-Dollar27 für eine Kabine bezahlten28, anstrengend genug. Mrs Mandelbaum reiste im Zwischendeck. Sie bezahlte29 20 Dollar30, um zusammengepfercht mit unzähligen anderen Immigranten in einem schlecht belüfteten, niedrigen Raum unter Deck zu hausen.31 Für die Eigentümer der Schifffahrtslinien ein äußerst lukratives Geschäft.32 Die Passagiere im Zwischendeck mussten sich mit karger Kost begnügen. Sie schliefen in engen Kojen, die Herman Melville so beschrieb: »drei übereinander […], aus rohen Planken eilig zusammengeschlagen.« Und er fügte hinzu: »Diese Kojen […] sahen mehr wie Hundezwinger aus als sonst etwas.«33
Im September 185034 ging Fredericka im Hafen von New York von Bord. Damals umfasste »New York City« ein weitaus bescheideneres Gebiet als ein halbes Jahrhundert später: Es bestand letztlich nur aus Manhattan35 und hatte etwas mehr als eine halbe Million Einwohner.36 Die City, die sich seit der Kolonialzeit langsam Richtung Norden ausgedehnt hatte, war um 1850 noch ungefähr drei Meilen von Manhattans Südspitze entfernt. Der Großteil der Bevölkerung lebte unterhalb der Fourteenth Street.37 Oberhalb hatte die Insel teilweise ihren ländlichen Charakter behalten.
Von der Fourteenth Street hinunter bis zur Battery auf der Südspitze Manhattans pulsierte die Stadt voller Leben.38 Auf den Gehsteigen wimmelte es von Fußgängern. Handkarren und Pferdegespanne aller Art – Wagen, Kutschen, Straßenbahnen, Busse, Leichenwagen – bevölkerten die Straßen. Am Hafen herrschte ein Kommen und Gehen von Schiffen und Frachtkähnen. An der Lower East Side, wo sich die Mandelbaums niederließen, waren die Verhältnisse besonders beengt. Slumartige Mietskasernen drängten sich zwischen Industriegebäude wie Fabriken, Gießereien oder Schlachthäuser.39 Zwar nahmen sicher nur wenige Migranten die Redensart, die Straßen der Neuen Welt seien mit Gold gepflastert, für bare Münze.40 Aber sicher waren sie nicht auf das Bild vorbereitet, das sich ihren Augen letztlich bot: Die Straßen waren übersät von Unrat41 und Kot, an dem sich umherstreifende Schweine gütlich taten. Abwasserkanäle flossen über. Die Kadaver zu Tode geschundener Pferde lagen herum, und Schwärme von Fliegen machten sich über sie her. Wie Charles Dickens nach einem Besuch in Amerika 1842 trocken bemerkte, war New York »keineswegs eine so saubere Stadt wie Boston«.42
Lesen wir Dickens’ Bericht über seinen Rundgang durch Five Points43, das Viertel in der Lower East Side, das ein moderner Historiker als »das berüchtigtste Elendsviertel der Welt« bezeichnete.44 Bei seiner Besichtigung der Gegend (die er sicherheitshalber in Begleitung von zwei Polizisten unternahm)45 schauderte Dickens mit viktorianisch-bürgerlicher Abscheu zurück. Heute würden wir sagen, er machte eine Slum-Tour wie die voyeuristischen Rundgänge,46 die die gut situierten New Yorker seit den 1830er-Jahren unternahmen und die nach dem Erscheinen von Dickens’ Schilderung noch populärer wurden. Aber mal abgesehen von Dickens’ tiefem Unbehagen angesichts der unzähligen Bordelle47 dort – und der unbekümmerten sozialen Durchmischung48 seiner weißen und afroamerikanischen Bewohner – war die geschilderte Armut äußerst real. So seien die engen Gassen von Unrat durchzogen gewesen, die Häuser »vor der Zeit gealtert«, die Balken einsturzgefährdet, und die kaputten Fensterscheiben würden einen finsteren Eindruck hinterlassen, gar wie Augen, »die in Prügelei braun und blau geschlagen« worden seien.
Zwischen wankenden Treppen, in schmutzigen Straßen beschreibt Dickens eine »Art Square von aussätzigen Häusern«, einen Stadtteil mit Gässchen mit »knietiefem Kot«, voll unterirdischer Räume, »wo getanzt und gespielt wird« [...], »scheußliche Wohnungen, die ihren Namen von Raub und Mord herleiten«. Kurz gesagt: Alles, »was ekelhaft, widrig und verworfen ist«, sehe man hier.49
Die Mandelbaums fanden eine Unterkunft in Kleindeutschland (Little Germany), einer Einwanderer-Enklave an der Lower East Side, die sich ungefähr über eine Quadratmeile erstreckte50 und die den 10., 11., 13. und 17. Ward51 der Stadt umfasste.52 Das Ehepaar lebte während der ersten zehneinhalb Jahre in der Stadt an verschiedenen Adressen, unter anderem an der East Eight Street 38353, in einem Mietshaus zwischen der C und D Avenue im 11. Ward und in der East Sixth Street 141 in der Nähe der Bowery im 17. Ward54, bevor es sich Mitte der 1860er-Jahre dauerhaft im 13. Ward niederließ.55
Die Wards von New York City um 1850
In den Mietskasernen – dunklen, instabilen und schlecht belüfteten Gebäuden – lebten manchmal 20 oder mehr Familien in einem einzigen kleinen Wohnhaus.56
Es gab kein fließendes Wasser57: Die Bewohner holten Wasser an Pumpen auf der Straße und schafften es die Treppen hoch. Sie erleichterten sich auf schäbigen hölzernen Plumpsklos in den Hinterhöfen. Ein Historiker berichtete, dass moderne Sanitäranlagen die Toiletten unter freiem Himmel mit den Kanälen für Abwasser verbänden, sodass der Unrat direkt vom Haus wegbefördert würde. Das sei aber nur auf ein einziges Viertel beschränkt gewesen, anderenorts sah es anders aus: Dort »faulte oft wochen- und monatelang in den Hinterhöfen der Mietskasernen« Abwasser vor sich hin.58
In diesen beengten und unhygienischen Verhältnissen grassierten allerlei Krankheiten wie Schwindsucht, Typhus, Ruhr, Diphterie und Scharlach.59 Unter den Einwandererfamilien war die Sterblichkeitsrate bei Säuglingen und Kindern besonders hoch.60 Und tatsächlich fällt schmerzlich auf, dass der Name der kleinen Bertha Mandelbaum in den Volkszählungsregistern der Zeit nirgends zu finden ist61: Wahrscheinlich fiel auch sie einer dieser Krankheiten zum Opfer.62
Trotz aller Entbehrungen bot Kleindeutschland – die erste der großen fremdsprachigen Siedlungen im Land63 – seinen Bewohnern Verbesserungen. So bezeichnet eine Historikerin diesen Teil als »die dritte Hauptstadt der deutschsprachigen Welt«. Zwischen 1855 und 1880 hatten demnach nur Wien und Berlin eine größere deutsche Bevölkerung.64 Nur Wien und Berlin hatten zwischen 1855 und 1880 mehr deutsche Einwohner. Bei der Gründung des Deutschen Reiches im Jahr 1871 hätte das New Yorker Viertel Kleindeutschland allein die fünftgrößte Stadt des Reiches dargestellt.
Die Mandelbaums konnten dort Seite an Seite mit ihren Landsleuten – sowohl Juden als auch Nichtjuden – arbeiten, einkaufen und ein geselliges Leben führen. Es gab deutschsprachige Theateraufführungen, Trachtenumzüge, in den Biergärten des Viertels wurde gesungen und getanzt.65 Sie konnten den ganzen Tag über ausschließlich Deutsch sprechen, auch wenn zumindest Fredericka Englisch beherrschte.66 »Unser Haus«67 wurde Kleindeutschland von einem seiner Bewohner genannt. In diesem Viertel würde Fredericka Mandelbaum für den Rest ihres Lebens zu Hause sein. Sie verließ es erst drei Jahrzehnte später mit größtem Widerstreben, als ihr die Rechnung für ihre Karriere präsentiert wurde und ihr keine andere Wahl blieb.68
Das Haus von Mrs Mandelbaum
Für Einwanderer im New York des 19. Jahrhunderts waren die Beschäftigungsmöglichkeiten äußerst beschränkt. Oft fand sich nur eine illegale und gefährliche Arbeit als Handlanger, Ausbeutung war an der Tagesordnung.69 Männer wurden etwa angeheuert, um Gräben auszuheben, Ziegelsteine und Mörtel zu tragen oder an den Anlegestellen im Hafen der Stadt Frachtgut zu be- und entladen. Sicherheitsmaßnahmen waren alles andere als selbstverständlich: Die Arbeiter riskierten, von Baustellen zu stürzen oder von außer Kontrolle geratenen Frachtgütern erdrückt zu werden.70 Sie wurden mit Stundenlohn oder pro Tag bezahlt, und wenn die Arbeit aufgrund von Kälte oder Regen ausfiel, kamen sie mit leeren Händen nach Hause.71
Manche deutschen Männer blieben beim Handwerk, das sie in der alten Heimat betrieben hatten. Sie arbeiteten als Metzger, Bäcker, Brauer, Lebensmittelhändler, Schuster, Schneider oder Zigarrenhersteller.72 Aber sogar für diejenigen, die einer regelmäßigen Arbeit nachgehen konnten, war der Ertrag mager. Viele Händler waren gezwungen, in den feuchten, unhygienischen Kellerräumen der Mietskasernen zu arbeiten. 1945 zum Beispiel berichtete die New-York Daily Tribune im Rahmen einer Reihe von Artikeln über die Arbeitsbedingungen in der Stadt auch über das Leben der eingewanderten Schuster:
Es gibt keine andere Handwerkerklasse in New York, die durchschnittlich so viel für so wenig Geld arbeitet, wie die Schuhmacher, die sich als Tagelöhner verdingen. Die Zahl der arbeitslosen Tagelöhner ist ebenfalls unverhältnismäßig hoch. In der Stadt gehen Hunderte von ihnen auf der Suche nach Arbeit von Geschäft zu Geschäft, und oft leben ihre Familien in größter Not. Nach und nach haben sie ihre ganze Einrichtung verkauft, um das Brot zu bezahlen, das der entmutigte Handwerker nicht verdienen konnte. Zu guter Letzt jagt man sie aus ihrer elenden Dachkammer oder ihrem Keller, weil sie die Miete nicht mehr bezahlen können. Selbst denjenigen, die arbeiten, geht es schlecht genug. Viele von ihnen entbehren alles im Leben außer das bloße Recht, zu atmen …
Wir waren in mehr als 50 Kellern in verschiedenen Stadtteilen, die jeweils von einem Schuhmacher und seiner Familie bewohnt wurden. Der Boden besteht aus rohen, losen Brettern, die Decke ist nicht ganz so hoch wie ein großer Mann. Die Wände sind dunkel und feucht. […] Es gibt keinen Ausgang nach hinten und natürlich auch keinerlei Hofprivilegien [d. h. Außentoilette]. […] In dieser Behausung leben oft der Mann mit seiner Werkbank, seine Frau und fünf oder sechs Kinder jeden Alters, vielleicht auch noch ein gelähmter Großvater oder eine gelähmte Großmutter und oft sogar beides. In einer Ecke steht ein armseliges Bett, und der Rest des Raums wird von der Werkbank, einer aus einer Kiste gebastelten Wiege, zwei oder drei kaputten Stühlen ohne Sitzfläche, einer Schmorpfanne und einem Kochkessel in Anspruch genommen.73
In New York nahm Wolf Mandelbaum seine Arbeit als Hausierer wieder auf, ein Geschäft, dem viele der deutschen Juden in der Stadt nachgingen. Die jüdischen Frauen aus Deutschland, deren Arbeit in der alten Heimat einen wichtigen Beitrag zum Einkommen der Familie darstellte, erwarteten, diesen auch in Amerika leisten zu können.74 Aber sie fanden schnell heraus, dass für Frauen die Aussicht auf Arbeit sogar noch schlechter war als für Männer.75 Manche deutschen Frauen fanden eine Beschäftigung als Hausangestellte. Das hieß kräftezehrende Arbeit von bis zu 16 Stunden am Tag76 für wenig mehr als Unterkunft, Verpflegung und einen Dollar77 die Woche. Andere betätigten sich als Wäscherinnen, nahmen Kostgänger auf oder erledigten zu Hause Näharbeiten, bei denen sie stundenlang mit gebeugtem Rücken über ihrer Handarbeit saßen und bei Kerzenschein Tausende winziger Stiche machten.78
»Das Heim der Näherin«, Illustration aus einem viktorianischen Bericht über New Yorks Halbwelt
Diese Schneiderinnen (»tailoresses«79), deren Arbeit ihren Körper mit krummem Rücken und Sehschwäche80 dauerhaft zeichnete, verdienten Mitte des 19. Jahrhunderts im Durchschnitt nur 91 Dollar jährlich.81 Ein Historiker berichtet über das Schicksal zweier von ihnen, die Zeitgenossinnen von Fredericka Mandelbaum waren. Die beiden deutschen Schwestern Cecilia und Wanda Stein wanderten demnach 1852 nach New York aus und lebten in großer Armut, während sie als Stickerinnen arbeiteten, aber kaum ihren Lebensunterhalt bestreiten konnten. Ihre Lage verschlechterte sich im Herbst 1855, als ihr Arbeitgeber das Geschäft aufgab und sie keine Arbeit mehr fanden, wodurch sie bald vor dem Nichts standen. In ihrer Verzweiflung nahmen sie gemeinsam mit Wandas sechsjährigem Kind am 4. September Blausäure und beendeten ihr Leben.82
Welche Möglichkeiten blieben den Einwanderern, wo ihnen so viele Wege zum wirtschaftlichen Aufstieg versperrt waren? Manche wurden zu Kriminellen – die schiefe Bahn (die man hier »crooked ladder« nennt83) war für sie der Weg nach oben. Zu den kriminellen Betätigungen gehörten damals für Männer zum Beispiel verbotenes Glücksspiel, Lotteriespiele, Schutzgelderpressung, Einsätze als angeheuerte Schläger und Hehlerei. Oder sie stellten sich in den Dienst der New Yorker Kommunalpolitik, die damals, in der Blütezeit der Parteiorganisation Tammany Hall, von Korruption bestimmt wurde.84 Aber für Frauen gab es in der Unterwelt noch weniger Karrieremöglichkeiten als in der »Oberwelt«85 – dem Reich der legalen Geschäfte. Während des gesamten 19. Jahrhunderts waren Ladendiebstahl und Prostitution praktisch die einzigen Optionen, die Frauen offenstanden, die – sei es in mutiger wirtschaftlicher Selbstbestimmung oder als verzweifelter letzter Ausweg – ihren Lebensunterhalt als Kriminelle zu bestreiten suchten.86
Unter den deutschen Einwanderinnen war Prostitution die verbreitetste Form der Kriminalität.87 Es war eine gefährliche Arbeit unter harten Bedingungen: Eine Studie aus dem Jahr 185888 fand heraus, dass jedes Jahr fast ein Viertel der Tausenden Prostituierten in der Stadt starben. Die Lebenserwartung einer jungen Frau, die in dieses Geschäft einstieg, betrug noch ungefähr vier Jahre.89
Für eine verheiratete Frau wie Fredericka Mandelbaum kam Prostitution natürlich nicht infrage. Aber sie wollte sich offensichtlich auch nicht mit einem Leben in Armut zufriedengeben. Schon sehr früh erkannte sie, dass die Arbeitsmöglichkeiten für Einwanderinnen niemals die Sicherheit oder die Aufstiegschancen bieten würden wie ein eigenes Unternehmen. »Die Frauen der Unterschicht waren zwar schon immer berufstätig, arbeiteten aber vorwiegend im häuslichen Bereich als Dienstmädchen, Krankenschwestern, Wäscherinnen, Schneiderinnen oder Zimmervermieterinnen«, erklärte mir kürzlich ein Historiker.90 »Mrs Mandelbaum erfasste den Unterschied zwischen Lohnarbeit und Kapitalakkumulation als Mittel, um reich zu werden, lange bevor Marx sein Hauptwerk91 veröffentlichte.«
Während ihrer ersten Jahre in New York ging auch Fredericka als Hausiererin von Tür zu Tür, um Spitze zu verkaufen. In den Straßen wimmelte es bereits von Männern, Frauen und Kindern, die ihre Waren feilboten.92 In Handkarren, Körben und Kesseln boten sie billigen Schmuck, Kämme und gebrauchte Kleidung an, Knöpfe und Bänder, Faden und Stroh, Hosenträger, Schnürsenkel und Handschuhe, abnehmbare Kragen und Manschetten, Streichhölzer und Anzündspäne, Töpfe und Pfannen, Besen, Zeitungen und Geigensaiten, Obst und Gemüse, Austern und Muscheln, Lebkuchen und geröstete Erdnüsse, heiße Maiskolben, Ofenkartoffeln und Baked Beans, Buttermilch, Eiscreme und Apfelkuchen. Messerschleifer, Kesselflicker, Kaminfeger, Schuhputzer, Glaser, Lumpensammler und Schirmflicker verstärkten das Gedränge noch.93
Die Straßen waren erfüllt vom vielstimmigen Chor der Händler, die lautstark ihre Ware anpriesen: »Teppiche – Teppiche – greifen Sie zu!«94 […] »Maifisch, ganz friiisch!«95 […] »Austern, köstliche Austern!«96 […] »Töpfe und Pfannen – hier kommt der Kesselflicker.«97 […] »Muscheln, Muscheln, Muscheln gibt’s heut / sie kommen direkt aus Rockaway, ihr Leut’ / Ob geröstet, als Pastete oder frittiert / ein köstliches Mahl wird sogleich serviert.«98 […] »Der Glaser ist da!«99 […] »Heißer Mais! Heißer Mais! / Lilienweißer Mais. / Ihr alle, die Geld habt / Ich Ärmste hab keins / Kommt und kauft meinen lilienweißen Mais / Damit ich heimgehen kann.«100 […] »Kaminfeger, Kaminfeger, wer braucht einen Kaminfeger?«101 […] »Erdbeeren, leckere Erdbeeren!«102 […] »Schauen Sie her, ich flicke Ihren Schirm!«103
Aber Mrs Mandelbaum erkannte bald, dass sie als fliegende Händlerin nicht weit kommen würde.104 Irgendwann in den 1850er-Jahren scheint sie zum Schützling von Abraham »General Abe« Greenthal, einem Großmeister der Hehlerei, aufgestiegen zu sein.105 Greenthal war, wie die New-York Times 1889 schrieb, »einer der ältesten und gewieftesten Verbrecher in diesem Land«106, der Kopf einer Bande jüdischer Krimineller, die unter dem Namen Sheeny Mob107 bekannt war – und deren Mitglieder sich stolz selbst so nannten.108 (Der Mob, wie es die Times elegant ausdrückte, war »eine Bande gerissener Taschen- und Ladendiebe«109, und Greenthal, »wenn er auch bei den Diebstählen nicht selbst die Finger im Spiel hatte, […] war maßgeblich am Absatz der Beute beteiligt.«110 Unter seiner Obhut und der von Mose Ehrichs111, einem anderen bekannten Hehler, wurde Mrs Mandelbaum zur Expertin, wo es um den Wert von Spitze, Seide, Kaschmir, Robbenfell und anderen Luxusgütern ging, die ihnen in die Hände fielen.112 Die Fähigkeiten, die Fredericka sich aneignete, legten den Grundstein für ihre so erfolgreiche Karriere als Kriminelle.
»General Abe« Greenthal, Mitte des 19. Jahrhunderts ein bekannter New Yorker Hehler. Unter seiner Anleitung erlernte Marm Mandelbaum das Handwerk.
Allen Berichten zufolge hatte Wolf Mandelbaum mit dem frühen Einstieg seiner Frau ins Hehlergeschäft nichts zu tun und war auch in der Folge weitgehend unbeteiligt an ihren lang währenden und lukrativen kriminellen Machenschaften. Später erinnerte sich der Polizeipräsident George Washington Walling: »Die Frau übernahm die Führung bei diesem schändlichen Treiben […] Sie war eine meisterhafte Geschäftsfrau. Ihr Mann war eine unbedeutende Figur.«113
Intelligent und tatkräftig, wie sie war, wollte Fredericka ihr Leben sicher nicht als fliegende Händlerin verbringen, über die andere das Sagen hatten. Sie wusste, dass sie mehr verdienen konnte, wenn sie sich selbstständig machte und ihr Warenangebot diversifizierte. Aber wie kam sie ohne Kapital überhaupt an Ware? Die Antwort auf diese Frage fand sie buchstäblich auf der Straße.
2
Und keine weiteren Fragen
Es ist ein ungeschriebenes Gesetz der Unterwelt, dass jeder Dieb, der gestohlene Kohle, Kupfer oder Baumwolle besitzt – ganz zu schweigen von einem Einbrecher, der Seide, Silber oder Saphire erbeutet hat –, einen Hehler braucht. Geklaut wird, seit es persönliches Eigentum gibt, und illegale Aufkäufer sind fast gleichzeitig in Erscheinung getreten. Denn der Dieb verfügt nur selten über die nötigen Kontakte, die Geduld und die Gewieftheit, um die heiße Ware selbst für einen lohnenden Gewinn absetzen zu können. Hier kommt nun der Hehler ins Spiel.
In Großbritannien ist Hehlerei seit mehr als einem halben Jahrtauend bezeugt. In seinem Hauptwerk A History of Crime in England beschreibt der viktorianische Rechtsanwalt Luke Owen Pike Fälle, die bis ins 14. Jahrhundert zurückreichen.1 »Der gemeine Hehler ist keineswegs eine Schöpfung unserer großen modernen Städte«, schreibt er, »er ist schon in den Tagen, als in Europa noch das Raubrittertum grassierte, zutage getreten […] In amtlichen Dokumenten werden zahlreiche Männer und Frauen so beschrieben. Sie waren die Geschäftspartner jener Klassen, die als […] gewöhnliche Diebe oder Räuber bezeichnet werden.«2
Obwohl Hehler viel Mühe aufwenden, der Polizei ein Schnippchen zu schlagen, betrachten sie sich selbst nicht als Kriminelle, sondern schlicht und einfach als Geschäftsleute: Sie sind der entscheidende Punkt B in einer Lieferkette, die dazu bestimmt ist, Ware effizient von Punkt A (dem Dieb) zu Punkt C (dem Käufer) zu befördern.3 Als Mittelsmann schottet der Hehler den Dieb sowohl von der Polizei ab als auch vom Abnehmer.4 Dass die Art von kaufmännischer Logistik, die er so meisterhaft beherrscht, rein zufällig als ungesetzlich gilt, ist ein Ärgernis – und mitunter ein Risiko.
Der Hehler sorgt für eine »Fassade« – ein quasi-legales Geschäft wie ein Pfandhaus, einen Trödelladen … oder eine Textilwarenhandlung –, hinter der die heiße Ware öffentlich an den Mann gebracht werden kann.5 Allerdings sind Hehlerei und Pfandleihe zwei Paar Schuhe. Ein Kunde, der in einem Pfandhaus eine Diamantbrosche verpfändet, hat (zumindest theoretisch) den Anspruch, sie wieder einzulösen. Ein Dieb, der dieselbe Brosche einem Hehler aushändigt, hat diesen Anspruch nicht, und genau das ist der Punkt: Ist das gute Stück erst einmal im Besitz des Hehlers, ist der Dieb aus dem Schneider und damit verhältnismäßig sicher.
Zu der Zeit, als Mrs Mandelbaum in der Neuen Welt ankam, machten mehrere Faktoren den Ankauf gestohlener Ware zur attraktiven Geschäftsidee. Dazu gehörten der kontinuierliche Wandel Amerikas von der einstigen Agrarnation hin zu einer von Handel und Industrie getriebenen Wirtschaftsmacht, das damit einhergehende Wachstum der Städte und der Aufstieg New Yorks zu einer weltweiten Produktions- und Handelsmetropole. Außerdem war der Ankauf rechtswidrig erworbener Güter in der damaligen amerikanischen Rechtsprechung nicht klar definiert und die noch in den Kinderschuhen steckenden Polizeikräfte von New York City waren total desorganisiert. Dies machte die erfolgreiche Strafverfolgung von Schiebern zu einer Seltenheit. Während ihres ersten Jahrzehnts in Amerika lernte Fredericka, aus all diesen Faktoren Kapital zu schlagen.
In jener Zeit unterlag die Wirtschaft New Yorks unkontrolliert ausschlagenden Zyklen. Auf Zeiten der Hochkonjunktur folgten schwere Finanzkrisen, die wie Flutwellen über die Stadt hinwegrollten.6 Fredericka erkannte, dass an beiden Extremsituationen des Zyklus Profit zu machen war. Ihr Erfolg basierte teilweise auf den Auswirkungen wirtschaftlicher Einbrüche, bei denen Unternehmen pleitegingen, Banken schlossen und viele Menschen arbeits- und obdachlos wurden, erklärt Rona Holub.7
Boomte die Wirtschaft, strömten immer mehr austauschbare Waren in die Stadt. Dazu gehörten auch die Luxusgüter, nach denen die aufstrebende Mittelschicht verlangte, wie sie es gelernt hatte. In Krisenzeiten wimmelte es in der Stadt von Plünderern – notleidende, plötzlich arbeitslose, enteignete Menschen –, die in den Straßen und an den Kais im Hafenviertel, aus Transportkutschen und Lagerhäusern stahlen, was immer ihnen in die Finger kam.
Mrs Mandelbaum dürfte in und um Kleindeutschland täglich Plünderern begegnet sein. Darunter waren auch viele Frauen8: Wäre sie nicht gewitzt genug gewesen, die Krisen der Stadt in bare Münze umzuwandeln, hätte sie leicht eine von ihnen sein können.
Ein Teil der Beute – Kohlen und Holzscheite9, verschüttetes Mehl, Zucker und Kaffee – war für den häuslichen Bedarf bestimmt. Der Rest, inklusive Lumpen, Seile und Schrott10, landete bei Trödlern, Geschäftsleuten und Hehlern in der Unterwelt, deren Geschäftsmodell unter den Armen New Yorks florierte.11
Während der Jahre, die Marm als fliegende Händlerin in New York verbrachte, stammte mindestens ein Teil ihrer Ware von Plünderern, Taschendieben und Kleinkriminellen.12 Ein für alle Beteiligten vorteilhaftes Übereinkommen: Den Zulieferern blieb das Problem erspart, einen Käufer zu finden, Mrs Mandelbaum hatte kaum Betriebskosten. Der Gewinn wurde zwischen Marm und dem Plünderer aufgeteilt, wobei Erstere den Löwenanteil erhielt.13 Ende der 1850er-Jahre hatte sie genug Kapital angehäuft, um den Straßenhandel ganz aufzugeben und als Einzelunternehmerin zu arbeiten. Sie nahm weiterhin Ware zweifelhafter Herkunft an, ohne den Plünderern und Kleinkriminellen Fragen zu stellen14, und verkaufte das Diebesgut gewinnbringend weiter. Fredericka Mandelbaum war zur Hehlerin geworden.
Aber wie sie wusste, würde sie mit Lumpen und Seilen schwerlich reich werden. Da gab es im Villenviertel, wo die wohlhabenderen Leute wohnten, eindeutig mehr zu holen.
Marm eröffnete ihr Geschäft zu einem Zeitpunkt, als die Ära, die bald als Amerikas »Gilded Age« bezeichnet würde, gerade ihren Anfang nahm – eine Zeit räuberischer Habgier, unkontrollierten Spekulantentums, grassierender Korruption und zunehmender Einkommensungleichheit.15 Nicht zufällig läuteten diese Jahre auch den Beginn des sogenannten ersten Goldenen Zeitalters des Diebstahls ein, das unmittelbar nach dem Sezessionskrieg seinen Höhepunkt erreichte.16 Um die Mitte des Jahrhunderts waren die Gelegenheiten für Taschendiebe so zahlreich und vielfältig, dass New Yorks Langfinger anfingen, sich zu spezialisieren. Ein entsprechendes Vokabular17 bezeichnete ihr »Revier«, die Schauplätze, an denen sie zum Beispiel »Leder« (Brieftaschen) oder »Rollen« (Geldnoten) erbeuteten. »Wagendiebe« arbeiteten in Straßenbahnen und von Pferden gezogenen Omnibussen. »Kirchendiebe« beklauten die Kirchgänger. »Reader merchants«18 (Brieftaschen-Händler) hatten die Bankkunden im Visier. »Seufzer« nahmen an Wohltätigkeitsveranstaltungen teil, um sich persönlich etwas von den Spenden zu sichern. »Puppendiebe« konzentrierten sich auf Frauen. »Schlitzer« benutzten kleine Messer, um Taschen aufzuschlitzen und diskret deren Inhalt zu klauen.
Diese explosionsartige Zunahme von Diebstählen beruhte auf einem rein pragmatischen Kalkül: Die Amerikaner der Ober- und Mittelschicht besaßen zu diesem Zeitpunkt viel hochwertiges Privateigentum, weitaus mehr davon als je zuvor. Im Villenviertel errichteten die Industriegiganten – die Vanderbilts, Rockefellers, Astors und ihresgleichen –, deren Imperien auf Eisenbahn, Öl und Pelzen gründeten, weitläufige Herrenhäuser, überfrachtet mit Gold, Seide und den Gemälden alter Meister. Mitten in einer Wirtschaftskrise19 ließ ein Zweig der Familie Vanderbilt für fünf Millionen Dollar20 ein Sommerhaus mit 70 Zimmern21 erbauen, in dem 33 Dienstmädchen und 13 Reitknechte22 arbeiteten. Um mithalten zu können, errichtete ein rivalisierender Familienzweig eine Villa, die zwar gerade mal zwei Millionen Dollar teuer war23, aber mit einer Innenausstattung im Wert von neun Millionen24 auftrumpfen konnte.
Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes beschränkte sich die Möglichkeit, Privateigentum anzuhäufen, nicht auf die Oberschicht. Mitte des 19. Jahrhunderts hatte sich eine Mittelschicht herausgebildet, die das Produkt von Industrialisierung, Urbanisierung und steter Zunahme der Berufstätigkeit war. Ihre Mitglieder wünschten sich bald mehr und erlesenere Besitztümer. Sie wurden von einfachen Käufern zu Konsumenten.25
In der landwirtschaftlichen Vergangenheit Amerikas wurde, wie auch in Europa, Reichtum normalerweise an Land und Viehbestand gemessen.26 Gegenstände, die man fürs Haus benötigte, wurden im Allgemeinen auch dort hergestellt: Holz wurde zu Möbeln verarbeitet, Flachs zu Garn gesponnen und dann zu Stoffen gewoben. Wohlhabendere Menschen besaßen vielleicht ein paar edle handgemachte Stücke – eine Golduhr, eine gravierte Schnupftabaksdose, einen Siegelring –, aber es gab nichts, was mit der Flut von Massenprodukten vergleichbar gewesen wäre, die im Zuge der Industrialisierung den Westen überschwemmte. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts jedoch wurde die Produktion von Gütern wie Möbel, Schmuck und Textilien zunehmend von den Werkstätten der Kunsthandwerker in zentralisierte »Manufakturen« – die ersten »Fabriken« – verlegt. Diese konnten kostengünstiger und größere Mengen produzieren. Und so begann Amerikas neu entstandene bürgerliche Klasse während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunehmend diese Gegenstände, die greifbare Verkörperung des amerikanischen Traums,27 für sich zu fordern.
Für Hehler war es eine paradiesische Zeit, fanden sie sich doch plötzlich inmitten einer Pandemie der Sehnsüchte wieder. Reklame in Zeitungen und Zeitschriften sowie die allgegenwärtigen Haushaltsratgeber28 für die Frauen der Mittelschicht weckten die Kauflust der Massen. Unter dem Einfluss dieser Rhetorik standen die bürgerlichen Hausfrauen Amerikas unter dem Druck, ihr Heim in einen Ausstellungsort für die zeitgenössische materielle Kultur zu verwandeln. Vor allem ihr Salon musste zwangsläufig vollgestopft sein: mit Sitzgruppen, Sofas und Beistelltischen, Schnickschnack und Nippes, Tischuhren, Kristallleuchtern und ornamentalen Lampen, aufwendig gerahmten Ölbildern und Aquarellen, Kissen in Hülle und Fülle, mit Klaviertüchern bedeckten Pianos, Ausbrennertapeten, dekorativen Wandschirmen und Vasen mit künstlichen Blumen, Samt, Plüsch, Spitzendeckchen, Gardinen, Teppichen und Chintz und natürlich Fransen, Fransen, Fransen.29 Wie ein viktorianischer Trendsetter völlig ironiefrei schrieb, entstehe wohl kaum zu viel Raum, solange man sich noch bewegen könne, ohne über die Möbel zu stolpern.30
Es galt, so viel anzuschaffen, dass die Frauen der Mittelschicht auf Vergünstigungen erpicht waren. Genauso ging es den kleinen Geschäftsleuten – dem Schneider, dem Kleidermacher, dem Nippesverkäufer, der sein Lager unbedingt mit Ware füllen oder Rohmaterialien kaufen wollte, die er sich im Normalfall nicht leisten konnte. Und hier, an der Schnittstelle von Sparsamkeit, Gütern, einer neu entstandenen Gesellschaftsschicht und ihren Sehnsüchten, fand Fredericka Mandelbaum ihre Berufung. Im Zentrum stand eine spezielle Art von Wiederverwendung: Sie sorgte dafür, dass ausgewählte Artikel aus einem bürgerlichen Haus ein anderes schmücken konnten. Oder sie ließ Seidenballen aus großen Textilfabriken stehlen, um sie dann an die Schneider im Viertel zu verkaufen. Alles sei auf das Genaueste geplant, beschrieb ein zeitgenössischer Beobachter ihre Geschäftsstrategie.31 Es könne vorkommen, dass »zwei Tage nach dem Verschwinden [des Diebesguts] sein ehemaliger Besitzer im selben [Straßenbahn]wagen« sitze wie »das Mädchen, dessen Bluse aus dem gestohlenen Material« genäht worden sei.
Mrs Mandelbaum widerstrebte es, selbst zu stehlen. Nicht etwa, weil sie Skrupel hatte, sondern aus reinem Selbstschutz: Sie wusste aus Erfahrung, dass Diebstahl ein riskantes Geschäft ist. Anlässlich einer ihrer seltenen frühen Verhaftungen veröffentlichte die National Police Gazette32, ein populäres Magazin33, neben dem moderne Boulevardzeitungen wie Kirchenblätter wirken, eine reißerische und ungeniert antisemitische Reportage:
Mike Weaver34hat zweifellos alle Hände voll zu tun; er hat in Form einer speziellen Beschäftigung mehr Arbeit, als er ordnungsgemäß erledigen kann.35In erster Linie muss er sich um die Angelegenheiten seiner treuen Braut Mary kümmern, die mit der Jüdin, Mrs Mendelbaum, und einem jüdischen Lehrmädchen beim Ladendiebstahl geschnappt wurde. Alle drei wurden in einem Laden am Broadway »auf frischer Tat« ertappt. Sie hätten inzwischen ihr Fett abbekommen und säßen im Gefängnis, wenn sich nicht der gegenwärtig größte Aufkäufer gestohlener Güter eingemischt und sich für sie verwendet hätte.
Mose Ehrick [sic], der moralisch verpflichtet war, dem Judenweib [Mrs Mandelbaum] aus der Patsche zu helfen, damit es keinen allgemeinen »Aufschrei« gäbe, stellte 2000 Dollar zur Verfügung und schickte einen Unterhändler in die Chambers Street, um auch die Kaution für Mary Hyman zu hinterlegen. Mose prahlt damit, dass er überall die Finger drin hat und dass diese jüdische Ladendiebin nie vor Gericht gestellt werden wird.36
Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts fand eine umfassende Professionalisierung statt, in Bereichen wie Medizin und Recht wurden strenge Vorschriften bezüglich Ausbildung, Zulassung und Verhalten eingeführt. 1847 wurde die American Medical Association gegründet, um die »grassierende Quacksalberei«37 in Gestalt von Straßenhändlern, die allerlei Allheilmittel und andere angebliche Wunderarzneien verhökerten, zu bekämpfen. Die American Bar Association wurde 1878 aus ganz ähnlichen Gründen ins Leben gerufen: Früher konnte ein angehender Rechtsanwalt sich sein Wissen einfach durch Lesen aneignen und versuchen, die Zulassungsprüfung zu bestehen, ohne je eine Law School, eine juristische Fakultät, besucht zu haben.38 So war es auch bei Abraham Lincoln39, dessen formelle Ausbildung miserabel war.40 Dasselbe galt für Mrs Mandelbaums bewährte Anwälte William Howe und Abraham Hummel, die zu den bekanntesten, bestbezahlten und bestechlichsten Mitgliedern der Bar Association gehörten.41 Und auch für William M. Tweed42, den langjährigen, noch korrupteren Boss der Tammany-Hall-Parteimaschinerie.43 Ein Jurist erklärte, dass der Begriff »Amateur« im Laufe des Jahrhunderts erstmals eine abwertende Bedeutung bekam. Demgegenüber wurde der professional als zuverlässig, kompetent und engagiert angesehen.44
Die Berufe im oberweltlichen Amerika wurden zunehmend modernisiert, organisiert und hierarchisiert, und dasselbe geschah in Amerikas Unterwelt. Zwar gab es bereits seit der Kolonialzeit vereinzelt professionelle Diebe.45 Aber erst mit der Entstehung großer Stadtzentren – in denen eine wohlhabende Klasse lebte und die den Ganoven ein willkommenes Maß an Anonymität boten – wurde das Stehlen zur praktikablen Vollzeitbeschäftigung.46
Um die 1840er-Jahre47 versetzten ethnische Gangs – vor allem Banden irischer Einwanderer, die sich zusammenschlossen, um sich gegen die bandenmäßige Gewalt der nativistischen, angelsächsischen Amerikaner48 zu wehren – das Elendsviertel Five Points im Süden Manhattans in Aufruhr. Zu diesen frühen Banden gehörten jene, denen Herbert Asbury in seinem 1927 erschienenen Buch The Gangs of New York49 ein Denkmal setzte: die Plug Uglies, die Shirt Tails, die Roach Guards.50 Da es ihnen aufgrund ihrer Herkunft weitgehend unmöglich war, ehrliche Arbeit zu finden, entwickelten sich die Bandenmitglieder zu gewieften Dieben. Sie klauten Waren aller Art aus den Lagerhäusern und an den Anlegestellen.51 Doch obwohl diese Art von Kriminalität weit verbreitet war, blieb sie weitgehend »unorganisiert«52: Die Diebstähle wurden planlos, unprofessionell, oft unter Einsatz von Gewalt begangen53 und waren nicht einmal besonders lohnend.54 (»Augenausstecher und Krawallkünstler« nannte sie Asbury.)55 Die Gangs vermittelten auch Auftragsschläger an Wahlkampfhelfer, die mit allen Mitteln Stimmen gewinnen wollten – selbstverständlich für die Mitglieder der Tammany Hall, der Organisation der Demokratischen Partei56.
In den darauffolgenden Jahrzehnten traten auch immer mehr Frauen den Gangs bei, aber wie ihre männlichen Kollegen waren die meisten von ihnen eher Haudegen als Geschäftsleute. Wie ein Historiker schrieb, hätten etwa Gallus Mag, Sadie the Goat, Hell-Cat Maggie, Battle Annie Welsh und Euchre Kate Burns dazugehört.57 Eine Zeitung habe sie als »Schwergewichtsmeisterin im Ziegelschleudern« von Hell’s Kitchen betitelt, sie seien alle »Spezialistinnen für Wahlkrawalle«.
Gallus Mag58, eine über 1,80 Meter große und bewaffnete Rausschmeißerin, arbeitete demnach in einer Spelunke und war für ihre Brutalität bekannt. Sadie the Goat, eine Flusspiratin, erhielt ihren Spitznamen, weil sie in Kämpfen ihren Kopf wie eine Ziege einsetzte. Hell-Cat Maggie, mit spitzen Zähnen und Messing-Spikes an den Fingern, verbreitete Angst und biss Sadie in einem Kampf ein Ohr ab. Battle Annie, eine gewalttätige Anführerin einer Frauen-Gang, wurde für ihre Stärke und Brutalität gefürchtet – selbst von Männern.59
Echtes Berufsverbrechen entwickelte sich erst in den 1860ern, parallel zur Professionalisierung in der Oberwelt. Da die Männer der Ober- und der Unterwelt gleichzeitig nach Reichtum und Macht strebten, verwischte sich die Grenze zwischen den beiden Welten bald. Die Verbrecherbarone des Villenviertels hatten ihr Vermögen mit Bestechung, Falschaussage, Veruntreuung und Nötigung erworben.60 Sie kauften Beamte, forderten Schmiergeld, manipulierten die Preise von Aktien und Währungen, erzwangen Fusionen und Übernahmen und schlugen, oft gewaltsam, Streiks nieder. (»Ich kann die eine Hälfte der Arbeiterklasse anheuern« – das heißt die Pinkertons –, »um die andere Hälfte umzubringen«61, prahlte der Finanzier und Eisenbahnmagnat Jay Gould.)62 Sie waren in der Lage, Märkte so zu manipulieren, dass sie Finanzkrisen auslösen konnten. In Kriegszeiten verkauften sie zu Wucherpreisen schadhafte Ware an die Armee. (»Gesetz! Was kümmert mich das Gesetz?«, spottete Cornelius Vanderbilt 1865, nachdem er die Nordstaaten mit verfaulenden Schiffen beliefert hatte. »Liegt die Macht nicht in meinen Händen?«)63 Es interessierte sie keinen Deut, ob ihre Angestellten in Gefahr gerieten oder genug Geld zum Leben hatten.
Während die Armen litten, »erfreuten sich die Reichen des Gilded Age […] ihres Wohlstands wie nie zuvor«, lesen wir in einer heutigen Geschichte des Verbrechens in Amerika.64 Da war die Rede von diamantbesetzten Zähnen oder Gästen, die beim Abendessen schwarze Perlen in ihren Speisen fanden. Es kam vor, dass bei einer Feier Zigarren in 100-Dollar-Noten gewickelt und angezündet wurden. »Hundehalsbänder aus Gold oder Diamanten waren bis zu 15 000 Dollar65 wert.« Ein Plutokrat hätte sich sogar einen Affen als Haustier gehalten, der von seinem Diener täglich in einer Privatkutsche in der Stadt herumgefahren wurde.
Dennoch wurden im Allgemeinen nur die Methoden der in der Unterwelt agierenden Figuren als kriminell betrachtet. Ein Historiker stellt fest, dass die überwältigende Mehrheit der Gesellschaft lediglich Verbrechen von ethnischen Minderheiten verurteilte. Es sei auffällig, wie gleichgültig das Land gegenüber Wirtschaftskriminalität blieb, auf die die meisten der einkommensschwachen Einwanderer, die Minderheiten angehörten, nach Definition keinen Zugang hatten.66
In der allgemeinen Vorstellung wird das organisierte Verbrechen in Amerika weitgehend mit der Mafia gleichgesetzt, deren Wurzeln ins Sizilien des 13. Jahrhunderts zurückreichen.67 Diese Organisation kam Ende des 19. Jahrhunderts68 mit der ersten großen Welle italienischer Migranten nach Amerika.69