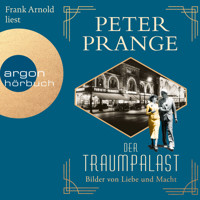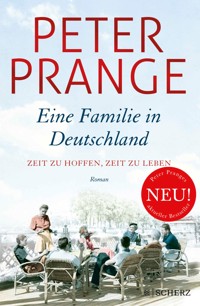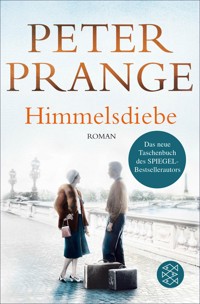9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Frauen zwischen Tradition und Moderne, Freiheit und Liebe Konstantinopel, 1909. Fatima und Eliza leben in der verborgenen Welt des Harems. Während die eine die Gunst des Sultans ersehnt, strebt die andere nach Freiheit, nach einem Leben jenseits der Palastmauern. Dann zerbricht das Osmanische Reich – und außerhalb des Serails wartet auf die Freundinnen eine Welt, die fremd und gefahrvoll erscheint. Wie sollen sie sich darin behaupten? Werden sie eine Brücke schlagen zwischen Orient und Okzident, Tradition und Moderne? Und können sie ihre Freundschaft bewahren, wenn die Liebe zwischen sie tritt? Der Roman erschien bei Droemer unter dem Titel "Der letzte Harem"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 739
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Peter Prange
Die Gärten der Frauen
Roman
Roman
Über dieses Buch
Elisa und Fatima sind mehr als Freundinnen – sie sind Schwestern. Schon als Kinder hat ihr Schicksal sie zusammengeführt, dabei könnten sie unterschiedlicher nicht sein. Fatima ist so schön, dass sogar die Pfauen im Garten des Harems bei ihrem Anblick ein Rad schlagen. Sie wünscht sich nichts sehnlicher, als eines Tages das Lager des Sultans teilen zu können. Die eigenwillige Armenierin Elisa hingegen setzt sich immer wieder über die strengen Regeln des Serails hinweg. Mehr als einmal sorgt ihr Temperament für Streit, doch erst als die alte Ordnung zerbricht, wird die Beziehung der beiden Frauen wirklich auf die Probe gestellt.
Es ist die Geburtsstunde der modernen Türkei, Revolution und Krieg überziehen das Land. Sultan Abdülhamid wird ins Exil verbannt, sein Harem aufgelöst. Hunderte Frauen bleiben schutzlos zurück, auch Fatima und Elisa. Im ganzen Land sucht die neue Regierung nach den Angehörigen der Haremsdamen, doch für Elisa und Fatima findet sich niemand. Auf sich allein gestellt, müssen die beiden lernen, sich in einer fremden Wirklichkeit zu behaupten.
Da treten zwei ungewöhnliche Männer in ihr Leben: Felix, ein Arzt aus dem fernen Deutschland, und Taifun, ein Offizier der neuen Regierung. Gelingt es der Liebe, eine Brücke zu bauen zwischen Orient und Okzident, zwischen Vergangenheit und Zukunft? Doch während das Land in Flammen aufgeht, droht ausgerechnet die Liebe den einzigen Halt zu zerstören, der den beiden Frauen geblieben ist: ihre Freundschaft.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Peter Prange ist als Autor international erfolgreich. Seine Werke haben eine Gesamtauflage von über drei Millionen erreicht und wurden in 24 Sprachen übersetzt. Mehrere Bücher, etwa sein Bestseller ›Das Bernstein-Amulett‹, wurden verfilmt. Nach seinem Erfolgsroman ›Unsere wunderbaren Jahre‹ erschien der große Roman in zwei Bänden, ›Eine Familie in Deutschland‹. Der Autor lebt mit seiner Frau in Tübingen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Aus Verantwortung für die Umwelt hat sich der S. Fischer Verlag zu einer nachhaltigen Buchproduktion verpflichtet. Der bewusste Umgang mit unseren Ressourcen, der Schutz unseres Klimas und der Natur gehören zu unseren obersten Unternehmenszielen.
Gemeinsam mit unseren Partnern und Lieferanten setzen wir uns für eine klimaneutrale Buchproduktion ein, die den Erwerb von Klimazertifikaten zur Kompensation des CO2-Ausstoßes einschließt.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.klimaneutralerverlag.de
Neuausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
Originalausgabe:
© 2007 Peter Prange, vertreten durch AVA international GmbH
Autoren- und Verlagsagentur, www.ava-international.de, und Droemer Verlag,
ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knauf Nachf. GmbH & Co. KG, München.
Die Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel ›Der letzte Harem‹
© 2020 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstraße 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: www.buerosued.de
Coverabbildung: www.buerosued.de, Arcangel/Susan Fox, Getty Images/Paul Gadd, akg-images
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490516-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Motto
Prolog Die Wunschnacht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Erstes Buch Der Schatten Gottes
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Zweites Buch Der Europäer
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Drittes Buch Taifun Pascha
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
Viertes Buch Der Goldschmied
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
Fünftes Buch Der Flötenspieler
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Sechstes Buch Der Sohn
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
Epilog Der letzte Harem
Dichtung und Wahrheit
Danke
Für die drei Frauen meines Lebens –
für die Frau, die mir das Leben gab,
für die Frau, die das Leben mit mir teilt,
für die Frau, die dieses Leben nach uns weiterlebt.
»Ich bin eine Haremsfrau, eine osmanische Sklavin.
Heißer Sand ist mein Vater, der Bosporus meine Mutter.
Weisheit ist mein Schicksal, Unwissenheit mein Verderben.
Ich bin reich gewandet und arm angesehen,
eine Herrin von Sklavinnen und selbst eine Sklavin.
Ich bin namenlos, ich bin ehrlos. Mein Heim ist dieser Palast,
wo Götter begraben und Teufel herangezogen werden,
das Land der Heiligkeit, der Vorhof der Hölle.«
Anonyma
PrologDie Wunschnacht
1895
1
Es war die Kadir-Nacht, die Nacht, die sich in vielen Jahren nur einmal ereignet, wenn die Geburt des Propheten Mohammed zusammenfällt mit der letzten Nacht des Fastenmonats Ramadan, in der Allah den Koran zur Welt herabsandte: jene geheimnisvolle Nacht der Nächte, in der nach dem Glauben der Rechtgläubigen alles, was auf Erden existiert, ob Pflanzen, Tiere oder Menschen, sich vor dem Schöpfergott verneigt und Wünsche in Erfüllung gehen.
Leise, damit ihre jüngeren Geschwister nicht aufwachten, stand Elisa von ihrem Strohlager auf, um sich in der dunklen Kammer anzuziehen. Es war so kalt, dass ihre Zähne aufeinanderschlugen, und ihre nackten Füße klebten auf dem gefrorenen Lehmboden beinahe fest, als sie sich zur Tür tastete, wo sie vor dem Schlafengehen ihren Filzmantel und die Wollstrümpfe bereitgelegt hatte. Sie war mit Fatma verabredet, ihrer besten Freundin. Zusammen wollten sie die Zauberkräfte dieser Nacht nutzen, um endlich den Krieg zu beenden, der seit einem Jahr in ihrem Dorf herrschte. Denn seit dieser Krieg begonnen hatte, durften Elisa und Fatma nicht mehr miteinander sprechen. Und wenn sie es doch taten, gab es Prügel.
Elisa zog sich gerade ihre Mütze über den Kopf, als sie aus der Wohnküche die Stimmen ihrer Eltern hörte. Sie presste ihr Ohr an die Tür, um zu lauschen.
»Ich will keine Pistole im Haus«, sagte ihre Mutter. »So was bringt nur Unglück.«
»Wir müssen uns wehren«, erwiderte ihr Vater. »Sie quetschen uns aus bis aufs Blut.«
»Trotzdem! Wir sind früher auch mit ihnen ausgekommen, wir sind doch alle Untertanen des Sultans.«
»Nein, das sind wir nicht! Wir sind Armenier! Wir sind getauft! Ungläubige Christen! Darum hassen sie uns!«
»Wir müssen tun, was sie von uns verlangen. Wenn wir uns wehren, bringen sie uns alle um!«
»Besser, sie bringen uns um, als vor Hunger zu krepieren!«
Der schwache Schein einer Lampe drang durch die Ritzen der Tür. In weißen Wölkchen stob der Atem aus Elisas Mund. Obwohl sie erst neun Jahre war, verstand sie nur zu gut, wovon die Rede war – seit Wochen sprachen ihre Eltern von nichts anderem. Von den Türken und den Kurden und den Armeniern und ihren Streitereien. Nie konnten sie sich vertragen. Wenn Kinder sich so böse stritten, wurden sie bestraft. Aber die Erwachsenen?
Von draußen näherten sich Stiefelschritte, und gleich darauf donnerten so schwere Schläge gegen die Haustür, dass die Holzwände davon bebten.
»Aufmachen!«, rief eine Männerstimme. »Oder wir schlagen die Tür ein!«
Elisas kleiner Bruder, der zusammen mit den Zwillingen in einem Bettkasten lag, richtete sich im Schlaf auf und fing an zu weinen.
»Pssst!«
Durch den Türspalt spähte Elisa in die Wohnküche. Ihr Vater ließ gerade seine Pistole in der Pluderhose verschwinden, während ihre Mutter die Haustür öffnete. Ein Mann mit einem riesigen Schnauzbart und einer hohen, von bunten Seidentüchern umwickelten Mütze betrat den Raum. In der Hand hielt er einen Säbel. Elisa kannte den Mann: Das war der kurdische Steuereintreiber. Ihm folgten weitere Kurden, die ihre Gewehre auf Elisas Eltern richteten.
»Was wollt ihr von uns?«, fragte ihr Vater
»Du hast deine Steuern nicht bezahlt!«
»Wir haben kein Geld mehr! Ihr habt uns schon alles abgenommen!«
»Soll ich dir suchen helfen?«
Der Steuereintreiber machte mit seinem Säbel einen Schritt auf Elisas Vater zu. Dabei schien er immer größer zu werden, wie ein Flaschengeist im Märchen, während Elisas Vater förmlich in den Boden schrumpfte.
Ihre Mutter drängte sich zwischen die beiden. »Hier«, sagte sie. Sie griff in ihre Schürze und holte ein Säckchen daraus hervor. »Das ist alles, was wir haben.«
»Nein, das gibst du ihm nicht!«
Der Steuereintreiber stieß Elisas Vater beiseite und nahm das Säckchen an sich. »Na also! Warum nicht gleich?« Er steckte das Geld ein. »Aber das ist doch bestimmt noch nicht alles.«
Zitternd vor Kälte und Angst sah Elisa, wie er die Schränke und Regale durchsuchte. Sie wusste, wenn sie jetzt nichts unternahm, würden sie alle bis zum Frühjahr wieder hungern, genauso wie im letzten Jahr. Sie bückte sich, um in ihre Filzschuhe zu schlüpfen.
»Wo willst du hin?«, fragte ihr Bruder. »Geh nicht weg, bleib bei mir!«
Mit erschrockenen Augen sah er sie an. Am liebsten wäre Elisa zu ihm in den Bettkasten gekrochen. Doch das durfte sie nicht. Sie musste zu ihrer Freundin, egal, wie groß ihre Angst war. Nur wenn man die Verneigung der Schöpfung vor Allah mit eigenen Augen sah und dabei betete, so hatte Fatma erklärt, konnten die Zauberkräfte dieser Nacht wirken.
Vom Minarett der Dorfmoschee wehte der Gesang des Muezzins herüber, um die Gläubigen zum letzten Gebet des Tages zu rufen.
»Hab keine Angst«, flüsterte Elisa. »Ich mache, dass alles wieder gut wird.«
Sie gab ihrem Bruder einen Kuss und warf einen letzten Blick auf ihre Eltern, die von einem der Kurden in Schach gehalten wurden, während die anderen auf dem Boden knieten, um zu beten.
Dann öffnete Elisa das Fenster und verschwand hinaus in die Nacht.
2
Zur selben Zeit schlüpfte Elisas Freundin Fatma durch den Hinterausgang ihres Elternhauses ins Freie. Dabei wehte ihr ein so eisiger Wind ins Gesicht, dass der Gesang des Muezzins darin zu gefrieren schien. Doch eingemummt in flauschig warme Lammfelle, konnte die Kälte ihr nichts anhaben. Sie musste sich beeilen, Elisa wartete bestimmt schon auf sie.
Fatma wickelte sich den Schal noch fester um den Kopf. Hoffentlich machte ihre Freundin ihr keine Vorwürfe. Wie immer, wenn Fatma ein schlechtes Gewissen hatte, überlegte sie schon im Voraus ihre Verteidigung. Nein, sie konnte nichts dafür, wenn sie zu spät kam – ihre Mutter war schuld! Sie hatte nach dem Abendessen Fatmas Hände mit Henna eingerieben, zur Vorbereitung auf das Bairam-Fest, das sie morgen feiern würden. Fatmas Vater war Kurde, doch ihre Mutter war Tscherkessin, und alle tscherkessischen Frauen färbten sich zum Bairam-Fest ihre Hände mit Henna rot. Tscherkessische Frauen, so sagte Fatmas Mutter immer, waren die schönsten Frauen der Welt, weshalb es im Harem des Sultans auch nur Tscherkessinnen gab. Davon war sie so fest überzeugt wie Fatmas Vater von der Tatsache, dass alle Armenier Lügner und Betrüger waren. Es hatte also keinen Zweck zu protestieren, wenn ihre Mutter einem die Hände mit Henna einreiben wollte. Das musste Elisa einfach glauben, und wenn sie sich die Nase beim Warten abfror. Dass Fatma selbst um das Henna gebettelt hatte, damit sie morgen genauso schön sein würde wie ihre Mutter, hatte sie schon vergessen.
Vorsichtig, damit niemand sie sah, spähte Fatma in die Dunkelheit. Die Schneeflocken, die lautlos vom Himmel fielen, glitzerten wie Kristalle im Mondlicht, das zwischen den Wolken hier und da hervorbrach. Hoffentlich hörte es bald auf zu schneien, sonst konnten Elisa und sie das Wunder gar nicht sehen – und wenn sie es nicht sahen, würden ihre Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Sie lief an dem zugefrorenen Bach entlang, der hinter dem Haus ihrer Eltern vorbeiführte. Die Dorfstraße war zu gefährlich. Dort patrouillierten seit ein paar Tagen Soldaten des Sultans, um die Armenier und Kurden, die nur durch die Straße voneinander getrennt in ihren Häusern lebten, daran zu hindern, übereinander herzufallen und sich die Kehlen durchzuschneiden.
Leise knirschte der Schnee unter Fatmas Füßen. Sie hatte geglaubt, dass sie in der Dunkelheit Angst haben würde, aber sie hatte keine – sie war viel zu aufgeregt, um sich zu fürchten. Gleich würde sie etwas sehen, was kaum ein Mensch je gesehen hatte. In den gefütterten Wildlederstiefeln, die ihr Vater ihr geschenkt hatte, ging sie mit so federleichten Schritten durch den Schnee, als würde sie tanzen. Warum schenkten Elisas Eltern ihrer Freundin nicht auch solche Stiefel? Vielleicht stimmte es ja doch, dass die Armenier böse Menschen waren.
Plötzlich zuckte Fatma zusammen. Nur einen Steinwurf entfernt, vor dem großen Schuppen, in dem die Schaffelle lagerten, sah sie im Schneetreiben ihren Vater. Er kommandierte ein halbes Dutzend vermummter Männer, die schwere Kisten von einem Pferdeschlitten in den Schuppen schleppten. Was hatte das zu bedeuten? Ihr Vater hatte doch gesagt, er wäre im Schafstall, um den Opferhammel auszusuchen, den er morgen früh schlachten würde. Und der Schafstall war am anderen Ende des Dorfes.
Vom Turm der armenischen Kirche schlug die Uhr. Wieder regte sich Fatmas Gewissen. Es war, als würde Elisa nach ihr rufen. Obwohl sie zu gerne gewusst hätte, was ihr Vater bei dem Schuppen trieb, überquerte Fatma den zugefrorenen Bach, um am anderen Ufer weiterzulaufen. Wenn ihr Vater sie erwischte, würden ihre Wünsche Allahs Ohr nicht erreichen – Elisa war eine Ungläubige, sie allein konnte das Wunder nicht bewirken.
Das Läuten der Kirchenglocke wies Fatma den Weg. Sie musste sich nur genau in die entgegengesetzte Richtung halten. Mit ihren leichten Stiefeln kam sie so rasch voran, dass der letzte Glockenschlag noch nicht verklungen war, als sie auch schon das freie Feld erreichte.
Da knallte irgendwo in der Ferne ein Schuss.
3
Warum nur hatte Allah den Winter erschaffen? Hätte er es nicht bei Frühling, Sommer und Herbst belassen können?
Wehmütig erinnerte sich Fuad, ein Händler aus der Provinzhauptstadt, an die letzte Reise, die ihn in diese Gegend geführt hatte, während er sich am offenen Kamin der Karawanserei, wo er vor wenigen Minuten eingekehrt war, die Hände rieb, um sich aufzuwärmen. Damals hatte er sich mit dieser kleinen armenischen Hure unter freiem Himmel vergnügt, eine wunderbar laue Sommernacht lang, um den Verkauf von vier Ballen Tuch und sieben Fässern Olivenöl zu feiern. Das süße kleine Dreckstück hatte ihm beim Vögeln den Sack so zärtlich gekrault, als wären lauter Goldstücke darin. Bei dem Gedanken daran durchzog ein wohliges Gefühl seine Lenden. War das wirklich erst vor zwei Monaten gewesen?
»Hier, dein Tee!«
»Stell ihn auf den Schemel.«
Fuad nahm einen Schluck. Wenigstens war der Tee heiß. Doch wenn er die Wahl gehabt hätte, wäre er hundertmal lieber in einer armenischen Taverne abgestiegen – die Christen hatten nicht nur die besseren Huren, sondern auch die besseren Getränke! Immer nur Apfeltee, Schwarztee oder Pfefferminztee. Das Zeug floss ihm allmählich aus den Ohren heraus.
Über den Rand seines Glases schaute Fuad sich um. In dem Teehaus saßen ein paar Bauern, ein Händler mit einem Fez auf dem Kopf, der irgendwelche Zahlen auf ein Blatt Papier kritzelte, und ein Dutzend Soldaten. Fuad musterte ihre Gesichter. Ob sie ihm einen Hinweis geben konnten? Schließlich war er nicht zu seinem Vergnügen hier. Der Provinzgouverneur hatte ihm einen ebenso einträglichen wie schwierigen Auftrag erteilt. Er sollte ein Lot schöner, gesunder Jungfrauen besorgen, mit blonden Haaren und hellen Augen, die nicht älter sein durften als zwölf Jahre, für den Harem eines hohen Herrn im fernen Konstantinopel, der Hauptstadt des Reiches. Wo aber sollte man solche Kostbarkeiten finden? Man hatte Fuad gesagt, in der Gegend würde es von blonden Menschen mit hellen Augen nur so wimmeln, Flüchtlingsfamilien aus dem Kaukasus, die sich hier angesiedelt hätten und die für einen vernünftigen Preis bereit seien, ihre Töchter zu verkaufen. Doch das einzige Wesen, das dieser Beschreibung einigermaßen entsprochen hatte und aus der Gegend stammte, war die kleine armenische Hure gewesen, die seinen Sack gekrault hatte. Und die war schon über dreißig und alles andere als das, was man in Konstantinopel unter einer Jungfrau verstand. Beim Barte des Propheten!
Fuad rückte seinen Turban zurecht und spitzte die Ohren, um den Gesprächen der Soldaten zu lauschen. Er konnte mit seinen Ohren, was andere Menschen nur mit ihren Augen konnten: Er konnte sie auf ein bestimmtes Ziel richten, so dass er nur zu hören bekam, was er auch hören wollte.
Die Soldaten redeten über ihren Einsatz, zu dem sie hierher kommandiert worden waren. Wenn Fuad richtig verstand, bildeten sie im Auftrag des Sultans bewaffnete kurdische Spezialeinheiten aus, damit diese den Armeniern ihre Frechheiten austrieben. Offenbar weigerten sich immer mehr Armenier, die Schutzzölle, die die Kurden im Namen der Regierung erhoben, ordnungsgemäß zu entrichten, ja sie fingen sogar an, Banden zu bilden, um sich zur Wehr zu setzen. Fuad hob anerkennend die Brauen. Was für ein kluger Schachzug: Man nahm die kurdischen Schurken, die ja auch nichts anderes konnten als überall Unruhe stiften, an die Kandare, indem man sie zu Aufsehern der armenischen Schurken machte … Die Christen hatten für so was eine treffende Redensart: Den Teufel mit dem Belzebub austreiben.
»He, du da! Was stehst du da rum? Setz dich zu uns!«
Drei Soldaten, die etwas abseits von ihren Kameraden in einer Ecke hockten, winkten ihn zu sich. Fuad ließ sich das nicht zweimal sagen.
»Darf ich die Herren auf ein Pfeifchen einladen?«, fragte er, als er sich auf ein freies Polster niederließ.
»Ja doch, gerne.«
Fuad bestellte eine Wasserpfeife, und während er mit den Soldaten ein paar belanglose Worte wechselte, überlegte er, wie er das Gespräch unauffällig auf das eigentliche Thema bringen konnte. Er musste höllisch aufpassen, was er sagte, der Sklavenhandel war seit Jahren offiziell verboten. Auch wenn sich die Herrschaften in Konstantinopel einen Dreck darum scherten.
Der Wirt brachte gerade die Wasserpfeife, da flog die Tür auf, und ein Melder stürzte in die Karawanserei.
»Sie haben den Steuereintreiber umgebracht!«, rief er, ganz außer Atem.
Die Soldaten zuckten gleichgültig die Achseln. Nur ein Offizier sprang auf.
»Was sagst du da?«
»Einfach abgeknallt!«, bestätigte der Melder. »Aus dem Hinterhalt erschossen!«
»Ja, und?«, lachte ein Soldat. »Das war doch nur ein Kurde!«
»Nur ein Kurde?« Der Offizier trat in die Mitte des Raums und blickte in die Runde. »Versteht ihr denn nicht? Er war einer von uns! Ein Moslem!« Sein Gesicht war weiß wie eine Wand, und die Spitzen seines Bartes zitterten vor Erregung.
Plötzlich war es so still in dem Teehaus, dass man nur noch das Gurgeln der Wasserpfeifen hörte.
»Dafür verpassen wir ihnen eine Ohrfeige!«, rief der Offizier. »Im Namen Allahs und des Sultans!« Er nahm seine Pistole aus dem Halfter und schoss in die Luft. »Padişahim çok yaşa!«
»Padişahim çok yaşa!«, brüllten die Soldaten im Chor. »Lang lebe der Padischah!«
4
Es hatte aufgehört zu schneien, und die Wolken trieben so weit auseinander, dass das Licht des Mondes in immer breiteren Silberstreifen auf die schneebedeckte Steppe herabflutete.
Elisa wusste nicht, wie lange sie schon auf dem erfrorenen Baumstumpf saß und wartete, oben auf der kleinen Anhöhe, unweit der Quelle des Baches, wo sie sich immer mit Fatma traf, seit ihre Eltern ihnen verboten hatten, einander zu sehen. Am Anfang hatte Elisa so heftig gefroren, dass sie geglaubt hatte, es keine fünf Minuten in der Kälte auszuhalten. Doch dann hatte sie sich einfach vorgestellt, sie wäre ein lebender Eiszapfen, das Kind einer Eiszapfenfamilie, das nichts mehr liebte als die Kälte. Seitdem hatte sie nur noch Angst, es könnte plötzlich warm werden und sie würde schmelzen.
Ein Knall wie von einer Peitsche hallte aus der Richtung des Waldes herüber, der sich hinter dem Dorf an der Straße zur Provinzhauptstadt erhob. Elisa kniff die Augen zusammen, doch sie konnte nichts erkennen. Wahrscheinlich war das ein Jäger gewesen, vielleicht auch der Wirt der Karawanserei – in dem Wald gab es jede Menge Wild. Aber musste er ausgerechnet heute auf die Jagd gehen, ausgerechnet in dieser Nacht, in der das Wunder geschehen sollte? Plötzlich war Elisa kein Eiszapfen mehr, sondern nur noch ein Mädchen, das entsetzlich fror und außerdem fürchterliche Angst hatte. Warum war sie nicht bei ihren Eltern geblieben? Vielleicht waren ihre Eltern gar nicht mehr da, wenn sie nach Hause kam. Vielleicht hatte der Steuereintreiber sie verhaftet und ins Gefängnis gesteckt.
»Allah sei gepriesen – da bist du ja!«
Wie aus dem Nichts tauchte Fatma vor ihr auf. Mit ihren Fellen und ihrem Schal um den Kopf sah sie aus wie ein Waschbär.
»Jesus Maria«, stieß Elisa hervor, »hast du mich erschreckt! Wo bist du so lange geblieben?«
»Ich kann nichts dafür. Meine Mutter …«
»Das sagst du immer, wenn du zu spät kommst.«
»Ist es etwa meine Schuld, wenn morgen Bairam ist? Das ist Kismet, der Wille Allahs.«
»Kismet? Daran glauben doch nur die Türken.«
»Du bist ja nur neidisch, weil euer Jesus kein Kismet kann. – Los, mach mal Platz.«
Elisa rückte ein Stück beiseite, damit Fatma sich neben sie auf den Baumstumpf setzen konnte. Elisa fiel ein Stein vom Herzen. Gott sei Dank, dass Fatma endlich da war!
Auch wenn Elisa es nie im Leben zugegeben hätte, weil sie und Fatma fast immer miteinander stritten, gab es doch keine bessere Freundin auf der Welt. Die beiden schmiegten sich so dicht aneinander, dass ihre Atemwölkchen sich in der Luft vermischten.
»Hast du deine Kette dabei?«, fragte Elisa.
»Ja«, sagte Fatma. »Du auch?«
Sie zogen ihre Ketten aus den Manteltaschen: zwei einfache Perlenkränze, die einander zum Verwechseln ähnlich sahen. Fast alle Bewohner des Dorfes hatten solche Gebetsketten – der Goldschmied im Ort machte nur diese eine Sorte. Damit beteten die Moslems die Suren des Korans, und die Christen die Gesetze des Rosenkranzes.
»Was wünschst du dir, wenn es passiert?«, fragte Fatma.
»Genau dasselbe wie du«, erwiderte Elisa.
»Woher willst du wissen, was ich mir wünsche?«, protestierte Fatma.
»Wollen wir wetten?«, fragte Elisa.
»Ja. Aber sag du zuerst!«
»Nein, du!«
Sie machten eine Pause. Dann platzten sie beide im selben Augenblick heraus.
»Dass wir für immer Freundinnen bleiben …«
»Ganz egal, was passiert …«
»Und wir uns immer helfen …«
»Und immer zusammenhalten …«
»Versprochen?«
»Versprochen!«
Sie nahmen sich in den Arm und drückten ihre Gesichter ganz fest aneinander. Erst als sie sich wieder losließen, fiel Elisa ein, dass sie ja eigentlich hierhergekommen waren, um sich etwas ganz anderes zu wünschen.
»Und was ist mit unseren Vätern?«, fragte sie.
»Wenn wir zusammenhalten«, sagte Fatma, »müssen die sich auch vertragen, irgendwann. Dann bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Und die anderen Männer im Dorf auch.«
»Und du glaubst wirklich, dass der Zauber wirkt?«
Fatma warf den Kopf in den Nacken, als dürfe ihr niemand widersprechen. »Der Hodscha hat es in der Koranschule gesagt, und der Hodscha ist der klügste Lehrer der Welt.« Plötzlich veränderte sich ihr Gesicht. »Eins könnte nur sein …«
»Nämlich?«
»Dass es wegen dir nicht geht.«
»Wegen mir? Warum?«
»Weil du eine Christin bist, eine Ungläubige, und ich weiß nicht, ob Allah …«
»Kann ich was dafür, dass meine Eltern mich getauft haben?«, fiel Elisa ihr ins Wort.
»Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich war das Kismet.« Fatma dachte nach. »Ich glaube, ich weiß was«, sagte sie dann. »Gib mir deine Kette.«
»Wozu?«
»Wir tauschen. Du gibst mir deine, und ich gebe dir meine. – Los, mach schon!«
Zögernd gab Elisa ihr den Perlenkranz und nahm dafür den ihrer Freundin.
»Jetzt kann nichts mehr schief gehen«, sagte Fatma zufrieden. »Im Namen Allahs!«
»Und der Jungfrau Maria!«, fügte Elisa hinzu.
Schulter an Schulter saßen sie da, und während sie die Gebetsketten so fest in ihren Händen hielten, dass sie die Perlen durch ihre Handschuhe spürten, warteten sie zusammen auf das Wunder. Vor ihnen lag die weiße Steppe im Mondlicht, eine leere Wüste aus Schnee und Eis. Irgendwo rief ein Käuzchen, und ein schwarzer Vogel glitt lautlos mit seinen ausgebreiteten Schwingen durch die Nacht.
»Da! Sieh nur! Ich glaube, es fängt an.«
»Ja! Ich sehe es auch, ganz deutlich.«
Endlich geriet die Landschaft in Bewegung. Ein eisiger Nachtwind strich über das Land, die Bäume des Wäldchens wiegten ihre Kronen wie Menschen ihre Köpfe, so als würden sie noch zögern, bevor sie sich verneigten. Die Mädchen hielten den Atem an. War dies das Wunder, das sie herbeigesehnt haben? Fast gleichzeitig fingen sie an zu beten.
»Bismillahrirahmanirahim …«
»Vater unser, der du bist im Himmel …«
Mit unterschiedlichen Worten, doch mit derselben Kraft des Glaubens an den einen, allmächtigen Gott wollten sie das Wunder herbeibeschwören. Und wirklich: Plötzlich sahen sie dunkle Gestalten, die zwischen den Bäumen hervorbrachen und auf das Dorf zustürzten.
»Gelobt sei Jesus Christus …«, flüsterte Elisa, so andächtig wie in der Kirche.
»Allah ekber …«, flüsterte Fatma und warf sich zu Boden. »Gott ist groß!«
Und dann geschah etwas, das noch viel größer, noch viel gewaltiger war als das größte und gewaltigste Wunder, das Elisa und Fatma sich vorstellen konnten: Eine Fackel zischte durch die Luft, in ihrem Schein sahen sie die Umrisse eines Schuppens, und im nächsten Augenblick erbebte die Erde in einer Explosion, als sei das Jüngste Gericht angebrochen.
5
Bis zu den Sprunggelenken versank der Esel in dem verharschten Schnee, während er die kleine Anhöhe erklomm. Dahinter musste sich die Ebene erstrecken, wo es angeblich ein paar Tscherkessen-Dörfer gab. Obwohl Fuad das Tier immer wieder mit seinem Bambusstöckchen auf die Kruppe schlug, knickte es alle paar Schritte ein. Fuad wünschte den Gouverneur zum Teufel, der ihn in diese gottverlassene Gegend geschickt hatte. Was für ein Land, das nur aus Steppe und endlosen Hügelketten bestand. Himmel und Erde verschmolzen am Horizont zu einem einzigen, ununterscheidbaren, schmutzigen Grau, in dem sich das ganze Elend des Winters offenbarte. Hier sollten Tscherkessen mit ihren schönen Töchtern hausen? Eher würden die Huris in der Hölle tanzen, als dass sich ein Mensch freiwillig in dieser Gegend ansiedeln würde.
Endlich erreichte Fuad die Hügelkuppe. Ebenso erschöpft wie er selbst, blieb sein Esel auf der Anhöhe stehen, alle vier Beine von sich gestreckt wie ein Sägebock. Fuad nahm einen Zipfel seines Turbans und trocknete sich den Schweiß am Hals, der ihm trotz der eisigen Kälte aus allen Poren drang. Eine Erkältung würde ihm gerade noch fehlen! Obwohl er im letzten Jahr seine Pilgerfahrt nach Mekka unternommen hatte, wie der Prophet es verlangte, und siebenmal gegen den Uhrzeigersinn um die heilige Kaaba geschritten war, so dass für ihn der Weg frei war zu den ewigen Freuden des Paradieses, hatte er nicht vor, ausgerechnet hier zu verrecken, an diesem gottverlassenen Ende der Welt.
Er griff gerade in seinen Mantelsack nach einem Stück Ziegenkäse, das der Wirt ihm mitgegeben hatte, da sah er zwischen den Ohren seines Esels eine Rauchfahne am Horizont aufsteigen. Beim Barte des Propheten, was war das?
Er gab seinem Esel die Fersen, und eine halbe Stunde später erreichte er den rauchenden Ort. Fuad drehte sich der Magen um. So musste die Hölle aussehen, in die Allah die Ungläubigen stieß. Hier hatte einmal ein Dorf gestanden, doch alles, was davon übrig war, zwischen den Überresten einer Kirche und der Ruine einer Moschee, waren abgebrannte Häuser, Schuppen und Scheunen, aus deren rauchgeschwärzten Wänden verkohlte Stümpfe hervorragten. Das Feuer hatte mit solcher Macht gewütet, dass Schnee und Eis geschmolzen waren und eine riesige, klaffende, schwarze Wunde in der weiten weißen Winterlandschaft hinterlassen hatten, schwärend von den Spuren der Verwüstung: umgestürzte Karren, zerstörte Pflugscharen, verendete Tieren. Und überall lagen Leichen, von Armeniern und Kurden, von Männern und Frauen, von Alten und Kindern – alle im Tod miteinander vereint. Gegen den beißenden Gestank bedeckte Fuad sein Gesicht mit dem Ende seines Turbans. War das die Ohrfeige des Sultans, zu der die Soldaten aufgerufen hatten, als sie aus der Karawanserei gestürmt waren? Die Strafe, mit der die Armenier zur Vernunft gebracht werden sollten?
Fuad stieg von seinem Esel und schaute sich um. Tatsächlich, die Spuren im Schnee deuteten auf Soldaten hin, Spuren von teuren Lederstiefeln. Obwohl er beim Anblick der verkohlten Leiche einer Frau, die zwei ebenso verkohlte Säuglinge in ihren erstarrten Armen hielt, sich fast erbrach, regten sich plötzlich in ihm jene Instinkte, denen er die besten Geschäfte seines Lebens verdankte.
Ob die Soldaten vielleicht etwas Brauchbares übersehen hatten?
Mit abgewandtem Kopf stieg er über die Leichen. Er näherte sich gerade einem Haus, das zu den größeren des Dorfes gehört haben musste, als er ein Geräusch hörte, ein leises Wimmern und Schluchzen. Er blickte in die Richtung, aus der die Laute kamen. Hinter einer Mauer tauchten zwei Mädchen auf – offenbar die einzigen Wesen, die die Verwüstung überlebt hatten. Ihre Gesichter waren von Tränen, Schmutz und Rauch verschmiert. Ihr Anblick rührte Fuad in der Seele. Er hatte von seinen vier Frauen selber ein halbes Dutzend Töchter.
»Allah, Allah«, sagte er. »Wer seid ihr denn? Na, kommt mal her, meine Täubchen.«
Er winkte sie zu sich heran. Doch die Mädchen waren so verängstigt, dass sie sich nicht vom Fleck rührten. Fuad machte einen Schritt auf sie zu.
»Habt keine Angst, ich tue euch nichts.«
Er griff in seine Tasche und zog ein Stück getrockneten Honig hervor.
»Seht mal«, sagte er und streckte ihnen die Süßigkeit entgegen. »Ich habe was für euch.«
Zögernd löste sich die größere der beiden aus ihrer Erstarrung, während ihre Freundin sie an ihrem Schaffell zurückhielt. Fuad machte noch einen Schritt auf sie zu.
»Wer seid ihr? Habt ihr keine Namen? Oder könnt ihr gar nicht sprechen?«
Die Größere wollte etwas sagen, aber die Kleinere hielt ihr den Mund zu. Die Größere wehrte sich, dabei verrutschte die Mütze der Kleinen. Die Mütze fiel zu Boden und ihr Haar flutete offen auf ihre Schultern.
Im selben Augenblick wich Fuads Mitleid freudiger Überraschung.
»Allah sei gepriesen!«, rief er. »Er hat meine Gebete erhört.«
Das Mädchen, das jetzt seine Mütze vom Boden hob, hatte blonde Haare und graue Augen. Und das andere, dessen Hände bis zu den Knöcheln mit rotem Henna eingerieben waren, war trotz der Verwüstung im Gesicht so schön, dass die Farbe der Haare und Augen vollkommen gleichgültig war …
Erstes BuchDer Schatten Gottes
1904
1
Wie ein riesiger Stern, der vom Himmel herabgefallen war, erstreckte sich Konstantinopel, die Hauptstadt des Osmanischen Reichs, über die sieben Hügel diesseits und jenseits des Bosporus, um hier, im Zentrum jahrhundertealter Macht, wo zwei Weltmeere zusammenströmten, die Kontinente Asien und Europa miteinander zu verbinden. Und wie ein Abbild dieses Sterns erhob sich, an grün bewaldeten Hängen über den funkelnden, ewig strömenden Gewässern, die tausend und ein Geheimnis in den Fluten wahrten, der Yildiz-Palast mit seinen kunstvoll ineinander verschachtelten Gärten und Gebäuden, eine weiße Stadt in der Stadt, in dreifachem Kreise von hohen Mauern umgeben, an denen jedes irdische Wägen und Meinen zunichte wurde. Hier residierte, durch fünftausend Wachen von seinen Untertanen abgeschirmt, der allmächtige Kaiser der Osmanen, Abdülhamid II., »der Schatten Gottes auf Erden, Sultan der Sultane, Beherrscher der Gläubigen, Herr zweier Erdteile und zweier Meere, Schutzherr der heiligen Städte« – das letzte Rätsel des Orients.
Der Mittag nahte, und mit flimmerndem Glast brannte die Sommersonne auf die Stadt herab, verwandelte das Blei der Kuppeln in Bronze, das Laub der Zypressen in Silber und übergoss die Moscheen und Paläste mit dem Gold von Byzanz. Angetan mit seinen prächtigsten Festtagsgewändern, durchschritt Abdülhamid das lebende Spalier, das die Frauen und Konkubinen seines Harems im Garten von Yildiz bildeten, und warf ihnen mit beiden Händen Goldstücke zu, die sie von den Kieswegen auflasen und dabei den Boden küssten, den seine Füße berührten. Seit einer Woche schon feierte man das Jahresfest seiner Thronbesteigung, ausgerichtet von der Sultan Valide, der Ziehmutter des Sultans und obersten Herrin des Serails, die keine Stunde verstreichen ließ, ohne ihrem Ziehsohn und Gebieter eine neue Freude zu bereiten, so dass das »Haus der Glückseligkeit«, wie der kaiserliche Harem bei seinen Bewohnerinnen hieß, von morgens bis abends vom Lachen der Frauen widerhallte.
Nur Elisa, eine kleine, unscheinbare, gerade achtzehn Jahre alte Sklavin, ein Nichts in dem unüberschaubar großen Getriebe, hielt sich abseits von den Feierlichkeiten. In der Haremshierarchie, die sich in Dutzende unterschiedlich privilegierter Kreise und Stände gliederte – angefangen vom Hofstaat des Sultans und seiner Ziehmutter über den seiner vier rechtmäßigen Ehefrauen sowie seiner Favoritinnen bis hinunter zu den Odalisken und Gözdes, jener Unzahl weiblicher Wesen, denen der Sultan bereits beigewohnt oder auf die er ein Auge geworfen hatte –, war sie auf der alleruntersten Sprosse der Leiter angesiedelt. Sie war nicht mehr als eine gesichts- und namenlose Dienerin, die von der Büyük Kalfa, der für die Ordnung und Disziplin zuständigen Oberaufseherin, zu beliebigen Arbeiten eingesetzt wurde und samstags, wenn die Sklavinnen das »Pantoffelgeld« ausgezahlt bekamen, den wöchentlichen Lohn für ihre Dienste im Harem, sich stets mit der geringsten Summe begnügen musste.
Wie jede freie Minute, die sie erübrigen konnte, war Elisa in die Menagerie verschwunden, sobald die Büyük Kalfa dreimal in die Hände geklatscht hatte, um den Putzdienst zu beenden. Das Gehege war ein kleiner zoologischer Garten mit wilden Tieren aus allen Gegenden des Reiches, mit Löwen und Tigern und Elefanten, und befand sich auf einer Insel inmitten eines von Seerosen bewachsenen Teiches, der in seiner äußeren Gestalt dem Schriftzug des Sultans nachgebildet war – Zeichen seiner Macht und Allgegenwart, die Allah ihm verliehen hatte.
»Wirst du denn heute gar nicht satt?«
In der spätsommerlichen Stille, die in diesem Teil des Parks nur vom Zwitschern und Singen der Vögel aus den goldenen Volieren gestört wurde, fütterte Elisa ihr Lieblingstier, eine Giraffe. Mit der Zunge nahm das Tier den Akazienzweig aus ihrer Hand und führte ihn sich ins Maul, um vorsichtig die Blätter mit den Lippen abzustreifen. Elisa musste jedes Mal staunen, dass die dornigen Zweige weder die rosafarbene Zunge noch die samtenen Lippen verletzten.
»Ach, wenn ich nur sehen könnte, was du gerade siehst«, seufzte Elisa, als die Giraffe den Hals wieder in die Höhe reckte, um über die Haremsmauer zu schauen. »Bitte, verrat es mir! Was passiert drüben in den Straßen und Gassen? Was für Menschen leben dort? Tragen die Frauen genauso schöne Kleider wie wir? Lachen oder weinen sie? Haben die Blumen und Bäume dort andere Farben als hier?«
Nach jeder Frage schaute sie zu der Giraffe auf, um aus den malmenden Bewegungen der Kiefer eine Antwort abzulesen. Stundenlang konnte Elisa dieses Spiel spielen. Die Giraffe lieh ihr die Augen, um zu sehen, was ihren eigenen Augen verborgen blieb. Mit ihrer Hilfe malte sie sich das Leben auf der anderen Seite der Umschließung aus, ein Leben, das sie selbst nie kennengelernt hatte. Wie alle Frauen und Mädchen des Harems glaubte Elisa zwar auch, dass das Leben im Haus der Glückseligkeit tausendmal schöner war als irgendwo da draußen – aber konnte man es wirklich wissen? Sie würde es so gerne selber erfahren, einfach nur, um es mit eigenen Augen zu sehen, statt sich auf die Schilderungen der Eunuchen verlassen zu müssen, ihrer einzigen regelmäßigen Verbindung zur Außenwelt. In fünf Jahren, so hoffte Elisa, würde sie wissen, wie das Leben auf der anderen Seite der Mauer aussah. Seit vier Jahren arbeitete sie bereits im Haus der Glückseligkeit, und nach neun Jahren wurden die meisten Sklavinnen frei gelassen – vorausgesetzt, sie empfingen kein Kind von ihrem Gebieter. Doch dass sie, Elisa die Armenierin, das unscheinbarste aller Haremsgeschöpfe, vom »Sultan der Sultane« schwanger würde, war so unwahrscheinlich wie die Aussicht, dass die Sonne in den Bosporus fiel.
»Kannst du ihn schon sehen?«, fragte Elisa.
Die Giraffe schaute nur hochmütig auf sie herab.
»Du weißt ganz genau, wen ich meine«, schimpfte sie.
Dabei konnte Elisa selber nicht sagen, wen sie meinte. Sie hatte das Gesicht des Menschen, nach dem sie fragte, noch nie gesehen, sie wusste nicht einmal, ob es einem Mann oder einer Frau gehörte. Es waren nur ein paar Töne, die sie von diesem Menschen kannte, eine kleine, wunderschöne Melodie. Aber diese Töne bedeuteten ihr Leben. Das Leben, das sie später einmal führen würde, auf der anderen Seite der Haremsmauer.
Sie gab der Giraffe noch einen Akazienzweig.
»Nun sag endlich – siehst du ihn?«
Aber bevor das Tier den Kopf heben konnte, erscholl vom Turm des Hauptgebäudes die Fanfare, die die Frauen zum Freitagsempfang rief.
2
Der Freitagsempfang war das wichtigste Ereignis der Woche im Haus der Glückseligkeit. Alle Frauen, die in der Haremshierarchie einen Rang bekleideten, fieberten ihm von Samstag bis Donnerstag entgegen, in der Hoffnung, dass das Auge des Herrschers auf sie fiel und er ein paar Worte an sie richtete. Worte, die das Paradies bedeuten konnten.
Ihrer Stellung entsprechend, wartete Fatima ziemlich weit unten in der endlos langen Reihe der juwelengeschmückten Frauen, die auf die große Flügeltür starrten, durch die der Sultan jeden Moment in den mit Gold und Stuck verzierten Saal eintreten musste.
Das Herz klopfte ihr bis zum Hals. Würde der Plan aufgehen, mit dem sie das kaiserliche Auge heute auf sich lenken wollte? Noch nie hatte Abdülhamid sie bislang eines Blickes gewürdigt, geschweige denn mit ihr gesprochen. Sie war für ihn nichts weiter als eine von zahllosen Perlen an einer unendlich langen Perlenkette, und wahrscheinlich wusste er gar nicht, dass es sie überhaupt gab. Als Zofe der vierten Kadin, die Anfang des Jahres gestorben war, musste sie froh sein, nach dem Tod ihrer Herrin noch an dem Empfang teilnehmen zu dürfen, und es war vielleicht nur eine Frage der Zeit, dass die Büyük Kalfa sie von der Zeremonie ausschließen würde. Darum musste der Plan gelingen, musste der Sultan sie heute endlich bemerken. Heute oder nie!
Fatima blickte zur Stirnseite des Saals, wo links und rechts von Abdülhamids leerem Thron die drei noch lebenden Kadins saßen, die Ehefrauen des Herrschers, zusammen mit der Sultan Valide, der kaiserlichen Ziehmutter, sowie den sieben Ikbals, den offiziellen Favoritinnen. Dort, so war Fatima zutiefst überzeugt, sollte sie selber sitzen, dort war der Platz, den das Schicksal für sie vorgesehen hatte – ihr Kismet! Auch wenn diese schönen und hochmütigen Frauen, die jetzt so gelangweilt auf das Erscheinen Abdülhamids warteten, unerreichbar hoch über allen anderen Bewohnerinnen des Harems zu thronen schienen, genügte ja ein einziges Wort des Sultans, um selbst die niederste Sklavin in eine Favoritin zu verwandeln, der dann bereits beim nächsten Freitagsempfang die Prinzessinnen die Hand küssen mussten.
Alles hing von Murat ab, dem Spaßmacher. Er hatte den Plan mit Fatima ausgedacht, und sie hatte ihm für den Fall des Gelingens ihr Pantoffelgeld eines ganzen Jahres versprochen. Obwohl sie sonst immer noch wie zu der Zeit, als sie Fatma geheißen hatte, jedes Geheimnis mit Elisa teilte, hatte sie ihre Freundin diesmal nicht eingeweiht. Sie kannte Elisa wie sich selbst – sie hätte mit Sicherheit versucht, sie von dem Plan abzubringen. Darum wusste außer ihr nur Murat, was gleich passieren würde. Durch das Gitterfenster hinter dem Thron glaubte Fatima für einen Moment das Gesicht des Zwerges zu sehen. Ob er wohl schon die Hand an dem elektrischen Zünder hatte, der die unterirdische Schnur mit der Fackel verband, die direkt vor Fatima im Boden eingelassen war?
Sie versuchte, einen Blick von Murat zu erhaschen, aber es gelang ihr nicht. Saliha, die sechste Ikbal, verdeckte die Sicht auf das Gitterfenster, hinter dem sich der Zwerg verbarg. Saliha war die schönste der sieben Favoritinnen, eine Tscherkessin wie Fatima, und im Haus der Glückseligkeit wurde getuschelt, sie habe Abdülhamid verhext, habe mit ihren goldenen Haaren, den rosigen Wangen und den blaugrünen Augen so vollständig von seinem Herzen Besitz ergriffen, dass keine andere Frau darin mehr Eingang finden könne. Niemand zweifelte daran, dass sie bald den verwaisten Platz der vierten Kadin einnehmen würde.
Als ihre Blicke sich begegneten, zuckte Fatima zusammen. Saliha schaute sie an, wie nur eine Frau eine andere Frau anschauen konnte. Ahnte die Favoritin, was sie vorhatte? Nein, das war unmöglich – Fatima hatte Murat zu viel Geld versprochen, als dass er sie verraten könnte. Trotzdem bekam sie plötzlich solche Angst, dass sie am liebsten alles abgebrochen hätte. Vielleicht war der Plan doch zu kühn? Vielleicht würde der Sultan das Zeichen missverstehen und sie aus seinem Harem verstoßen … Sie stellte sich auf die Zehenspitzen, verrenkte sich den Hals nach dem Zwerg, hob sogar die Hand, um ihm einen Wink zu geben.
Doch da ging schon die Flügeltür auf, und der Sultan betrat den Saal. Grüßend durchschritt er die doppelte Reihe seiner Frauen, mit langsamen und gemessenen Schritten, um den links und rechts niedersinkenden, seidenrauschenden Wesen Gelegenheit zu geben, den Boden zu berühren, den seine Herrscherfüße streiften.
Fatima hielt den Atem an. Wie würde der Sultan reagieren?
Er führte gerade grüßend die Hand an die Schläfe, als es geschah. Eine kleine, einsame Flamme, wie von Geisterhand entzündet, loderte aus dem Boden empor, nur wenige Schritte von Abdülhamid entfernt.
Ein kurzer Aufschrei ging durch den Saal, doch der Sultan hob nur die Hand, um die Frauen zu beruhigen.
Mit einem erstaunten Lächeln blickte er auf die Fackel, dann auf Fatima.
»Was hat diese Flamme zu bedeuten?«, fragte er.
Sie nahm ihren ganzen Mut zusammen und sagte die Worte, die sie vorbereitet hatte.
»Es ist die Flamme der Liebe, ewige Majestät, die sich nach Ihnen verzehrt.«
»Von welcher Liebe redest du? Schau uns an, wenn du mit uns sprichst!«
Fatima hob ihren Blick. Aus solcher Nähe hatte sie den Sultan noch nie gesehen. Abdülhamid war schon Mitte sechzig, doch seine Augen glänzten so schwarz wie der Bart auf seinen Wangen, und die große, kräftige Nase versprach einer Frau Freuden, die eines Herrschers würdig waren.
»Mein niederer Rang verbietet es mir, Ihnen darauf Antwort zu geben«, flüsterte sie.
»Dein niederer Rang? Oder die Scham?«, erwiderte Abdülhamid. »Vielleicht schämst du dich ja, weil die Flamme so klein ist. Sie ist ja kaum größer als ein neugeborenes Kind.«
»Ich weiß«, sagte Fatima, »sie ist Ihrer nicht würdig. Aber wenn sie so brennen dürfte, wie sie es möchte, würde Ihr Harem in Flammen aufgehen.«
Sie hatte noch nicht ausgesprochen, da wuchs die Flamme auf Mannshöhe heran.
»Genug! Genug!«, rief der Sultan und lachte. »Was für eine gelungene Überraschung!«
Er tätschelte ihre Wange. »Jetzt würde uns nur noch eins interessieren«, sagte er dann. »Teilt diese Flamme noch andere Eigenschaften mit dir?«
3
Elisa wartete immer noch in der Menagerie auf die geheimnisvollen Klänge, auf die sie jeden Tag hier wartete. Aber in der Hitze des späten Sommernachmittags war nur das Zirpen der Grillen im Gras zu hören. Enttäuscht fütterte sie die Giraffe, doch ohne mit dem Tier zu sprechen. Hatte sie den Moment verpasst? Sie verstand selbst nicht, warum, aber aus irgendeinem Grund musste sie diese Töne mindestens einmal am Tag hören. Das war ihr ein ebenso dringendes Bedürfnis wie das Glas Tee oder das Stück Brot mit Rosenmarmelade, das sie morgens als Frühstück zu sich nahm.
Sie wollte sich gerade zum Gehen wenden, da sah sie ihre Freundin Fatima. Sie eilte mit wehenden Schleiern über die Brücke, die über den Teich zur Menagerie führte.
»Da bist du ja! Allah sei gepriesen!«, sagte sie, ganz außer Atem. »Du kannst dir nicht vorstellen, was passiert ist!«
»Soll ich raten?«, fragte Elisa. »Der Obereunuch hat dich geküsst!«
»Der Obereunuch hat wirklich damit zu tun. Er hat mir den Befehl überbracht! Der Kizlar Aga persönlich!«
»Der Kizlar Aga? Welchen Befehl? Ich verstehe kein Wort!«
»Der Sultan will wissen, ob ich mich wie eine Flamme bewegen kann.«
»Wie bitte?«
Fatima nahm Elisas Hände, als müsse sie sich selbst beruhigen, bevor sie weitersprach.
»Der Sultan will, dass ich für ihn tanze«, erklärte sie schließlich.
»Um Gottes willen!«, platzte Elisa heraus. »Das ist ja entsetzlich!«
»Entsetzlich?« Fatima schaute sie an, als hätte sie den Verstand verloren. »Begreifst du nicht, was das bedeutet?«
»Und ob ich das begreife! Das bedeutet, dass du hier nie wieder rauskommst! Du bleibst hier gefangen, dein Leben lang!«
»Allah segne deine Worte!«, seufzte Fatima. »Möge es wirklich so sein.«
Ein Hauch von Rosa, zart und durchsichtig wie ein Schleier, lag auf ihrem Gesicht. Doch auch ohne dass sie errötete, wusste Elisa, was in ihr vorging. Im Gegensatz zu ihr selbst war Fatima mit ihren großen Mandelaugen, den vollen roten Lippen und den kastanienbraunen Locken zu einer solchen Schönheit herangewachsen, dass sogar die kastrierten Pfauen im Park bei ihrem Anblick ein Rad schlugen. Und sie war entschlossen, ihre Schönheit zu nutzen.
»Davon hast du geträumt, seit wir hier sind, nicht wahr?«, sagte Elisa.
»Das weißt du doch«, nickte Fatima. »Aber sag, freust du dich denn gar nicht mit mir?«
»Doch, natürlich tue ich das. Wenn es dich glücklich macht.«
»Ich weiß, ich weiß«, unterbrach Fatima sie, »du träumst von einem Leben auf der anderen Seite der Mauer. Aber das ist falsch! Der Harem ist unser Leben, unser Kismet – das Schicksal, das Allah für uns bestimmt hat.«
»Für dich vielleicht, aber nicht für mich. Ich glaube nicht ans Kismet.«
»Und woran glaubst du?«
Elisa zögerte. Für Fatima war alles, was geschah, Schicksal.
Doch war das Schicksal wirklich die einzige Macht, die sie regierte?
»Siehst du?«, sagte Fatima. »Darauf hast du keine Antwort. Also sei vernünftig, und nimm die Dinge, wie sie sind. Wenn wir irgendwann nicht mehr gebraucht werden und sie uns aus dem Harem entlassen, sind wir alt und hässlich, und unser Leben ist vorbei. Deshalb müssen wir zusehen, dass wir hier auf unsere Kosten kommen.«
»Hässlich bin ich jetzt schon«, lachte Elisa. »So hässlich, dass die Büyük Kalfa mich beim Singen immer hinter dem Vorhang versteckt. Eine Beleidigung für das Auge des Sultans!«
»Das sagt die alte Hexe ja nur, weil sie neidisch auf deine Stimme ist.« Fatima zog Elisa am Arm. »Komm, wir müssen los. Die Vorstellung findet noch vor dem Abendgebet statt.«
»Ich wünsche dir viel Glück. Aber was habe ich damit zu tun?«
»Stell dich nicht dümmer, als du bist! Du musst für mich singen. Ohne deinen Gesang tanze ich wie ein Kamel.«
Elisa schüttelte den Kopf. »Nein«, sagte sie. »Das kannst du nicht von mir verlangen.«
»Warum nicht?«
»Weil ich mir immer gewünscht hatte, dass ich den Harem zusammen mit dir verlassen würde, eines Tages. So wie wir immer alles zusammen gemacht haben. Wenn du heute für den Sultan tanzt, ist es damit vorbei.«
Fatima ließ ihren Arm los. »Soll das heißen, du lässt mich im Stich? Ausgerechnet jetzt? Im wichtigsten Moment meines Lebens?«
Elisa musste schlucken.
»Außerdem, was uns betrifft, wird sich ja gar nichts ändern. Nichts kann uns je trennen. Selbst wenn du irgendwann den Harem verlässt und ich hier bleibe, kannst du mich immer noch besuchen.«
Fatima sprach so ernst, dass es keinen Zweifel an ihrem Entschluss geben konnte.
»Du … du willst es also wirklich darauf ankommen lassen?«, fragte Elisa.
»Ja, das will ich.«
»Aber …«
»Kein Aber mehr – bitte!«, sagte Fatima. »Du musst mir helfen!«
Dabei warf sie den Kopf so energisch in den Nacken, dass jeder Widerspruch zwecklos war. Plötzlich sah Elisa wieder die kleine Fatma vor sich, mit der sie zusammen von zu Hause fortgelaufen war, um das Wunder der Kadir-Nacht zu erleben. Schon damals hatte sie davon geträumt, in den Harem des Sultans zu gelangen. Ihre Mutter hatte ihr immer erzählt, dort würde ein schönes Mädchen wie sie es viel besser haben als irgendwo sonst auf der Welt, und hatte ihr Lieder vorgesungen, wie viele tscherkessische Mütter sie ihren Töchtern vorsangen: von dem herrlichen Leben, das sie im Palast des Herrschers führen würde, von dem Reichtum dort und den Festen – vor allem aber von dem Glück, das in den Armen des Herrschers auf sie warte … Ihre Mutter hatte sie sogar von einem russischen Arzt gegen Windpocken impfen lassen, damit keine Pusteln Fatmas Schönheit zerstören konnten.
Wie lange war das her? Elisa schloss die Augen. Die ganze Vergangenheit tauchte wieder auf, der ganze Weg, den sie zusammen gegangen waren. Sie sah das verwüstete Dorf, die Leichen ihrer Eltern, spürte wieder die entsetzliche Angst, die sie gehabt hatte, als sie mit ihrer Freundin durch die rauchenden Ruinen irrte, bis plötzlich Fuad auftauchte, der Sklavenhändler. Wie ein Erlöser war er ihnen erschienen.
Er hatte sie in die Provinzhauptstadt gebracht. Eine Woche brauchten sie für den Weg, sieben endlos lange Tage bei klirrender Kälte. Vom Morgengrauen bis zum Sonnenuntergang schleppten sie sich durch den knietiefen Schnee, immer der Spur des Esels folgend, auf dem der Sklavenhändler vor ihnen herritt, um abends auf fauligem Stroh in stinkenden Herbergen einzuschlafen, mit leerem Magen, einander weinend an den Händen haltend.
Halb verhungert und erfroren kamen sie in Adana an. Doch kaum hatten sie die große Stadt erreicht, veränderte sich ihr Leben, als hätte eine Fee sie mit ihrem Zauberstab berührt. Der Gouverneur war ein dicker freundlicher Mann mit rosigem Gesicht, der sie einen Monat lang fütterte, bis sie wieder bei Kräften waren, bevor er sie nach Konstantinopel brachte, mit einem dampfenden Stahlross, einer Eisenbahn, die so schnell durch die Landschaft brauste, dass einem schwindlig davon wurde.
In Konstantinopel lebten sie im Haus eines reichen Paschas, der sie für seine Söhne erziehen ließ. Fatma sollte den ältesten Sohn und Erben heiraten, Elisa dessen jüngeren Bruder, der ein verkümmertes Bein hatte und hinkte. In ein und derselben Woche bekamen sie beide ihre erste Monatsblutung. Von nun an mussten sie ihre Gesichter verschleiern, während sie für ihr künftiges Leben als Ehefrauen nähen und sticken, kochen und backen lernten. Doch wenige Monate, bevor die Hochzeit stattfinden sollte, überlegte der Pascha es sich anders. Es hieß, er könne Minister des Großwesirs werden, und um die Gunst des Sultans zu gewinnen, beschloss er, ihm die Mädchen zum Geschenk zu machen.
Am Tage des Opferfests wurden sie in den kaiserlichen Palast gebracht. Voller Wohlwollen nahm die Büyük Kalfa Fatma im Namen des Sultans als Geschenk an. Doch als sie Elisa sah, wies sie diese entsetzt zurück – sie sei viel zu hässlich, um dem Padischah unter die Augen zu treten. Ein schwarzer Eunuch kam, um Fatma allein in den Serail zu führen, aber sie ließ sich nicht von ihrer Freundin trennen. Sie kratzte und biss und wehrte sich so heftig, dass die Büyük Kalfa schließlich entschied, auch Elisa in den Harem aufzunehmen, wenn auch nur als Arbeitssklavin.
Vor der endgültigen Aufnahme wurden die zwei Mädchen gründlich untersucht, von einem grauhaarigen Eunuchen, der kaum noch Zähne hatte. Während er bei Elisa nur prüfte, ob sie kräftig genug war, um auch schwere körperliche Arbeiten zu verrichten, musste Fatma sich vor ihm entblößen, damit er ihren ganzen Körper in Augenschein nehmen konnte – der kleinste Makel genügte, um ein Mädchen zurückzuweisen. Nachdem sie diese Musterung bestanden hatte, führte der Obereunuch sie der Sultansmutter zur Genehmigung vor. Die Valide erklärte ihr Einverständnis, indem sie Fatma einen neuen, arabischen Namen gab, wie allen Mädchen, die so schön waren, dass sie das Verlangen des Sultans erregen konnten. Ab sofort hieß sie Fatima, und während Elisa als einfache Bedienstete ihre Arbeit begann, wurde Fatma dem Gefolge der vierten Kadin zugeteilt, wo sie zur Konkubine ausgebildet wurde. Doch zum Glück durfte auch Elisa die Haremsschule besuchen. So lernten sie beide lesen und schreiben, Gedichte aufsagen und Musikinstrumente spielen. Vor allem aber singen und tanzen.
»Warum antwortest du nicht?«, fragte Fatima. »Hörst du mir überhaupt noch zu?«
Wie aus weiter Ferne drang die Stimme an Elisas Ohr. Sie schlug die Augen auf. Mit einer Mischung aus Hoffen und Bangen blickte Fatima sie an. Als Elisa dieses Gesicht sah, wurde ihr ganz flau. Seit dem Tod ihrer Eltern hatten sie beide nur noch sich und niemanden sonst. Alles, was sie seitdem erlebt hatten, hatten sie zusammen erlebt. Sie waren mehr als Freundinnen, sie waren Schwestern.
Elisa nahm Fatima in den Arm und küsste sie auf die Wange.
»Also gut, wenn es dein größter Wunsch ist, lasse ich dich nicht im Stich.«
»Das heißt, du willst für mich singen?«
»Nicht für dich«, lachte Elisa, »für den Sultan!«
»Komm her, mein Zuckerchen – ich muss dich umarmen!«
Fatima drückte sie so fest an sich, als wollte sie sie zerquetschen.
»Hör sofort auf«, keuchte Elisa, »oder ich kriege gleich keinen einzigen Ton raus!«
Auf der Stelle ließ Fatima sie los. Mit einem Seufzer tätschelte Elisa der Giraffe das Maul, und zusammen gingen sie auf den Teich zu, der die Menagerie vom Rest des Parks trennte. Dabei redete Fatima wie ein plätschernder Brunnen. Jetzt, da Elisa ihr Hilfe versprochen hatte, war sie so zuversichtlich, dass sie sich ihre Zukunft in den herrlichsten Farben ausmalte. Als hätte sie schon für den Sultan getanzt und dieser sie zu seiner neuen Favoritin erhoben.
»Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schön alles wird. So schön, dass du gar nicht mehr fortwillst. Ich bekomme einen eigenen Hofstaat, und du ziehst in meine Wohnung ein. Jeden Tag feiern wir ein Fest, und einmal im Monat machen wir einen Ausflug auf die Prinzeninseln oder zu den süßen Wassern. Die Huris im Himmel werden uns beneiden.«
Sie betraten gerade die Holzbrücke, als Elisa plötzlich von Ferne etwas hörte. Sie blieb stehen, um zu lauschen. Nein, sie hatte sich nicht getäuscht. Da endlich waren sie, die Töne, auf die sie so lange gewartet hatte: das Spiel einer Flöte, irgendwo jenseits der Mauer, ein zarter, heller Klang, zögernd und tastend, als würde jemand versuchen, eine halbvergessene Melodie aus der Erinnerung hervorzuholen.
»Was ist?«, fragte Fatima. »Willst du hier Wurzeln schlagen?«
»Pssst«, machte Elisa. »Ist das nicht wunderschön?«
»Ja, ja. Trotzdem müssen wir uns beeilen.«
»Nur einen Augenblick.«
Elisa hielt ihre Freundin am Arm zurück. Jeden Tag ertönte diese Melodie, manchmal am Nachmittag, manchmal am Abend, manchmal mitten in der Nacht, und jedes Mal rührte sie etwas in ihr an, das tief verborgen in ihr lag und das sie selber nicht benennen konnte, als gäbe es einen uralten Vers zu dieser Melodie, auch wenn ihr die Worte entschwunden waren: die Ahnung von einem anderen Leben, eine geheimnisvolle Verlockung und zugleich eine dunkle, unbekannte Gefahr …
Sogar die Giraffe reckte neugierig den Hals in die Höhe.
»Was meinst du wohl, wer die Flöte spielt?«, fragte Elisa. »Ein Mann oder eine Frau?«
Fatima schaute sie mit gerunzelten Brauen an.
»Verbringst du darum jede freie Minute hier?« Dann schwanden die Zweifel aus ihrem Gesicht, und ein Grinsen machte sich darin breit. »Ich glaube, jetzt weiß ich, warum du unbedingt auf die andere Seite willst.«
4
Nadir war der hübscheste und beliebteste Eunuch des ganzen Harems, stolzer Sohn eines sudanesischen Stammesfürsten, der vor zweimal zehn Jahren an den Ufern des Nils geboren war. Er gehörte zu den wenigen privilegierten Menschen im Reich, die in der Gegenwart des Sultans leben durften, Gottes Schatten auf Erden, und dieses Privilegs war er sich mit jedem Atemzug bewusst. Seine Aufgabe war es, die Frauen und Konkubinen des Herrschers vor den Gefahren einer Welt zu schützen, die in seinen Augen nichts anderes war als ein Gefängnis der Gläubigen und ein Paradies der Ungläubigen. Mit beispielloser Würde trug er die Peitsche aus Nashornleder, sichtbares Zeichen seines Amtes. Nur wenn er in seinem engen schwarzen Stambulin-Mantel und dem roten Fez auf dem Kopf das Badehaus betrat, war es mit seiner Würde vorbei. Dann fühlte er sich wie eine Krabbe, die in kochendes Wasser geworfen wurde.
»Hast du den Kizlar Aga gesehen?«, fragte er Murat, den Spaßmacher-Zwerg, der am Eingang des Badehauses einen Teller auf der Nasenspitze balancierte. »Er hat mich rufen lassen.«
»Ich weiß«, antwortete Murat, ohne den Teller von der Nase zu nehmen. »Er wartet am anderen Eingang auf dich.«
Schwerer, dichter Schwefeldampf erfüllte die Halle, wo aus Dutzenden von Quellen warmes und kaltes Wasser in die marmornen Brunnen plätscherte. Das Wasser musste stets in Bewegung bleiben, denn in stehenden Gewässern hausten böse Geister und Kobolde. Von der hohen Kuppel hallten die Rufe der Sklavinnen wider, die, von den Hüften aufwärts nackt, auf ihren Köpfen Stapel von Tüchern trugen oder ihre unbekleideten Herrinnen auf den steinernen Bänken mit rauen Handschuhen einseiften, ihre Körper mit duftenden Ölen massierten, ihre Hände und Füße mit rotem Henna färbten oder ihre Haare zu kunstvollen Frisuren flochten, während an den Brunnen vereinzelte Gruppen von Mädchen, die heute keine Verpflichtungen mehr hatten, sich lachend und schwatzend mit Sorbets und Limonaden erfrischten, die schwitzende Eunuchen ihnen auf immer neu gefüllten Tabletts herbeischaffen mussten.
»Warum so eilig, mein Hübscher?«
»Komm, setz dich ein wenig zu uns!«
»Seht nur, wie er mit den Augen rollt!«
Nadir ignorierte die verliebten Rufe und Blicke, die aus den Badenischen zu ihm drangen. Er würde sich niemals auf die Verlockungen einlassen, mit denen jene Frauen und Mädchen, die zu beglücken der Sultan keine Zeit oder Neigung fand, die jüngeren Eunuchen verfolgten, um mit ihnen ihre ungestillten Sehnsüchte zu befriedigen, so weit die Natur dies erlaubte. Dabei war es weniger die Angst vor möglicher Entdeckung und Strafe, die ihn verzichten ließ, als vielmehr die Erkenntnis, dass es immer nur Ärger gab, wenn zwei weibliche Wesen ein und denselben Mann begehrten. Gleichgültig, ob dieser Mann der Sultan oder ein Eunuch war: Sobald er ins Spiel trat, war es mit dem Frieden zwischen den Frauen vorbei. Nadir würde sich darum auf keines dieser Abenteuer einlassen, in keinem Harem der Welt – und sollte man ihm einen eigenen schenken.
»Aus dem Weg, du Schlange!«
Mit dem Knauf seiner Peitsche stieß er eine kleine Odaliske beiseite, die wie zufällig ihr Leinentuch von ihrem nackten Leib fallen ließ, gerade als sie seinen Weg kreuzte. Kaum war sie in den Dampfschwaden verschwunden, wuchs vor seinen Augen der Kizlar Aga aus dem Nebel empor, der große und mächtige Obereunuch.
»Neger, da bist du ja!«, rief er mit seiner Fistelstimme, die so hell und dünn klang, als spräche ein dreijähriges Kind aus seinem gewaltigen Körper.
Doch für Nadir gab es keine fürchterlichere Stimme als diese. Er verharrte auf der Stelle, legte die Hände vor der Brust übereinander und verbeugte sich.
»Was wünschen Sie, Aga Efendi?«
Der Kizlar Aga war schon bejahrt und so fett wie ein gemästeter Kapaun. Obwohl er mindestens vier Zentner wog und denselben engen Stambulin-Mantel trug wie Nadir, glänzte keine einzige Schweißperle auf seiner schokoladenbraunen Stirn.
»Geh ins Theater und schau nach, ob alles in Ordnung ist. Es gibt eine zusätzliche Aufführung vor dem Abendgebet. Fatima, die Zofe der verstorbenen vierten Kadin, soll für den Sultan tanzen.«
»Oh, hat sie es also geschafft?«, fragte Nadir. Er hatte von dem Spektakel, das das kleine Luder veranstaltet hatte, längst gehört und sich einen Reim darauf gemacht.
»Das geht dich nichts an, Neger!«
»Sehr wohl, Aga Efendi.«
»Du bist mir persönlich verantwortlich, dass ewige Majestät die Vorstellung ungestört genießen kann!« Der Obereunuch tippte ihm mit seinem spitzen Fingernagel auf die Brust. »Und beeil dich, oder ich lasse dich auspeitschen.«