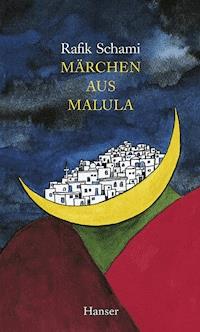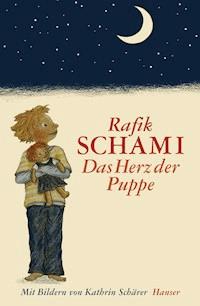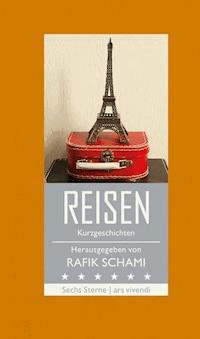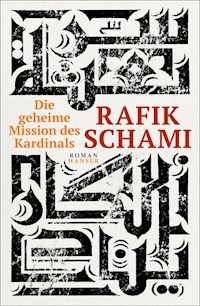
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Ein italienischer Kardinal, eine geheime Mission, ein Mord in Damaskus - der spannende neue Roman vom Meistererzähler Rafik Schami
Noch herrscht Friede in Syrien. Die italienische Botschaft in Damaskus bekommt 2010 ein Fass mit Olivenöl angeliefert, darin die Leiche eines Kardinals. Kommissar Barudi will das Verbrechen aufklären; Mancini, ein Kollege aus Rom, unterstützt ihn und wird sein Freund. Auf welcher geheimen Mission war der Kardinal unterwegs? Wie stand er zu dem berühmten Bergheiligen, einem Muslim, der sich auf das Vorbild Jesu beruft? Bei ihrer Ermittlung fallen die beiden Kommissare in die Hände bewaffneter Islamisten. Rafik Schamis neuer Roman erzählt von Glaube und Liebe, Aberglaube und Mord und führt uns tief in die Konflikte der syrischen Gesellschaft und in das berufliche Schicksal und die Liebe eines aufrechten Kommissars.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 613
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Noch herrscht Friede in Syrien. Die italienische Botschaft in Damaskus bekommt 2010 ein Fass mit Olivenöl angeliefert, darin die Leiche eines Kardinals. Kommissar Barudi will das Verbrechen aufklären; Mancini, ein Kollege aus Rom, unterstützt ihn und wird sein Freund. Auf welcher geheimen Mission war der Kardinal unterwegs? Wie stand er zu dem berühmten Bergheiligen, einem Muslim, der sich auf das Vorbild Jesu beruft? Bei ihrer Ermittlung fallen die beiden Kommissare in die Hände bewaffneter Islamisten. Rafik Schamis neuer Roman erzählt von Glaube und Liebe, Aberglaube und Mord und führt uns tief in die Konflikte der syrischen Gesellschaft und in das berufliche Schicksal und die Liebe eines aufrechten Kommissars.
Rafik Schami
Die geheime Mission des Kardinals
Roman
Carl Hanser Verlag
Meiner Mutter, Hanne Joakim, gewidmet,
die mir mit ihren Geschichten
jedweden Aberglauben vertrieben hat.
Schade, dass sie diese Geschichte
nicht mehr lesen kann.
Glaube versetzt selten Berge,
Aberglaube immer ganze Völker.
Resümee meiner bisherigen Beobachtungen
1.
Der Bergheilige
Der Regen klopfte mal schüchtern, mal aufdringlich gegen die Fensterscheiben. Kommissar Barudi schaute, wenn die Tropfen heftig trommelten, kurz von seiner Arbeit auf. Er saß in seiner Küche. Auf dem Küchentisch lagen, neben dem Laptop, der nur am Wochenende hier war, Papier, Schere, Filzstifte und eine Tube mit Klebstoff. »Ein Mistwetter«, flüsterte er und war dankbar, in seiner warmen Wohnung zu sein. Bis auf das Geschmetter des Nachbarn über ihm, der fürchterlich falsch sang, das aber mit Leidenschaft, war die Atmosphäre sehr beschaulich — wie bestellt, dachte Barudi. Sobald er im Februar in Rente gehen würde, wollte er in eine andere Wohnung umziehen. Diese hier war billig. Die Wände filterten nur Gerüche, nicht aber Geräusche.
Kommissar Barudi war Mitte sechzig, seine kräftige Gestalt und sein glattes, wenn auch ernstes Gesicht ließen ihn jedoch jünger erscheinen. Er war mittelgroß und neigte zur Fülle, sein graues Haar war schütter. Die Kurzsichtigkeit zwang ihn, da er keine Kontaktlinsen vertrug, eine immer dickere Brille zu tragen, bis seine Augen wie zwei Erbsen wirkten, die in einen Glasstrudel geraten waren.
Er hatte gerade seinen Spezialkalender zusammengeklebt, November und Dezember des aktuellen Jahres 2010, und die Monate Januar und Februar des kommenden Jahres. Darüber hatte er in großer, bunter Schrift geschrieben: Die Tage vor der Befreiung.
Dreizehn Tage im November waren bereits durchgestrichen, und über dem Februar stand in gelbleuchtender Schrift »Ich bin frei«.
Er nahm einen Schluck von seinem nach Kardamom duftenden Mokka und hängte den Kalender an die Wand neben dem Esstisch. Ein Kugelschreiber baumelte an einem Faden vom Nagel über dem Kalender.
In diesem Moment fiel Barudi auf, dass er zwar den gestrigen Tag, einen Samstag, ausgestrichen hatte, nicht aber den Sonntag. Und so nahm er den Kugelschreiber und schrieb ein großes X in das entsprechende Feld.
»Vom heutigen Sonntag, dem 14. November, bis zum 1. Februar 2011 sind es genau 79 Tage. Das macht immerhin …«, flüsterte er und tippte einige Zahlen in den Rechner seines Laptops: 79 x 24 x 60 x 606.825.600 Sekunden. Er pfiff durch die Zähne. »Fast sieben Millionen Herzschläge bis zur Rente.«
Nachdem er den Tisch freigeräumt hatte, bestellte Barudi bei einem Imbiss Köfte mit Reis und Salat und wunderte sich, wie schnell der durchnässte Bote da war. »Haben Sie einen fliegenden Teppich?«, fragte er und gab dem Mann aus Mitleid reichlich Trinkgeld.
»Danke, mein Herr, nein, keinen Teppich, sondern ein gutes Mofa.«
Der Salat war ein wenig welk, dafür war das Essen kochend heiß. Es schmeckte ihm, und er beschloss, ein Glas trockenen Rotwein dazu zu trinken.
Er schenkte sich den Rest aus der Rotweinflasche ein, warf die leere Flasche in den Mülleimer, füllte eine kleine Schale mit gesalzenen Pistazien, stellte alles auf ein kleines Tablett und trug es ins Wohnzimmer. Dort setzte er sich auf das Sofa gegenüber dem Fernseher. Er zappte eine Weile von Kanal zu Kanal. Plötzlich hielt er inne und zappte wieder zurück, denn erst in letzter Sekunde hatte er den eingeblendeten Titel der Sendung bemerkt: Heilung des Unheilbaren.
Es war eine der wenigen seriösen Talkshows, die er ab und zu sah. Er mochte den Moderator, ein bekannter, schon älterer Journalist, zu dem die Experten gerne kamen, weil er sie ernst nahm und sich exzellent vorbereitete. Nur einmal im Monat wurde seine Sendung »Unter der Lupe« im staatlichen Fernsehen ausgestrahlt.
Barudi hatte Glück. Die Sendung hatte gerade erst angefangen. Es ging um den berühmten »Bergheiligen« und seine Erfolge. Durch Handauflegen heilte dieser nicht nur »gewöhnliche« Krankheiten, es hieß, er helfe mit einer magischen Flüssigkeit sogar Krebskranken. Der Moderator hatte zwei Patienten und zwei berühmte Medizinprofessoren eingeladen. Sie hatten die Patienten lange erfolglos behandelt, bevor diese in ihrer großen Verzweiflung den Bergheiligen im Norden des Landes aufsuchten.
»Wir haben heute einen jungen Mann eingeladen, der nach einem Autounfall querschnittsgelähmt war, und eine Frau, die einen schweren Krebs hatte. Was für eine Flüssigkeit kann das sein, die solche Gesundheitsschäden heilt, bei denen die moderne Medizin scheitert?«, fragte der Moderator und gab selbst die Antwort: »Der Bergheilige residiert in einer uralten Kirche in der kleinen Stadt Derkas südwestlich von Aleppo. Hinter dem Altar liegt eine Felsenhöhle, die einst den heiligen Paulus beherbergte. Damals lag sie in einem dichten Wald. Paulus war auf einer seiner Reisen von Räubern überfallen und schwer verletzt worden. Mit letzter Kraft konnte er sich in die Höhle retten. Wasser floss dort aus einem Spalt und heilte, so will es die Legende, seine Wunden. Und es heilte Tausende von Kranken. Später hat man um die Höhle eine Kirche errichtet, die aber von Barbaren zerstört wurde. Die Anhänger des Bergheiligen haben die Kirche vor zehn Jahren wiederaufgebaut, und jetzt ist die Quelle wieder zugänglich.
Das Erstaunliche dabei ist jedoch, meine Damen und Herren, der Bergheilige ist Muslim. Viele konservative Muslime mögen ihn nicht, aber auch sie schicken ihre kranken Angehörigen — wenn auch oft heimlich — zu ihm«, erzählte der Moderator. Ein Lächeln umspielte seine klugen Augen.
Der junge Mann war nicht sonderlich gesprächig und konnte seine Freude über die Heilung nur stotternd zum Ausdruck bringen. Er ging ohne jede Hilfe durch das Studio und war fest davon überzeugt, dass der Bergheilige über göttliche Kraft verfüge. Schwarz-Weiß-Fotografien, die in die Kamera gehalten wurden, zeigten den Unfall, den Patienten im Krankenhaus und im Rollstuhl, dann ein Farbfoto nach der Begegnung mit dem Bergheiligen. Er spielte wieder Fußball. Der berühmte Orthopäde, der den jungen Mann behandelte, bestätigte diese wundersame Entwicklung.
Die Patientin neben ihm, eine vierzigjährige attraktive Frau, hatte an Darmkrebs gelitten. Nach Operation und Chemotherapie war eine geringfügige Besserung eingetreten, dann aber streute der Tumor. Ihr Arzt, der neben ihr saß, bestätigte die damals hoffnungslose Diagnose und lobte die Tapferkeit seiner Patientin. Er sagte offen, dass er lange gezögert habe, die Einladung zu dieser Sendung anzunehmen, da die Heilung, die ihn natürlich sehr freue, die Schulmedizin infrage stelle.
Sie sei im Frühjahr dieses Jahres durch eine Freundin auf den Bergheiligen aufmerksam gemacht worden, erzählte die Frau. »Was hatte ich zu befürchten! Ich hatte nichts mehr zu verlieren«, sagte sie und berichtete, wie sie dem Bergheiligen begegnet war und wie er mit ihr lange über ihren Willen zum Leben und über ihre Zukunftspläne gesprochen hatte. »Ich gebe dir Liebe und Kraft, und du wirst den Krebs besiegen«, habe er zu ihr gesagt und sie umarmt. Er habe sie mit seinen feinen Händen am Kopf, Rücken und Bauch gestreichelt und in einer fremden Sprache ein Gebet gesungen.
In drei aufeinanderfolgenden Wochen hatte sie mehrere Begegnungen mit dem Heiligen gehabt. In dieser Zeit musste sie regelmäßig fasten und durfte nur bei ihm in der Höhle einen kräftigen Schluck von seinem Elixier nehmen.
Humorvoll erzählte die Frau, wie sie an den Kebab-, Schawarma- und Falafel-Imbissständen vorbeigegangen war und den Duft gierig in sich aufgesogen hatte und wie die Lust nach deftigen Gerichten und der Hunger sie gequält hatten.
»Wenn mein Magen schon nichts bekommt, so sollen wenigstens meine Nase und meine Lunge den Duft genießen«, sagte die Frau. Das Publikum im Fernsehstudio lachte. Barudi auch.
In der vierten Woche war sie geheilt.
Der Professor bestätigte die Aussagen der Frau. Sie sei von ihm und drei Kollegen, alle bekannte Krebsexperten, zweimal gründlich untersucht worden. Es habe sich kein Tumor mehr gefunden.
»Und ich konnte mit meinem Mann und meinen drei Kindern wieder unbeschwert lachen«, erzählte die Frau und begann leise zu weinen. Ihr Nachbar, der geheilte junge Mann, strich ihr liebevoll über die Schulter.
Barudi begann ebenfalls zu weinen. Vielleicht war es dem Wein geschuldet, vielleicht seiner Einsamkeit.
»Du hättest auf mich hören sollen«, sagte er mit heiserer Stimme. Basma, seine geliebte Frau, war jung an Darmkrebs erkrankt. Als die Ärzte sie aufgaben, schlug Barudi ihr vor, zu einem berühmten Heiler im Libanon zu gehen. Es war sechzehn Jahre her. Damals war der Bergheilige noch nicht bekannt.
Sie hatte abgelehnt. »Lieber möchte ich in meinem Bett sterben als bei einem Scharlatan. Gib mir deine Hand. Sie ist mir die größte Hilfe«, hatte sie gesagt.
Barudi schaltete das Fernsehgerät aus. »Basma«, flüsterte er sehnsüchtig.
2.
Das Geschenk
Damaskus, 15. November 2010
Bereits in der Morgendämmerung sandte der Montag seine unfreundliche Botschaft: kaltes, regnerisches Wetter. Der Wind schlug die eiskalten Regentropfen in die Gesichter der Passanten und raubte ihnen die letzte Spur guter Laune.
Der Sommer hatte sich bis Ende September gedehnt, jetzt hatte der Herbst in Damaskus Einzug gehalten. Als hätte er große Achtung vor der uralten Stadt, hatte er seit vier Wochen vor ihren Toren gekauert und auf seine Gelegenheit gewartet. Nun fegte der November durch die Stadt und eroberte sie im Handumdrehen. Er zwang die Bäume, ihr grünes Sommerkleid abzulegen und die Blätter fallen zu lassen.
In der Ferne donnerte es laut. Der Donner erschütterte die Luft und die Häuser, die wie ihre Bewohner zu zittern schienen. Damaskus war nicht für den Winter gebaut.
Vor der italienischen Botschaft in der Ata-al-Ayubi-Straße, an der Ecke zur Manssur-Straße, hielt kurz vor sieben Uhr morgens ein Ape-Transporter. Der Fahrer trat — aus welchen Gründen auch immer — zweimal aufs Gaspedal, um dann scharf zu bremsen. Das Motorengeheul hallte von den kahlen Mauern wider. Dann schaltete der Mann den Motor aus, wartete eine Weile, und als ihm schien, dass der Regen nun etwas nachließ, stieg er aus. Er warf einen Blick auf die Ladefläche und auf den Zettel in seiner Hand, musterte die Gebäude auf beiden Seiten und ging, als er die italienische Fahne erkannte, leise vor sich hin fluchend auf die Tür der Botschaft zu.
Ein Polizist eilte aus seinem Wachhäuschen und fing den etwa fünfzigjährigen untersetzten Mann ab, bevor dieser die Tür erreichte.
»Ich habe ein Fass für den Herrn Fransisku Lungu.« Den Namen las der Mann von einem Zettel ab, aber der Wächter verstand, wer gemeint war: Francesco Longo, der Botschafter der Republik Italien. Er musterte den Fremden und das vorsintflutliche rote Lastendreirad, das einst die italienische Firma Piaggio produziert und das in Syrien so viele Veränderungen und bunte Reparaturen durchgemacht hatte, dass die Italiener bestimmt nichts dagegen hätten, das Endprodukt als »made in Syria« zu bezeichnen. Der Blick des Wächters fiel auf das Schild über der Fahrerkabine: Der Neider soll erblinden, stand darauf, und er konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Jedes dieser rostigen Fahrzeuge erzeugte mehr Gestank und Höllenlärm als zehn Limousinen. Aber es war beliebt, weil es wendig war und mit einem gewissen Tempo durch die engen Gassen fahren konnte, und vor allem war es billig und robust. Mehrere Tausend Transporteure verdankten der Ape ihr Brot und versahen sie mit Sprüchen, vor allem gegen Neider. Sie schmückten sie liebevoll mit Spiegeln, Kanarienvögeln aus Kunststoff und bunten Girlanden aus Draht und Blech.
»Ein Fass? Zu dieser frühen Stunde?«, fragte der Wächter fast empört und zeigte auf seine Armbanduhr. Es war ein paar Minuten nach sieben, und ohne die Antwort abzuwarten, fuhr er ungläubig fort: »Und was für ein Fass soll Seine Exzellenz der Botschafter bekommen?« Dabei warf er einen schiefen Blick auf die Ape und erkannte nun die Konturen eines großen Holzfasses unter der grauen Regenplane, die über die Ladefläche gespannt war.
»Ich weiß es nicht. Es riecht nach Olivenöl, aber es ist viel schwerer als Öl. Viel, viel schwerer«, betonte der Mann überzeugend, wie einer, der sein Leben lang nur Lastenträger gewesen war und erst vor zehn Jahren durch das Dreirad zum Transporteur geworden war.
»Olivenöl?«, fragte der Wächter ungläubig. Sein Staunen legte seine Stirn in Falten.
»Ja«, antwortete der Mann ungeduldig.
»Dann fahr um das Gebäude herum zum Lieferanteneingang«, erwiderte der Uniformierte und wies dem anderen fast gelangweilt mit der Hand den Weg. Dann brachte er sich vor dem Gestank der grauen Wolke, die das Fahrzeug beim Start erzeugte, rasch in Sicherheit.
Der Transporteur fuhr geschickt rückwärts in die Einfahrt und hielt dicht vor der Hintertür an. Er stieg aus und sah in den Himmel. »Na endlich«, sagte er erleichtert und dankbar, dass der Regen eine Pause eingelegt hatte. Er klingelte und begann die Plane abzunehmen, die an den vier Ecken mit Haken an der Ladefläche befestigt war. Aus dem Fenster des benachbarten Hauses warf eine Frau einen prüfenden Blick auf den Mann.
Neben dem Fass lagen mehrere dicke Bretter und eine Sackkarre. Gerade hatte der Transporteur die Plane zusammengerollt, als ein beleibter Mann mit Glatze und Kochschürze die Tür öffnete und ihn misstrauisch musterte.
»Was gibt’s?«
»Gesegneten Morgen, ein Ölfass für die Botschaft«, erwiderte der Mann, verwundert über die Unhöflichkeit, die an der Botschaft herrschte. Dann begann er die Bretter nebeneinanderzulegen, bis sie eine Rampe von der Ladefläche bis zur Tür bildeten.
»Öl? Zu dieser Stunde? Ich bin hier allein!«
»Ja, und? Alles ist bezahlt, und ich brauche keine Hilfe«, sagte der Transporteur. Aus Erfahrung wusste er um die Angst der Empfänger. Erst bringt man ihnen etwas, und dann folgt die Rechnung.
»Bezahlt von wem?«, fragte der Koch etwas verwundert.
»Keine Ahnung, ein Mann aus dem Norden, ein großzügiger eleganter Herr mit Mantel, Handschuhen und Schirm in einem weißen Mercedes Sprinter.« Mit diesen Worten stemmte er sich gegen das Fass und legte es behutsam auf den Bauch. Dann stieg er auf die Rampe und ließ es langsam herunterrollen. Es war nicht ganz leicht, das Fass im Rückwärtsgehen zu bremsen, damit es nicht zu schnell rollte und an der Mauer zerschellte. Der Koch machte keine Anstalten, dem Transporteur zu helfen.
»Aus dem Norden? Wie heißt denn der Herr?«
»Keine Ahnung, aber er hatte einen deutlichen Akzent, wie die Leute aus Aleppo. Ich sagte zu ihm, Sie kommen aus Aleppo, da lachte er und sagte, nein, nicht ganz, aber auch nicht weit davon. Er war bestimmt kein Damaszener, er war großzügig wie mein Schwager, der stammt auch aus Aleppo, weißt du? Jedenfalls gab mir dieser Herr doppelt so viel, wie ich verlangte, und half mir, das Fass von seinem Auto auf die Ladefläche meiner Ape zu verfrachten. Ich kenne die Menschen. Ein Damaszener hätte eine Viertelstunde gefeilscht und keinen Finger gerührt. Sie sind Damaszener, oder?«, fragte er und lachte hämisch.
Der Koch verstand die Stichelei. »Nein, ich komme aus dem Süden, aber ich habe Probleme mit dem Rücken.«
»Wohin damit?«, fragte der Transporteur, als das Fass nun auf den Boden lag.
»Hierher ins Haus«, sagte der Koch und machte Platz. Er wies auf eine Stelle hinter der großen Tür. »Hier aufstellen. Erst mal sehen, ob wir damit was anfangen können.«
Elegant rollte der Transporteur das Fass ins Haus, und mit einem geschickten, kraftvollen Handgriff richtete er es auf.
»Gut so?«, fragte er. Und um den misstrauisch dreinblickenden Mann zu beruhigen, fügte er hinzu: »Und wenn das Öl nichts taugen sollte, das Fass ist nagelneu und allein eine Stange Geld wert. Ich weiß Bescheid über Fässer.«
»Schon gut«, brummelte der Koch und schloss die Tür hinter dem redseligen Mann. Er hörte ihn noch pfeifen, bevor dieser seine Ape startete und davonfuhr.
An vier Stellen war der runde Deckel auf dem Fass festgeschraubt. Der Koch löste die Schrauben und nahm den Deckel ab. Er lehnte ihn neben dem Fass an die Wand. Ein Sack aus festem schwarzem Kunststoff kam zum Vorschein, dessen Ende mit einer blauen Schnur sorgfältig verschnürt war. Als er die Schnur mit einer Schere durchschnitt, entdeckte er einen zweiten Sack, dessen offenes Ende ebenfalls zugebunden war. Offenbar hatte man zwei Säcke genommen, um ganz sicherzugehen, dass kein Öl austrat. Der innere Sack war mit einem dünnen Ölfilm bedeckt. Als der Koch etwas Rundes unter den Fingern spürte, tastete er die Stelle ab. Etwas Hartes bewegte sich im Öl hin und her. Er dachte an eingelegten Kohl und wusste, der Botschafter würde die Augen verdrehen. Er mochte Kohlgerichte genauso wenig wie der Koch. Dann schnitt er den zweiten Knoten durch.
Sein entsetzter Schrei gellte bis zum zweiten Stock hinauf, wo die Sekretärin gerade ihren ersten Schluck Espresso nehmen wollte.
In dieser Sekunde zerriss ein Sonnenstrahl den grauen Schleier über Damaskus.
3.
Ein Kardinal in Olivenöl
Gegen acht Uhr erfuhr der italienische Botschafter Francesco Longo durch seinen Sekretär von der gelieferten Leiche. Er war auf einem Höflichkeitsbesuch in Beirut.
»Was für eine Leiche?«, fragte der Botschafter erschrocken.
»Die Leiche von Kardinal Angelo Cornaro«, antwortete der Sekretär mit brüchiger Stimme am Telefon.
»Sind Sie sicher? Das ist ja eine Katastrophe!«, rief Longo immer noch hoffend, dass sich der Sekretär irrte.
»Ja, Exzellenz. Er ist es. Ich habe die Leiche gesehen. Kein Zweifel! Er ist es.«
Der Botschafter ließ sich in einen Sessel neben dem Bett fallen. Sein Blick wanderte ziellos im Zimmer umher. Ein düster verhangener Himmel schaute durch das große Fenster herein. Eigentlich hatte Francesco Longo im Schwimmbad ein paar Runden drehen und danach prächtig frühstücken wollen. Das luxuriöse Hotel Radisson Blu Martinez war seine feste Adresse in Beirut. Das Zimmer bot einen weiten Blick über die Dächer der Stadt, aber dafür hatte der Botschafter jetzt kein Auge. Er schüttelte bedauernd und traurig den Kopf. Der Besuch dieses Kardinals hatte von Anfang an unter einem schlechten Stern gestanden. Schon bei der Ankunft hatten ihm fanatische islamistische Terroristen aufgelauert. Wie er vom vatikanischen Botschafter erfahren hatte, wollte die Gruppe, die sich »Saladins Brigaden« nannte — eine Abspaltung der Kaida —, den Kardinal nicht ermorden, sondern entführen und mit ihm die Freilassung ihrer gefangenen Kameraden erpressen. Die Entführung schlug fehl, weil der syrische Geheimdienst die Gruppe längst unterwandert hatte und seine beste Antiterrortruppe zum Flughafen schickte.
Die ganze Aktion sollte nach dem Wunsch des Geheimdienstes nicht publik werden, da dies die Terroristen aufwerten und Nachahmer auf den Plan rufen könnte. Nicht einmal die Kriminalpolizei erfuhr etwas davon. »Das ist unsere Angelegenheit«, soll der Geheimdienstchef den Gesandten des Vatikans angeherrscht haben.
Der Kardinal war von alldem wenig beeindruckt. Als der erste Schuss fiel, der zum Glück in der Wagentür stecken blieb, gab der Chauffeur der Botschaft Gas und raste davon. Die Agenten des Geheimdienstes erschossen drei der Attentäter, zwei weitere seien entkommen, hieß es in einem vertraulichen Bericht an die vatikanische Botschaft.
Auch er, der italienische Botschafter, sollte niemandem davon berichten, bat der vatikanische Kollege.
Die beiden hatten lange gerätselt: War das eine verschlüsselte Botschaft? Und wenn ja, von wem? Von den Islamisten? Warum? Vom syrischen Geheimdienst? Und wenn ja, konnte der Geheimdienst eine solche Aktion ohne Genehmigung des Präsidenten durchführen?
Den Kardinal selbst schien die ganze Sache am allerwenigsten zu interessieren. »Erstens hält der Heilige Geist seine schützende Hand über mich und meine Mission, und zweitens wird das gastliche Syrien schon dafür sorgen, dass mir nichts passiert. Hier bin ich sicherer als in Italien«, sagte er und lachte. Kardinal Cornaro war bekannt für seine kritische Haltung gegenüber der italienischen Mafia.
Weder Longo noch der Botschafter des Vatikans konnten den sturen Kardinal von seinem Vorhaben abhalten. Der alte Herr war entschlossen, seine Mission durchzuführen … Und nun das!
Eine halbe Stunde später rief der Staatsanwalt aus Damaskus an und bat um eine formelle Erlaubnis, die Spuren durch die Kriminalpolizei sichern zu lassen. Er versprach, dass seine Männer ihre Arbeit so unauffällig wie möglich verrichten würden. Die Leiche würde so schnell wie möglich ins rechtsmedizinische Institut gebracht, um die Todesursache festzustellen. Außerdem sollte die Botschaft nicht länger als nötig blockiert werden. Longo versprach, der Staatsanwalt werde umgehend ein Fax mit der offiziellen Erlaubnis erhalten.
Longo rief seinen Sekretär an und diktierte ihm den Text. Die Sache sei streng geheim. Er selber würde sofort nach dem Treffen mit dem libanesischen Präsidenten aufbrechen. Er wäre gegen vierzehn Uhr in Damaskus. Man solle das Personal anweisen, zu Hause zu bleiben. Der Sekretär beruhigte den Botschafter, das sei bereits geschehen.
Gegen neun Uhr wurde die italienische Botschaft für Besucher gesperrt. Ein kleines Schild an der Tür verkündete: Wegen eines Wasserrohrbruchs und Reparaturen geschlossen. Der kleine blaue VW T5 Transporter der Spurensicherung stand ein paar Meter entfernt vom hinteren Eingang. Seine Tarnung war perfekt: Sanitär- und Heizungsdienst stand darauf. Ein zweiter Wagen der Mordkommission parkte unauffällig in der nahen Al-Maari-Straße. Auf das typische Absperrband der Kriminalpolizei hatte man absichtlich verzichtet. Ein herbeieilender Journalist wurde von einem Zivilbeamten abgefangen und in den Eingang eines benachbarten Gebäudes gezogen.
Der Mann erzählte, er habe am frühen Morgen erfahren, dass irgendein wichtiger Italiener umgebracht worden sei, und hoffe auf einen guten Bericht für die staatliche Zeitung Tischrin. Woher er das Gerücht habe, wollte er dem Geheimdienstler nicht verraten.
Dieser beschimpfte alle Journalisten als Hurensöhne und Unruhestifter und verlangte, den Journalistenausweis zu sehen. Der Journalist, ein Damaszener, hörte am Akzent, dass der Mann wie die meisten Geheimdienstler und der Staatspräsident aus dem Küstengebiet stammte. Er bekam Angst. Der unfreundliche Herr in Zivil gab die Daten des Journalisten über Handy an die Zentrale durch und reichte dem erblassten Mann schließlich den Ausweis zurück. »Lass dich hier nicht mehr blicken!«, sagte er zum Abschied, und der Journalist zog unverrichteter Dinge ab. Erst in einigem Abstand verfluchte er den Beamten, dessen Augen ihn an den kalten toten Blick eines Krokodils erinnert hatten. Ihm waren die anderen fünf Geheimdienstler entgangen, die gut getarnt entlang der Straße darauf achteten, dass kein Neugieriger der italienischen Botschaft zu nahe kam.
Erst gegen Mittag sollte der Journalist einen Anruf von seinem Informanten Hamid bekommen, der ihm knapp mitteilte, er solle die Finger von diesem Fall lassen, sonst würde es für ihn lebensgefährlich. Der Journalist lachte zynisch. »Meine Finger! Ha, ha! Ich habe die Botschaft nicht einmal erreicht.«
Er würde nie erfahren, dass dieser Geheimdienstler, der ihn so barsch zurückgewiesen hatte, sein Schutzengel gewesen war. Er war zwar mit allen schmutzigen Wassern der Geheimdienste gewaschen, aber er hatte dem Journalisten unfreiwillig das Leben gerettet. Denn der Geheimdienst war entschlossen, jeden Journalisten zu erledigen, der auch nur ein Wort über den Fall in der italienischen Botschaft zu schreiben wagte. Die Zensoren lasen an jenem Abend die Ausgaben der Zeitungen so genau wie nie. Die Anweisung des Innenministers war deutlich gewesen.
Bei seiner Ankunft in der italienischen Botschaft im Laufe des Vormittags erklärte Kommissar Barudi dem Sekretär, einem jungen italienischen Diplomaten, dem Koch, dem Wächter vor der Tür und dem Wachmann für den Innenbereich höflich, warum eine absolute Nachrichtensperre über die Ermordung des Kardinals verhängt worden war.
Die Nachbarschaft würde später sagen, man habe nichts mitbekommen und nicht einmal geahnt, dass in unmittelbarer Nähe eine Leiche aufgetaucht war, die beinahe zu einer Staatskrise zwischen Syrien und Italien geführt hätte. Ebendeshalb waren die Syrer darauf bedacht, den Mord so geheim wie möglich zu halten.
Sicherheitshalber postierte die Kriminalpolizei nach Absprache mit der Botschaft im Eingangsbereich der Küche einen Beamten hinter der Tür. Er sollte dafür sorgen, dass keiner den Raum betreten oder verlassen konnte.
Hauptmann Schukri, der Leiter der Spurensicherung, ein großer, athletischer Mann mit einem dichten grauen Schnurrbart, beaufsichtigte die Arbeit seiner Männer, die mitten in dem breiten Gang zwischen Haustür und Küche die Leiche des alten Kardinals, die auf einer Kunststoffplane lag, untersuchten. Die Männer trugen weiße Einwegschutzanzüge mit Kapuzen und Latexhandschuhe.
Ein Fotograf machte Detail-, Groß- und Totalaufnahmen von der Leiche aus allen möglichen Perspektiven.
Noch immer und trotz jahrzehntelanger Erfahrung ging der Anblick mancher Leichen Schukri durch Mark und Bein. Der tote Kardinal sah allerdings aus, als würde er friedlich auf der Plane schlafen. Er war nackt. Das Olivenöl ließ seine Haut glänzen. Sein Körper war wohlproportioniert, er hatte graues Haar und feine Gesichtszüge. Einer der Männer schätzte sein Alter auf zwischen fünfundsechzig und siebzig.
Neben der Tür rechts vom Wachmann stand das halbvolle Fass, über dessen oberen Rand wie eine schlaffe schwarze Zunge ein Zipfel des Kunststoffsacks hing. Der Deckel war an die Wand gelehnt. Die Leiche hatte Spuren von Öl hinterlassen, als sie vom Fass auf die ausgebreitete Plane gehievt worden war.
Unmittelbar nach ihrer Ankunft hatten die Beamten das Fass und die beiden Plastiksäcke sorgfältig nach Spuren untersucht. Auf dem Fass und dem äußeren Sack fanden sie einige Fingerabdrücke. Hauptmann Schukri und seine Männer machten sich keine allzu großen Hoffnungen. Die Erfahrung lehrte, dass sich Morde, die von erfahrenen Killern verübt wurden, oft nicht oder nur schwer aufklären ließen.
Dennoch trieb Schukri seine Männer an, alles sorgfältig zu prüfen und zu notieren. »Eure Arbeit wird dieses Mal von mehr Leuten kontrolliert, als es euch und mir lieb ist.«
Dem Toten hatte man die Armbanduhr abgenommen. Seine Haut war an dieser Stelle — wie im Süden üblich — heller. Die Augenlider waren sorgfältig zugenäht. Zwei Schnitte verliefen schräg von beiden Schlüsselbeinen zur Mitte des Körpers hin und trafen sich auf dem Brustbein. Von dort setzte sich ein Schnitt gerade fort bis zum Schambein. Auch dieser Schnitt war perfekt genäht.
»Ein Y-Schnitt, wie bei einer Obduktion. Das Werk eines Profis«, sagte Hauptmann Schukri, als hätte er die Gedanken seiner drei Untergebenen gelesen.
Er zog sein Smartphone aus der Tasche und wählte eine Nummer. »Ja, mein Lieber. Wie geht’s? … Bei mir das Übliche. Leichen, so weit das Auge reicht. Mein Arbeitsplatz ist sicher. Hör zu. Ich habe hier einen delikaten Fall. Die Leiche eines prominenten Ausländers«, er hielt einen Moment inne und lachte. »Nein, nein, nicht Madonna … nein, auch nicht Gaddafi, viel wichtiger … Nein, nein, hör doch auf, du Atheist, Gott ist es auch nicht, etwas tiefer in der Hierarchie. Spaß beiseite, der Staatsanwalt schickt dir noch heute die notwendigen Unterlagen. Ich habe vor einer halben Stunde mit ihm telefoniert. Wir nennen unsere Leiche vorerst Maher, ja?« Wieder hörte er einen Moment lang zu. »Warum? Darum, weil der Innenminister das so will … Ich glaube, es ist der Name seines Schwiegervaters, dem er den Tod wünscht … Also, ich bitte dich, mir schnellstmöglich einen kleinen Bericht deiner Obduktion zu geben. Es waren Profis am Werk … Nein, ich übertreibe nicht. Wenn du den Schnitt und die zugenähten Augen sehen würdest! Du kennst dich besser aus als ich, aber die Naht ist so gut wie … wie … wenn sie von einem Herrenschneider ausgeführt worden wäre … Wann darf ich deine Auskunft erwarten? … Was? Und mit Nachtschicht? … Nein, ich bin kein Sklaventreiber. Das ist der Außenminister … Er setzt den Innenminister unter Druck und dieser meinen Chef bei der Mordkommission und der mich und Kommissar Barudi … Nein, er ist noch nicht in Rente. Er vernimmt nebenan gerade den Koch … Nein, keine Ambulanz, das wäre in diesem Fall zu auffällig. Wir bringen die Leiche in einem getarnten Transporter zu dir … Was? Nein, mach dir keine Sorgen, die Leiche ist sehr frisch und das Olivenöl hat sie geschmeidig gemacht … Nein, noch keine sichtbare Verwesung, aber wenn du mich noch länger verhörst, werde ich verwesen. Lach ruhig, aber bitte schicke zwei zuverlässige Männer zum Eingang deiner heiligen Burg der Rechtsmedizin. Ja? Was? … In einer halben Stunde. Sei so lieb. Danke, grüß deine Frau von mir.«
Schukri schaltete sein Smartphone aus und steckte es wieder in die Hosentasche. »Der Kardinal muss ins rechtsmedizinische Institut. Dort werdet ihr erwartet«, sagte er zu seinen Männern. »Für den Transport packt ihr ihn in einen Leichensack. Das Ölfass nehmt ihr mit aufs Revier. Ich will alles noch einmal in Ruhe prüfen. Sollte auch nur ein Detail nach außen dringen, seid ihr alle drei entlassen«, er machte eine Pause, »und ich mit euch. Der Fall ist politisch heikel. Die Presse muss warten, bis wir den Mord aufgeklärt haben, und das wird lange dauern — wenn wir es überhaupt schaffen. Also kein Wort, zu niemandem. Haben wir uns verstanden?«, setzte er nach, und dabei fixierte er seinen Mitarbeiter Hamid, einen untersetzten Mann mit feuerroten Haaren. Er war mit mehreren Lokalreportern befreundet. Schukri vermutete, dass er sie mit Nachrichten fütterte und dafür reichlich belohnt wurde. »Der Journalist, der von dem Fall erfährt«, sagte Schukri süffisant und machte eine Pause, als suche er nach einem ausreichend bedrohlichen Szenario, während Hamid unruhig mit den Fingern knackte, »wird seinen Beruf nicht mehr lange ausüben.«
Die drei Männer hatten sehr wohl verstanden, dass es sich hier um einen raffinierten, kaltblütigen Mord handelte, womöglich ein Verbrechen der Mafia. Der Fall würde vermutlich politische Folgen haben und die Geheimdienste auf den Plan rufen. Und keiner der drei Beamten wollte seinen Job verlieren.
»Alles klar, Chef«, sagte Isam, ein dürrer Mann mit Glatze, »aber darf ich noch etwas anmerken?« Und bevor Hauptmann Schukri antworten konnte, fuhr der Mann fort. »Mir scheint, dass hier ein Fehler vorliegt«, sagte er und steckte seinen Kugelschreiber in die Brusttasche seines Hemdes.
»Ein Fehler? Was für ein Fehler?«
»Der oder die Mörder hätten die Leiche des Kardinals nicht an die italienische, sondern an die vatikanische Botschaft schicken müssen. Also vermute ich, sie sind Muslime und kennen den Unterschied nicht.«
Der Hauptmann, der der drusischen Minderheit angehörte, verstand nicht gleich. »Aber er ist doch Italiener, oder?«
»Ja, sicher. Die Botschaftsangestellten, allen voran der Koch, haben ihn auch sofort identifiziert und kannten seinen Namen, da er vor seiner Abreise hier in der Botschaft zu einem Festessen eingeladen war. Gewohnt hat er, wie mir der Koch erzählte, in der vatikanischen Botschaft. Ein Kardinal ist in erster Linie ein Bürger des Vatikans, auch wenn er ursprünglich aus Frankreich, Amerika oder wie Papst Benedikt aus Deutschland stammt.«
Hauptmann Schukri nickte schweigend. Er schätzte Isam sehr, diesen dürren, oft schweigsamen Mann, und er wusste, dass alles, was er sagte, Hand und Fuß hatte.
»Nun gut, schafft den Mann unauffällig weg. Ich gebe diese neuen Informationen an Kommissar Barudi weiter.«
»Und noch etwas, Chef«, wandte Isam fast schüchtern ein. »Der Kardinal hatte seinen Ring am falschen Finger.« Isam ging zu der Leiche. Schukri folgte ihm neugierig. »Normalerweise«, erklärte der christliche Beamte, »trägt der Kardinal seinen Ring als Symbol der Treue zur Kirche am rechten Ringfinger. Der Papst verleiht dem gewählten Kardinal in einer Zeremonie den Ring, und dieser trägt ihn sein Leben lang. Auch das Opfer trug ihn so, schaut euch die blasse Einkerbung am rechten Ringfinger an. Man hat ihm den Ring abgenommen und ihn an den viel zu dünnen linken Ringfinger gesteckt. Dort sitzt er locker, schaut her!« Isam ließ den Ring über den leblosen Finger gleiten.
»Und was bedeutet das?«, fragte Schukri.
»Keine Ahnung«, antwortete Isam und zuckte mit den Schultern.
»Nun gut, wir werden sehen«, beendete Schukri die Unterredung. »Hamid«, wandte er sich an den Rothaarigen, »du fährst. Habib fühlt sich heute nicht wohl, und ich will nicht, dass ihr drei bald im Jenseits mit dem Kardinal Karten spielt.«
»Wird gemacht, Chef«, antwortete Hamid. Habib bedankte sich leise für die Rücksicht. Er war seit zwei Tagen wie abwesend, weil seine Frau ihn verlassen hatte. Ohne Streit, ohne auch nur eine Nachricht zu hinterlassen, war sie mit den beiden Kindern einfach verschwunden, und niemand wusste wohin. Habib war nicht nur in seiner Ehre, sondern auch in seiner Eitelkeit verletzt. Zwar war er ein bekannter Schürzenjäger und Hurenbock, aber er hätte lieber selbst seine Frau verlassen. Im Amt hatten die Neider ihren Augenblick für eine gnadenlose Rache kommen sehen. Die Kollegen verspotteten ihn jetzt lauthals und rücksichtslos. Schukri verstand seinen Freund Kommissar Barudi. »Wenn ein Schaf ausrutscht, werden viele zu Metzgern«, hatte dieser voller Bitterkeit gesagt.
Schukris Blick wanderte zwischen seinen Männern hin und her. Er hatte die besten Experten an seiner Seite, aber alle drei hatten sie einen Knacks. Isam war geizig und trotz Frau und Kindern einsam. Seitdem er einen Mann überfahren hatte, wollte er nie wieder hinter dem Lenkrad sitzen. Er war der Mann für die feinen Beobachtungen.
Hamid kam mit seinem Gehalt nicht aus und hatte ständig Schulden. Die Medikamente für seinen kranken Jungen verschlangen Unsummen. Er hatte eine böse Frau und wollte abends lieber noch im Amt bleiben, als nach Hause zu gehen. Da er Chemie studiert hatte, war er der beste Experte, wenn es darum ging, die Wirkung eines Giftes zu verstehen. Habib war der Geduldigste und Hartnäckigste von allen. Aber nun hatte er, der schöne stolze Gockel, einen herben Schlag erlitten. Welche Schmach hatte seine Frau in all den Jahren ertragen müssen, in denen alle von Habibs ausschweifendem Leben wussten. Jetzt zahlte sie ihm alles auf einmal zurück.
Aber, dachte Schukri und kratzte sich am Ohr, auch er hatte ein Problem, und das war vielleicht größer als all die Probleme seiner Mitarbeiter zusammen. Er konnte mit keiner Frau mehr zusammenleben. Affären genoss er, doch sie machten ihn nur noch misstrauischer, noch einsamer. Er war einmal verlobt gewesen, aber Latifa, die immer die Unberührbare spielte, war eine Heuchlerin. Sie hatte ihm nicht mehr als einen Kuss auf die Wange erlaubt, und dann wurde sie von ihrem Nachbarn, einem jungen Apotheker, schwanger. Schwangerschaft, Verliebtheit und Kamele kann man auf Dauer schlecht verbergen, wie ein altes Sprichwort sagt. Einen Monat vor seiner Hochzeit merkte Schukri, dass Latifas Bauch und ihre Lügen dicker wurden. Sie flüchtete mit dem Apotheker und brachte fünf Monate später ein Mädchen zur Welt.
Schukri, Sohn eines bekannten und reichen Damaszener Arztes, hatte damals als Lehrer in der südlichen Stadt Suwaida gearbeitet. Er wollte die benachteiligten Provinzkinder unterstützen. Seine Eltern lebten in Damaskus, aber sie stammten aus einem drusischen Dorf nahe Suwaida. Latifa, eine Grundschullehrerin, war eine ferne Verwandte seiner Mutter.
Nun musste er Suwaida verlassen, denn er war zur allgemeinen Zielscheibe des Spotts geworden. In einer Provinzstadt kennt jeder jeden, und die gelangweilten Zungen hatten Blut geleckt. Die Lästermäuler ließen nicht mehr los, bis ihr Opfer verschwand.
Schukri kehrte nach Damaskus zurück und bewarb sich bei der Polizei. Aber insgeheim schüttelte er über sich selbst den Kopf, ja, fand es fast charakterlos, dass er selbst jetzt, dreißig Jahre später, immer noch an Latifa hing.
Hamid stieg jetzt in den kleinen Bus und fuhr ihn langsam rückwärts bis direkt an die Haustür. Die beiden anderen schoben den toten Kardinal im Leichensack auf einem Brett durch die Hecktür ins Auto, ohne dass irgendein neugieriger Nachbar aus seinem Fenster etwas bemerkte. Für das Fass aber gab es wegen der Kästen mit den Instrumenten, Pulvern und Chemikalien der Spurensicherung keinen Platz mehr. Das würden die Männer später holen.
Hauptmann Schukri beobachtete einen Spatzen, der unmittelbar neben dem Auto ängstlich ein paar Brotkrümel pickte. Sein Hunger förderte seine Dreistigkeit, die seine Angst jedoch im Zaum hielt. Als der Motor aufheulte, suchte der Spatz sein Heil wie ein Pfeil in der Ferne.
Hauptmann Schukri winkte seinen Männern noch einmal zu und kehrte ins Hausinnere zurück. »Sie bleiben da. Keiner darf den Raum ohne die Genehmigung von Kommissar Barudi betreten oder verlassen«, sagte er zu dem Wachmann.
Der Mann war seit zwanzig Jahren bei der Polizei.
»Selbstverständlich, Herr Hauptmann«, erwiderte er und setzte leise sein Gebet für seine Tochter fort, die an diesem Tag eine schwere Prüfung an der Universität hatte.
4.
Kurz vor dem Abschied
Kommissar Barudis Tagebuch
Seit Monaten leide ich unter massiven Schlafstörungen. Das laugt mich aus. Immer wieder das gleiche grausame Spiel: Ich schlafe rasch ein, aber nur für kurze Zeit, danach bin ich lange wach und todmüde, irgendwann schlafe ich wieder ein und schrecke dann aus einem Albtraum auf.
Mein Freund und Hausarzt Omar hat mir gesagt, ich müsse ein Ventil für meine Ängste, Trauer und Wut finden, und da man niemandem mehr trauen könne, solle ich all meine Gedanken einem Tagebuch anvertrauen. Wenn ich dagegen stur bliebe und alles in mich hineinfräße, könnte ich an einem Magengeschwür, Hirntumor oder Herzinfarkt krepieren.
Nicht nur meine Blutwerte, alle Untersuchungen wiesen eindeutig auf einen schlechten Gesundheitszustand hin. Omar ist Facharzt für Psychosomatik. »Du musst auf deinen Körper hören. Er kann nur so protestieren. Frei sprechen kannst du heute mit niemandem mehr, auch mit mir nicht. Ich weiß nicht, was ich unter Folter preisgebe. Nein, schreib dir alles von der Seele. Du wirst sehen, es hilft«, sagte er und schaute mich über den Rand seiner Brille hinweg an.
Als ich ihm sagte, er spinne, lachte er nur und entgegnete, ich solle trotzdem auf ihn hören, Kinder und Spinner sagten oft die Wahrheit, und er kenne mich besser als jeder andere.
Da hat er recht. Seit dreißig Jahren ist er mein Arzt und Vertrauter. Allerdings muss man zehn Jahre abziehen, die Omar im Knast verbracht hat, weil er in einem Artikel die Korruption im Gesundheitswesen angeprangert hatte. Der Bruder des Gesundheitsministers, ein bekannter brutaler Geheimdienstler, ließ die ganze Redaktion foltern, bis sie den Namen des Autors preisgab. Zehn harte Jahre wegen Rufschädigung des Vaterlandes. Omar kann auch heute noch darüber lachen. »Es stimmt«, sagte er, »die Korruption ist ihr Vaterland.«
Ich habe ihm damals beigestanden und über Umwege und Bestechung einige schöne Sachen sowie Geld ins Gefängnis bringen lassen. Er ist ein aufrechter, aber schwieriger Mann! Sehr verbittert und misstrauisch!
»Schreibst du selbst Tagebuch?«, fragte ich ironisch.
»Selbstverständlich, sonst wäre ich längst in der Psychiatrie«, antwortete er mit brüchiger Stimme. Ich schämte mich.
»Über was und wie soll ich denn jetzt mit fünfundsechzig schreiben?«
»Das Wie ist mir egal, du kannst es so kurz, lang, poetisch oder sachlich, ordentlich oder chaotisch halten, wie du willst. Du schreibst ja nicht für die anderen, sondern für dich, um dir Klarheit zu verschaffen. Denk nicht viel nach, fang einfach an! Schreib deine Seele frei. Hauptsache, du hast ein absolut sicheres Versteck für dein Tagebuch …«, er schwieg einen Moment. »Übrigens weiß ich ja, dass du schreiben kannst. Ich habe die Briefe, die du mir ins Gefängnis geschmuggelt hast, aufbewahrt. Einer hängt neben meinem Spiegel, so dass ich ihn jeden Morgen lese. Steh auf, steht da, und erhebe deine Stirn. Nichts anderes ärgert unseren Feind mehr.«
»Du übertreibst wie immer«, sagte ich leise.
Omar lachte und sagte: »Wer weiß, vielleicht baust du diese Notizen aus, wenn du Rentner bist, und machst daraus einen Roman, statt dich zu langweilen, dann will ich aber ein Freiexemplar haben, von dir im Knast signiert.«
Ich konnte nicht anders, als den Kopf zu schütteln. »Ich glaube, mein Arzt braucht einen Arzt«, sagte ich, und er lachte noch lauter.
Wie dem auch sei. Ein sicheres Versteck habe ich. Nicht einmal der Teufel kommt darauf. Dort liegt das Tagebuch neben der Schatulle mit den Goldmünzen, die ich für meine Rente aufbewahre.
Omar hat recht, seit dem Tod meiner geliebten Frau Basma habe ich keinen wirklichen Freund mehr. Ich habe gute Bekannte, gute und schlechte Kollegen. Schukri ist der beste unter ihnen, aber ein Freund? Nein, das nicht! Ihm und Omar vertraue ich nicht alles an. Was der Geheimdienst nicht auf direktem Weg erfährt, indem er Menschen verführt oder erpresst, spioniert er durch Wanzen aus. Er macht jeden gefügig.
Heute fange ich an, am Samstag, den 18. September 2010. Das heutige Datum halte ich fest … danach werde ich einfach so weiterschreiben. Jeder Tag endet mit einem Stern. So habe ich auch die Briefe an meine geliebte Frau unterschrieben. Sie nannte mich mein Stern.
Wissen ist Macht, sagte mein Kollege Schukri gestern, aber mich macht Wissen ohnmächtig. Vor allem wenn es um die Wahrheitsfindung in diesem Land geht.
Wenn ich zurückblicke, so ist mein Leben eine lange Kette von Niederlagen, im Privaten wie im Berufsleben.
Bevor ich Basma kennenlernte, hatte ich nur Pech mit Frauen. Schon als Jugendlicher war ich arm, kurzsichtig, unattraktiv. Auch mein Beruf war Grund für meine Einsamkeit: ein Kriminalpolizist, der nur einen Hungerlohn bekommt und einer lebensgefährlichen Tätigkeit nachgeht, die weder Ruhe noch einen geregelten Alltag erlaubt. Meine Mutter meinte, ich solle ein wenig angeben. Sie sagte: »Jeder Hahn muss seinen Misthaufen finden, auf dem er kräht.« Ich konnte dieser lieben Seele nicht die Wahrheit sagen: Wenn andere Hähne auf Misthaufen stehen, krähe ich in einem tiefen Erdloch.
Dann traf ich Basma, das Glück meines Lebens. Ihr Name war Programm, Basma, ein Lächeln, zog in mein Leben ein. Aber der Tod hat sie mir vor sechzehn Jahren geraubt. Und die Einsamkeit, nun begleitet vom Zweifel, kehrte zurück, gemeinsam zernagten sie mein Gemüt und meine Ruhe.
Ich habe in meinem Leben viele Niederlagen erlitten. Den frühen Tod meiner geliebten Frau aber kann ich bis heute nicht verwinden. Wie oft kam ich nach Hause und bildete mir ein, sie würde mir entgegenlachen. Wie oft haben Kollegen versucht, mich zu verkuppeln. Aber bei mir war nicht einmal das körperliche Verlangen wiederzuerwecken. Ich war wie eine Mauer und so kalt, dass mich ein Kollege einmal durch die Blume fragte, ob ich schwul sei. Nein, habe ich erwidert, aber ich bin für den Rest meines Lebens besetzt von Basma. Er schüttelte nur den Kopf.
Und beruflich? Wie oft träumte ich von einem Fall, den ich bis zum Ende aufklären kann, ohne dass Hunderte von Händen hineinwirken, bis die Sache in eine Sackgasse gerät und scheitert. Vielleicht wird es mir in der noch verbleibenden Zeit gelingen, meinen Dienst mit einem großen Fall zu beenden.
Ich habe keine Lust mehr, kleine Gauner zu verhaften und zu vernehmen. Die großen Verbrecher schicken solche kleinen Handlanger und Laufburschen vor. Sie lassen sie die Verantwortung für einen Mord, einen brutalen Überfall oder einen Einbruch übernehmen, zahlen ihnen Geld dafür und lassen sie, wenn es darauf ankommt, im Gefängnis umbringen. Einmal hatte ich einen bereits verurteilten Gauner beinahe zum Sprechen gebracht, indem ich immer wieder das Gespräch suchte. Er war ein armseliger Mann. Ich garantierte ihm Schutz, wenn er als Kronzeuge auftreten würde. Er sollte das, was er mir anvertraut hatte, offiziell vor dem Richter wiederholen, nämlich, dass General Nassif Barakat, ein ferner Cousin des Präsidenten und hochverschuldeter Spieler, einen Juwelier hatte entführen lassen. Er bat mich um drei Tage Bedenkzeit und wollte mit seiner Frau sprechen. Einen Tag später wurde er erhängt in seiner Zelle gefunden. Angeblich Selbstmord.
Mein damaliger Chef tadelte mich und behauptete, ich sei der Todesengel für den armen Kerl gewesen. Das hat mich über Monate gequält. Ich fühlte mich schuldig. Und ich hätte mich auch ohne seinen Tadel verantwortlich gefühlt. Der Fall erinnerte mich nämlich an eine alte Schuld, von der ich niemandem erzählt habe, auch Basma nicht. Ich hatte als naiver Junge von zehn Jahren unbedacht und arglos einem Nachbarn erzählt, dass immer ein Mann zu seiner Frau kommt, wenn er, der Ehemann, ein Lastwagenfahrer, wochenlange Transportfahrten nach Saudi-Arabien oder Kuwait unternimmt. Eine Woche später tat der Nachbar so, als würde er wegfahren, parkte den Lastwagen am Stadtrand und kam des Nachts zurück. Er erschoss seine Frau und ihren Liebhaber im Bett. Und dann richtete er die Waffe gegen sich selbst … Mein Gott, drei Tote durch mein leichtsinniges Ausplaudern. Auch heute kriege ich noch Magenkrämpfe, wenn ich daran denke.
*
Wir dürfen jeden vernehmen, der nicht zu den Großen auf den obersten Stufen der Pyramide gehört. Denen, die sich an der Spitze befinden, darf man nicht einmal eine Frage stellen. Und jeder Syrer weiß, dass sie da oben die Fäden in der Hand halten wie eine gut organisierte Mafia. Die Söhne der ersten Generation des Herrscherclans sind schlimmer als ihre Väter, denn diese Generation wuchs in den Häusern von absoluten Herrschern auf. Sie haben nie erfahren, wie man sich als Normalsterblicher verhält. Sie haben Gorillas an ihrer Seite, die jeden demütigen, der in ihre Nähe kommt. Erst in der vergangenen Woche hat ein Kollege aus der Drogenfahndung versucht, den Sohn des Generals Durani zu sprechen, der hinter einem Handel mit einer afghanischen Drogenmafia steht. Durch Zufall hat man eine große Ladung Opium entdeckt, und alles deutet auf den Sohn des Generals. Als der Kollege am Tor klingelte und um ein Gespräch bat, wurde er vor laufender Kamera geschlagen, mit Beschimpfungen gedemütigt und weggeschickt. Unser oberster Chef versprach eine Untersuchung der »Sache«, aber nichts ist passiert.
*
Seit Wochen habe ich nicht mehr geschrieben. Ich kam jeden Tag erschlagen vor Müdigkeit nach Hause und wollte nur noch schlafen.
Schukri hat manchmal witzige Ideen. Wir waren gegen Mittag in der Nähe des Gerichtshofs unterwegs. »Weißt du, warum Justitia eine Augenbinde trägt?«, fragte er.
»Ich denke, damit sie jeder Person gerecht wird, unabhängig von deren Äußerem oder Ansehen«, antwortete ich.
»Nein, mein Junge, damit sie nicht sieht, was in ihrem Namen alles begangen wird.«
»Noch eine solche Klugscheißerei und wir sitzen im Knast«, sagte ich ernst. Er lachte.
Schukri ist ein anständiger Kollege. Trotz seiner unzähligen Affären ist er ein einsamer Mann. Auch das verbindet uns auf sympathische Weise. Er gestand mir einmal bei einem Glas Wein, seine Affären seien bloß Augenblicke genussvoller Selbsttäuschung. Er sei immer einsam, und Einsamkeit sei eine nicht anerkannte Todesart.
Wir haben beide unsere Methoden zur Tarnung unserer Einsamkeit. Er durch seine Affären, die mir wie eine hoffnungslose Flucht vorkommen. Und ich? Ich bilde mir ein, ich hätte die Einsamkeit freiwillig gewählt. Aus Treue. Und wem war und bin ich treu? Einer toten Geliebten.
Manchmal liege ich wach im Bett und denke darüber nach, wie viele Paare in Damaskus wohl zu dieser Stunde dicht beieinanderliegen.
*
Vor ein paar Tagen fragte mich ein befreundeter Journalist, ob mich ein Mordfall nicht traurig macht. Mordfälle bewegen mich kaum. Alles bleibt ruhig in mir. Außer wenn das Opfer ein Kind ist. Nach vielleicht hundert Leichen stumpft man ab. Ich habe in vierzig Jahren über tausend gesehen.
*
Besuch beim Friseur. Burhan ist wahrscheinlich der schlechteste Friseur in Damaskus, in Syrien und vielleicht sogar auf der ganzen Welt, aber sein Salon ist immer proppenvoll. So voll, dass er extra einen Lehrling anstellen musste, der rund um die Uhr kostenlosen Tee für die Kunden kocht, damit alle zufrieden sind. Einzig der Kaffeehausbesitzer schräg gegenüber hasst Burhan, weil er ihm das Geschäft verdirbt. »Ich fange doch auch nicht an, meine Gäste nebenher zu rasieren«, sagt er jedem, der Ohren hat.
Doch nicht der Tee zieht die Kundschaft an, sondern Burhans Geschichten. »Bei Burhan hast du für fünfhundert Lira eine schlechte Rasur und eine gute Geschichte«, sagt mir mein Nachbar, der Postbote Elias.
Das ist wahr. Immer wenn ich traurig, frustriert, verzweifelt oder wütend bin, gehe ich zu ihm, und dann komme ich mit glattem Gesicht, mindestens einer kleinen Schnittwunde und frohen Herzens wieder nach Hause.
*
Als ich heute aus dem Friseursalon trat, war der Himmel strahlend blau, nur ein paar verstreute schneeweiße Wolkenfetzen hingen davor, als hätte Gott seine Pinsel an einem blauen Tuch gereinigt.
An der Kreuzung traf ich Georg Satur, meinen Freund aus Kindheitstagen, der wie ich nach langer Odyssee in Damaskus gelandet ist. Er hat als Beamter in einem staatlichen Export-Import-Unternehmen gearbeitet. Seit Ende Juni ist er Rentner. Nun genießt er endlich das Leben.
Unsere Mütter waren beste Freundinnen, und immer wenn wir uns sehen, tauschen wir Erinnerungen aus und lachen darüber. Wir waren sieben oder acht, als wir beide gleichzeitig erkrankten. Ich hatte eine bakterielle Augenentzündung, und er litt wochenlang unter Durchfall. Er war schon auf die Hälfte geschrumpft. Weil wir arm waren, griffen unsere Mütter zu Naturheilmitteln. Kräuter und Öle wurden uns verabreicht, in Form von Tees oder als Einreibungen. Aber die Heilung ließ auf sich warten. So kam es, dass seine sehr gläubige Mutter meine davon überzeugte, das nahe Kloster der heiligen Maria aufzusuchen. Es kostete nichts bis auf die Kerzen, die man anzündete. Dann kniete man nieder und betete und brachte seine Bitte vor. In einem großen Saal konnte man des Nachts auf dem Boden schlafen.
Georg und ich aßen unsere mitgebrachten Brote und schliefen bald auf einer kleinen Strohmatte dicht aneinandergeschmiegt ein. Es war Sommer, und die zwei Freundinnen setzten sich auf eine steinerne Bank im Freien und lästerten vertraulich über die ganze Welt. Irgendwann machte meine Mutter einen Witz über die heilige Maria. Ihre Freundin lachte, dann sagte sie mehrmals, wie ein Papagei: »Heilige Maria, nimm meine Freundin nicht ernst. Verzeih ihr und mir.« Und schon erzählte meine Mutter den zweiten und dritten Witz über Josef und Maria. Georgs Mutter lachte Tränen und entschuldigte sich immer wieder bei der heiligen Maria.
Am nächsten Morgen waren wir nicht nur nicht geheilt. Ich hatte zu meiner Augenentzündung auch noch Durchfall, und Georgs Augen waren blutrot.
»Die heilige Maria hat sich gerächt«, sagte Georgs Mutter. Meine lachte. »Dummes Zeug. Wenn sich die heilige Maria wegen meiner harmlosen Witze nicht an mir, sondern an den zwei hilflosen Kindern rächt, dann ist sie nicht heilig, sondern ganz schön dämlich.«
Wir fuhren nach Hause und wurden von einem gutherzigen Arzt kostenlos behandelt und bald wieder gesund. Georgs Mutter erzählte Jahre später, dass meine Mutter sie in jenen Tagen von ihrem Aberglauben geheilt habe.
»Merkwürdigerweise kann ich mich nicht genau an das Gesicht meiner Mutter erinnern«, gestand mir Georg, »aber an ihren Geruch sehr wohl: Sie roch nach Brot und Jasmin.«
*
5.
Der unleserliche Brief
Kommissar Barudi war, nach über vierzig Jahren im Dienst, ein berühmter Mann in Damaskus, der einige spektakuläre Fälle hatte aufklären können. Diese Erfolge regten die Fantasie der Damaszener an, die von ihm schwärmten, als wäre er der syrische Sherlock Holmes oder Magnum oder eine Mischung aus beiden. Aber neben diesen Fällen gab es, für die Öffentlichkeit unsichtbar, unzählige Mordfälle, die er nicht hatte lösen können oder dürfen, wenn etwa der Verbrecher dem innersten Kreis der Macht angehörte.
Wer Kommissar Barudi begegnete, war enttäuscht von seiner behäbigen, ja fast stoischen Art. Aber genau die war seine beste Tarnung. Barudi versteckte seine List hinter einer gut gespielten Arglosigkeit. Die dicke Brille ließ ihn eher wie einen Antiquar wirken. Er war so gar nicht der athletische, charmante Held, den die Damaszener in ihm sehen wollten.
Barudi war einer der wenigen Kommissare alter Schule und weigerte sich, der herrschenden Partei beizutreten. Dafür nahm er in Kauf, dass er nie aufstieg. Wann immer eine Beförderung anstand, kam eine Dienstbeschwerde dazwischen oder eine kritische Äußerung Barudis, die irgendein Spitzel gehört haben wollte. Nicht selten gaben ihm Kollegen oder Bekannte den Rat, in die Partei einzutreten, er aber ließ sie ein ums andere Mal wissen, wie gleichgültig ihm jedwede Chance auf einen Führungsposten war. »Mir gefällt mein Job und ich möchte ihn behalten, bis sie mich rausschmeißen.« Nach dem Tod seiner Frau war er zum Einzelgänger geworden, und nur dank seines schüchternen Lächelns schrappte er am Ruf eines Misanthropen vorbei. Wer ihn auf seinen Gleichmut ansprach, bekam zur Antwort, er solle unter der syrischen Bürokratie und Vetternwirtschaft erst einmal vierzig Jahre lang Mord und Totschlag aufklären, dann wisse er, warum ihn, Barudi, nichts mehr umwerfe.
Als Hauptmann Schukri die geräumige Küche der italienischen Botschaft betrat, saß Barudi mit dem Koch am Tisch und trank langsam seinen dritten Mokka. Vor ihm lagen wie immer ein Notizbuch mit wenigen Eintragungen und ein Bleistift. Schukri sah Barudi nie ohne Heft und Bleistift. Oft war er der Einzige in den Besprechungsrunden, der sich dauernd Notizen machte.
»Hauptmann Schukri«, rief Barudi und winkte den Kollegen herbei, »nimm dir einen Stuhl und trink mit uns einen Mokka. Ich bin hier gleich fertig, dann fahren wir zusammen los. Mein Wagen steht ganz in der Nähe.« Und an den unsicher dreinschauenden Koch gewandt: »Hauptmann Schukri ist einer meiner besten Kollegen. Er sagt bestimmt nicht nein.«
Der Koch hatte ein törichtes Gesicht, in dem eine rote Nase glühte. Er verstand die Aufforderung, dem müden Beamten einen Mokka zu kredenzen. Also erhob er sich, um ein Mokkatässchen aus dem Regal zu holen. Torkelnd, als wäre er betrunken, wankte er zum Herd. Schweigsam und in sich gekehrt kochte er den Mokka. Bald duftete der Raum nach Kardamom. Hauptmann Schukri nahm die dampfende Tasse dankbar entgegen. Seine Nase war vom Geruch des Olivenöls fast betäubt. Die Leiche hatte zwar nicht gestunken, sie war ja gewissermaßen einbalsamiert, doch der süßliche Geruch des Todes, vermischt mit einer unangenehmen Note von ranzigem Öl, hatte bei ihm Brechreiz erregt.
Barudi setzte sein Gespräch mit dem Koch fort. Aber dieser konnte nichts Genaueres sagen, außer dass er Kardinal Cornaro sofort erkannt habe. Hauptmann Schukri bewunderte Barudi, wie er immer wieder eine Frage stellte, die eher nebensächlich wirkte, aber den Kern der Angelegenheit traf. Er ging mit einer unbestechlichen, eigenartigen Ruhe an die Sache heran.
Seit über fünfzehn Jahren arbeiteten die beiden zusammen, und Schukri hatte vom ersten Augenblick an eine gewisse Nähe zu dem fleißigen Einzelgänger gespürt, der immer wieder mutig das Sippenhafte der Araber kritisierte und deshalb überall aneckte. »Mörder sind meist Einzeltäter, aber das Sippenhafte ist eine ansteckende Krankheit«, hatte Barudi einmal zu ihm gesagt.
Seit dem Tod seiner Frau lebte Barudi in einer kleinen Wohnung in der Midan-Straße, nicht einmal dreihundert Meter vom Büro entfernt. Das Gebäude, eine Bausünde der sechziger Jahre, war ein hässlicher großer Betonblock, alles Grau in Grau. Die schöne Wohnung in Bab Tuma, die Barudi mit seiner Frau bewohnt hatte, hatte er nach deren Tod aufgegeben. »Zu viele Erinnerung wohnen da«, hatte er damals gesagt.
Der Koch wiederholte, er habe den Eindruck gehabt, dass der Transporteur nicht wusste, was er transportierte. Der redselige Mann habe einen roten Ape gefahren. Nebenbei habe er erwähnt, dass er oft vor dem Hijaz-Bahnhof auf Kunden warte.
»Und Sie haben nicht zufällig erfahren, wie er heißt?«
»Ja, warten Sie«, erwiderte der Koch nach kurzem Zögern, »er erwähnte, dass man ihn Abu Ali nennt, aber so heißt doch jeder zweite Lastenträger.«
Barudi schrieb den Namen dennoch auf.
Als Schukri seinen Mokka ausgetrunken hatte, packte Barudi sein Heft in die Tasche und gab dem Koch seine Visitenkarte. »Falls Ihnen noch etwas einfallen sollte, lassen Sie es mich wissen. Auch Kleinigkeiten können uns helfen.«
Der Koch nickte wie abwesend. Barudi nahm seinen Mantel vom Haken an der Wand und trat vor die Tür.
»Der arme Kerl ist völlig durch den Wind«, sagte er zu seinem Kollegen, als beide schließlich im Auto saßen. Es regnete nicht mehr, aber ein starker Wind fegte durch die Straßen.
»Übrigens hat mich ein Mitarbeiter auf etwas aufmerksam gemacht: Der Tote hätte nicht in die italienische, sondern in die vatikanische Botschaft gebracht werden müssen. Dort ist seine Vertretung. Du bist doch Christ, du müsstest das wissen.«
Barudi lächelte. »Mein letzter Besuch in der Kirche liegt etwa ein Vierteljahrhundert zurück.«
»Ja, aber warst du nie in der vatikanischen Botschaft? Der Botschafter ist doch auch für euch zuständig, oder?«
»Nein, er ist zuständig für ein paar Gassen in Rom, die man Vatikan nennt. Ich bin zwar katholisch, aber bitte, mein Herr, ich gehöre zur katholischen Ostkirche. Wir haben den Europäern das Christentum gebracht und nicht umgekehrt.«
»Aber habt ihr keine Kardinäle?«
»Nein, wir haben Pfarrer, Bischöfe und einen Patriarchen für den gesamten Orient.«
»Also bist du ein orthodoxer Christ?«
»Nein«, erwiderte Barudi und lachte, »bei uns ist es fast so kompliziert wie bei euch. Ich sage ja immer, die Kirchen verlängern bloß den Weg zu Gott. Ich bin katholisch, und wir erkennen den Papst an, aber wir haben unsere eigene Kirche und auch etwas andere Riten. Die Orthodoxen erkennen den Papst nicht an, genauso wenig wie die Protestanten.«
»Aber ihr seid keine Kopten?«
»Nein, das sind die ägyptischen Christen. Die haben ihren eigenen Papst, er heißt Schenuda III.«
»Gott im Himmel«, sagte Schukri, »das soll einer wie ich noch verstehen, der nicht mal eine Ahnung von seiner eigenen Religion hat!« Schukri gehörte den Drusen an. Diese religiöse Minderheit wurde jahrhundertelang verfolgt und beschuldigt, den Islam zu verfälschen. Deshalb sind viele ihrer Rituale geheim. Die meisten Drusen bleiben als »Unwissende« ohne religiöse Erziehung. Nur die wenigen »Eingeweihten« wissen Genaueres über ihre Religion. Schukri war einer der Unwissenden.
»Aber zurück zu deiner Frage«, sagte Barudi. »Ich weiß, dass wir in Damaskus zwei verschiedene Botschaften haben, eine für Italien und eine für den Vatikanstaat.«
»Das aber bedeutet, dass der Herr, der dem Transporteur Fass und Adresse gegeben hat, diesen Unterschied nicht kannte, sprich: ein Muslim war.«
»Kann schon sein«, gab Barudi zu, »aber«, fuhr er nach kurzem Nachdenken fort, »es könnte auch ein Christ, ein Druse, ein Sunnit, ein Alawit oder sonst jemand gewesen sein, der sich mit unseren Botschaften nicht auskennt.« Barudi zögerte einen Augenblick. »Oder ein raffinierter Verbrecher, der eine falsche Fährte gelegt hat.«
»Du hast recht«, sagte Schukri, etwas enttäuscht über die vielen Möglichkeiten, die seine Information nahezu wertlos machten. »Und was tun wir jetzt?«
»Ich erledige ein paar Dinge, mache den Transporteur ausfindig und warte auf deinen Bericht«, antwortete Barudi.
»Übrigens, noch ein Detail, das einer meiner Mitarbeiter bemerkt hat. Ich weiß nicht, ob es interessant für dich ist. Der Kardinal trug seinen Ring nicht am rechten, sondern am linken Ringfinger. Ich verstehe nichts davon. Hat das eine Bedeutung?«
»Oh, ja. Bitte notiere es in deinem Bericht, unbedingt!«, erwiderte Barudi. »Wer den Ring vom rechten auf den linken Ringfinger setzt, will damit seine Verachtung zum Ausdruck bringen. Das ist, als ob man einem Offizier die Rangabzeichen von der Schulterklappe reißt. Damit ergibt das Ganze ein Bild. Man hat den Kardinal verurteilt, verstoßen und degradiert. Die Leiche ist absichtlich an seine nationale und nicht an seine geistliche Heimat geschickt worden. Das bedeutet, der Täter weiß genau Bescheid über die Feinheiten der Macht in der katholischen Kirche. Gratuliere deinem Mitarbeiter, das ist eine großartige Beobachtung.«
Schukri nickte nachdenklich. Der Fall schien sich für ihn eher zu verkomplizieren, und er teilte den Optimismus seines Kollegen nicht. Als er die Arbeit der syrischen Kriminalpolizei mit dem Gang über ein Minenfeld verglich, winkte Barudi ab.
»Übertreib nicht. Wir haben es hier sehr gut. Zwar gilt es bei unserer Arbeit das eine oder andere Hindernis zu überwinden, aber dafür werden wir ja bezahlt. Und wenn ich mich umschaue, was die anderen alles tun müssen, die genauso qualifiziert sind wie wir beide, dann fühle ich mich privilegiert.«
»Na, Glückwunsch zu diesem Gefühl, das ich nie gehabt habe und auch nie haben werde«, erwiderte Schukri trotzig.
Eine nervöse Stille machte sich breit. Barudis Gewissen meldete sich. Er kam sich vor wie ein schäbiger Krämer, der das glänzende Gemüse in seiner Kiste lobt, insgeheim aber sehr genau weiß, dass verdorbene Ware darunterliegt. Wie zu Beginn eines jeden Falles fühlte sich Barudi ziemlich hilflos. Auch dem Profi blieb in diesem Stadium nichts anderes übrig, als zu mutmaßen, ohne sich festzulegen.
»Wo willst du hin? Ins Büro?«, erkundigte sich Barudi, als ihm das Schweigen auf die Nerven ging.
»Nein, ich muss ins Präsidium, lass mich bitte hier raus, dann nehme ich ein Taxi. Du kümmerst dich derweil um den Transporteur.«
»Ich bin gern dein Taxi. Macht zwanzig Lira oder ein Glas Rotwein.«
»Dann lieber den Wein«, sagte Schukri und lachte. Er freute sich über die seltenen Abende mit dem kauzigen Kollegen.
»Am Freitag?«
»Gut, das passt. Um wie viel Uhr?«
»Zwanzig Uhr. Bis dahin hast du gegessen. Ich mache zurzeit eine Diät«, sagte Barudi und schlug sich mit der rechten Hand auf den Bauch, der sich unter dem Pullover wölbte. »Ich esse nichts zu Abend. Das soll das Leben um mindestens fünf Jahre verlängern. Ohne Zigaretten habe ich mir weitere fünf und ohne Frauen noch einmal zehn Jahre gesichert«, sagte er.
»Wozu dann leben?«, erwiderte Schukri fast ein wenig zynisch. Er kochte und trank gern.
Kurz darauf bremste Barudi den Wagen vor dem Präsidium in der Khaled-bin-al-Walid-Straße. »Bis Freitag, wir bleiben in Verbindung«, sagte Barudi, als sein Kollege ausstieg. Das war nur eine Floskel. Sie arbeiteten im selben Gebäude und waren ständig in Kontakt.
Barudi fuhr weiter zum Hijaz-Bahnhof. Und als hätten sie es vereinbart, dachte Schukri noch eine ganze Weile über den Witwer Barudi nach und dieser über den ewigen Junggesellen Schukri. Und seltsamerweise ergriff beide ein gewisses Mitleid.