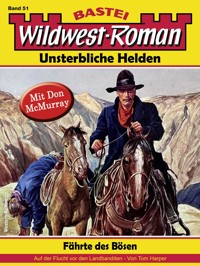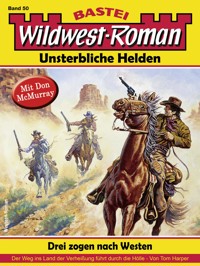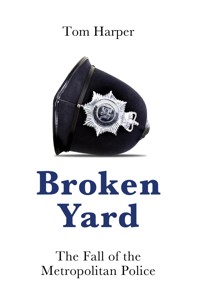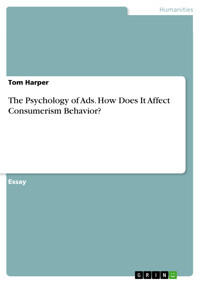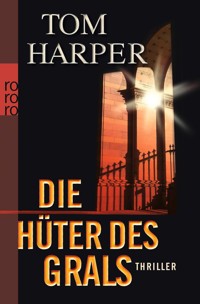9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Alte Gräber, neue Tote Ein romantischer Wochenendtrip entwickelt sich für Abby Cormac zum Albtraum: Ihr Freund wird vor ihren Augen ermordet, sie selbst überlebt schwerverletzt. Michael, ein angesehener Diplomat, soll illegal mit Antiquitäten gehandelt haben. Sein wichtigster Geschäftspartner: ein international gesuchter Kriegsverbrecher. Abby findet heraus, dass Michael auf dem Balkan auf ein altrömisches Grab gestoßen war. Ein Grab, das ein Geheimnis birgt. Und das Vermächtnis eines der größten Herrscher der Antike … «Großartig erzählt und exzellent recherchiert. Faszinierend und unterhaltsam zugleich.» (The Times)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 619
Ähnliche
Tom Harper
Die Geheimnisse der Toten
Thriller
Aus dem Englischen von Michael Windgassen
Rowohlt Digitalbuch
Inhaltsübersicht
für
Dusty und Nancy Rhodes
und
Patrick und Mary Thomas
In memoriam
Güte, bewaffnet mit Macht, ist verdorben;
ohne Macht geht reine Liebe verloren.
– Reinhold Niebuhr, Jenseits der Tragödie
Die Toten bewahren ihre Geheimnisse, bald
werden wir so klug sein wie sie.
– Alexander Smith
1Priština, Kosovo – Gegenwart
An einem Freitagnachmittag der Arbeit entfliehen zu können war für Abby immer noch ein ungewohnter Luxus.
Zehn Jahre lang hatte sie von früh bis spät an den dunklen Stellen der Welt gearbeitet, hatte zugehört, wenn gebrochene Menschen von unvorstellbar brutalen Gewaltakten berichteten, und hatte abends dann in umgebauten Frachtcontainern, die je nach Jahreszeit unerträglich heiß oder kalt waren, diese Geschichten in ihren Laptop getippt, das Blut und die Tränen aus ihnen herausgewrungen, bis sie nur noch trockenes Papier waren, das am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag als Zeugnis vorgelegt werden konnte. In dieser Zeit hatte sie nie entfliehen können. Sie hatte ihre Albträume zu zählen aufgehört oder die vielen Male, die sie spät in der Nacht vor der chemischen Toilette gekniet und versucht hatte, sich von den schrecklichen Dingen zu reinigen, die ihr zu Ohren gekommen waren. Zu dem, was sie über die Jahre hatte opfern müssen, zählten mehrere hoffnungsvolle Beziehungen, eine Ehe und schließlich sogar ihr Mitempfinden. Trotzdem war sie am nächsten Morgen immer wieder zur Stelle gewesen.
Dieser Abschnitt in ihrem Leben war nunmehr Geschichte. Man hatte sie in den Kosovo entsandt, wo sie im Rahmen der Rechtsstaatlichkeitsmission der Europäischen Union, kurz EULEX, aus Kosovaren mustergültige Europäer machen sollte. Es war natürlich auch dort zu Kriegsverbrechen gekommen, doch darum kümmerten sich jetzt andere. Sie arbeitete mit den Zivilgerichten zusammen und versuchte, die verwickelten Fragen der Eigentumsrechte für die Nachkriegszeit zu klären. Michael nannte ihre Dienststelle das «Fundbüro». Seine Hänseleien machten ihr nichts aus. Sie konnte nachts wieder schlafen.
Abby sammelte ihre Akten ein, schloss sie weg und räumte den Schreibtisch für die Putzfrauen auf, die am Wochenende kommen würden. Feierabend. Sie wollte gerade ihren Computer ausschalten, als ihr der Eingang einer neuen E-Mail gemeldet wurde. Dass sie davon nicht Notiz nehmen musste, war ebenso ein Luxus. Sie würde sich am Montag damit befassen. Es war zwei Uhr am Mittag, ihre Arbeitswoche war beendet.
Draußen auf der Straße stand Michaels Wagen, ein Porsche Cabrio, Baujahr 1968, wahrscheinlich der einzige seiner Art auf dem Balkan. Obwohl Gewitterwolken aufgezogen waren, war das Verdeck heruntergeklappt. Michael ließ den Motor aufheulen, als Abby vor die Tür trat. Wäre sie nicht so glücklich gewesen, hätte sie sich für diese Angebergeste geschämt. Typisch Michael. Sie glitt auf den Beifahrersitz, gab Michael einen Kuss und spürte seine grau melierten Stoppeln auf der Haut. Leute kamen aus dem Haus und glotzten. Sie fragte sich, ob deren Neugier dem Wagen galt oder ihr. Michael war zwanzig Jahre älter als sie, was durchaus auffiel, doch das Alter stand ihm gut. Die Falten betonten seine angenehmen Seiten: sorglose Heiterkeit, Zuversicht und Stärke. Als seine Haare grau wurden, hatte er sich einen goldenen Ohrring zugelegt. Um keinen allzu respektablen Eindruck zu machen, sagte er. Abby fand, dass er wie ein Pirat aussah.
Er legte ihr eine Hand unters Kinn, hob ihren Kopf an und warf einen Blick auf den Hals. «Du trägst die Kette.»
Offenbar freute er sich darüber. Er hatte ihr die Kette vor einer Woche geschenkt, ein feingliedriges goldenes Gewebe mit fünf roten Glasperlen, in der Mitte ein frühchristliches Monogramm in der Form eines P mit einem Querstrich, obwohl Michael mit Religion eigentlich nichts am Hut hatte. Die Kette fühlte sich uralt an. Das dunkle Gold glänzte wie Honig, der rote Stein war angelaufen. Auf die Frage, woher die Kette stamme, hatte Michael schief gelächelt und gesagt, eine Roma habe sie ihm gegeben.
Den Kopf zur Seite gedreht, bemerkte sie aus den Augenwinkeln, dass ihre schwarze Reisetasche auf der Rückbank lag, gleich neben seinem Aktenkoffer.
«Wohin fahren wir?»
«Zur Bucht von Kotor. Montenegro.»
Sie verzog das Gesicht. «Aber das sind sechs Stunden bis dahin.»
«Nicht unbedingt.» Er scherte aus der Parklücke aus und passierte den Sicherheitsposten in seinem blauen Blazer und der Baseballkappe. Der Mann war sichtlich angetan von dem Wagen und salutierte zackig. Unter den vielen schlechten Fahrzeugen, die von der EU gestellt wurden, stach der Porsche wie der seltene Vertreter einer bedrohten Spezies hervor.
Michael löste eine Hand vom Steuer und griff nach einem Flachmann neben der Handbremse. Seine Hand streifte Abbys Schenkel am hochgerutschten Saum ihres leichten Sommerkleides. Er nahm einen Schluck aus dem Fläschchen und reichte es ihr.
«Es wird sich lohnen. Versprochen.»
Wahrscheinlich würde er recht behalten. So war es immer bei ihm: Man wollte ihm glauben, egal, wie verrückt seine Ideen auch sein mochten. Mit halsbrecherischen Manövern, die wohl selbst hiesige Fahrer, die zu den rücksichtslosesten in Europa zählten, nicht gewagt hätten, schlängelten sie sich durch das Verkehrschaos von Priština. Kaum hatten sie es hinter sich gelassen, drückte Michael das Gaspedal bis zum Anschlag durch. Abby lehnte sich zurück und sah die Landschaft vorbeifliegen. Mit heruntergelassenem Verdeck jagten sie vor dem Sturm her, der sich hinter ihnen zusammenbraute, über die Ebene des Kosovo und auf die Ausläufer der Berge zu, die die sinkende Sonne gegen den Himmel quetschten. Er schien scharlachrot zu bluten. An der Grenze zu Montenegro wechselte Michael ein paar Worte mit den Zöllnern, die sie sofort durchwinkten.
Sie waren jetzt tief in den Bergen, umwirbelt von kaltem Wind. Obwohl schon August war, hatten sich auf den Höhen vereinzelt Schneefelder gehalten. Michael ließ das Verdeck unten, drehte aber die Heizung voll auf. Abby fand eine Decke im Fußraum und wickelte sie um sich.
Und plötzlich war das Ziel erreicht. Die Straße führte um einen Felsvorsprung herum auf einen Hang hoch über dem Meeresarm, auf den sich die Schatten der Berge gelegt hatten. In kleinen Buchten und an Stränden funkelten dicht an dicht die Lichter der Segel- und Motoryachten wie leuchtender Seetang.
Michael bremste ab und steuerte scharf nach links. Abby schnappte nach Luft. Es schien, als schleuderte er über den Rand der Klippe hinaus. Tatsächlich aber befanden sie sich auf einem unbefestigten Fahrweg, der vor einem schmiedeeisernen Tor in einer verputzten hohen Mauer endete. Aus dem Handschuhfach holte Michael eine Fernbedienung hervor. Das Tor glitt auf.
Abby krauste die Stirn. «Kommst du häufiger hierher?»
«Heute ist es das erste Mal.»
Den Blick durch das geöffnete Tor gerichtet, entdeckte Abby das Flachdach eines Gebäudes, das in der Dämmerung gespenstisch weiß aufleuchtete. Es stand auf einem Felsvorsprung weiter unten am Hang, an der einzigen Stelle diesseits des Meeresarms, wo ein Haus überhaupt stehen konnte. Jenseits der Bucht waren die Lichter einer Stadt zu sehen, die sich über die gesamte Bergflanke ausbreitete.
Michael hielt auf einem kiesbedeckten Vorplatz vor dem Haus an. Er stieg aus, zog einen Schlüssel aus der Tasche und öffnete die schwere Eichentür.
«Nach Ihnen, gnädige Frau.»
Von außen schlicht, war das Innere der Villa umso überwältigender. Als gutdotierte EU-Gesandte wohnte Abby in Priština durchaus komfortabel, aber dieser Luxus hier rangierte auf einer völlig anderen Ebene. Die Böden waren aus Marmor: grünliche und rosafarbene Fliesen, in geometrischen Mustern verlegt. Das Mobiliar schien von Riesen getischlert worden zu sein. In den Sesseln und Sofas konnte man sich verlieren. Ein Esstisch aus Mahagoni bot Platz für zwölf Personen, und an der Wand hing der größte Flachbildschirm, den Abby je gesehen hatte. Die gegenüberliegende Wand beherrschte eine ebenso große, dreigeteilte Ikone, von der drei orthodoxe Heilige vor einem Hintergrund aus Blattgold auf sie herabblickten.
«Wie viel hat dich das gekostet?»
«Keinen Penny. Das Haus gehört einem italienischen Richter, einem Freund von mir. Er hat es mir für das Wochenende überlassen.»
«Erwarten wir noch andere Gäste?»
Michael schmunzelte. «Wir haben das ganze Haus für uns.»
Sie blickte auf den Aktenkoffer, den er bei sich trug. «Du willst doch hoffentlich nicht arbeiten?»
«Warte, bis du den Pool gesehen hast.»
Er öffnete die Glastür. Abby trat nach draußen und schnappte abermals unwillkürlich nach Luft. Die Pool-Terrasse reichte bis zum Felsrand hinaus und wurde auf drei Seiten flankiert von klassischen Säulen, deren Kannelierung und korinthischen Kapitelle nicht so recht zu der ansonsten modernen Architektur passten. Auf der vierten Seite stürzte der Fels jäh in die Tiefe. Im Dämmerlicht hatte es den Anschein, als schwebte der Pool über dem Meer. Ein Geländer gab es nicht.
Abby hörte ein leises Klicken im Rücken. Michael hatte einen Schalter bedient. Indirektes Licht ließ das Wasser aufleuchten. Abby blickte auf eine Unterwasserwelt aus Nymphen und Delphinen, Meerjungfrauen und Seesternen. Ein kunstvolles Mosaik aus kleinen schwarzen und weißen Steinen zeigte eine Gottheit mit Haaren aus Seetang, die in einem Streitwagen von vier Pferden gezogen wurde. Im flimmernden Licht des leicht bewegten Wassers schien das ganze Ensemble zu tanzen.
Hinter den Säulen flammten weitere Lichter auf, gerichtet auf marmorne Skulpturen: Herkules in einem Löwenfell, auf seine Keule gestützt; eine barbusige Aphrodite, die das bis zu den Hüften heruntergerutschte Gewand mit den Händen festhielt; Medea mit einem Gewusel von Schlangen auf dem Haupt. Abby nahm an, die Skulpturen seien durch und durch aus Marmor, doch als sie eine mit der Hand berührte, geriet sie auf ihrem Sockel ins Wanken. Sie war so leicht, dass ein Windstoß sie zu Fall gebracht hätte. Erschrocken wich Abby zurück.
«Vorsicht», sagte Michael. «Die werden heute nicht mehr hergestellt.»
Abby lachte. «Du willst doch nicht behaupten, das seien Originale?»
«O doch. Das wurde mir jedenfalls versichert.»
Verwirrt schlenderte Abby an den stummen Gestalten vorbei. Sie erreichte das Ende der Terrasse und schaute in die Tiefe. Der Fels war so steil, dass man den Fuß nicht sehen konnte, nur den silbrigen Schaum des von den Klippen aufgewühlten Wassers. Sie fröstelte. Das dünne Sommerkleid, das sie trug, reichte so spät im August bei weitem nicht mehr.
Plötzlich knallte es hinter ihr. Irgendetwas flog dicht an ihrem Kopf vorbei, streifte fast ihre Wange. Für einen Moment wähnte sie sich nach Freetown, Mogadischu oder Kinshasa zurückversetzt. Herumwirbelnd geriet sie am Rand der Terrasse aus dem Gleichgewicht und griff instinktiv nach der nächsten Säule, um sich daran festzuhalten.
«Alles in Ordnung?»
Michael stand neben dem Pool. Er hielt zwei Champagnerflöten in der einen und eine geöffnete Flasche Pol Roger in der anderen Hand.
«Tut mir leid, wenn ich dich erschreckt habe. Ich dachte, wir sollten feiern.»
Feiern? Was? Abby lehnte sich an die Säule und hielt sich fest, als eine Windböe an ihrer goldenen Halskette zupfte. Ein verrückter Gedanke schoss ihr durch den Kopf. Wollte er ihr etwa einen Antrag machen?, fragte sie sich mit pochendem Herzen.
Michael schenkte den Champagner ein und drückte ihr eines der Gläser in die Hand. Ein kleiner Schluck schwappte über den Rand und tropfte ihr von den Fingern. Er legte ihr einen Arm um die Schulter und zog sie an sich. Abby nippte an ihrem Glas. Michael schaute aufs Meer hinaus, als suchte er etwas. Am Horizont verlosch das letzte dünne Lichtband des Tages.
«Ich habe Hunger.»
Michael holte eine Kühltasche aus dem Wagen, und bald duftete es im Haus nach geschmortem Knoblauch, Krevetten und Kräutern. Abby schaute ihm beim Kochen zu und trank. Der Champagner hielt nicht lange vor. Aus der Kühltasche tauchte eine Flasche Sancerre auf, und auch sie war bald leer. Abby fand einen Schalter, mit dem sich die Heizstrahler auf der Terrasse in Betrieb nehmen ließen. Sie aßen draußen am Pool. Ihre nackten Beine baumelten im Wasser. Das Licht umspülte die Säulenreihe, und am Himmel funkelten Sterne.
Abby fühlte sich völlig entspannt, was wohl nicht zuletzt dem guten Essen und Trinken zu verdanken war. Weil es kühler wurde, machte Michael Feuer im Wohnzimmerkamin. Vom Sofa aus betrachteten sie die Sterne über der Bucht. Abby rollte sich wie ein Kätzchen zusammen, bettete ihren Kopf auf Michaels Schoß und schloss die Augen, während er ihr streichelnd durchs Haar fuhr. Du bist zweiunddreißig, ermahnte eine kleine Stimme sie, keine siebzehn mehr. Was soll’s? Es gefiel ihr, gestreichelt zu werden. Michael gegenüber hatte sie keinerlei Verpflichtungen. Das Leben mit ihm war leicht.
Viel später – nach einer zweiten Flasche Wein, als die Lichter der Stadt auf der anderen Seite der Bucht schon verloschen waren und im Kamin nur noch Glut glomm – erhob sich Abby vom Sofa. Sie wankte. Michael, noch überraschend sicher auf den Beinen, gab ihr Halt.
Sie schlang die Arme um ihn und küsste seinen Hals.
«Gehen wir ins Bett?» Ihr war bewusst, dass sie einen Schwips hatte, doch es fühlte sich gut an. Sie wollte ihn und machte sich daran, sein Hemd aufzuknöpfen, was er aber nicht zuließ.
«Du bist unersättlich», rügte er sie.
Er führte sie ins Schlafzimmer, löste ihr die Kette vom Hals und setzte sie auf das Bett. Abby versuchte, ihn auf sich zu ziehen. Er aber trat einen Schritt zurück.
«Was hast du vor?»
«Ich bin noch nicht müde.»
«Ich auch nicht», log sie. Doch kaum hatte er ihr einen Gutenachtkuss gegeben und die Tür hinter sich zugezogen, schlief sie bereits tief und fest.
Die Kälte weckte sie. Sie lag auf der Decke, immer noch in ihrem Sommerkleid, und spürte den kalten Hauch von der Klimaanlage ihre Haut streifen. Sie wälzte sich auf die Seite, um bei Michael Wärme zu suchen. Tastend streckte sie den Arm aus, über die gesamte Breite des Bettes bis ans Nachttischchen.
Er war nicht da.
Sie blieb eine Weile lang liegen und versuchte, sich in dem ungewohnten Zimmer zu orientieren. Einen Lichtschalter konnte sie nirgends ausmachen. Sie hörte nur das Summen der Klimaanlage und eine tickende Uhr neben dem Bett. Ihre Leuchtziffern schrieben 3:45 Uhr.
Und dann war da noch etwas – eine murmelnde Stimme. Abby lauschte in die Stille des Hauses. Waren es zwei Stimmen, im Gespräch miteinander? Oder hörte sie nur Wellen an den Fuß des Felsens branden?
Es war der Fernseher, glaubte sie endlich zu wissen. Vielleicht hatte Michael ferngesehen und war darüber eingeschlafen. Ihre Augen hatten sich inzwischen an die Dunkelheit gewöhnt. Sie sah ein schwaches bläuliches Licht unter der Tür her vom Flur hereinflackern.
Träge von Schlaf und Alkohol, wusste sie nicht recht, was sie tun sollte. Vielleicht war es besser, Michael schlafen zu lassen, bis er von allein aufwachte. Aber es war so kalt im Bett!
Sie stand auf und tappte auf bloßen Füßen durch den Flur ins Wohnzimmer. Der riesige Bildschirm an der Wand schimmerte diodenblau. In einem silbernen Aschenbecher lagen sechs Zigarettenkippen. Das Ledersofa zeigte eine Vertiefung, wo Michael gelegen haben musste.
Aber er war nicht da. Und der Fernseher war auf stumm geschaltet.
Was habe ich da gehört?
Ein Windstoß führte Düfte der Nacht mit sich: Jasmin, Feigen und Chlor. Die Außenbeleuchtung war immer noch eingeschaltet. Die Tür stand offen. Abby sah Michael am Pool stehen und eine Zigarette rauchen. Neben ihm lag auf einem Metalltisch sein Aktenkoffer mit aufgeklapptem Deckel. Ein Mann in weißem Hemd und schwarzer Hose begutachtete seinen Inhalt.
Abby ging hinaus, immer noch wacklig auf den Beinen. Hinter der Schwelle prallte sie mit den nackten Zehen gegen einen harten Gegenstand, den sie im Dunkeln nicht gesehen hatte. Vor Schmerz und Schreck stieß sie einen kleinen Schrei aus. Die leere Champagnerflasche rollte über die Fliesen und fiel platschend in den Pool.
Die beiden Männer fuhren herum und starrten ihr entgegen.
«Störe ich?»
«Geh wieder rein!», rief Michael.
Er klang verzweifelt. Irritiert ging sie zwei Schritte weiter und trat ins Licht der Poolscheinwerfer. Der Mann im weißen Hemd griff hinter sich. Als er die Hand wieder zeigte, hielt er eine schwarze Pistole darin.
Es war der letzte Eindruck, an den sie sich später klar erinnerte. Alles andere war im Nachhinein verschwommen und bruchstückhaft. Michael stieß den Mann zurück, worauf der Schuss ins Leere ging. Der Tisch kippte um. Der Aktenkoffer landete mit allem, was darin lag, auf dem Boden. Doch darauf achtete sie nicht. Sie sprang zurück, glitt aus und stürzte.
Hart traf sie auf dem Wasser auf. Zappelnd ging sie unter. Sie schmeckte Chlor in der Kehle und musste würgen. Der Saum des Sommerkleids klebte an ihrem Gesicht.
Wieder an der Oberfläche, strampelte sie auf den Beckenrand zu. Die vom weichen Licht umspülten Nymphen in der Tiefe lockten sie zu sich, doch mit beiden Armen stemmte sie sich aus dem Wasser.
Ausgestreckt am Beckenrand, sah sie aus der Froschperspektive den Aktenkoffer und seinen verstreuten Inhalt am Boden liegen. Die marmornen Gottheiten blickten auf sie herab. Am anderen Ende der Terrasse rangen zwei Männer über dem Abgrund. Michael schlug mit der Faust zu und verfehlte sein Ziel. Von seinem Gegner am Arm gepackt, wurde er zur Felskante hin herumgeschleudert. Für einen Moment sah es so aus, als umarmte sich ein Liebespaar. Doch plötzlich und blitzschnell trat der Fremde auf Michaels Standbein ein und stieß ihn zur Seite. Michael wankte und flatterte mit ausgestreckten Armen wie ein flügellahmer Vogel. Fast wäre es ihm gelungen, das Gleichgewicht wiederzufinden. Doch schon setzte sein Gegner zum Todesstoß an, der aber gar nicht mehr nötig war. Ohne einen Ton von sich zu geben, kippte Michael über den Rand und verschwand in der Tiefe.
Abby konnte nicht anders und schrie laut auf. Der Mann wandte sich ihr zu. Seine Bewegungen waren präzise, ohne jede Hast. Er hob die Pistole vom Boden auf, die er im Kampf mit Michael fallen gelassen hatte, prüfte den Schlitten und das Magazin, ließ die im Lauf steckende Patronenhülse auswerfen und lud neu durch.
Abby stand vom Boden auf, behindert durch das nasse Kleid, das an ihrem Körper klebte. Sie musste fliehen – aber wohin? Zum Wagen? Sie wusste nicht, wo Michael die Schüssel abgelegt hatte. Der fremde Mann kam mit erhobener Waffe auf sie zu. Abby sprang hinter die nächste Säule, als sich der Schuss löste. Stein splitterte, irgendetwas zerbarst krachend.
Geduckt rannte sie die Säulenreihe entlang, an den Skulpturen vorbei. Sie kam sich vor wie auf einem Schießstand, doch es fiel kein weiterer Schuss. War dem Eindringling die Munition ausgegangen?
Am Ende der Kolonnaden angekommen, blieb sie stehen, überragt von einem marmornen Jupiter, der einen Blitz in der Faust hielt. Schritte näherten sich langsam.
Mit Entsetzen wurde ihr klar, warum er seine Waffe nicht mehr auf sie abfeuerte. Sie hatte sich in eine Ecke abdrängen lassen, in der sie wie in einer Falle steckte. Sie kauerte sich hinter den Sockel einer Statue und hörte, wie der Mann stehen blieb.
Die Stille war schlimmer als alles andere.
«Was wollen Sie?», rief sie.
Eine Antwort blieb aus. Wasser tropfte von ihrem nassen Kleid und lief unter ihr zu einer Pfütze zusammen. Worauf wartet er?
Sie hatte geglaubt zu wissen, wie es war, den Tod vor Augen zu haben. Ihr waren in zahllosen Berichten solche Momente geschildert worden. Aber alle, die Zeugnis ablegen konnten, hatten schließlich doch überlebt. Manche hatten, als die Mörder kamen, fliehen können; andere hatten sich auf den Schlachtfeldern tot gestellt, stundenlang, während Familienangehörige und Nachbarn um sie herum starben.
Ihr blieb jetzt nur eine einzige Chance. Sie schnellte in die Höhe, warf sich mit voller Wucht gegen die Statue und stürzte die Gottheit vom Sockel. Der fremde Mann wich vor den fliegenden Scherben zurück und geriet ins Wanken.
Abby rannte los. Sie überquerte die Terrasse und hastete ins Haus. Auf dem riesigen Bildschirm waren die üblichen Szenen von Krieg und Rache zu sehen, fernab von dem realen Schrecken, dem sie ausgeliefert war.
Wohin?
Der Killer hatte sich offenbar wieder gefangen. Die erste Kugel ließ die Scheibe hinter ihr zerplatzen, die zweite traf ihre Schulter und wirbelte sie herum. Sie sah ihn durch das zerbrochene Fenster steigen, die Waffe auf sie gerichtet.
«Bitte», flehte sie. Sie wollte fliehen, fühlte sich aber wie gelähmt. «Warum tun Sie das?»
Der Mann zuckte mit den Achseln. Er hatte einen schwarzen Schnauzbart und ein behaartes Muttermal auf der rechten Wange. Seine Augen waren dunkel und hart.
Ihr letzter Gedanke galt einer Zeugin, die sie vor Jahren interviewt hatte, einer ergrauten Hutu-Frau, die in irgendeinem Dschungellager zwischen Kongo und Ruanda Getreide mahlte. «Sie haben nie aufgegeben», hatte Abby voller Bewunderung zu ihr gesagt, doch die Frau schüttelte den Kopf.
«Ich hatte einfach nur Glück. Im Unterschied zu den anderen.»
Der Mann hob die Pistole und drückte ab.
2Römische Provinz Moesia – August 337
Es ist noch August, aber schon hat der Herbst Einzug gehalten. Wie jeder alte Mann fürchte ich diese Jahreszeit. Schatten fallen, die Nächte werden länger, Messer blitzen. An Abenden wie diesem, wenn die kalte Luft meine alten Wunden quält, ziehe ich mich ins Badehaus zurück und lasse von meinen Sklaven Feuer machen. Das Becken ist leer. Trotzdem setze ich mich an den Rand und gieße Wasser über die heißen Steine. Der Dampf steigt mir in die Nase und tut meiner Haut gut. Vielleicht mache ich es so meinen Mördern, wenn sie kommen, leichter.
Ich bin bereit zum Sterben – es schreckt mich nicht. Mein Leben währt schon länger, als ich es verdient habe. Ich war Soldat, Höfling und Politiker. Keines dieser Ämter steht für Langlebigkeit. Wenn meine Mörder kommen – und ich weiß, dass sie kommen –, werden sie nicht zögern. Sie haben in diesen Tagen viel zu tun. Ich bin nicht der Letzte, den sie töten müssen. Foltern werden sie mich nicht, denn dazu fehlen ihnen die Fragen.
Sie haben keine Ahnung, was sie von mir erfahren könnten.
Ein kalter Schauer läuft mir über den Rücken. Ich habe mich nicht ausgezogen – nackt will ich nicht sterben –, und meine Kleider sind durchnässt. Ich gieße noch mehr Wasser ins Becken, beuge mich in den Dampf und starre durch die Schwaden auf die schwarzweißen Meeresgötter am Boden. Sie starren vorwurfsvoll zurück. Sterbende Götter einer sterbenden Welt. Wissen sie, welche Rolle ich bei ihrem Niedergang gespielt habe?
Wieder schaudert es mich. Ich bin bereit zum Sterben. Was mich schreckt, ist der Tod. Das Danach. Götter, die im Frühling sterben, finden mitunter ins Leben zurück. Nicht so alte Männer, die im Herbst getötet werden. Aber wohin gehen sie stattdessen?
Der Dampf wird dichter.
Zeit meines Lebens habe ich mit Göttern gerungen, genauer: mit einem Gott, der Mensch wurde, und einem Menschen, der Gott wurde. Jetzt, zum Ende hin, blicke ich in den dampfenden Abgrund und weiß ebenso wenig, was die Götter mit mir vorhaben, wie vor all den Jahren, als ich gerade über den Rand meiner Wiege hinausschaute. Rätselhaft bleibt mir auch das, was mir vor vier Monaten an einem staubigen Apriltag in Konstantinopel geweissagt wurde, dass nämlich ein toter Mann mein Leben verändern würde. Das, was davon übrig geblieben ist.
Erinnerungen umwölken mich und gerinnen zu Tropfen auf meiner Haut. Der Geist ist ein fremdes Land mit vielen Mauern, aber ohne Entfernung. Ich bin nicht mehr im Badehaus, sondern an einem anderen Ort, in einer anderen Zeit, und mein ältester Freund sagt …
«… ich brauche dich.»
Wir sind im Audienzsaal des Palastes, doch außer uns ist niemand zugegen. Zwei alte Männer, gezeichnet von der Zeit. Doch zwischen uns hat sich nichts geändert. Seit ich denken kann, führt er das Wort, und ich applaudiere.
Diesmal aber applaudiere ich nicht. Ich höre ihm zu – er spricht von einem Toten –, und ich frage mich, ob meine Miene angemessen ist. Nach so vielen Jahren bei Hof kann ich meine Gefühle wie Masken aufsetzen, die aus einer gutgeölten Lade hervorgeholt werden. Doch ich weiß nicht, was dieser Augenblick verlangt. Ich möchte dem Toten Respekt zollen, aber nicht zu viel, denn in seinen Tod investieren, wie es von mir verlangt wird, will ich nicht. Bin ich deshalb gefühllos und abgestumpft?
«Sie fanden ihn vor zwei Stunden in der Bibliothek der Akademie. Und kaum dass ihnen bewusst war, wer er ist, schickten sie einen Boten zum Palast.»
Er versucht, mir die Geschichte schmackhaft zu machen, meine Neugier zu wecken. Ich schweige. Es gibt nicht viele, die stumm bleiben, wenn er zu ihnen spricht. Vielleicht bin ich der Einzige. Wir sind wie Brüder aufgewachsen, waren die unzertrennlichen Söhne zweier Offiziere in derselben Region. Seine Mutter führte ein Wirtshaus, meine eine Wäscherei. Heute schmücken ihn Titel, so zahlreich wie die in sein Gewand gestickten Edelsteine. Flavius Valerius Constantinus – Kaiser, Cäsar und Augustus, Konsul und Prokonsul, Hohepriester. Konstantin der Fromme, der Gläubige, der Gesegnete und Gütige. Konstantin der Siegreiche, der Triumphator, der Unbezwungene. Kurzum: Konstantin der Große.
Und noch immer, obwohl er ein alternder Großvater ist, strahlt er Größe aus. Das spüre ich. Sein rundes Gesicht, puppenhaft und verführerisch, als er jung war, mag dick und schlaff geworden sein, die Muskeln, die ein Imperium errungen haben, sind vielleicht verkümmert. Aber die Größe bleibt. Künstler, die ihn mit goldener Gloriole darstellen, kolorieren nur, was jedermann weiß. Er verkörpert Macht – jene unbezwingbare Zuversicht, die nur von den Göttern verliehen werden kann.
«Der Name des Toten ist Alexander. Er war ein Bischof und von großer Bedeutung für die christliche Gemeinschaft. Und offenbar unterwies er einen meiner Söhne.»
Einen meiner Söhne, offenbar. Mir ist, als spülte eine kalte Meeresströmung über mich hinweg, doch ich zucke nicht. Ich verziehe keine Miene. So wenig wie er.
Ohne Vorwarnung wirft er mir etwas zu. Ich bin zwar langsam und schwerfällig geworden, kann mich aber immer noch auf meine Reflexe verlassen. Ich fange es mit einer Hand auf und öffne meine Faust.
«Das hat man neben seiner Leiche gefunden.»
Es ist eine Kette mit Amulett, ungefähr so groß wie mein Handteller. Konstantins Monogramm, leicht verändert, der Buchstabe P mit einem aufrechten Kreuz verbunden, eingefasst in ein feinziseliertes Goldgewebe und besetzt mit roten Glasperlen. Die Kette ist aufgebrochen und scheint von jemandes Hals gerissen worden zu sein.
«Gehörte es dem Bischof?»
«Sein Diener sagt nein.»
«Hat sein Mörder die Kette verloren?»
«Vielleicht wurde sie auch absichtlich neben die Leiche gelegt.» Er seufzt ungeduldig. «Auf diese Fragen brauche ich eine Antwort, Gaius.»
Die Kette liegt kalt in meiner Hand, ein unliebsames Pfand des Toten, das ich zu tragen gezwungen bin. Ich wehre mich noch dagegen. «Über Christen weiß ich nichts.»
«Unsinn.» Konstantin berührt meine Schulter. Früher hätte mir diese Geste geschmeichelt, aber jetzt fühle ich mich wie von einem starren Arm zurückgehalten. «Du weißt immerhin, dass sie sich befehden wie Katzen in einem Sack. Wenn ich einen von ihnen zu mir bestellte, käme gleich die Hälfte seiner Bruderschaft angelaufen, um ihn als Schismatiker und Häretiker zu verdammen. Die andere Hälfte würde nicht lange auf sich warten lassen und sie derselben Verbrechen bezichtigen.»
Er schüttelt den Kopf. Obwohl selbst ein Gott, vermag er nicht, die Mysterien der Christen zu ergründen.
«Glaubst du, ein Christ hat ihn getötet?»
Er gibt sich schockiert, und ich bin fast geneigt, ihm seinen Schrecken abzunehmen. «Bewahre! Sie spucken und kratzen, beißen aber nicht.»
Ich widerspreche nicht. Ich weiß ja nichts von den Christen.
«Aber die Leute werden spekulieren. Manche werden behaupten, der Mord an Alexander wäre ein Angriff auf die gesamte Christenheit, verübt von denen, die sie hassen. Die Wunden liegen bloß, Gaius. Wir haben fünfzehn Jahre lang Krieg geführt, um das Reich zu vereinen und Frieden zu schaffen. Es darf nicht auseinanderbrechen.»
Seine Sorge ist begründet. Er hat seine Stadt in aller Eile aufgebaut. Der Mörtel ist kaum getrocknet, und schon zeigen sich erste Risse.
«In zwei Wochen werde ich ins Feld ziehen. Ich kann dieses Problem nicht zurücklassen. Ich brauche jemanden, der schnell eine Lösung herbeiführt. Bitte, Gaius. Hilf mir, unserer Freundschaft wegen.»
Glaubt er wirklich, mich damit locken zu können? Ich habe um unserer Freundschaft willen Dinge getan, die mir nicht einmal der angeblich so nachsichtige Christengott verzeihen würde.
«Ich wollte in der nächsten Woche nach Moesia zurückkehren. Es ist schon alles für die Reise vorbereitet.»
In seinen Gesichtsausdruck schleicht sich Wehmut. Sein Blick ist in die Ferne gerichtet.
«Erinnerst du dich, Gaius? Wie wir vor Naissus auf den Feldern gespielt haben? Wie wir in die Hühnerställe geklettert sind, um Eier zu stehlen? Man hat uns nie dabei erwischt, nicht wahr?»
Man hat uns nie erwischt, weil dein Vater Tribun war. Aber das sage ich nicht. Es ist gefährlich, die Erinnerungen eines alten Mannes zu korrigieren.
«Vielleicht sollte ich wieder einmal Heimatboden unter den Füßen spüren. Wenn ich von Persien zurückkehre.»
«Du bist immer willkommen in meinem Haus.»
«Ich werde kommen. Und du wirst vor mir dort sein, sobald du dieses Problem für mich gelöst hast.»
Wie gehabt. Ein Gott hat keine Zeit für lange Dispute. Sein Urteil steht fest, und davor zerschellt all mein Widerstand. Meine Ausflüchte und meine Entschlossenheit, mich nicht von ihm einspannen zu lassen, sind nichts wert.
«Willst du einen Sündenbock? Oder willst du, dass ich den wahren Täter finde?»
Ich stelle die Frage nicht von ungefähr. In dieser Stadt ist nicht jeder Mord ein Verbrechen. Und nicht alle Verbrecher sind schuldig. Keiner weiß das besser als Konstantin.
«Du sollst den finden, der es getan hat. Und zwar diskret.»
Er will also die Wahrheit erfahren. Dann wird er entscheiden, wie er damit umgeht.
«Öffnen mir die Christen, wenn ich bei ihnen anklopfe?»
«Sie werden wissen, dass du in meinem Auftrag kommst.»
Zeit meines Lebens bin ich in deinem Auftrag unterwegs. Als dein Berater und Freund, dein rechter Arm. Wenn ich zur Tat schreite, lehnst du dich zurück. Du führst das Wort, ich applaudiere. Und gehorche.
Er klatscht in die Hände. Wie aus dem Nichts taucht ein Sklave auf. Natürlich: Ich bin in dieser Stadt wahrlich nicht der Einzige, der applaudiert und gehorcht. Der Sklave bringt ein Diptychon aus Elfenbein, zwei kleine Tafeln, die in der Mitte von einem Lederband zusammengehalten werden. Auf der einen Seite ist ein Flachrelief des Kaisers zu sehen, mit einer Sonnenkrone auf dem Haupt und den Blick himmelwärts gerichtet; daneben das vertraute Monogramm, das gleiche wie auf dem Amulett. Ein Text von wenigen Zeilen verleiht mir die Vollmacht, in seinem Namen zu handeln.
«Danke, Gaius.» Er umarmt mich, und diesmal tauschen unsere alten Körper so etwas wie Wärme aus. Er flüstert mir ins Ohr: «Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Jemanden, der weiß, wo die Leichen vergraben sind.»
Ich lache. Etwas anderes bleibt mir nicht übrig. Natürlich weiß ich, wo die Leichen vergraben sind. Die meisten Gräber habe ich schließlich selbst ausgehoben.
3Gegenwart
Die Deckenverkleidung war weiß, die Wand grau und pockennarbig, darin eingelassen eine Holztür mit verschmiertem Fensterglas und einem Kruzifix darüber. Ein statisches Summen schwang in der Luft, dazu ein unregelmäßiger Piepton, der sich anhörte wie die Schießerei in einem alten Videospiel. Sie hatte wahnsinnige Schmerzen.
Sie lag auf dem Rücken und konzentrierte sich auf Einzelheiten, um die Schmerzen zu bekämpfen. Die Wand war doch nicht pockennarbig. Das es so schien, lag an der vom Beton abblätternden Farbe. Graue Farbe. Sie fragte sich, wer um alles in der Welt auf die Idee gekommen war, Beton grau zu überstreichen. Das Piepen war auch nicht wirklich unregelmäßig. Es kam aus zwei rhythmisch pulsierenden, aber leicht phasenversetzten Quellen. Die eine piepte ein bisschen schneller als die andere, sodass sich die Töne einander annäherten, für einen kurzen, gnädigen Moment synchron pulsierten und dann wieder auseinanderdrifteten.
Wirklich weiß war die Decke auch nicht. An manchen Stellen hatte sie dunkle Flecken wie von verschüttetem Wein.
Hinter der verschmierten Glasscheibe bewegte sich etwas. Jemand schien davorzustehen, mit dem Rücken zur Tür. Sie wünschte sich, er würde gehen, aber das tat er nicht.
Wo bin ich?, dachte sie. Und dann, eine Sekunde später, stellte sich ihr eine noch beunruhigendere Frage: Wer bin ich?
Von Panik ergriffen, versuchte sie aufzustehen, musste aber feststellen, dass sie sich nicht bewegen konnte. Angst schnürte ihr die Kehle zu. In ihrem Kopf schwirrte es so sehr, dass sie fürchtete, er könnte zerspringen. Es wurde dunkel im Raum. Sie wand sich, kämpfte und schrie.
Die Tür flog auf. Ein Mann in einem eng sitzenden Anzug stürmte herein und brüllte Wörter, die sie nicht verstehen konnte. Sein Jackett öffnete sich. In einem braunen Lederholster unter dem Arm steckte eine Pistole.
Sie verlor die Besinnung.
«Abigail? Können Sie mich hören?»
Die Panik hatte sich gelegt, aber sie ruhte nur und brannte sich durch ihren Magen. Der flache Atem verschaffte ihr nicht genügend Luft. Sie versuchte, den Arm zu bewegen. Vergeblich. Sie atmete schneller. Ruhig bleiben.
Sie ortete die Pieplaute, lauschte angestrengt auf den Rhythmus innerhalb der Synkopen und zwang sich, im Gleichtakt zu atmen. Es beruhigte sie ein wenig, gerade genug, um zu wagen, die Augen aufzuschlagen.
Ein Gesicht starrte auf sie herab. Braune Haare, braune Augen, brauner Bart. War das, was sie sah, real, oder eine aus den braunen Flecken an der Decke zusammenphantasierte Vision?
Das Gesicht bewegte sich. Die Decke nicht.
«Abigail Cormac?», fragte er wieder.
«Ich weiß nicht …»
«Sie erinnern sich nicht?»
Wieder von Angst gepackt, fragte sie sich: Sollte ich mich erinnern? Woran sollte ich mich erinnern? Ihr Verstand war so hilflos wie ihr Körper und stemmte sich gegen unsichtbare Fesseln.
«Nein.»
«An nichts?» Unglaublich. Ihre Verzweiflung nahm zu.
Das Gesicht zog sich zurück. Sie hörte einen Stuhl über den Boden kratzen. Weiter entfernt tauchte das Gesicht wieder auf, wie eine Sonne am Horizont ihrer flachen Welt.
«Ihr Name ist Abigail Cormac. Sie arbeiten für das Auswärtige Amt und wurden entsandt, um an der EULEX-Mission im Kosovo teilzunehmen. Sie haben ein paar Tage Urlaub gemacht. Und plötzlich ist etwas schiefgelaufen.»
Was sie hörte, klang vernünftig. Es war, als sähe sie den Film zu einem Buch, das sie einmal gelesen hatte. Manches stimmte mit der Vorlage halbwegs überein, anderes war aus unerfindlichen Gründen geändert worden. Sie betrachtete den Mann.
«Wer sind Sie?»
«Norris. Von der Botschaft hier in Podgorica. Das ist …»
«… die Hauptstadt von Montenegro.» Ihre Aussage kam wie aus der Pistole geschossen und überraschte sie selbst so sehr wie ihn. Woher weiß ich das?
Die braunen Augen verengten sich. «Sie erinnern sich also doch.»
«Ja. Nein. Ich …» Es fiel ihr schwer, einen Gedanken zu fassen. «Manches verstehe ich. Zum Beispiel Wörter wie ‹Botschaft›, ‹Kosovo› oder ‹Urlaub›. Sie ergeben Sinn. Aber wenn Sie mir eine Frage stellen, weiß ich keine Antwort darauf. Da ist nichts.»
«Wirklich nichts?»
Ihren Kopf zu gebrauchen strengte sie so sehr an, dass sie sich schon allein davon erschöpft fühlte.
«Da war ein Mann mit einer Pistole», sagte sie vorsichtig und wählte ihre Worte wie ein Kostüm, das ihr nicht zu passen schien.
«Erinnern Sie sich an ihn?»
Sie schloss die Augen und versuchte, Bilder heraufzubeschwören. «Ein blauer Anzug. Er kam durch die Tür.»
«In der Villa?»
«Hier. In diesen Raum.»
Norris lehnte sich seufzend zurück. «Das war heute Morgen der Polizist, der vor Ihrer Tür postiert ist. Er hörte Sie schreien und kam herein, um zu sehen, ob mit Ihnen alles in Ordnung ist.»
Ein Wachposten? «Stecke ich in Schwierigkeiten?»
«Sie erinnern sich wirklich an nichts?»
Sie wünschte, er würde ihr nicht immer wieder diese Frage stellen, und ließ ihren Kopf auf das feste Kissen zurückfallen. «Klären Sie mich doch einfach auf.»
Er warf einen Blick zur Tür, als wollte er sich irgendeine Erlaubnis einholen. Abby spürte wieder Angst aufwallen. Ist da noch jemand? Sie hob den Kopf, konnte aber niemanden sehen.
«Auf Sie ist geschossen worden. Die Polizei hat Sie halbtot am Tatort vorgefunden. Überall Blut und Sie von einer Kugel getroffen. Die Beamten fanden Ihren Pass und haben uns informiert. Was Ihren Ehemann angeht …»
Ihr Magen verkrampfte sich. «Was ist mit ihm?»
«Sie erinnern sich nicht?»
Sie schüttelte den Kopf. Norris warf wieder einen verstohlenen Blick zur Tür.
«Es fällt mir nicht leicht, aber ich muss Ihnen leider sagen, dass Ihr Mann tot ist.»
«Hector?»
Jetzt stutzte Norris. «Wer ist Hector?»
Ich weiß nicht!, wollte sie schreien. Der Name war ihr plötzlich in den Sinn gekommen, völlig unerwartet und wie eine gespenstische Eingebung. «Ist er denn nicht mein Mann?»
Noch während sie dies sagte, wurde ihr der Irrtum bewusst. Ich bin doch gar nicht verheiratet, dachte sie. Und dann, mit einem gequälten Lächeln: Daran müsste ich mich schließlich erinnern.
Norris schaute auf ein Stück Papier. «Laut Reisepass war sein Name Michael Lascaris.»
Das Lächeln verschwand aus ihrem Gesicht. Sie fiel aufs Bett zurück. Der Monitor beschleunigte auf Millionen Meilen pro Stunde. Piep. Und ein roter Sportwagen raste durch Berglandschaften. Piep. Eine Bucht in nächtlichem Schatten und ein heller Pool und Gestalten, die aus toten Augen von ihren Sockeln herabstarrten. Piep piep. Ein Mann mit Pistole. Ein Kampf. Der Schrei, als Michael von den Klippen stürzte – ihr Schrei. Piep piep piep piep …
Jemand klopfte an die Tür – kein Mann mit Pistole, sondern eine Frau in grünem Overall und mit einer Spritze in der Hand. «Augenblick», hörte sie Norris sagen. «Geben Sie ihr eine Chance.»
Doch die gab man ihr nicht. Kräftige Hände klammerten sich um ihren Arm, sie spürte einen Einstich. Der Monitor beruhigte sich.
Dann war es still.
«Sie erinnern sich also an Michael Lascaris.»
Der Monitor piepte jetzt stetig wie ein Metronom, ein sanftes Andante. Man hatte Abby in ihrem Bett aufgerichtet, doch bewegen konnte sie sich immer noch nicht. Der rechte Arm, die Schulter und ein Teil ihres Oberkörpers steckten in einem Gipskorsett. Irgendwo da drunter war, wie man ihr gesagt hatte, die Einschusswunde.
Du bist angeschossen worden. Sie konnte es immer noch nicht glauben. Geschossen wurde auf andere – andere wurden Opfer von Verbrechen. In ihrem alten Job waren ihr zwar hinreichend viele Verletzungen zu Gesicht gekommen, um zu wissen, dass Gewalt nicht nur im Fernsehen oder Kino vorkam, doch hatte sie stets Abstand dazu halten können.
«Erinnern Sie sich an Michael?»
«Er fuhr einen Porsche.»
Norris’ Papierzettel waren zu einem Aktenordner angewachsen. Er blätterte in den Seiten.
«Einen roten Porsche Targa, Baujahr 1968. Britisches Kennzeichen. Ist das richtig?»
Abby zuckte mit der heilen Schulter. «Er war rot.»
Dass ihre Antwort patzig klang, war von ihr nicht beabsichtigt. Norris reagierte gereizt. Er stand auf und wedelte mit dem Aktenordner durch die Luft.
«Ich weiß, es geht Ihnen schlecht, und Sie können von Glück sagen, dass Sie überhaupt noch am Leben sind. Trotzdem sollten Sie die Sache ernst nehmen. Da bricht jemand in ein Haus ein und fällt über zwei europäische Diplomaten her. Das ist nicht lustig.»
Er ist nicht eingebrochen, dachte Abby. Er war bereits im Haus, draußen am Pool, zusammen mit Michael.
«Die Montenegriner rennen kopflos herum, als würde die Welt untergehen. Sie fürchten, der Fall könnte in Brüssel einen Sturm der Entrüstung auslösen, ihre Europapläne über den Haufen werfen und sie auf die schwarze Liste der Schurkenstaaten setzen. Natürlich übertreiben sie.» Er musterte Abby mit strafendem Blick. «Denn so wichtig sind Sie nicht, Mrs. Cormac.»
«Danke.»
«Wir versuchen immer noch, die Sache kleinzuhalten. Aber für uns sieht es auch nicht gut aus. Wir stehen ziemlich dumm da, um ehrlich zu sein.»
Der Monitor beschleunigte ein wenig. «Tut mir leid, wenn ich Sie in Verlegenheit gebracht habe.»
«Damit kommen wir klar.» Ihr Sarkasmus schien ihn nicht erreicht zu haben. «Aber wir müssen wissen, was passiert ist.»
«Das würde ich auch gern wissen.»
Trotzdem hielt sie ihn weiter hin. Es gab Dinge, die darauf warteten, aufgedeckt und untersucht zu werden. Davor fürchtete sie sich, obwohl sie nicht einmal wusste, was zum Vorschein käme.
«Beginnen wir mit Michael Lascaris.»
Abby erinnerte sich an das, was sie bereits gesagt hatte. «Er ist nicht mein Mann.»
«Das wissen wir inzwischen. In Ihrer Londoner Personalakte steht, dass Sie verheiratet waren, und weil man Sie mit Michael zusammen gesehen hat, haben wir angenommen, er sei Ihr Mann. War ein Irrtum.»
«Bin ich geschieden?» Wieder glaubte sie, die Antwort zu kennen, ehe Norris ihre Frage bejahen konnte. Das Wort schmeckte sauer und zutreffend.
«Michael Lascaris stürzte von einem Felsen in den Tod», fuhr er fort. «Drei Tage später fischte die Polizei seine Leiche aus der Bucht von Kotor.»
Abby versuchte, sich gerader aufzurichten, und wurde mit einem heftigen Schmerz bestraft, der ihr durch die Rippen fuhr und sie zum Winseln brachte. Aber sie hielt sich trotzdem aufrecht. «Er ist nicht gestürzt. Er wurde gestoßen.»
«Sie erinnern sich also.»
«Nach und nach.»
Norris nahm einen Kugelschreiber zur Hand. «Fangen wir von vorn an. War es Ihre Idee, zu dieser Villa zu fahren?»
«Ich glaube nicht.»
«Michaels?»
«Die Villa gehört einem Freund von ihm.»
«Hat er gesagt, wer dieser Freund ist?»
Die Erinnerungen stellten sich jetzt leichter ein. «Ein italienischer Richter.»
Der Kugelschreiber kam in Bewegung. «War er dort? In der Villa?»
«Nein. Wir waren allein.»
«Zu einem romantischen Wochenende.» Sein Tonfall gefiel ihr nicht. Sie sank aufs Bett zurück.
«Es nahm keinen besonders romantischen Verlauf.»
Sie erzählte schnell, was ihr in den Sinn kam. Dass sie in der Nacht aufgewacht war, ein Geräusch gehört hatte, nach draußen auf die Pool-Terrasse gegangen war.
«Michael kämpfte mit einem anderen Mann.» Sie stockte. Ihre Erinnerungen waren bruchstückhaft, verworren. Norris wollte eine stimmige Geschichte hören. «Das Haus war voller Antiquitäten. Möglich, dass es der Mann darauf abgesehen hatte und von Michael ertappt wurde. Ich versuchte zu helfen. Er –» Sie brach ab. Sie wollte sich erinnern, aber nicht an dieses Bild. «Er stieß Michael vom Felsen. Und dann ging er auf mich los.»
«Wissen Sie noch, wie er ausgesehen hat?»
Sie versuchte, sich zu entsinnen, doch wie in einem Traum rückte all das von ihr ab, worauf sie ihren Blick richtete. Sie schaute in Gesichter und sah nur verwischte Schemen.
«Tut mir leid.»
«Sind Sie sicher, dass sonst niemand da war?»
«Ziemlich sicher.» Sie merkte ihm an, dass er ihr nicht glaubte. «Wissen Sie mehr?»
«Jemand hat die Polizei gerufen.»
«Vielleicht ein Nachbar.» An diese Möglichkeit glaubte sie selbst nicht. Sie erinnerte sich an die dunkle Umgebung. Weit und breit war kein Licht zu sehen gewesen. Und Norris schüttelte den Kopf.
«Der Anruf kam aus der Villa. Nur deshalb hat man Sie gefunden.» Er legte den Kugelschreiber nieder. «Wie es aussieht, haben Sie angerufen. Aber Sie waren zu geschwächt, um irgendetwas zu sagen, haben den Hörer fallen lassen und sich davongeschleppt.»
Vor lauter Anstrengung, sich zu erinnern, hatte Abby Kopfweh. Sie drückte die Augen zu und massierte sich die Schläfen. «Auch davon weiß ich nichts mehr.»
Sie öffnete die Augen und hoffte, Norris wäre verschwunden. Aber er saß immer noch vor ihr und zog aus einer Tasche im Deckel des Aktenordners eine Klarsichthülle heraus, in der etwas Goldenes steckte. Er zeigte es ihr: ein feingesponnenes Gewebe, darin ein Monogramm in der Form des Buchstabens P mit einem Querstrich in der Mitte. Es sah alt aus.
«Erkennen Sie die Kette wieder?»
«Sie gehört mir», antwortete sie. «Ich habe sie in jener Nacht getragen.»
«Was hat es mit dem Anhänger auf sich?»
Stellte er sie auf die Probe? Wollte er sie in eine Falle locken? Was beweist das? Ich kann mich kaum an meinen eigenen Namen erinnern. Ihr Blick huschte durch das Zimmer, auf den Monitor, der wie ein altes Funkgerät aussah, den Infusionsschlauch, der in ihrer Armbeuge endete, auf die abblätternde Farbe, das Kruzifix über der Tür …
… und plötzlich war ihr, als spränge ein Funke von dem Kruzifix auf die Kette über, ein Lichtblitz, der auf schmerzliche Weise eine Lücke in ihrem Gedächtnis schloss.
«Die Kette ist von Michael. Er sagte, der Anhänger sei ein altes christliches Symbol.»
Sie wollte danach greifen und glaubte, über die Berührung mit dem alten Metall einer Erinnerung an Michael habhaft werden zu können, doch die Verbände und das Gipskorsett hinderten sie daran.
Norris steckte die Kette in die Hülle zurück. Abby sah sich der letzten Verbindung zu Michael beraubt. Werde ich damit bis an mein Ende leben müssen? Mit der unerfüllten Sehnsucht, zurückzugewinnen, was verloren ist?
«Die Polizei fand die Kette im Pool und hielt sie für einen Hinweis auf den Mann, der auf Sie geschossen hat.»
Er klappte den Aktenordner zu und stand auf. «Das wär’s. Es sei denn, Sie haben mir noch etwas zu sagen.» Er ging zur Tür.
«Augenblick!», rief Abby ihm nach. Sie spürte, wie sie wieder in Panik zu geraten drohte. «Was geschieht mit mir?»
Norris blieb kurz auf der Schwelle stehen.
«Sie fahren nach Hause.»
4Konstantinopel – April 337
Jedes Mal, wenn ich in dieser Stadt eine Tür öffne, ist mir, als würde ich in einem großen Herrenhaus eine vergessene Vorratskammer betreten. Alles ist von Staub bedeckt. Jeder Schritt hinterlässt einen Abdruck, was man auch anfasst, hinterlässt Spuren. Man könnte meinen, die Stadt sei schon vor Jahrhunderten aufgegeben worden. Aber es ist nicht der geheiligte Staub des Altertums, der alles bedeckt, sondern der Staub der Handwerker, der Staub des Entstehens. Er hängt als Glocke über der Stadt. Auf meinem Weg in die Bibliothek schmecke ich ihn auf der Zunge: die Schärfe geschnittener Steine, die Süße gesägten Holzes oder das Ätzende von Kalk, den man unter Mörtel mischt. Ich werde wohl bald ein Feinschmecker sein, der die feinen Nuancen Athener Marmors, ägyptischen Porphyrs oder römischen Granits als Staub in der Luft zu unterscheiden versteht.
Meine Erinnerungen aber setzen keinen Staub an. Je länger ich lebe, desto klarer sind sie mir vor Augen, eingemeißelt ins Gedächtnis und so gründlich poliert, dass sie glänzen. Unwichtige Details sind ausgewetzt und geglättet. All das ist meine Erzählung.
Ich kenne die Bibliothek der Akademie, war aber noch nie in ihrem Inneren. Zu beiden Seiten der Pforte kauern schwarze Sphinxe, die dem Betrachter Rätsel aufgeben. Sie sind wohl dafür verantwortlich, dass man von der Ägyptischen Bibliothek spricht. Die Skulpturen sind alt. Nicht einmal Konstantin kann seine neue Stadt aus dem Nichts entstehen lassen, zumal er es damit eilig hat. Er plündert das Reich, um seine Stadt mit antiken Schätzen zu schmücken: mit Statuen, Säulen, Steinen und selbst Dachziegeln.
Und mit Büchern. Als ich durch das Tor gehe, an den Menschen vorbei, die sich auf den Stufen drängen, fällt mein Blick auf Hunderte, wenn nicht Tausende von Manuskriptrollen, aufgestapelt in Regalen wie Knochen in einem Beinhaus. Ein Wimpernschlag später weht mir ihr Geruch entgegen: der muffige Mief von altem Pergament und ein Gestank, der an faulendes Gras erinnert. Er geht vom Papyrus aus und wird durch die Hitze noch gesteigert, so sehr, dass ich unwillkürlich würgen muss.
Der riesige Raum mit seinen Galerien ist rund und hat ein hohes Kuppeldach, bemalt mit Zyklamen und Rosen. Entworfen als Garten der Wissenschaft und Architektur, sollte der Raum den Geist beflügeln, aber die Regale in dem großen Rund sehen aus wie drolliges Gestrüpp, dunkel und verworren. Aus manchen fallen schon Früchte herab. Die Fenster sind verglast, und so bleibt der Gestank, von der Sonnenhitze intensiviert, im Raum gefangen. Alles scheint Gift auszuschwitzen.
Leute, die sich miteinander unterhalten haben, verstummen, als ich hereinkomme. Den Mienen Einzelner ist abzulesen, ob sie mich erkennen oder nicht. Ich nehme ihre Reaktionen nicht persönlich. Im Gegenteil, in meinem Gepränge genieße ich sie meist.
Ein Mann wartet auf mich. Er wirkt älter, als ich es bin, obwohl er wahrscheinlich jünger ist. Er blinzelt mir entgegen und trägt dabei den Hals wie eine Wachtel, die Körner pickt. Seine Tunika aus grauem Tuch reicht ihm bis über die Waden. Im Unterschied zu denen der anderen sind seine Hände nicht von Tinte befleckt, woraus zu schließen ist, dass er seinen Lebensunterhalt nicht als Kopist verdient, sondern mit dem Schleppen von Manuskripten.
«Bist du der Bibliothekar?»
Er nickt flüchtig. Sein Gesicht ist zerknautscht wie ein zusammengeballter Stofflappen. Er lebt seit Jahren zwischen diesen Schriftrollen und hat mit dem, was vorgefallen ist, wohl nicht gerechnet.
«Ist die Leiche noch da?»
Er zuckt vor Schreck zusammen. «Der Bestatter kam vor einer Stunde.»
Ein Mordfall ohne Leiche. «Kannst du mir zeigen, wo du ihn gefunden hast?»
Er führt mich durch einen engen, verwinkelten Gang zwischen Regalen vor ein Stück Wand mit Fenster, durch das gelbliches Licht auf einen Schreibtisch voller Manuskripte fällt, der daruntersteht. Der Schemel ist abgerückt. Man kann sich leicht vorstellen, dass soeben noch jemand darauf gesessen hat, kurz austreten musste und gleich zurückkehrt, um seine Lektüre fortzusetzen.
«Weißt du, wer es getan hat?»
Die Frage liegt auf der Hand, ich muss sie stellen. Der Bibliothekar schüttelt heftig den Kopf und deutet auf die Bücherwände, die die Sicht versperren.
«Keiner hat etwas gesehen.»
«Wer hat ihn gefunden?»
«Sein Assistent, ein Diakon namens Simeon. Der Bischof lag vornübergebeugt auf dem Tisch. Der Diakon dachte, er schliefe.»
«Ist er hier?»
Ohne zu antworten – oder wie zur Antwort – eilt der Bibliothekar durch den Gang davon, die Hände erhoben und an den Manuskriptreihen entlangtastend. Anscheinend haben ihn die vielen Jahre fast erblinden lassen. Als Zeuge ist er nicht zu gebrauchen.
Und was sehe ich? Ein Tintenfass und ein Schreibrohr auf dem Tisch, ein Messer mit elfenbeinernem Griff und ein kleines Gefäß daneben. Späne, die abgefallen sind, als der Bischof das Rohr spitzte.
Warum hat er sich nicht mit dem Messer verteidigt?, frage ich im Stillen. Das Gefäß ist mit einer weißen Paste gefüllt. Sie riecht nach Kleber. Ich stelle es zurück und untersuche die Schriften. Bischof Alexander hat offenbar viel gelesen. Der Tisch ist voller Schriftrollen; manche sind unberührt, andere haben sich vom Holzstab in der Mitte abgewickelt, vielleicht, als der Tote auf den Tisch fiel.
In der Mitte liegt ein sogenannter Kodex, gebunden aus einzelnen Pergamentseiten. Darin zu lesen muss ziemlich umständlich sein, aber ich weiß, dass die Christen solche Kodizes den Schriftrollen gegenüber bevorzugen. Ich beuge mich vor, um zu sehen, was der Bischof kurz vor seinem Tod gelesen hat, kann aber nichts entziffern. Die aufgeschlagene Seite, auf der sein Kopf gelegen hat, ist blutdurchtränkt, die Seite daneben unbeschrieben. Seine Vergangenheit ist unkenntlich, die Zukunft leer. Ich versuche, das Geschriebene sauberzuwischen, aber das Blut ist geronnen. Ich verschmiere es nur noch mehr. Unter den Flecken schwimmen Schatten von Worten wie Fische unter Eis – unerreichbar.
«Willst du darin Antworten finden?»
Ich blicke auf. Der Bibliothekar ist mit einem jungen Mann zurückgekehrt – hoch aufgeschossen, mit ansehnlichem Gesicht und zerzausten schwarzen Haaren. Er trägt eine schlichte schwarze Robe und Sandalen. Auch seine Hände sind so schwarz, dass ich auf den ersten Blick annehme, er trägt Handschuhe. Doch dann sehe ich, dass es sich um Tinte handelt. Aber wieso sind beide Hände verschmiert?
Ich deute auf den Schreibtisch. «Du hast die Leiche gefunden?»
Der junge Mann nickt. Ich mustere ihn genau, gefasst darauf, einen Anflug von Schuld in seinen Gesichtszügen zu erkennen, doch sie spiegeln alle möglichen Emotionen, vor allem Trauer, aber auch Wut, Angst und ein wenig Trotz – nur keine Schuld. Wenn er noch nicht wusste, wer ich bin, wird es ihm der Bibliothekar inzwischen bestimmt gesagt haben. Er ist offenbar entschlossen, sich nicht von mir einschüchtern zu lassen.
«Dein Name ist Simeon?»
«Ja, ich bin – ich war Bischof Alexanders Sekretär.»
Seine dunklen Augen prüfen mich. Er scheint sich zu fragen, was ich denke. Ob er es wirklich wissen will? Du könntest es gewesen sein. Konstantin verlangt nach einer raschen Aufklärung. Dieser Bursche, der den Toten gefunden und Tinte oder Blut an den Händen hat, war womöglich voller Zorn auf seinen Herrn, aus welchen Gründen auch immer. Er könnte es gewesen sein oder zumindest als Sündenbock herhalten. Wenn er Priester ist, wird Konstantin ihm Folter oder Hinrichtung ersparen, ihn stattdessen auf einem Fels im Meer aussetzen und auf diese Weise Gerechtigkeit walten lassen.
Aber eigentlich will Konstantin etwas anderes.
«Wie ist er gestorben?»
«Sein Gesicht wurde zerschlagen», antwortet der Diakon in einem Ton, mit dem er mich offenbar schockieren will. Aber um das zu erreichen, muss er schon zu anderen Mitteln greifen.
«Wie?»
Er versteht mich nicht. «Zerschlagen», wiederholt er. «Er war voller Blut.»
«Wie wurde das Gesicht verletzt?»
Simeon tippt sich an die Stirn. «Die Wunde war hier.»
«Eine saubere Wunde, wie von einem Messer herbeigeführt?»
Er hält mich anscheinend für begriffsstutzig. «Ich sage doch, das Gesicht wurde zerschlagen. Zertrümmert.»
Das ergibt keinen Sinn. Wenn der Bischof am Schreibtisch saß, mit dem Rücken zum Raum, hätte doch sein Hinterkopf das Angriffsziel geboten. Das Blut auf dem Buch aber bestätigt die Worte des Diakons.
Ich hole die Kette hervor, die mir Konstantin gegeben hat.
«Hast du die hier gefunden?»
«Ja, auf dem Boden, gleich neben der Leiche.»
«Kennst du sie?»
«Sie gehörte nicht Alexander.»
«Weißt du, wer ihn umgebracht hat?»
Meine Frage scheint ihn zu überraschen. Er starrt mich an, wittert offenbar eine Falle, spürt aber wohl, dass er keinen guten Eindruck auf mich macht, wenn er schweigt.
«Er war schon tot, als ich ihn fand.»
Ich lasse Ungeduld erkennen, um seine Nerven zu reizen. «Das weiß ich. Und wer ihn umgebracht hat, ist nicht spurlos verschwunden. Er wird Blut an seinen Kleidern gehabt haben. Oder an seinen Händen.» Ich richte meinen Blick auf Simeons tintenverschmierte Hände. Er ballt sie zu Fäusten.
«Ich habe niemanden gesehen.»
«Hast du etwas gehört?» Die Frage gilt vor allem dem Bibliothekar – vielleicht kompensiert sein Gehör die schwachen Augen. Doch der schüttelt bereits den Kopf.
«Nebenan wird eine neue Kirche gebaut. Wir hören die ganze Zeit nur den Lärm der Handwerker. Es ist so laut hier, dass wir uns kaum auf unsere Lektüre konzentrieren können. Wie sagte schon Juvenal? ‹Eripient somnum Druso vitulisque marinis.›»
Seine Gelehrsamkeit interessiert mich nicht. Konstantin meinte einmal, Männer, die mit ihrer Schulweisheit angeben, hätten selbst nichts zu sagen. Ich lasse meinen Blick schweifen.
Mir fällt etwas auf. Ein Blutspritzer auf Schriftrollen im Regal, recht weit entfernt von der Stelle, wo die Leiche gelegen hat. Ich schiebe den Bibliothekar beiseite. Er stolpert und fällt fast in seine geliebten Manuskripte.
Ich stoße mit dem Fuß vor einen Gegenstand am Boden. Er rollt tiefer in den Schatten. Simeon will ihn aufheben, doch ich winke ab und bücke mich selbst. Der verstaubte Boden ist übersät mit Wachsstücken und feinen Fasern von Papyrus. Meine Finger ertasten etwas Kühles, Glattes. Ich hebe es auf und blicke auf eine kleine Büste aus schwarzem Marmor, groß wie eine Faust. Das Gesicht hat edle Züge und tote Augen, auf denen getrocknetes Blut klebt. Ich schätze, dieses Antlitz war das Letzte, was Alexander gesehen hat, ehe er erschlagen wurde.
«Wer ist das?»
«Der Name steht unterm Fuß», erklärt der Bibliothekar. Er scheint selbst nicht hinsehen zu wollen.
Ich drehe die Büste um. «Hierocles.»
Der Name sagt mir nichts. Vielleicht habe ich ihn schon einmal gehört, ohne weiter darauf geachtet zu haben. Aber die anderen kennen ihn.
«Hierocles war bekannt dafür, dass er die Christen hasste», antwortet Simeon, und ich sehe ihm an, dass ihm zu diesem Namen noch sehr viel mehr durch den Kopf geht.
«Weißt du, woher diese Büste kommt?»
«Von hier», antwortet der Bibliothekar. «Wir haben Dutzende davon.»
Was ich dann sofort bestätigt finde. Ungefähr in Schulterhöhe sehe ich in der Mitte eines jeden Regalbodens eine solche Steinbüste auf hölzernem Sockel, die die Manuskripte zu bewachen scheint. Nur dort, wo Blut hingespritzt ist, steht ein Sockel ohne Büste.
Die Geschichte breitet sich wie eine Schriftrolle vor mir aus.
Item: Alexander stand vor dem Regal und suchte nach einem Dokument.
Item: Sein Mörder schnappte sich die Büste und schlug damit auf Alexanders Stirn ein.
Vor meinem inneren Auge taucht die letzte Zeile auf.
Item: Er schleppt den Leichnam zum Schreibtisch und platziert ihn so, dass man meinen könnte, er schliefe. Dann flieht er.
Oder aber er machte sich auf den Weg, um den Fund der Leiche zu melden. Ich richte meinen Blick wieder auf Simeon. Er ahnt, was ich denke. Seine Miene ist wie versteinert, sein Zorn unterdrückt. Er wartet darauf, dass ich ihn anklage.
Wie beiläufig wende ich mich dem Bibliothekar zu.
«Wie viele Männer sind heute Nachmittag hier?»
«Vielleicht zwanzig.»
«Kannst du mir ihre Namen nennen?»
«Der Pförtner wird alle gesehen haben.»
«Er soll eine Liste aufstellen.»
«Aurelius Symmachus war hier», sagt Simeon unvermittelt und so schnell, dass ich den Namen kaum verstehe. Er gibt sich dem Kampf gegen seinen Zorn geschlagen und blickt mir trotzig ins Gesicht. Vielleicht glaubt er, er habe nur noch diese eine Möglichkeit, zu Wort zu kommen.
«Du nennst den Namen eines der vornehmsten Männer der Stadt», gebe ich zu bedenken. Aurelius Symmachus ist von altem römischen Geschlecht, ein Patrizier durch und durch, ein Mann, mit dem man rechnen muss, obwohl er der Vergangenheit angehört und in diese neue Stadt nicht mehr zu passen scheint. Aber vielleicht gilt das auch für mich.
«Er war hier», beteuert Simeon. «Ich sah ihn am frühen Nachmittag im Gespräch mit Bischof Alexander. Und kurz bevor ich die Leiche fand, ist er gegangen.»
Ich will mir diese Auskunft vom Bibliothekar bestätigen lassen, doch der fummelt an dem Griffel herum, der an einem Armband befestigt ist, und weicht meinem Blick aus.
Simeon zeigt auf die Büste, die ich immer noch in der Hand halte. «Hierocles war ein Philosoph und bekannt für seinen Hass auf die Christen. Das Gleiche trifft auf Symmachus zu.»
Ein alter Römer, der die alten Götter verehrt. Dass er die Christen ablehnt, kann nicht überraschen. Aber das macht ihn noch nicht zum Mörder.
«Vielleicht wollte er ein Zeichen setzen», insistiert Simeon.
Vielleicht. Ich erinnere mich an Konstantins Worte: Manche werden behaupten, der Mord an Alexander sei ein Angriff auf die gesamte Christenheit, verübt von denen, die sie hassen.
«Das werde ich mir genauer ansehen.» Ich drehe mich um und will gehen, doch Simeon hat noch etwas zu sagen.
«Heute Morgen hatte Alexander Dokumente bei sich, in einer ledernen Schatulle mit Messingbeschlägen. Ich durfte sie nicht sehen. Er wollte nicht einmal, dass ich die Schatulle trage.»
«Und?»
«Sie ist verschwunden.»
5London – Gegenwart
Auch aus der Vogelperspektive ist England unverwechselbar. Andere Länder sehen unordentlich aus: Felder und Häuser sind über die Landschaft verstreut, ohne ein logisches Muster erkennen zu lassen, versprengte bebaute Rechtecke in umkämpfter, zerklüfteter Landschaft. In England dagegen fügen sich alle Linien zu einem geordneten Bild. Beim Landeanflug auf Gatwick breitete sich vor Abbys Augen ein schachbrettartiges Mosaik aus Äckern, Weiden und Anwesen aus, grau und feucht wie in einem Verlies.
Man hatte sie zurückgeschickt, so früh, wie es gerade noch zu verantworten war. Sie trug einen formlosen Kittel und einen Rock, den man anscheinend in einem Geschäft für Schwangerschaftsmode erstanden hatte. Darunter war sie immer noch verpackt wie eine Mumie. Immerhin konnte sie sich wieder bewegen, mehr oder weniger gut, und so verzichtete sie auf den am Flughafen bereitgestellten Rollstuhl. Jeder Schritt aber machte sich in der Schulter schmerzhaft bemerkbar, und ihre Lungen brannten wie bei einem Marathonlauf. Trotzdem bestand sie darauf, ohne Hilfe zum Ausgang zu gehen.