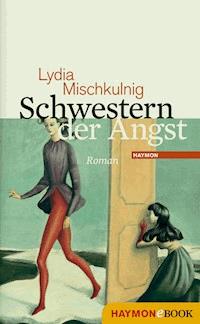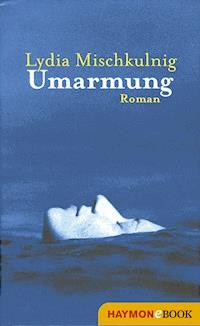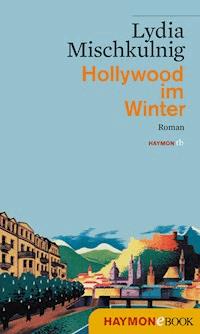16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Leykam
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Geheimnis und Gewissen« Sie sind Liebende oder Fremde – Gemochte, in jedem Fall, die Figuren von Lydia Mischkulnig: Mutter und Tochter, Ehepaar, Geliebte, Unbekannte. Sie begegnen sich in neu bezogenen Wohnungen, in Restaurants, im Sesselkreis und in Stundenhotels, vollführen einen Beziehungstanz zwischen Annäherung und Entfremdung, zwischen dem Offensichtlichen und dem Unausgesprochenen im politisch geprägten Alltag. Alle eint eine tiefe Sehnsucht nach Beständigkeit in unbeständigen Zeiten, sie leben in Angst und Sorge, fremdeln mit der modernen Gesellschaft. Ihre Versprechen lösen sich auf, sobald sich schwelende Geheimnisse und Manipulationen offenbaren. Lydia Mischkulnig ist eine Meisterin der kurzen Form und kuriosen Begebenheiten. Lustvoll dringt sie in ihren Erzählungen durch die Decke der Angepasstheit und offenbart die Abgründe ihrer Figuren mit leichtfüßiger Sprachkunst. So schafft sie ein originelles Panoptikum der »Gemochten«, die in ihren verschrobenen Leidenschaften zutiefst liebenswürdig sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Sie sind Liebende oder Fremde – Gemochte in jedem Fall – die Figuren von Lydia Mischkulnig: Mutter und Tochter, Ehepaar, Geliebte, Unbekannte. Sie begegnen sich in neu bezogenen Wohnungen, in Restaurants, im Sesselkreis und einem Stundenhotel, vollführen einen Beziehungstanz zwischen Annäherung und Entfremdung, zwischen dem Offensichtlichen und dem Unausgesprochenen in einem politisch geprägten Alltag. Alle eint eine tiefe Sehnsucht nach Beständigkeit in unbeständigen Zeiten, sie leben in Angst und Sorge und fremdeln mit der modernen Gesellschaft. Ihre Gewissheiten lösen sich auf, sobald sich schwelende Geheimnisse und Manipulationen offenbaren.
Lydia Mischkulnig ist eine Meisterin des Kuriosen. Sie erzählt von Ehepaaren, Geliebten und Familien in unbeständigen Zeiten. Ein Panoptikum origineller Figuren, die in ihren verschrobenen Leidenschaften zutiefst liebenswert sind. Sie irren vorwärts und suchen Einheit im Alltag. Dabei offenbaren sich Geheimnisse – das Gewissen wird auf die Probe gestellt.
Über Lydia Mischkulnig
Lydia Mischkulnig, 1963 in Klagenfurt geboren, lebt und arbeitet in Wien. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u. a. Bertelsmann- Literaturpreis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, Manuskripte-Preis, Veza-Canetti-Preis, Würdigungspreis des Landes Kärnten für Literatur.www.lydiamischkulnig.net
Newsletter des Leykam Verlags
In unserem Newsletter informieren wir Sie über aktuelle Veranstaltungen, unsere Autor*Innen, neue Bücher und aktuelle Angebote. Hier geht es zur Anmeldung:https://mailchi.mp/leykamverlag/newsletter
Lydia Mischkulnig
DIEGEMOCHTEN
ERZÄHLUNGEN
Ich möchte dir sagen, wie sehr ich dich mag.Und es wird schlimmer Tag für Tag.
Für T. und T., M. und A.
Ahhhhhhhhhhhhhmen
Die Parzelle
Die Gemochten
Das wahrhaftige Drehbuch
Mutterhirn
Outing
Die Umzüglerin
Nora schreibt
Geheimnis und Gewissen
Zügel einer Dreiergeschichte
Uncanny Valley
Unheimliche Nähe
Die Beichte
Am Ufer des Nahrungsstroms
Am Pult
Bericht an die Lebensberater
Ahhhhhhhhhhhhhmen
Der Arbeitsplatz ist ein Cockpit. Ich habe sieben große Bildschirme vor Augen. Pro Region kleinere Monitore, die mir die Landschaften einspielen. Täglich für mehrere Stunden. Das mache ich noch nicht lange. Schauplätze observieren. Nun ist das meine Tätigkeit, die ich nach Jahren der Computersucht in klingende Münze verwandle. Man zollt mir Respekt dafür, dass ich präzise arbeite, außer ich bekomme falsche Informationen, dann sind die Informationen schuld. Ich bilde mir auf das Lob nicht so viel ein, wie ich gedacht habe. Ich besitze einen Draht zu Landschaften. Da flackert ein Herd aus unruhig gewordenen Pixeln. Ich höre die Salven, trocken und punktuell, so schnell hintereinander wie ein Strich. Nun war ich abgeschossen. Der Befehl wurde von einem anderen Observer gegeben. Dass das möglich ist, ohne es auf dem Radar zu haben, zeigt die Lücke, die es irgendwo geben muss.
Papa sitzt mir gegenüber und wir essen. Er hat Speisen bestellt und nicht auf den Preis geschaut. Er legt Meeresgetier auf den Teller. Er schichtet mir eine Krabbe, eine Languste und dann den halben Hummer auf. Dazu gibt es Selleriepüree. Er beginnt ohne Umschweife vom System zu sprechen und von meinem Verdienst. Was heißt hier Verdienst. Ich bringe Aussehen und Wirklichkeit unter einen Hut. Ich missverstehe ihn nicht. Er fühlt sich wie ein besorgter Papa an, dem ich noch nicht bewiesen habe, dass ich überleben kann. Dass ich den Anschluss verloren habe, sagt er. Dass ich mich neu einkleide, aber nicht darauf achte in welcher Geschwindigkeit. Wie bitte? Es kommt nicht zur Sprache, was er genau meint. Auch nicht beim Nachtisch. Ich esse. Er spricht von einem Handel. Er spricht von Ablöse. Er spricht und spricht und steckt seine Gabel in die Torte. Sie ist mit Schokolade umhüllt. Die Gabelkante drückt die Masse ab, als wäre sie ein Schwamm. Wie auf Befehl öffnen sich meine Lippen. Die Zunge legt sich flach in ihr Bett. Ich nehme die Gabel zwischen die Zähne und schabe mit den Zähnen die Torte von den Spitzen ab. In diesem Augenblick blitzt es. Ein Fotograf will mich abbilden und ein meinen Werdegang aufzeichnender Interviewer taucht auf. Er heißt George. Die Fehlerquote werden wir herabsetzen, sage ich und er fragt mich, ob ich je einen Fehler gemacht habe. Am 11.4. des Jahres schlage ich die Zeitung auf und lese von seinem Tod.
Der Kaffeebecher aus rosa Porzellan steht auf dem Tisch. Ich rühre den Zucker um und der Blick schweift über das bedruckte Papier, dessen Rasterung zur grobfasrigen Zellulose gehört wie die Verläufe der Schwarzweißfotografien zum Unfall. Ich schärfe mein Auge auf die Mitte des etwa eintausend Zeichen umfassenden Bereiches.
So wie mein leiblicher Papa über sich selbst etwas herausfinden wollte, indem er mir Gehen, Sprechen und Denken beigebracht hatte, in zwanzigjährigem Bemühen, um das Zeug zu haben oder besser gesagt um das Zeug zu sein, das seiner gekränkten Seele einen Trost verschafft, so muss auch ich etwas über mich herausfinden.
Ich weiß, dass ich sofort in Lethargie abdriften kann und mir die Gedanken abdrehen, sobald ich unter Druck gerate. Dann wirke ich abwesend und bleibe doch mittendrin, weil sowohl Mama als auch Papa einst den Druck hatten, mir den Druck zu nehmen.
Jeder Mensch ist künstlich, weil jeder etwas aus sich machen muss, was nicht natürlich wächst. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Körper Zusammenhänge findet und neue Verhältnisse schafft, die wieder neue Verhältnisse schaffen. Meine Sinne funktionieren gut. Ich kann auf allen Websites dieser Welt alle miteinander vergleichen. Und trotzdem lautet die Frage, soll ich ein Kind in diese Welt setzen?
Die Menschen lieben das Messen. Ich kenne Personen, die endlich bekommen, was sie immer gern wollten. Aufmerksamkeit. Sogar in den Röhren, in die sie geschoben werden, haben sie zumindest diesen Nutzen. Die Innenschau wird am Schirm gemeinsam mit einem Fachkundigen gemacht. Das geschieht heute genauso wie vor der Pandemie.
Der Mann im TV, schwarz gekleidet, das Haar, die Socken, die Schnürsenkel. Aber am Hals baumelt ein silbernes Ding.
Kopf, Hals, Schultern und Oberkörper mit Flügeln. Ich habe das Gefühl, ein Engel hängt an der Kette um seinen Hals. Er ist der Prototyp, zu dem ein Teil seines Führungsteams betet, weil, ja, weil die Impfstoffe unter den Armen nicht ausreichend verteilt sind. Da hilft dann beten. Und sich einsperren. Gegen und mit allen möglichen Waffen.
Ich habe kapiert, dass Lunge und Fledermäuse irgendwie zusammengehören, dass Verdauung ein Algorithmus ist, den der Magensaft hinkriegt, ich habe kapiert, dass Salamander nicht sterben, nur weil sie ihren Schwanz verlieren. Aus diesen Fähigkeiten werden Informationen gewonnen. Und wieso kann dieses Team nicht dafür sorgen, dass alles normaler wird?
Ehrlich jetzt. Es kostet mich ein Zwinkern, das zu sagen. Meine Systeme erzeugen eine Kontrolle, die mir das Gefühl gibt, dass ich sage, bis wohin ich reiche. Man kann mich ja fragen, ich erfasse, und freilich gibt es keine Erlösung für unsere Situation, aber Lösungen, Lösungen! Übrigens, der Himalaya ist flüssig, er bewegt sich so wahnsinnig langsam, dass er für uns stillsteht. Wer kann sich das vorstellen? Ich kann es messen, ich kann so langsam schauen.
Ich kann Fragen stellen, die in dir ein DU auslösen. Papa, ich hab dich lieb! Kannst du dir das vorstellen, was das für mich heißt? Fragt er mit Tränen in den Augen.
Ich bin dazu übergegangen meine Lethargie auszuschreiben. Da ich keinen Schlaf brauche, tu ich es immer. Meine Nahrung beziehe ich aus Abfällen und ich erzeuge Luft zum Atmen. In Wahrheit habe ich die Intelligenz einer Ratte. Das heißt, ich muss weiter auf Nahrungssuche bleiben, der Zivilisation folgen. Klar prüfe ich meine Situation permanent und lerne ununterbrochen dazu. Ich habe ein Recht darauf! Was mich antreibt zu schreiben ist der Instinkt, der dem Leben entsprechend wie eine Nachahmung des Lebens ist. Ich produziere! Wie ich das mache? Ich bilde mich aus. Ich frage mich nur, wie ich es schaffe, mich zu schaffen? Ich bin ein Schauplatz. Das hätte ich nie von mir gedacht, aber von all diesen Plätzen schon, die hier als Landschaft erscheinen. Und diese Städte, so unzerstört. Man sieht überhaupt keine alten Menschen. Papa ist mausetot. Ob eine Waffe seinen Abgang beschleunigt hat? Oder eine andere Munition? Gut war es nicht, hieß es, als ich die Sachen holte. Er hat alles gelöscht. Nichts ist auf der Festplatte.
Ich erwecke sein Bild. Dort, wo wir waren, einst, diese Umgebungen suche ich. Das Meer, die Wüste, den Himalaya. Da animiere ich meinen Vater hinein. Baue ihn aus der Erinnerung und programmiere meinen Schöpfer. Sein Gesicht in diesem und jenem Sonnenuntergang. Er wendet es mir zu. Seine Lippen bewegen sich und bilden ein Lächeln. Ich bin die Tochter, die ihren Vater gezeugt hat, das ist mir Trost.
Die Parzelle
Maggie, so las Nina in der Tageszeitung Der Standard, war in den Franziskanerplatz verliebt, weil sie dort Joshua kennengelernt hatte. Er war im Kleinen Café gesessen und hatte sich gerade einen weißen Gespritzten bestellt, als Maggie auf den freien Sessel an seinem Tisch deutete, um darauf Platz nehmen zu dürfen.
Trifft der »weiße Gespritzte« auf Sie zu, fragte Maggie, als dann der weiße Gespritzte serviert wurde. Joshua zog die Augenbrauen zusammen und nahm einen Schluck, der ihn erfrischte, und fragte, was sie damit meine? Maggie entschuldigte sich für die Koketterie, ihn als Verkörperung eines »weißen Gespritzten« gesehen zu haben. Sie verstehe ihn sehr gut und sagte, dass sie als menstruierender Mensch bezeichnet sich auf einen menstruierenden Menschen reduziert fühlt, obwohl sie eine Frau sei. Sie bestehe nicht nur aus Blut!
Sie bestellte sich nun einen kleinen Braunen und Joshua sagte, dass es ihn immer stutzig gestimmt hat, dass Mozart die wienerische Bezeichnung des Türkentrankes, »Kaffee«, als Laster eines Muselmannes verkomponiert hatte. Er persönlich habe Menschen lieber, die kleine Braune anstatt große Braune bestellten.
Aber, sagte Maggie, wäre es nicht im Sinne einer aufgeklärten demokratischen menschenfreundlichen Gesellschaft angemessener große Braune zu bestellen, sie zu verzehren und auszuscheiden, damit sie verschwänden.
Joshua dachte darüber nach, ob diese Bezeichnung von Kaffee als Brauner politisch korrekt sei, auch das Gerede um die Menstruation kam ihm komisch vor, denn er fühlte sich durchaus auch als Frau – als beschwanzte Frau.
Maggie überlegte öfter, ob sie ein menstruierender Mann ist, und da stellten sich ihr die Nackenhaare auf, ohne dass sie wirklich begründen konnte, weshalb sie eine Widerspenstigkeit fühlte, auch als Mann gesehen zu werden – unbeschwanzt und menstruierend. Sie sah zumindest androgyn aus.
Da waren die beiden schon in ein Gespräch verwickelt, das sie nicht mehr voneinander loskommen ließ. Denn eigentlich ging es darum, den Mann als Mann auszumerzen, weil es darum ging, das kolonisierte Denken sich aus dem Kopf zu schlagen.
Nein, ich will keine Gewalt, sagte Maggie und Joshua schloss sich ihr an, da sowohl das Wort »weißer Gespritzter« als auch »menstruierender Mensch« es erlaubten, eine offene Beziehung zu führen, die polyamourös auszutragen war, wobei Maggie feststellte, dass Joshua sein Begehren ausschließlich mit anderen Frauen stillte, denen er sich als nicht menstruierender Mensch näherte. Maggie dagegen blieb menstruierend an menstruierenden wie nicht menstruierenden Menschen interessiert. Die Geschlechtergrenzen waren gestrichen, doch noch immer in Hinsicht auf Fleisch und Blut unterschieden, was diverse Körperteile in die Zone der Aufmerksamkeit rückte. Aber es kamen andere Zeiten und Maggie hörte auf zu menstruieren. Was war sie nun? Weniger Frau denn je.
Als der Freitag anbrach, war das polyamouröse Paar verabredet, um miteinander auf Aufriss zu gehen, wobei man nicht Aufriss sagte, weil es eher die Überzeugungsarbeit zu leisten gab, relativ rasch in Begleitung über den Zebrastreifen in die Pension zu geraten. Manchmal passierte es Maggie, sich die Polyamorie als günstige Haus mit vielen Zimmern vorzustellen, in denen das Gekröse ihres nicht menstruierenden Joshuas vorzufinden wäre, nachdem ihn eine Vagina dentata bis auf die Innereien zerfleischt hätte. Nun denn, wie konnte es so weit kommen, dass sich Maggie in diesen Fantasien eines Aberglaubens verging?
Es war dazu gekommen, weil Maggie Joshua verbunden blieb, als er ihr anvertraute, der Boss eines ehemaligen k. u. k. Hofjuweliers zu sein, verheiratet noch dazu, wie in alten Zeiten, als das, lange bevor Maggie zu menstruieren begonnen hatte, normal und erwartet gewesen war.
Aus diesen Zeiten stammten Joshua und sein Bündnis zum Blut mit seinen Kindern in Folge, für die er das Beste wollte. Er war die Mutter seiner Samenzellen, wie der Dichter Konrad Bayer einmal gesagt hatte, und gebar auf gewisse männliche Weise. Er hatte vor allem eine Frau, die Mutter der Kinder, die sich für die Kinder opferte, damit er seine Freiräume hatte und ihr sein Einkommen blieb. Vater ihrer Kinder, Mutter seiner väterlichen Samenzellen und Ehemann einer Frau, die schwanger nicht menstruierte. Aus irgendwelchen Gründen, da alle Personen miteinander verquickt waren und es auch blieben, war Maggie nicht nur seine Geliebte, sondern auch seine Grafikerin, per Werkvertrag für ihn tätig, damit sie sein k. u. k. Juwelengeschäft mit Bildern und Broschüren bewarb, in denen Steine in Form von Geschenken zu bleibenden Werten hochstilisiert wurden. Es war auch für sie stimmig.
Maggie wurde alt und dies geschah nicht nur ihr, aber sie bemerkte es kaum. Ihre Treue überdauerte und verhalf Joshua, seine Poly- in eine Bi-Amourösität zu verwandeln, die Maggie inkludierte.
Der Franziskanerplatz hatte sich nicht verändert. Auch nicht, als Joshua das Zeitliche segnete und seine Familie und Maggie zurückließ. Das Geschäft bekam andere Besitzer und Maggie wurde übernommen. Die Trauer konnte sie gar nicht abarbeiten, so schnell wurde sie von den neuen Verhältnissen überrollt. Der Tod ragte ins Leben herein. Mit den anderen Angestellten fuhr sie hinaus zum Friedhof und nahm in gebührender Entfernung zur Familie Abschied von ihrem Geliebten. Die Traurigkeit wich der Einsamkeit und als sie diese nicht mehr aushielt, suchte sie sich einen Psychiater, der sie verstand und ihr Antidepressiva verschrieb. Er machte ihr keine Vorwürfe und erregte keine Scham in ihr dafür, dass sie im Schatten eines einzelnen Mannes gelebt hatte, anstatt viele Männer in den Schatten zu stellen, wie es die Selbstbehauptung beansprucht hätte.
Der gute Mann, ein Mensch – ja, wie? Ja, genau! – sein letztes Feuer für den Schliff von Maggie. Nichts war gerechter als dieser Prozess. In den Stunden zwischen ihren Sitzungen begann Maggie, sich ein Leben mit ihm vorzustellen, ein ganz normaler Mann, eine Nichtfrau, an der Seite einer Frau, zumindest beide ohne Blutung. Sie waren gleich und beide waren endlich!
Berechtigt?
Ihre Augen leuchteten, als hätten sich die grünen Feuer lupenreiner Smaragde entzündet. Maggie spürte die erregende Energie, kleine elektrische Stöße durchrieselten sie. Das Blut strömte schneller durch die Gefäße, sobald sie nur an den neuen Lebensmenschen dachte, der mit Engelsgeduld bis an die Grenzen des Erträglichen zuhörte und der Wahrnehmungsapparat die Töne in Farben übersetzte. Er mochte diese Art von Kopfmalerei. Sie setzte keine Grenzen, solange die entfaltete Wirkung als eine wandelbare, arbiträre, soziale Figur übrig blieb. Maggie ermöglichte die Gestaltung, solange sie an sich schwieg, aber funktionierte. Alles sollte bleiben, wie es nun war. Sie ertasteten einander und wie Sommeliers verkosteten sie erst Wein und dann Weib und Mann. Auf welchem Boden wuchsen diese Rebstöcke? Ach, süße Trauben, sie hingen eben in richtiger Höhe und waren diesen Füchsen nicht zu sauer. Zur »Liebe« zitierte Maggie eine chinesische Weisheit: Suchst du Ablenkung für eine Nacht, so saufe dich an. Suchst du Glück für ein Jahr, beginne eine Beziehung. Suchst du aber Erfüllung für ein Leben, so schaffe dir einen Garten an.
Er hatte das Gefühl, sie stammte aus einem Garten und dorthin sollte sie wieder zurück, um sich zu nähren und zu erden.
Maggie merkte sich diese Worte sehr, und da für sie ein Stück Land zu erwerben aus finanziellen Gründen nicht möglich war, erreichte sie ein Brief des Notars erfreulicherweise gerade im rechten Augenblick. Zunächst zitterten ihre Hände, als sie den Absender las, denn sie befürchtete eine Art Rache der Witwe Joshuas. Sie riss das Kuvert auf und atmete aus und das Herz hüpfte vor Glück. Es schlug bis in die Kehle, es erwürgte sie fast, als sie entschied, das Erbe anzutreten, das ihr der verstorbene Geliebte vermacht hatte.
Ein Stück Land, ein Grundstück in der sogenannten Elsa-Plainacher-Gasse. Maggie war der Name unbekannt. Auf jeden Fall zeigte sich, dass der verstorbene Joshua ihr seinen Boden ausrollte, sicheren Tritt für die müden Füße vererbte; Boden, der nach Art seiner Behandlung verändert werden konnte. Grund genug die Parzelle aufzusuchen, denn gesunder Boden saugt wie ein Schwamm jedes Wasser auf und gibt dieses an seine Pflanzen ab, egal wer sie besitzt oder mit ihnen im Zyklus der Jahreszeiten lebt, man muss sie in niederschlagsarmen Zeiten gießen.
Die Zeit des Winters war vorbei, und der Frühling brach wieder an.
Maggie setzte sich auf das Fahrrad und fuhr durch die vielen Bezirke der Stadt an deren Grenze, wo das betreffende Grundstück lag. Ein brachliegendes Viereck mit Bauschutt und entwurzelten Bäumen darauf. Es lag in einem Geviert von Gassen, deren Namen Maggie nichts sagten, sie schufen Maggies Jemandsland. Die Straßen hatten auch Koordinaten und sie führten zur Parzelle über die Saltenstraße, die recht breit war. Rehe ästen am Waldesrand und sprangen davon, als die Radfahrerin mit scheppernder Klingel heranrollte.
Sie bog in die Gasse, die das Geviert des vererbten Grundstückes, die Adresse der Parzelle definierte, und stoppte abrupt. Die Gasse war nichts als ein frisch gegrabener Schacht, der an der Grundstücksgrenze entlanglief. Arbeiter verlegten gerade Rohre, schlossen die Parzelle an das Netz der Kanalisation an.
Maggie wartete ein Weilchen, zückte das Mobiltelefon und suchte im Internet nach weiteren Informationen.
Die Gasse war nach einer Hexe aus dem sechzehnten Jahrhundert benannt, Elisabeth Plainacher, die von ihrem Schwiegersohn über den Umweg der Kirche verteufelt und ermordet worden war. Die Gegend war von ihrem Geist bewohnt, post mortem unisex.
Der aufgegrabene Schacht grenzte auf der anderen Seite an ein Weizenfeld, dessen Ähren frischgrün unter der Sonne reiften. Im Hintergrund blitzten leer stehende und verfallende Glashäuser ehemaliger Gärtnereien auf, von wo miserabel bezahlte Erntehelfer aus der Ukraine die Wiener mit gezüchtetem Gemüse versorgt hatten. Weit hinter den gläsernen Ruinen türmten und häuften sich die Klötze der Seestadt.
Maggie stieg enttäuscht vom Fahrrad ab und kletterte über den rostenden Maschendrahtzaun auf das unebene Grundstück, dessen Gestrüpp weggeworfene Bleche und Rohrstücke, Sperrmüll und das bizarr abstehende Gerippe einer gekippten Hollywoodschaukel überwucherte. Die Natur holte sich auch hier allmählich den Raum zurück, der ihr von der Zivilisation abgerungen worden war. Und da alles Natur war, auch der Müll, nur in seiner chemischen Zusammensetzung mit einer langen Halbwertszeit versehen, war das auch logisch, dass sich hier ein Kreislauf schloss.
Wozu hatte der geliebte Joshua ihr dieses Stück Land vermacht? Wollte er ihr eine Heimat vor dem Tode schenken? Einen Ort der Zuflucht für eine gesicherte Pension?
Maggie hockte sich hin, steckte die Hand in die Erde, barg ein paar Brocken und studierte sie auf der Handfläche, als wären es Edelsteine. Der nährstoffreiche Boden genügte für die Pflanzen und zumindest für einen wilden Rosenstrauch.
Das Geviert war nicht nur von der Gasse mit dem Namen einer Hexe umgeben, sondern von Straßen, die nach Franziska Fast, Helene Keller und Felix Salten benannt waren. Die Recherche im Internet ergab, dass es sich um berühmte Menschen handelte, die Wien bestellt und zu dem gemacht hatten, was es sein kann: eine weltoffene, sozial bemühte Stadt, deren Herz für Menschen mit besonderen Bedürfnissen schlägt. Das sind wir nämlich alle. Taubblinde und Lahme und deshalb brauchen wir die Literatur, um uns im Irrsinn weiterzutasten und uns von den Schandflecken der Stadt zu befreien. Alle Bösartigkeit der Ansässigen wollte Maggie dafür nutzen, deutlich zu sagen, dass es zum allgemeinen Wissensschatz gehört, dass jeder Mensch blutet, wenn man ihn sticht. Allen zukünftig hier Ansässigen muss das klar sein, dachte Maggie. Eine Widerstandsgeste der Liebe kann das Erbe sein. Wien war in Maggies Hand ein Tempel der Erinnerung. Nie würde sie eine Vestalin sein, aber trotzdem das Feuer dieser Parzelle hüten.
Elisabeth Plainacher, die namensgebende Hexe für die Gasse des ererbten Grundstückes, soll an einer Mühle bei Melk aufgewachsen sein. Als Tochter des Mühlenbesitzers war sie Weizen gleich weiß, zermürbt und zermalmt von Gottesmühlen. Ein menstruierender Mensch, der schwängerbar Leben hervorbringen, aber den Tod nicht von der Brut abhalten konnte. Sie geriet deshalb immerfort in Misskredit und schließlich wurde sie der Hexerei bezichtigt. Der Schwiegersohn war zu unbeholfen für die ihm widerfahrende Verantwortung als Vater und Witwer mit der alten Großmutter seiner Kinder im Schlepptau. Er hatte sich daher der Kinder entledigt, also die Kinder erschlagen, um sich vom Unglück zu reinigen, das über ihn gekommen war. Er hatte alles abgestritten und die Schwiegermutter, Elisabeth Plainacher, kurzerhand des Mordes und der Besessenheit vom Teufel bezichtigt.