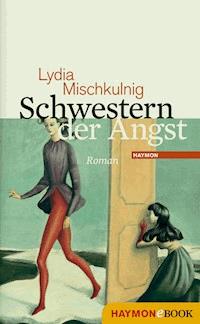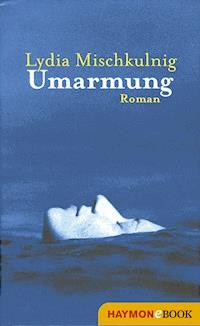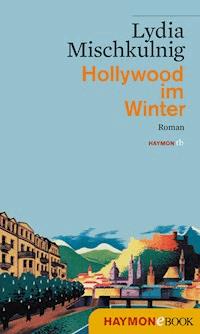Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Leon ist noch im Kindesalter, als er jener Frau begegnet, die er sein Leben lang begehren wird. Aufgewachsen in einem Altersheim, in dem seine Mutter arbeitet, lernt er früh die Freuden und Schmerzen großer Leidenschaft kennen - früh gerät er zwischen die Fronten von Liebe und Tod. So will er sich mit dem Verlust des alten Giovanni, dessen bizarrem Charme Leon erlegen ist, nicht abfinden. Gleichzeitig erwacht die Begierde nach der geheimnisvollen Tänzerin Irmgard. Als er die Schöne Jahrzehnte später beim Tangotanzen wiedertrifft, zögert er keine Sekunde und nimmt sich, wonach er seit jeher trachtet. Mit emotionaler Wucht und sprachlicher Präzision fühlt Lydia Mischkulnig direkt an den Puls einer fatalen Leidenschaft und leuchtet zwischenmenschliche Abgründe aus, immer auf der Suche nach der Freiheit, der alle Figuren zustreben. Einmal mehr inszeniert Lydia Mischkulnig in ihrem Roman einen mitreißenden Tanz der Gefühle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lydia Mischkulnig
Vom Gebrauch
der Wünsche
Roman
Ichi-go ichi-e
One time, one meeting
(Sprichwort nach Sen no Rikyū)
Für Theodor und Theresia
I
Die Erinnerung an böse Menschen kann zauberhaft sein. Sie setzt mit dem Kind in einem Prachtbau ein.
Das Haus lag nicht in den ansteigenden Weinhügeln von Sievering, es thronte auf einer Anhöhe mitten in Sievering. Im Park um das einst herrschaftliche Anwesen aus dem Besitz einer vertriebenen Familie erhoben sich über hundert Jahre alte Mammutbäume, die alle unter Naturschutz standen. Die fossilen Riesenzypressen umringten den mächtigen Bau der Jugendstilvilla. Sie stammten aus Amerika. Wie sie hierhergekommen waren, interessierte noch keinen. Es wimmelte nur so vor Urzeit in diesem seltsamen Park, wo die Zeit an- und abebbte, ganz nach dem botanischen Gesetz der Pilze und Myzelien, Flechten und Moose. Darin waren die Gartenmöbel eingebettet und die Gartenkunst der innewohnenden Zeit gedieh im ewigen Wechsel mit der menschlichen Gepflogenheit, die Natur mit künstlichen Zerstörungsanflügen auszugleichen. Seit dem 19. Jahrhundert wuchsen die frostverträglichen Bäume, von einem Handlungsreisenden in der kaiserlichen Residenzstadt eingesetzt. Sie wuchsen und überdauerten die ständestaatlichen Zeiten, überlebten das Bombardement des Zweiten Weltkrieges und vegetierten weiter bis in die Restitutionsprozesse der neunziger Jahre, als niemand der einst Verjagten die Rückgabe der Villa einforderte, weil sie alle ermordet worden waren. So war der Besitz in Leons Herkunftsfamilie gefestigt.
Leon war ein Augenmensch. Er hob die Lider, um zu atmen und die Aura einzusaugen. Er kannte das geheimnisvolle Wort Mammutbaum und hier standen nun die monströsen Zeitzeugen einfach herum und der Kinderblick, welcher sich an Bilderbüchern geübt, verschlang die Welt, konnte sich nicht sattsehen.
Der schwere Wagen rollte über den Kies, bahnte sich den Weg, drang in die grüne Luft, wie ein Schiff mit dem Bug die milden Wasser einer Lagune teilt. Der Wind fuhr durch die Zweige, und überrascht, gleich auch etwas enttäuscht, doch in Verwunderung über die Wirklichkeit, die als Vorstellung nun entlarvt, sah er den Wald als nackte Tatsache; ihn bewohnten weder Kobolde noch wilde Kerle, weder mit Hörnern noch mit Krallen ausgestattete wilde Tiere. Er hatte Nadelbäume vor der Nase, die sich in die Höhe reckten, die an ihm vorüberzogen. Ein Rucken des Wagens erinnerte ihn daran, dass nicht die Stämme an ihm vorbeiglitten, sondern er an ihnen vorbeirollte. Er befand sich in Bewegung und diese Wahrheit fühlte sich wirklich und lebendig an. Nicht die Bäume kreisten um ihn, sondern er um sie. Die wilden Kerle, Monstren mit Klauen und Hufen, Stoßzähnen und Säbeln, waren wohl auch nur eine Erfindung von Menschen. Und auch Mutter war nur ein Mensch, der ein Leben als Kind hinter sich hatte, sich nun Mamu nannte, weil sie Mamu sein wollte, eine liebende, aufrechte Frau und Mutter, die gegen Atomenergie war und gegen den Atomtod demonstrierte, hoffend, eines Tages Politiker wählen zu können, die auf die Nachhaltigkeit der natürlichen Ressourcennutzung setzten.
Sie schwieg und bestaunte die Mammutbäume. Die Fahrt durch den Park genoss sie sichtlich. Sie legte den Kopf in den Nacken, die Kehle frei, sie war eine hingebungsvolle und sinnliche Frau. Sie hatte Vertrauen in die Natur: „Hier sind sie. Schau, die Mammutbäume.“
Mammut wie Mamu. Und als dieses Wort im Wageninneren sich ausbreitete, bogen sich die Wipfel, schaukelten die Stämme wie Masten von Yachten im Wind. Die Knickstelle eines Baumes lag da, ein offener Bruch, von Moos und Efeu überwachsen. Ein Hochgefühl befiel Leon. Er tauchte ins Paradies. Er fühlte die Kraft, eine Wucht an Lebenslust, als hätte so eine Kraft einst den Urknall ausgelöst. Als hätte er schon vor dem Urknall gelebt.
Leon öffnete die Tür und setzte die kleinen Füße, die in durchsichtigen Sandalen aus Plastik steckten, auf den gerechten Kies des Parkplatzes. Er hörte die Stimme der Mutter, die das vornehme Taxi bedankte. Sie verlangte eine Rechnung samt einkalkuliertem Trinkgeld. Mutter war keine gewöhnliche Mama, sondern Mamu, weil sie das Kind lange gestillt hatte, ihm eine gute und geduldige Kuh war. „Mamu“, sagte Leon und schmatzte schon, wenn er das Wort hörte. Er liebte sie auf eine besondere Weise, er verehrte sie und fand sie schön, und wünschte sich für sie einen Mann, also einen Vater. „Ach, die Mammutbäume“, wiederholte sie auf den Wald schauend, „siehst du die Mammutbäume, Leon? Die kenne ich schon, seit ich Kind war. Hier bin ich“, sagte sie zu den Bäumen und entstieg dem Auto. Sie breitete die Arme aus, als fasste sie Luft.
Es roch harzig. Der Geruch eines Konzentrats aus überstandenen Eiszeiten und Hitzeperioden, ein Existenzbeweis von Leben und Tod der Organismen. Die Bäume hatten eine dicke Rinde aus groben, dichten und weichen Fasern, die an behaarte Elefantenhaut erinnerten und den harten Kern umschichteten. Die einheimischen Horden hatten auch in diesen Breitengraden Lendenschurze aus Fellen getragen und ihre Speere geschwungen, mit denen sie auf den Rücken der gefällten Baumleiber herumgesprungen waren und über erlegte Bäume und Tiere triumphiert hatten. Leons Yetis waren mitteleuropäische Urmenschen, die gegen Kälte und Eis das Winterfell eines Mammuts trugen. Natürlich wusste er, dass Bäume grün sind, dass sie leben, doch war er enttäuscht, dass der Mammutbaum letztlich nichts urwaldig Altes an sich hatte, nur eine Mischung aus Föhre und Tanne war, mit haariger Rinde, und nicht blutete, sondern harzte wie jede billige Fichte. Er hatte sich die Spezies als riesenwüchsigen Farn erhofft. Die gewöhnlichsten Illustrationen kindlicher Fantasien für das Große, Ausgestorbene und Überlebte sind von der Sehnsucht nach der Liebe überzuckert, die erst entzaubert wird, wenn die Geschichte wirkt, die durch das Altersheim geistert und in Urkunden Besitz als Beute der Feigheit entblättert.
Leon lernte, dass Benennungen nicht das bedeuteten, was man sich unter ihnen vorstellt. Mammut und Mamu. Mamu war diejenige, die ihn in den Bann gezogen hatte, ihn mit dem Geheimnis des Wortes gelockt hatte. Nicht die Mammutbäume waren es, sondern die Erzählung von ihnen, die jede Wirklichkeit als Idee formte, Luftballone, die an den Nadeln des Baumes zerplatzten. Der Klang der Worte bedingte Leons Bilder und er hatte Lust an der Erzählung gewonnen und damit Interesse für die Begeisterung seiner Mutter. Er identifizierte sich mit dem kleinen Mädchen, das hier geboren und aufgewachsen war, bei Verwandten in Pflege. Sie hatte die Mammutbäume als Paten gesehen, als Beschützer und Zeitzeugen. Dabei waren diese Pflanzen nicht alt genug für eine solche Instanz, nur riesig eben, aber eingesetzt von jenem reichen Handelstreibenden, dem früheren Besitzer, der hier Wurzeln schlagen wollte, bevor man ihn vertrieb. Die hergebrachte Botanik war somit kein Naturwunder.
Leon lebte mit Mamu allein in einem der zentralen Bezirke der Stadt. Sein leiblicher Vater war als sein persönlicher Vater nicht existent. Er war Garderobier und verdiente im Akademietheater sein Geld. Er hatte Schauspieler werden wollen, es jedoch nur zum Garderobier gebracht. Doch sein Traum vom Theater war nicht geplatzt. Leon bewunderte diesen Mann, als er ihn, oder war es irgendein Garderobier eines anderen Ranges, im Akademietheater beobachtete. Eines Tages würde er ihn auf sich aufmerksam machen, dachte er. Auch er wollte Schauspieler werden, noch lieber aber Artist, der auf dem Trapez seine Kunstflüge vollziehen würde, ganz ohne Sicherheitsnetz, was dem ignoranten Vater den Atem verschlagen sollte. Der Mann, als Garderobier sein Kind verleugnender Vater, hatte Mamu während der Schwangerschaft verlassen. Seine Familie hätte das Theater werden sollen. Er wusste es damals nicht besser und war gescheitert. Das Theater hatte ihn nicht gemocht. Er selbst war wiederum ein vaterloses Geschöpf, verlassen, weil sein Erzeuger nach Damaskus verschwunden war.
Leon spürte, dass er seinen Vater noch nicht einmal verloren hatte. Eine plötzliche Traurigkeit überschwemmte Leon, als er den Mann die Mäntel aufhängen sah. Er wollte selbst bestimmen, wann es Zeit wäre zu weinen, und deshalb verbot er sich die Tränen.
Leon wusste, dass er Vergangenheit anhäufte. Sie war in Sehnsucht gehüllt, vom Vater geliebt zu werden. Dabei wusste dieser nicht einmal, zu welcher Frau das Kind gehörte, das ihn beim Theaterbesuch anstarrte. Leon war froh, ein Bub zu sein. Diese Typen waren letzten Endes Väter ihrer selbst und viel leichter als eine Mutter in der Lage, ihre Familien zu verlassen. Ach, Leon vergaß darauf, dass Mädchen ganz anders verstrickt waren, er dachte nicht an seine Mutter, nur an den ihm fehlenden Vater.
Bis heute war sein Verrat tabu, blieb die Kluft zwischen ihnen. Leon verfügte über das natürliche Inventar zum Glück in menschlichem Ausmaß. Erst wenn die Trauer über die Vergangenheit einsickert, entsteht die ätzende Gewissheit der Trübnis jeglicher Hoffnung. Sie erzeugt das schale Gefühl, bald an der Leere der Zukunft zu resignieren. Welcher Zukunft? Noch gab es darauf keine Antwort.
Der Garderobier bewältigte jeden Nachmittag und jeden Abend die Mantelberge, die die Theaterbesucher auf seinen Tresen türmten. Leon konnte den schütter behaarten Kopf ausmachen, als er Schicht für Schicht vor sich abtrug. Das Gesicht war alt, fremd, und trotzdem rührten die traurigen Augen das Kind. Ein Vater, der mit den Mänteln anderer Leute fertig wurde, aber seinen Sohn ablehnte, überstieg sein Verständnis. Er suchte nach Erklärung und fand sie in der Überzeugung, all diese Mäntel zu verwalten, zu ordnen, um sie wieder auszuhändigen, musste eine Aufgabe sein, die seine gesamte Konzentration beanspruchte.
Mamu war mit Leon in die Kindervorstellung gekommen. Der Mann fragte: „Was tust du hier?“
„Das ist Leon“, sagte Mamu.
„Hallo, Leon!“
„Wann überweist du?“, fragte Mamu.
„Ich tu doch, was ich kann!“, erwiderte er. „Nach der Vorstellung, okay?“ Er lud Leon und Mamu auf die Garderobengebühren ein. Leons Vater war eigentlich zu alt für Mamu. Die wenigen Haare waren ganz grau, die faltige Halshaut erinnerte an ein Krokodil und außerdem fehlten ihm Zähne. Und doch räumte ihm Leon seinen Platz ein. Vielleicht käme er in die Familie und lebte das Glück. Vielleicht besserte er sich und würde sich sogar verjüngen, weil er nun Leon aus der Nähe gesehen hatte. Leon gab ihm den Namen des Stücks, Rappelkopf.
Mamu, Rappelkopf und Leon besetzten die Kinderwelt und waren glücklich mit wenig Geld. Das Theater ließe sich doch als Familie inszenieren. Leider war der Garderobier nach der Vorstellung verschwunden. Die Mäntel wurden von einer Garderobiere ausgehändigt. Leons Vater hatte Dienstschluss, hieß es.
Mamus Vater, also Leons Großvater mütterlicherseits, war steinalt, als Mamu auf die Welt gekommen war. Sie konnte sich nicht an ihn erinnern. Er war lange vor Leons Geburt verstorben. Hier bei den Mammutbäumen hauste der Tote, als Geist des Waldes mit Astgeweih. Der alte Großvater hatte die Villa erworben. Billig. Niemand bedachte den Horror, der hier geschehen war. Mamus Mutter hatte die Villa übernommen und der Tochter übergeben, bevor sie das Zeitliche segnete. So kam es, dass Mamu die Besitzerin der Villa war, sie aber an die Tante verpachtet hatte. Der Erhalt des Gebäudes verschlang den Zins und überstieg die Unterhaltskosten Mamus. Neue Finanzierungskonzepte mussten erdacht werden und hier bei dieser Tante sollte das Leben ab heute leichter werden.
Mamu liebte die Tante, das Haus und den Park. Sie fühlte sich so jung, wie schon lange nicht mehr. Sie streckte die Arme in den Himmel, wie eine durchgedrehte Flügelmutter schraubte sie sich tanzend durch den Park. Und dann bückte sie sich nach den Weinbergschnecken. Die Luft erfüllte Mamus Lungen, sie jauchzte vor Freude, ihr Echo erreichte den kleinen Leon und er fühlte sich geborgen darin. Auch er atmete tief ein. Er wähnte sich mit Mamu in gegenseitigem Verständnis. Er freute sich auf die gemeinsame Zeit und schon klaubte er das vollendete Gehäuse einer Weinbergschnecke auf, das geringelte Horn eines sehr jungen Widders. Er überbrachte es Mamu. Am Abend würde man die Kriechtiere kochen und das Fleisch mit einer Nadel aus dem Gehäuse zupfen.
Leon war verliebt in Mamu, aber er idealisierte sie nicht nur, er war auch irritiert. Zum Beispiel wollte er in Erfahrung bringen, wieso er auf den Namen Leon getauft worden war. „Was heißt ‚getauft‘?“, fragte Mamu zurück. Sie ging nicht auf seine Frage ein. Irritation erzeugt Lust auf die Entdeckung neuer Zusammenhänge. Er hatte sich Lesen und Schreiben beigebracht, hatte seinen Namen in den Büchern wiederentdeckt, einmal sogar mit dem Accent aigu auf dem e. Es war ein französisches und dickes Buch, und Mamu hatte lange darin gelesen.
Der Klang der eigenen Stimme beim Lesen machte ihm Spaß. Sein Kehlkopf intonierte die Schrift und seine Gedanken verflossen zu einer Komposition. Seine Kinderfreunde sagten aber, Léon, dieser Name sei der Name eines Schwulen.
„Was heißt schwul?“, fragte Leon. Aber Mamu redete über die Taufe und die Religion und das Christentum. Leon musste wiederholen, ob der Name Leon „schwul“ bedeute. Mamu stockte der Atem, dann war sie erboster als zuvor. Die einzigen männlichen Freunde, die bei ihnen zu Hause zeitweise auftauchten, waren Homosexuelle. Schwul war eine Bezeichnung, die sie nicht zulassen konnte. Schwul war damals ein Schimpfwort. „Das heißt ‚Homosexuelle‘!“, sagte sie. Sie zählte die Namen ihrer Freunde auf, Kreon, Anton, Egon, und fragte Leon spitz, ob diese Freunde etwa schwul seien, wenn man homosexuell dazu sagen kann. „Ich frag ja nur“, meinte Leon verwirrt. Mamu konfrontierte die Kinderfreunde und deren Eltern mit dem Vorwurf der politischen Inkorrektheit. Leon hatte doch nur wissen wollen, was das Wort bedeutete, aber der Fall spitzte sich zu und Mamu wollte ihn aus der Kindergruppe nehmen, weil sie ein weltoffenes Umfeld ohne Diskriminierung für den Knaben wünschte. Plötzlich waren die Begriffe „schwul“ und „homosexuell“ viel bedeutsamer als alles „Sexuelle“ auf der Welt und sie waren peinlich und negativ, bohrten sich ins Gehör, als wüchse ein Stachel ins Fleisch. Schwul würde er nie werden, schwor sich Leon, denn das machte alles komplizierter. „Es ist ganz normal, homosexuell zu sein“, erklärte Mamu. Leon war das nicht egal, denn ein komisches Gefühl rieselte durch den Bauch. Er wollte eines Tages eine Frau heiraten und basta. „Wir sind nicht so bieder“, sagte Mamu. Wieso konnte sie sich so erbosen und einen Vorwurf gegen ihre eigene Lebensweise darin sehen? Leon hätte es schon ertragen, ausgelacht zu werden, aber die Fixierung auf Mamus Überzeugung, dass Schwulsein oder Nicht-homosexuell-Sein furzegal sei, das irritierte ihn wirklich. Furzen, das gehe schon gar nicht. Er wäre zwar gerne einmal als Prinzessin zum Fasching gegangen, jedoch hatte Mamu sein Vorhaben vereitelt. Statt als Prinzessin durfte er als Engel verkleidet zum Fest erscheinen. Mamu hatte Engelsflügel gebastelt. Für sich selber hatte sie ein schwarzes Trikot gekauft und mit Deckweiß ein Gerippe daraufgemalt, damit sie als Atomtödin zum Engerl passte. Sie nahm Leon auch zu einer Demonstration gegen den Bau von Atomkraftwerken mit.
Mamu war engagiert, aber schlecht organisiert. Die Wohnung bestand aus Zimmer, Küche, Kabinett. Die Dusche war in der Küche untergebracht, und so fungierte diese auch als Badezimmer. Das Klo befand sich am Gang. Mamu hatte die Angewohnheit, Leon nachts, sogar noch im Kindergartenalter, eine Windel anzulegen, weil sie Angst hatte, er würde es nicht bis zur Toilette schaffen oder neben den Topf machen.
Leon wehrte sich gegen Mamus Übergriffe. Aber es nützte nichts.
Er konnte doch schon stehend sein Geschäft erledigen. Zu Hause bekam er die Windel umgelegt, von spitzen Fingern gehalten und mit gerümpfter Nase, und jedes Mal nahm sie die Beine hoch und stäubte Puder auf die Pobacken. „Du bist mein größtes Glück“, sagte Mamu, „um es zu erhalten, werde ich gegen Atomkraft kämpfen.“ Leon fühlte sich eingeschränkt. „Du machst ein Baby aus mir“, sagte er und brachte ihr Problem auf den Punkt: „Ein Gentleman ist ein Gendarm im Anzug und vor dem hast du Angst. Nur deshalb nimmst du mich auf deine Demos mit, als deinen Schutzengel.“
Nun, da sie mit der Tante in der Villa Aurelia kooperieren wollte, würden die Lebensumstände komfortabler werden. Die Aussicht auf eine richtige Wohnung, die sie sich leisten würden können, versprach Hoffnung auf mehr Autonomie.
Ausgelacht zu werden, war für ihn nur ein Problem, wenn er sich seiner selbst dabei schämte. Die Frage, warum er Leon genannt worden war, blieb offen. Er lernte mit einem Lächeln blöde Bemerkungen abzuschmettern. Das Lächeln richtig einzusetzen und andere damit zu entwaffnen, trainierte er vor dem Spiegel. Der Mund, Ausgang erster und letzter Worte, zeichnete ihm ein schiefes Grinsen ins Gesicht. Lächelnd konnte er die Notdurft verrichten oder umgekehrt beim Lächeln daran denken. Erwachsene grinsten gern zurück. Kinder hingegen, denen er sich lächelnd näherte, mochten ihn nicht, sie witterten sein „Ich scheiß auf dich“.
Der Umgang mit erwachsenen Menschen würde sich in der Villa Aurelia anders gestalten.
Noch war er im Park. Er spürte den Druck in der Blase. Er versteckte sich hinter den Bäumen. Eine Lache lag zu seinen Füßen. Ein Schwarm Kaulquappen wedelte durch das Wasser und fächelte Wellen auf die Oberfläche. Leon war verlockt, die Tierchen zu fangen, als ihn eine Stimme zurückbefahl. Er streckte die Hand schon nach dem Laich aus, der schaumige Flaum trieb auf der Oberfläche, als hinter dem Mammutbaum ein Rollstuhl auftauchte.
„Das sind schwimmende Prinzen“, sagte der Rollstuhlfahrer, „lass sie in Ruh.“ Er bediente die Hebel seines Gefährts, die an der Lehne hochragten, und drehte ihm mit sirrendem Motor den Rücken zu. Für den Kranken gab es nichts mehr zu lachen, es galt mit einer Depression fertigzuwerden und den Lebenstraum von Freiheit an den Nagel zu hängen. Als Rollstuhlfahrer war man zumindest Chauffeur.
Leon pinkelte, wusch seine Hände mit ein paar Wasserspritzern und widmete sich den Kaulquappen.
Mamu entdeckte ihn. „Was machst du hier?“ Sie schnappte den kleinen Leon bei der Hand. Die Ärmel waren nass vom Kaulquappen-Fangen und die Tropfen spritzten, als sie ihn schroff mit sich zerrte. Leon wehrte sich, er wollte dem alten Rollstuhlfahrer nachgehen, der nun einen Pirouettentanz auf der Wiese aufführte. Leons Lächeln schlug in Geschrei gegen Mamu um. Und noch viel deutlicher verspürte er das Verlangen, seine Lippen an die Frau zu pressen und sie zu beißen.
„Gib das her“, sagte Mamu. Leon steckte sich blitzschnell eine Kaulquappe in den Mund. Die Kaulquappe zuckte auf der Zunge und berührte kitzelnd sein Gaumenzapferl, bevor er sie schluckte. Sie flutschte in den Schlund. Kalt rutschte sie hinab, ein kleiner Flossenschlag noch, dann war sie im Magen angekommen. „Wenn sie giftig ist, wirst du sterben und ich werde ins Gefängnis kommen“, sagte Mamu. „Willst du das?“
Sein Zorn legte sich und der Wunsch entstand, die Frau wieder glücklich zu machen und am Leben zu bleiben. Mamu war die erste Frau, die er haben wollte, und ihr zum Geschenk würgte er die Kaulquappe heraus.
„Du musst dich jetzt gut benehmen“, ermahnte ihn Mamu und stapfte mit ihm durch den Park auf die Aurelia zu. Leon war feinfühlig genug, die neue Bestimmung zu wittern. Er würde zum Prinzen werden und sei es auch nur, dass er ein Quaken hervorbrächte, dann wollte er diese Stimme zu Gehör bringen. Das ganze Universum um ihn herum brüllte nach seinem Existenzbeweis. „Wenn du jetzt Durchfall bekommst, werde ich dich wieder wickeln müssen“, drohte Mamu.
Sie ließ den Buben los. Sie wollte keinen Schlappschwanz an der Hand, er sollte eigenständig auf ein besseres Leben zuschreiten und nicht dem Garderobier des Akademietheaters nachgeraten, den sie eine Zeit lang durchgefüttert hatte. Sie wollte an noblen Menschen Gefallen finden und diese warteten in der Aurelia. Mamu fühlte sich durch den Versager, den gefallenen Schauspieler, wie kastriert.
Die Entdeckung, dass jedem Körper magnetische Kräfte innewohnen und er Anziehung und Abstoßung gleichermaßen birgt, machte Leon bewusst, dass er Mamu gleichzeitig lieben und hassen konnte. Der Gedanke genügte, um jetzt zu prüfen, welches Leben sie für ihn gestalten mochte. Sie hatte in einem Buchladen ausgeholfen, Töpferkurse gegeben, sich gegen Atomstrom ausgesprochen und kaum das Existenzminimum gesichert. Sie hatte sich ein Herz gefasst und einen Induktionsherd erworben, auf dem sie kalte Gefühle und nüchterne Gedanken aufwärmte. Ein Bad einzubauen, ein eigenes WC anzuschließen oder gar eine neue Wohnung zu organisieren, war ihr nicht in den Sinn gekommen. Mamu erlangte sehr langsam die Vernunft, dass ihre Töpferkurse kein Einkommen regelten und die Buchhandlung ihre finanzielle Situation nicht aufbesserten. Sie musste einsehen, dass ein regelmäßiges Gehalt die Basis für ein besseres Leben bieten könnte. Sie suchte einen bezahlten Regel-Job und das Problem dabei war das Kind gewesen.
Sie schritt auf die Aurelia zu.
Der Knabe entdeckte den Buchsbaum, der in Form eines Ponys zugeschnitten war. Die grüne Skulptur stand in der Wiese. Wer hat es so frisiert? Leon beobachtete sehr genau, wie Mamus Augen jede Bewegung verfolgten, die um das Haus stattfand. In den Fenstern des Erkers erschien die Gestalt eines Kellners oder gar eines Pflegers im weißen Sakko, aus der Küche im Souterrain hörte man einen Mixer. Eine Zeitung lag im Gras neben einem Gartenstuhl und der Wind blätterte die Seiten um. Leon bückte sich danach. Das Fernsehprogramm war aufgeschlagen. „Werden wir abends wieder zu Hause sein?“, fragte er.
Mamu antwortete nicht. Und da sagte Leon mit verzweifelndem Blick: „Mamu, ich sag das nur, damit wir uns nicht verloren gehen.“
„Es ist nicht so einfach, wie du glaubst“, antwortete Mamu. „Wir werden umziehen, nicht in die Villa Aurelia, aber in ihre Nähe.“
Mamu hatte Leon nicht nur auf die Welt gebracht, sie selbst war wie neugeboren. Mamu war aufgeregt gewesen, als sie in den Park eingefahren waren. „Schau, Leon, wie herrlich die Mammutbäume blühen, alles für dich und uns.“ Sie schloss den Kreis um ihren Sohn und die beiden waren im Schoß der reichen Verwandtschaft. Doch sie zögerte noch, blinzelte etwas geblendet im Sonnenlicht. Sie fürchtete Zurückweisung.
Leon nahm ihre Hand, vielleicht verband ihn schon damals diese Furcht vor der Einsamkeit mit der verstoßenen Mamu.
Leon zog sie in den Mammuthain. Die Rinde der gewaltigen Pflanzen war rissig. Der Klang des Wortes Borke tönte weich in seinen Ohren und verknüpfte sich mit dem haarigen Gefühl, als er die Fasern streichelte. Mamu boxte in die Borke. Sie erklärte, dass dieser Baum auch einen Waldbrand überstehen würde, da der weiche Mantel den harten Kern schütze. Was sie verschwieg, war, dass unter diesem Geäst der Garderobier aus dem Akademietheater seinen Mantel ausgebreitet hatte, für die höchstprivate Kernschmelze. Saatgut, aus dem Leon erwuchs. Und natürlich, ohne es zu wissen, zog er sie in die Zone der Liebe.
Nicht weit vom Stamm war die Unschuld seiner Mutter gefallen. Butterweich gab die Borke nach. Leon streichelte die Pflanze und holte aus. Sie wuchs für ihn, und dass sie einmal gefällt werden würde, tat ihm leid. Der Fausthieb atomisierte die Ewigkeit auf ein Jetzt. Kurz, er hielt sich damals, als er in die Borke boxte und die Knöchel nicht knackten, zum letzten Mal für unverwundbar.
Die Weitläufigkeit des Parks erregte Leons Fantasie, hier für immer verschwinden zu können. Der Kiesweg schlängelte sich durch das gestutzte Gras und mündete in die marmorne Rampe, die durch das Spalier kugeliger Rosenstöcke auf das Haus zuführte.
Die Fassade des Hauses war reich gegliedert, Ondulierungen, Pilaster und Kapitelle zierten die Erker an den Hausecken. Ein bauchig vorspringender Balkon spannte sich quer über die Fassade auf der Höhe der Beletage. Der Bau war mit Klimtgold unterm Dach beschlagen und doch dezent, weil das Ornament im Goldenen Schnitt gehalten war. Das Kuppeldach und die Türmchen streckten das Haus in die Höhe und die Laterne gab ihm einen sakralen Hauch.
Mamu war ganz geduckt und nieste von der mit Pracht geschwängerten Luft, als strömte die Fassade ein Fluidum aus, das ihre Schleimhäute reizte. So war es auch. Sie hatte eine gesicherte Zukunft vor Augen und das war ein Reiz in positiver Hinsicht. Leon spürte die Erleichterung. Den fixesten Job ihres Lebens, dem sie über die Rampe entgegenstieg, sollte sie erhalten. Sie war bereit, ihn anzunehmen, eine Karriere als Altenpflegerin zu starten, hier, am Rande der verbliebenen Möglichkeiten einer Endzwanzigerin, die sich bisher mit Bastelarbeiten und Aushilfsjobs über Wasser gehalten hatte. Endlich war sie so weit, einen Brotjob nicht nur angeboten zu bekommen, sondern ihm auch nachzukommen. Die Verwirklichung eines Lebenswunsches war damit noch nicht abgeschlossen. Sie wollte nur endlich in Würde leben. Leon war hier keine Last, keine Störung. Es war nicht nur erlaubt, das Kind zu haben, es steigerte sogar ihren persönlichen Wert. Leon war geschätzt und freudig erwartet. Jeden Tag würde er hier willkommen sein, und später, wenn er zur Schule ginge, käme er in die Villa Aurelia nach Hause. Kein Kindergarten mehr, kein Klo am Gang, kein Schwulsein, kein Atomtod.
Tante Agnes trat aus der Beletage und stand auf dem Podest der Freitreppe. Sie war zart gebaut, eine Frau, die wenig aß, und wenn, dann nur das Beste. Sie trug ein kleines Pillendöschen bei sich, in dem sie Schokoladenerbsen aufbewahrte für den Fall, dass der Zuckerspiegel absackte und ihr schwindlig wurde. „Notfall“, wie sie sagte. Ihr gepflegtes Haar war eingerollt. Ein japanisches Essstäbchen fixierte die Schnecke im Nacken. Tante Agnes war alleinige Pächterin der Villa Aurelia. Das Haus war gediegen, ein alter Kasten, wie sie es liebevoll nannte. Tante Agnes trug dieselbe Tracht wie ihre Angestellten, sie war eine Schwarz-Wählerin und wollte ihre Autorität als Verantwortliche nicht durch Äußerlichkeiten herauskehren. Die Geschichte des Hauses war dokumentiert, auch hierin versuchte sie keine Beschönigung zu bewirken. Die Schürze, das hochgesteckte Haar, das ungeschminkte, offene Gesicht, die klaren Augen und ihr praktisches Denken unterstrichen höchstens ihre Haltung, autoritäres Getue nur gerechtfertigt zu sehen, wenn es um Leben und Tod ginge. Sie war eine Rudolfinerin, eine besonders gut ausgebildete Krankenschwester. Sie wusste Patienten menschenwürdig zu behandeln und zu pflegen. Ihre gütigen Gesichtszüge waren das Ergebnis ausgewogener Verhältnisse. Sie gewährte Hilfe. Ihre Aufmerksamkeit, die sie tatkräftig und resolut im Auftreten gemacht hatte, formte sie zu einer Hausherrin, die ihr Haus als Basis ihres Lebenswerkes einzusetzen und zu nutzen wusste. Tante Agnes hatte das Zertifikat zur gerontologischen Fachkraft erworben. Die Urkunde hing gerahmt in der Halle; gegenüber die Gedenktafel mit den eingemeißelten Namen der verschwundenen, vertriebenen und ins Gedächtnis aufgenommenen Gründer. Tante Agnes war nach österreichischem Gesetz gewerbeberechtigt und durfte die Villa Aurelia als Altersheim führen. Sie war so zart und zerbrechlich in ihrem dunkelblauen Kleidchen und dem weißen Schürzchen, den Stiefelchen an den zündholzdünnen Beinchen, dass sie für ein junges Stubenmädchen gehalten werden konnte. Sie wirkte nicht wie eine Herrin, weil ihr strahlend blauer Blick, ungetrübt und liebend, die Dinge und Menschen mit warmem Interesse umfloss. Ihre Gegenwart flößte Vertrauen und Lebendigkeit ein.
Tante Agnes stand auf der schwingenden Treppe, schwebte über dem Parkgrün. Sie waren elegant und stilvoll, beide, die Treppe und die Tante Agnes darauf. Das Haus wirkte federleicht im Hintergrund.
„Gott sei Dank seid ihr endlich da!“, rief sie und lief ihnen entgegen. Sie umarmte Mamu. „Ich hab lang auf diesen Augenblick gewartet“, sagte sie. Als sie Leon in Augenschein nahm, kuschelte sie sich an ihn wie ein treuherziges Stoffkätzchen mit gläsernen Steiffaugen.
Tante Agnes wartete auf den Ansturm des Kindes, und ihre Geduld gefiel ihm. Es ging ihr das Herz auf, sie hatte die Arme um den kleinen Leon geschlungen, der vor allem spürte, dass sie biegsam genug war, beinharte Geschäfte zu machen. Tante Agnes war hier wie zu Hause. Sie las jeden Morgen die Zeitung. Sie hatte Mamus berufliche Entwicklung verfolgt und das harte Brot der töpfernden Mutter mit ihrer Bewunderung und mit Apanagen versüßt. Nun war die Nichte am Bau der Menschlichkeit tätig und mit ihr physisch verbunden.
Sie traten durch die Pforte in die Halle der Aurelia ein.
Leon folgte den weißen Stoffballen, einer duftenden Batistwolke, die von zwei blau gewandeten und weiß beschürzten Mädchen hochgehalten und weggetragen wurde. Ihren Weg kreuzte ein vollgestopfter Wäschesack aus hellem Leinen, den ein Pfleger heranschleppte. Ein gelber Fleck breitete sich im Stoff aus. Seine Quelle musste im Inneren des Sackes liegen. Der Bursche trug ihn treppab. Den Leinensack übernahmen unten ältere Burschen in weißen Hosen und blauen Hemden und schleiften ihn weiter hinab. In der Eingangshalle warteten Männer in grauen Mänteln, die ein längliches Leinenbündel auf einem Rollwagen übernahmen, Papiere unterschrieben. Ein anderer Bursche brachte einen Stapel weißer, gebügelter und gefalteter Wäsche daher. Der Rollwagen entsprach den Einkaufswägen im Supermarkt, nur prangten am Griff die Lettern der RESIDENZ AURELIA in granatroter Farbe. Die Buchstaben waren von einer goldenen Linie durchzogen.
Die Mädchen kicherten hinter der Batistwolke, reckten die Köpfe und zischelten dem Buben zu. Leon sah ja aus wie ein Engelchen mit seinen frisch gewaschenen Locken. Er roch das Wachs, das aus den Bodenbrettern aufstieg, warm wie Honigwaben, und er sog den Vanilleduft der Täfelung aus dem Herrenzimmer ein, wo zwei betagte Damen ihm entgegenlugten. Leons Erscheinen wirkte sofort stimmungsaufhellend. Sie hoben ihre Arme und winkten. Der Bub winkte zurück, wie ein mit Batterie betriebener Plüschbär hob er automatisch die Tatze.
Auf der anderen Seite der Halle ging es zum Salon und dort hing ein großer Spiegel. Er brauchte einige Sekunden, um sich im ungewohnten Ambiente zu entdecken. Er zuckte regelrecht zusammen, als er seine Gestalt im Ornament aus Stuck, Tapeten und Teppichen eingebettet sah.
„Das bin ich“, sagte er und trat näher. Er staunte über die Erfahrung, sich von Kopf bis Fuß als unversehrt und als ganz wahrzunehmen. Dieses kleine Ego schritt ihm entgegen, hob den Kopf, reckte das Kinn, und er mochte es auf Anhieb, das Spiegelbild, das Kind im Altersheim. Er gefiel sich nicht nur gut; je länger er hineinsah und auf sich zusteuerte, umso liebenswerter erschien er sich. Ecce homo. Er war das lockige Kind, der Genius, der in diesem Haus auflebte, aus Fleisch und Blut. Es war ihm, als hörte er Kinderlachen, und er hüpfte auf einem Bein, setzte zu einem Sprung an, kam sich noch näher. Er verkörperte die Heiterkeit der Villa Aurelia. In seiner Gestalt kumulierte die Hoffnung auf die neue Generation, den Tod zu überwinden. Die Begeisterung über sich selbst erschreckte ihn ein bisschen. Er verlor die Unschuld, weil er die Lust, sich seiner habhaft zu werden, sich an die Eitelkeit wegzuwerfen, sich selbst zu vereinnahmen und zu besitzen, nicht als zügellos und radikal begriff. Mit jeder Faser seines Leibes befand er sich für wertvoll und deshalb wert zu leben, obwohl, umarmen konnte er sich selber nicht.
Er war doch nur ein Kind, das die Alten einmal waren, aber nicht mehr sein konnten. Er war jung, weil er noch Zukunft hatte. Leon war das Ich, das alle gerne verkörpert hätten. Nur Leon hatte dieses Ich. Er wünschte sich ein langes Leben. Sollte er vergreisen, wäre bis dahin viel Zeit. Er hatte zwar keinen Vater, aber das Glück, sich selbst und niemand sonst anzustreben. Er trat von einem Bein auf das andere und versteckte sich hinter dem Türleib, sprang wieder hervor und überraschte sich mit dem Triumphblick.
Die Augen halb geschlossen und ein Lächeln um die Lippen. Das lautlose Zähnefletschen, als hätte er Lust auf Knochen, verwandelte seinen Ausdruck zu einer Fratze. Er knurrte wie ein Löwe und quakte wie ein Frosch.
Die Tür zur Küche wurde aufgestoßen und weißer Dampf stob zischend heraus. Geschirr klapperte. Duftwolken frisch gemahlenen Kaffees schwollen an und breiteten sich schlagartig aus.
Der Bub lief den Gang entlang in die Küche, wo er von den Rohstoffen zu Gericht geladen wurde, den salzlosen und eingekochten, laktosearmen, fettfreien Gemüsen nachzuschmecken und den Haubenköchen zuzuschauen, wie sie ohne Kalorien aus Eiweiß Augenschmäuse anrichteten. Saucen schäumten aus Pipetten. Leon durfte eine Erbse kosten, ihre karamellisierte Haut und das süßlich grüne Mus auf dem Gaumen zerquetschen. Die Schleimhäute regten den Speichelfluss an. Die Köche benützten Leon als Vorkoster. Er durfte immer nur winzig kleine Portionen in den Mund schieben, um alle Geschmacksnuancen zu erleben. Er schlürfte, als wäre er ein Verdurstender in der Wüste. Nie durfte er den Mund voll nehmen. Erst, wenn die Köstlichkeiten abserviert wurden und unberührt wieder in die Küche kamen, war dieser Ort eine Oase in der Aurelia, wo er sich laben konnte ohne Tantalusqualen.
Leon liebte die Küche und die Köche hatten in ihm einen neuen Mitarbeiter. Er bekam einen Löffel mit langem Stiel und durfte an den dampfenden Töpfen stehen und die bunten Saucen rühren. Rote Rüben, grüne Erbsen, orangene Süßkartoffeln wurden sorgfältig zu makrobiotischen Breien verarbeitet.
Jeder Insasse sollte auf seinen Geschmack kommen. Besser gesagt, jeder hatte das Recht, gut satt zu werden. Die Kost war gesund und leicht verdaulich, leicht zu löffeln und leicht zu schlucken. Wer die Babynahrung ablehnte, bekam zu zerlegende Substanzen auf den Teller. Leon kostete die Breie und der Koch legte Hühnerkeulen dazu. Bald konnte Leon an den Gerichten erkennen, welchem Patienten gerade das Mahl zubereitet wurde.
Bald wusste er auch um seine Bestimmung im Heim. Bald schon bereitete er nicht nur in der Küche die Breie zu, er war auch der Mundschenk der seltsamen Alten, die manchmal sprechfaul herumsaßen. Er konnte die Nuancen ihrer Gesichtsausdrücke deuten, erriet, ob es sich um eine Depression handelte oder leichte Melancholie, eine ernstere Verstimmung oder einfach keinen Appetit. Je trauriger der Blick, umso mehr aufzuhellen durch Fisch und Granatapfelbrei mit Ingwer und Cranberry-Sauce. Rote und gelbe Speisen vertreiben die dunkle Hoffnungslosigkeit. Das richtige Essen bewirkt gute Stimmung bis ins hohe Alter. Jeder Mensch hat das Recht auf Glück, selbst die Toten.
Es gab ein Geisterhäuschen vor dem Küchenfenster, und die Köche legten mittags einen Bissen als kleine Opfergabe hinein, um die Seelen anzulocken und zu befrieden.
Mächtige Saatkrähen flatterten heran und Spatzen, die auf den wippenden Astwipfeln schaukelten. Die Krähen nahmen das Geisterhäuschen unter ihre schlagenden Flügel und hackten mit den Schnäbeln die Fensterchen auf. Die Spatzen waren klein und schlüpften durch diese Öffnungen in das Innere, sobald die Krähen abgeflogen waren.
Schliefen die faulen Esser unter den Insassen im Haus, streichelten hübsche Volontärinnen, Mädchen aus den Hochschulen für Sozialarbeit, mit Lavendelzweiglein die Engelsfurche zwischen Nase und Oberlippe, um den Appetit anzuregen. Schon bald öffneten sich die Schnäbelchen der schwächsten Esser, und sie konnten gefüttert werden.
Leons Kenntnis über die Qualität der Gemüsebreie bezog er aus der Babynahrung, die er lang genug genossen hatte. Das lind gekochte Gemüse machte ihn krank, weil der Geschmack blass war, ihm keine Gerüche und Farben des Lebens in den Sinn kamen. Die Dichte fehlte. Daher wusste Leon, worauf es ankam, um den Eigengeschmack einer Erbse oder einer Erdbeere hervorzuheben. Leons Geschmacksnerven verlangten, die Erwachsenennahrung mit einem Hauch von Schärfe zu versehen. Schärfe ist kein Geschmack, Schärfe ist Schmerz. Seine Zunge lernte Safran, seine Nase Muskatblüte und sogar Pfefferkorn zu schätzen. Kräuter setzten die Glanzlichter auf pastose Saucen.
Leon verstand, dass die Menschen so gelaunt waren wie ihre Speisen zubereitet, immer genießbar, nie verdorben. Darin lag sein Irrtum. Denn dass er selbst zum Futter würde, war ihm noch lange nicht klar.
Der Servierwagen rollte lautlos über die versiegelten Holzböden durch die Räume des Erdgeschosses. Der Kellner trug das im Restaurant übliche weiße Hemd mit Fliege und dazu die schwarze Bügelfaltenhose. Die Schuhe aus gewichstem Leder knirschten dezent. Die Zofen trugen Schuhe ohne feste Sohlen. Sie strichen leichtfüßig wie Katzen auf ihren Zehenkuppen durch die Räume. Sie trugen Socken aus Rehleder. Das reich gefensterte Haus war entsprechend lichtdurchflutet. Vorhänge aus Seidenorganza wehten und winkten den Frühlingshauch herein.
Der mächtigste Mammutbaum ragte weit über die Höhe des Hauses hinaus, füllte den Fensterausschnitt. Eichhörnchen hausten in den Zypressen und jagten von Ast zu Ast.
Leon folgte dem Servierwagen andächtig wie einem Leichenzug, als ginge es für das angerichtete Fleisch ans Grab. Das Geräusch der aufsetzenden Tatzen kündigte ihn taktvoll an, bevor er die Schwelle einer mit Glas ausgefüllten Doppelflügeltür überschritt. Die hohen Wände, die Tapisserien, die rosa Färbung des Zimmers mit dem teils vergoldeten Stuck, eine Zuckerdose, in der das ziselierte Silber auf dem Servierwagen zarte Speisen überkuppelte, gaben sich dem kindlichen Auge in selbstverständlicher Pracht hin. Er inhalierte den Reichtum, den Staub der Gediegenheit, der sich in ihm ablagerte. Die Ruhe und Gemächlichkeit des Kellners signalisierten Noblesse. Der Sinn für Schönheit fiel mit der Lust auf Genuss zusammen. Je mehr Sorgfalt aufgewandt wurde, umso besser schmeckte das Essen, umso feiner die Dekoration des Hauses, umso stärker sein Wohlgefühl.
Ja, entschied Leon für sich, genau so wollte er einmal leben. Wie prestigeträchtig die Villa Aurelia war, konnte er noch nicht erkennen. Die weißköpfigen Alten in der altrosa Verbrämung mussten sich diesen Luxus leisten können. Hier herrschte nicht nur Luxus. Das Alter bedeutete Schwerarbeit, die geleistet und belohnt werden musste. Leon hatte seine Sonderstellung, er war mit Abstand der Jüngste hier, seine Position war gesichert, solange es kein anderes Kind gab. Hauptsache, er war feinsinnig genug, Genuss zu bereiten genießen zu können. Er nahm einen tiefen Zug von dieser stickigen Pracht und sein Vertrauen in den Frieden des Altersheims wuchs. Ja, hier wollte er bleiben! Er seufzte. Hierher hatte Tante Agnes Mamu eingeladen. Hier sollte sie mitarbeiten, um die Pacht aufzufetten. Eine neue Wohnung für Leon und Mamu war der Lohn für Mamus Einsatz.
Die Tapeten waren aus Brokat, im neuen Zuhause herrschte Ikea-Design, auch nicht schlecht, aber der Sinn für Eleganz wurde an den dezenten Farben der Fortuny-Stoffe aus Venedig geschärft, die die Wände in der Aurelia bespannten. Mamu war mit der Neubauwohnung der Sprung in eine universal eingerichtete Wohngeografie gelungen, doch geht nichts über den Prunk und die Gediegenheit in einer Wiener Gründerzeitvilla. Der große Salon war bekrönt von einer Stuckmanschette um den Maria-Theresien-Luster. Die Spiegel verdoppelten das Kristallfunkeln und die Kerzen leuchteten den Saal aus, an dessen Stirnfront eine steinerne Skulptur des Begründers der Villa Aurelia stand; der angeblich reiche Geschäftsmann, dessen Spuren als vertriebener Handelstreibender verwischt waren.
Tante Agnes war mit den Recherchen gescheitert, das Haus war 1945 durch eine Heirat in den Besitz der Familie gelangt, es hatte vor der Vertreibung jemand anderem gehört. Die Gelegenheit, die Liegenschaft zu erwerben, war günstig, sonst hätte sie die Stadt genommen. Mamu widmete den Besitz einem guten Zweck, um die Geschichte des Hauses und das Erbe zu ertragen. Die Villa war alt genug, wie sie meinte, und das Geld, das Tante Agnes hineingesteckt hatte, schwer verdient.
Das Gesicht der Skulptur war auffallend klein und detailliert, mit zart geschnittenen Zügen, ja, als würde die Figur eine Frau darstellen. Nur der steife Kragen, ein sogenannter Vatermörder, der damals zum modisch gekleideten Mann gehört hatte, wies auf die eigentliche Geschlechtsidentität hin. Zu den Füßen der Skulptur plätscherte ein Brunnen. Die hauseigene Quelle war dafür angezapft, die traditionellerweise den Nymphen gehörte, Wassergeistern, bevor Männer sie für ihre Tempelstätte eingenommen hatten, so auch in der Aurelia. In der Hauschronik wurde von einem Indianer berichtet, der den Unterdrückungen entkommen, in Europa Fuß gefasst haben und die Tochter des einstigen Gründers, des Handelstreibenden, geehelicht haben soll. Er habe nicht nur seine Gene, sondern auch die Samen für die Mammutbäume mitgebracht und eingepflanzt. Sie stammten aus dem Sequoia-Park in Kalifornien.
Von der Veranda ging der Blick auf den Rosengarten und hinunter zur Stadt. Die Stufen wurden teils mit einer schrägen Ebene überbrückt, damit auch die körperlich Behinderten in den Garten rollen konnten.
Der Kellner schob den Servierwagen vor sich her. Das Klirren der Gläser, das Rattern der Räder. Der Kristallluster hing still, und der Servierwagen hielt vor einem josefinischen, kirschrot gepolsterten Sessel mit Armlehnen und hochragendem Rücken. Der abgeblätterte Lack und die Risse waren mit Blattgold verfugt. Auf dem Hocker lag eine Brokatdecke bereit. Ein Knauf lugte hervor, faustgroß. Es war ein Zepter und daneben auf der Decke lag eine Krone, Requisiten, als wäre es die Bühne für den Auftritt eines Prinzen. Oder hatte hier ein König abgedankt?
Der Kellner hob seine Fußspitze und setzte sie an die Radstopper, blockierte den Servierwagen. Die Verschlüsse klickten.
Leon war von den herrschaftlichen Insignien angezogen und schritt auf sie zu. Er streckte die Hand nach der Krone aus, um sie zu betasten, um zu spüren, ob sie Wirklichkeit war oder nur ein Traum. Natürlich konnte er nicht fühlen, ob das Gold echt war, aber wenigstens, ob aus Metall oder Papier. Der Kellner breitete das Tuch aus, faltete es zu einem Stanitzel und legte es neben das Besteck. Dann zog er Teller aus dem unteren Stockwerk des Servierwagens und stellte das beflorte Porzellan auf den Tisch.
„Halt“, sagte der Kellner scharf und kalt, als wären seine Stimmbänder Rasierklingen, „das Ding greifst du nicht an!“
Leon zuckte sofort zurück. Er ließ die Hand fallen, sie schlug auf dem Oberschenkel auf. Er war peinlich berührt wegen seiner Gier. Seine Hand fühlte sich steif an, fremd, als wäre sie aus einem anderen Holz als er geschnitzt.
Der Kellner öffnete die Verandatür und schob die Flügel auf, hakte sie gegen Windstöße fest, gähnte in die Weite über der Stadt und streckte sich in der Sonne. Er ging zu den Rosenstöcken auf der Terrasse, um sie zu begrüßen wie alte Bekannte. Er benahm sich wie ihr Besitzer, distanzlos.
Leon lauerte auf jede seiner Bewegungen. Der Mann schien länger beschäftigt, denn er zog sich nun Handschuhe über die Finger. Er zupfte an den Rosenstöcken herum, wandte ihm den Rücken zu.
Neben dem großen Saal befand sich nur zwei Stufen höher ein kleinerer Salon. Leon sah sich ungeniert um, da er jetzt allein war. Er wagte sich vor, immer mutiger, weil niemand auftauchte, weder Personal noch Insasse. Hier unter dem venezianischen Luster wollte er spielen, seine Bauklötze türmen und mit einer Kutsche und zwölf Rappen durch die Zimmer galoppieren. Floral gezierte Spiegel byzantinischen Stils holten die mächtigen Bäume herein. Die Pflanzen schaukelten in den Rahmen der Spiegel und ihre indianische Herkunft erzeugte die Fantasie einer dahinterliegenden Prärie. Während sie im Wind wankten, blieb Leon beglückt über ein Steckenpferd stehen, das völlig unerwartet neben dem Kamin lehnte, als hätte jemand seinen Wunsch verstanden und zumindest das Pferd herbeigezaubert. Er würde die Krone mit Krähenfedern schmücken.
Leon drehte auf dem Absatz um und setzte sich die Krone kurzerhand auf, suchte den Spiegel. Stille herrschte rundum und die Krone verströmte einen kalten Hauch. Der goldene Rahmen blitzte. Ein Handlauf für den Blick. Der Spiegel warf das Bildnis des Dauphins zurück. Die Zweige der Rosenstöcke knisterten, als der Kellner die Köpfe zur Seite bog, um die weitest entfernte Blüte samt Stiel abzuzwicken. Er war beschäftigt. Wie gut, dass niemand sehen konnte, wie Leon die Krone wieder anhob und sie bis zum Äquator auf den Kopf presste.
„Hallo, ich bin Imrgard“, sagte da jemand mit sonorer Stimme. Leon fuhr zusammen, ertappt wandte er sich um.
Nichts zu sehen. Nur die Stimme, gedämpft durch die schweren Stoffe, drang heran. Leon bemerkte erst jetzt die Nische. Der Vorhang wurde zurückgeschoben. Wie vom Donner gerührt vergaß er die aufgesetzte Krone, drehte den Kopf und starrte Irmgard an.
Die Frau hatte markante dunkle Augenbrauen, langgezogene, mit Ölkreide betonte Striche. Richtige Torbögen über den klaren Augen mit dem jungen Blick. Eine schlanke Person, schwarz gewandet, und das einzig Knallige an ihr war der rote Mund. Ihre Jugend glänzte, Heiligenschein einer noch nicht Sehnsüchte erfüllenden Nymphe. Ihre weiße Haut erhellte den Zwerg. „Da ist ja die Prinzessin“, rief sie und sagte freundlich zu ihm, „hast du schon alles gefunden?“ Sie erschien Leon erwachsen und reif, doch war sie kaum zwanzig, die wunderschöne Dame mit der sanftmütigen Stimme, die Leon sogleich als Wohltat empfand, obwohl sie ihn „Prinzessin“ genannt hatte.
Dann trat sie ganz hervor, diese Gestalt im eng anliegenden, asymmetrisch geschnittenen Rock. Die dünnen, wohlgeformten Beine mündeten in silbernen Sandalen. Die kleinen Füße waren mit Bändchen gehalten, festgezurrte Wurzelballen ausgerissener Lilien. Diese Frau war zwar jung, aber nicht frei, sie würde erst viel später zur Blüte kommen, wenn sie den richtigen Nährboden gefunden hatte. Und dennoch wirkte sie mit ihren unter der Haut vorschießenden Schlüsselbeinknochen, Gerippe des Todes, wie eine Allegorie auf das ganze Leben. Sie war in Begleitung. Ein Schlurfen folgte ihr auf dem Fuß. Sie stützte einen buckligen Greis. Der Alte war vielleicht ihr Großvater? Etwa achtzig und gezeichnet von Schwäche. Vielleicht auch nur von Lustlosigkeit. Kaum erblickte er das Kind, funkelte er auf und ein Schuss Neugier animierte seinen Leib. Der gekrönte Leon wirkte belebend und vertrieb die Depression. Der Mann erwachte regelrecht und blinzelte verführerisch, mit den faltigen Lidern zwinkernd, als wäre er genauso jung, um neckisch zu wirken wie das Kind. Plötzlich war er geschmeidig und anschmiegsam, wirkte viel zu interessiert an der Welt, als dass man ihn als Greis bezeichnen mochte. Beim Anblick des kleinen Leon fiel das Alter richtiggehend ab von ihm. Er richtete sich auf, der Buckel wurde gerade. Er bewegte sich kraftvoll, elegant wie ein Jaguar. Seine Augen notierten flink, klar, stechend, dass es sich um neue Beute handelte. Seine Stimme war fester Ausdruck eines ungebrochenen Körpers, eines unbeugsamen Willens. Seine Freude schmeichelte Leon, doch da musterte ihn der Alte plötzlich kritisch und brach ungestüm in Hohngelächter aus, als er sagte: „Das soll ein Mädchen sein?“
Leon wusste nicht, wie reagieren, außerdem trug er noch die Krone, doch sah er an sich hinunter, als müsste er sich seiner Physiognomie erst vergewissern. Seine Füße, seine Knie, das Becken, der Rumpf, der Hals, das Haupt, und als er sich bewusst wurde, dass er seit einigen Jahren diesen Körper bewohnte, sich zweifelnd fragte, ob er nun einen Knaben ausmachte oder der Körper ihn, fiel die Krone auf den Boden.
„Er ist ein ganz normales Kind“, sagte die Frau.
„Der ist schwul“, sagte der Alte.
Dieses Wort folterte das Kind, penetrierte sein Trommelfell, schnalzte im Ohr und brannte wie eine Stichflamme. Mochte der Alte ihn nicht? Wieso sagte er das so bestimmend? Was war denn am Schwulsein dran? Mamus beste Freunde, verdammt.
Leon starrte entsetzt auf die Krone, natürlich war ein Zacken abgebrochen. Die junge, erlesene Dame in den silbernen Schuhen stand ihm bei. Sie hob die schwarzen Augenbrauen, rüschte die roten Lippen, blies die Wangen auf, hob das runde Kinn und schnaubte störrisch, ein Pferd imitierend, das den Kopf vor der Hürde beutelte. „Es ist ja nichts Schlimmes passiert“, sagte sie und kniete nieder, brachte sich auf Augenhöhe, hob die Krone auf, reichte sie dem Kind und sagte mit samtenem Akzent, „natürlich bist du ein Prinz.“ Leon begriff, dass die Krone für ein Mädchen bereitgelegen sein musste. Er genierte sich, sie aufgesetzt zu haben, und er nahm sie und stellte sie auf das Tischchen zurück. Vom Kopfe bis zum Fuße stand er stramm und sprachlos vor dem Paar. Die Frau stellte keine Böswilligkeit dar, sie war gut und schön und würde beides für immer bleiben. Leon schloss ihr Bild ins Herz, weil sie ihn mit ihrem Herzen noch nicht meinte. Sie erweckte, was sie darstellte, das Verlangen, eine manichäische Mischung aus Erwartung und Leistung. So fühlte er nur ihr wohlmeinendes Annehmen und verwuchs mit dem Augenblick, der in seinem Inneren zu einem Leuchten aufstrahlte.
Der Alte schlich zum Klavier. Ein kräftiger Bursche noch, und jetzt bewegte er sich ohne Stütze durch den Raum. Lange Arme. Minoisch anmutende Augen.
„Giovanni, so heiße ich“, sagte er und legte die Finger auf die Tasten. Er spielte ein paar Takte. Sein lichtes Haar stand hinter der Stirnglatze zu Berge. Die Spitzen waren silbern meliert und bogen sich im Nacken zu einer Welle auf. Die Haut glänzte. Der helle Flaum auf dem Haupte krönte das Gesicht, das wächsern in Form und Ton einer geschälten Mandel entsprach. Die Augäpfel schimmerten wie poliert, während der Rest vergilbt war und die Haut zersprungen wirkte. Don Giovanni war gut erhalten, mit Lack versiegelt, wie der Boden unter Leons Kinderfüßen. Der Alte schürfte an den Pedalen herum. Er spreizte die bizarr spitzen Finger, spielte sachte die Tasten an, erzeugte Töne und plötzlich schwer atmend erinnerte er sich seines späten Frühstücks und sagte streng: „Irmgard!“ Er stemmte die Hand in die Nierengegend seines Rückens und Leon beobachtete ihn verschämt. Sein Blick drang vor bis zur Intimität des Alten und er war gefasst darauf, mit einer Demütigung für seinen Voyeurismus bestraft zu werden. Trotzdem war er gereizt und geradezu aufgefordert, den Alten zu erschauen. Aufmerksamkeit war auf jeden Fall gefragt, denn er benahm sich nicht umsonst theatralisch. Blicke tasten nicht nur. Leon fühlte sich wie ein Schwein, das sein Gegenüber mit Augenrüsseln beschnüffelte. Giovanni klopfte mit den Absätzen auf dem Boden herum, in den Takt kommend und am Klavier hustend drehte er sich blitzartig um und bot dem Kind die Stirn. Als könnte er Leons Gedanken lesen, hell, klar und aufgemuntert, erweckt, riss er die Arme weit auseinander und rief: „Ich tu dir nichts! Willst du mich vor Argwohn umbringen?“
Aber die Augen des Alten machten kein Bild vom Kind, auch seine Worte meinten es nicht, niemanden, selbst wenn die Stimme erklang. Er sang für Irmgard. Die Frau stellte sich taub. „Irmgard, willst du mich umbringen?“ Leon verstand den Sinn der Worte nicht, er bekam Angst um Irmgard. Wer lässt sich schon gern ertappen, wenn man sich auf seine Zukunft, die man doch hat, freut? Der Alte hat seine Zeit gehabt, sie geht erbarmungslos vorbei und ins Jetzt seiner Tage tritt das Ende. Der Faden wird bald reißen, oder ein Unglück passieren? Was bleibt ihm? Dieser alte Mann könnte sich höchstens über seine Vergangenheit freuen. Tut er das? Hat er Geschichte, oder hat sie Geschichte aus ihm gemacht? Die Frage lag plötzlich im Kopf des Kindes und drehte sich wie ein Spieß, denn was bedeutet Vergangenheit für ein Kind? Sie ist ein Äther, den auch Leon einatmete. Er war ein Kind und würde es noch lange bleiben. Zukunft ist die verlängerte Vergangenheit, die er eines Tages einholen wird, wenn sein Leben zur Geschichte verfließt.
„Irmgard, mir schwindelt“, sagte der Alte. Irmgard nestelte an der Spange ihres Schuhs herum. Sie reagierte nicht. Hörte sie ihn nicht?
Giovanni konnte niemandem mehr etwas anhaben, seine katzenhafte Gefährlichkeit war durch das Alter gebrochen, das Tier in ihm gezähmt. Trotzdem fühlte sich eher Leon ermüdet, während der Alte sich im Kreis zu drehen begann und dazu ausrief: „Mir schwindelt, Irmgard!“ Er stolperte, fing sich und landete mit einem Ächzen auf dem Sofa. Irmgard sah ihn aus heimtückischen Augenwinkeln an. Leon verstand die Aggression des Blickes nicht, die Tiefe, die Abgründe, aus denen sie lugte.
„Das ist eine Leistung, auf die ich stolz sein kann“, sagte der Alte, „seit dreißig Jahren schwöre ich auf die fünf Tibeter.“ Er lag auf dem Möbel wie hingeleert und dann schmunzelte er. Irmgard richtete sich auf. Leon wippte unwohl hin und her, von einem Bein auf das andere. Er spürte durch die Sandalensohlen ein Hölzchen, das in diesem Boden locker war und ihn nahezu aufforderte, herumzuwippen wie auf einem wilden Bock. Der Alte glotzte ihn an. Sein Haar leuchtete, als ginge der Mond in wiederkehrender Herrlichkeit auf. Der Schein um diesen alten Kerl, so konnte Leon plötzlich von Giovanni denken, gehörte sich nicht. Es gehört sich nicht, so stolz zu sein. Ein Satz, der aus Mamus Mund stammen hätte können. Die Vitalität des Alten beschlich ihn als dunkle Ahnung, denn dieser Typ hatte es auf etwas abgesehen. Nicht nur auf sein Geschlecht, sondern auf das ganze Universum, den Leon’schen Kosmos. Leons Leben gehörte Leon allein, soviel war dem Knirps schon klar, und er wusste deshalb, es würde sich lange Zeit nur um den Alten drehen, darum, den Eitlen auszutreiben. Das Kind spürte die saugende Kraft, die indiskrete Anziehung, die es im Grunde verabscheute, aber fasziniert zuließ.
„Hast du dich schon entschuldigt?“, flötete der Alte mit Vanillestimme. Wen oder was meinte er jetzt wieder? Leon wollte widersprechen, weggehen, sich fernhalten. Das Gewicht seines Hauptes lastete auf der Wirbelsäule, er spürte den Punkt, wo er ins Nicken kippen könnte. Er spürte den Druck der Krone noch auf Schläfen und Stirn, als sich die Gedanken unwillkürlich mit den Händen verknüpften, die er nun hob und an die Stirn führte. Er streifte das Haar zurück und betastete die Schädeldecke.
„Es tut mir leid“, sagte Leon automatisch.
„Was tut dir leid?“, fragte Giovanni.
„Dass ich die Krone aufgesetzt habe“, antwortete er.
„Bring ihm einen Gaul, Federn und den Tomahawk“, sagte der Alte und blinzelte ihn an. „Ist doch nicht so schlimm! Bist du halt ein Junge! Schau, was ich für dich habe, das wird dich vielleicht trotzdem freuen.“
„Lass ihn zufrieden!“, rief Irmgard.
Giovanni hielt Irmgard ein rosarotes Säckchen hin. „Gib ihm das!“, befahl er. Doch dann warf er es auf den Boden.
„Hol’s dir, Junge!“
Nun schoss Irmgard hoch. Und als hätte sie über das Mitgefühl hinaus auch noch das Bedürfnis zu retten, beugte sie sich vor, ging in die Knie, hob das Säckchen auf und brachte es dem Kind.
„Ich freu mich, dass du hier bist. Das ist ein Geschenk von mir. Weißt du noch, wie ich heiße?“
Leon hatte keine Zeit zu antworten, als der Alte zu jammern anfing und Irmgard nachäffte.
„Eurydike, Eurydike, suchst du deinen Orpheus?“, krächzte Giovanni verächtlich.
Leon verstand nicht, was der Alte meinte.
„Eurydike lebte in der Unterwelt bei den Toten“, sagte Irmgard. „Ich bin ich und auf der Welt. Er kapiert es nicht mehr.“
Was meinte sie?
„Ich will ein Mädchen“, sagte Giovanni.
Irmgard nahm Leons Hand und drückte sie fest. „Lass ihn doch sein, wie er ist!“, sagte sie.
Leon fühlte nur den Druck, als sie ihm das längliche Viereck im Säckchen in die Hand schob. Die Finger schlossen sich reflexhaft darum. Irmgard legte die Zeigefingerspitze auf ihren Mund. Er hielt das Päckchen umfaustet. Seine Zurückhaltung kam der Unterzeichnung eines Paktes gleich.
Aber er befühlte das rosarote Knisterding. Was immer es verhüllen mochte, es war ein Geschenk. Das heimliche Kleinod, die saubere und sorgfältige Zwirn-Verschnürung, die geklöppelte Borte, in die das Ding gewickelt war, sagten alles über den Stil dieser schönen Frau, von der Leon nun praktisch etwas in der Hand hatte. Sie zwinkerte. Doch Giovanni sagte: „Na los, auspacken!“
Leon war so irritiert, dass er das Päckchen zu kneten begann.
Er spürte dem langgestreckten Gegenstand nach, ein masturbatorischer Akt, würde ihm ein Freud sagen. Ein Ring hing dem Gegenstand an. Irmgard sah ihm zu, wie er ins Schwitzen geriet, unter diesen Augen aus der Dunkelheit, im Angesicht dieses Teints der weißen Wüste, des Safranmundes und des Karawanengesangs, der runden Schultern wie glatt geschliffener Fels. Der arme Giovanni kannte die Gefühle, die im Knaben vor sich gingen, als dieser mit dem Geschenk der Frau auf Tuchfühlung war. Die Sehnsucht spannte sich in ihm und schlug wie die Taste des Klaviers eine Saite der Traurigkeit an.
„Willst du es mir nicht zeigen?“, fragte er. Er gestand seine Anteilnahme, doch er blieb auf Distanz. Giovanni sah einen Konkurrenten im Kind.
Plötzlich schnellte er vor und packte Leon. Mit seinen spitzen Fingern versuchte er die Faust aufzubohren. Leon ließ das Päckchen fallen. Der Alte bückte sich, erreichte es aber nicht. Leon gab dem Päckchen einen Tritt. Die Augen Giovannis leuchteten, obwohl er das Kind als schuldig erkannte. Allgemein lastete er der Jugend seine Verurteilung zum Altsein nicht an, um sich bei Laune zu halten und nicht in Wehklagen auszubrechen. Das Handgemenge war eine Art Sport für ihn. Die Eifersucht erzeugte die Aggression kindischen Trotzes, die ihn jung und alt zugleich fühlen ließ. Er maulte: „Ein äußerst störrisches Kind. Hat es sich jetzt schon entschuldigt?“
Leon stand sprachlos da, schließlich lief er davon.
„Er kann doch nichts dafür! Die Krone war ein Missgeschick.“
„Er soll bleiben, er tut mir gut!“ Und dann setzte Giovanni noch hinzu: „Und jetzt führ mich aufs Klo.“
Der zarte Frühsommermorgen hob sich und die Mittagsglocken läuteten. Der Alte musste auf die Toilette und die junge Schönheit führte ihn durch einen Seitengang dorthin. Hinter der Tapetentür versteckte sich ein Gang für die Dienstboten, der nun dazu diente, es rascher in die Waschräume zu schaffen. Leon hörte sein Brummen und Irmgards Besänftigung.
„Man hat mir gesagt, ein Mädchen würde kommen!“
„Er ist in diesem Alter doch so gut wie ein Mädchen.“
Der Knabe schlich zurück ins Zimmer, schnappte das Säckchen und wickelte sein Geschenk aus. Ein Lächeln zeichnete sich in sein Gesicht. Er berührte das Taschenmesser, es war klein und praktisch, ein Schlüsselanhänger.