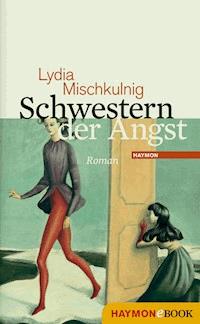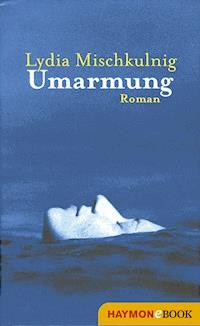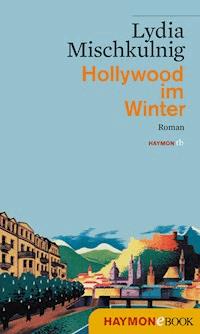Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
UNBESTECHLICHE BEOBACHTERIN UND SPRACHMÄCHTIGE AUTORIN Ein Besuch bei der Kosmetikerin, der zum mythischen Ereignis wird; eine Heuschrecke, die erstaunlich der Kreatur Mensch ähnelt; ein Ausflug ins Wiener Umland, der einen unheilvollen Verlauf nimmt; ein Kuss auf dem mondänen Kärntner Landgut, der empört; und eine Handschrift, die dem größten Liebhaber aller Zeiten gehört - in ihren Erzählungen fächert Lydia Mischkulnig alle Facetten des Mensch-Seins auf. Unbestechlich in ihren Beobachtungen lotet sie die Machtverhältnisse zwischen Mann und Frau aus, die Grenzen zwischen Vertrautem und Fremdem, das Gefälle zwischen Stadt und Land. ERZÄHLUNGEN, DIE UNTER DIE HAUT GEHEN Längst gilt Lydia Mischkulnig als eine der spannendsten und unkonventionellsten Stimmen in der österreichischen Literatur. Mit ihren neuen Erzählungen geht sie unter die Haut - sie ist witzig und abseitig, tiefschürfend und klug, feinnervig und aufrüttelnd, und immer: sprachgewaltig. Zum Teil autobiographisch gefärbt, führen uns ihre Texte von Kärnten über Wien und Venedig bis ins japanische Nagoya, wo die Autorin einige Zeit lebte: Geschichten, die sich tief eingraben und einen nicht mehr loslassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lydia Mischkulnig
Die Paradiesmaschine
Erzählungen
Weil wir im Paradies sind, schmerzt uns alles in dieser Welt.
Außerhalb des Paradieses stört nichts, weil nichts zählt.
Ono no Komachi (circa 825–900)
Kloster Neu Burg
Der Rasenmäher stotterte. Ich schlüpfte aus den Zockeln und zog die Turnschuhe an, setzte mich aufs Fahrrad und fuhr zur Tankstelle, um Sprit zu besorgen. Der Hügel war schon überwunden. Ich trat noch einmal mit vollem Gewicht in die Pedale, rollte um die Kurve, als ein Mann und eine Frau mir plötzlich im Wege standen. Die Frau hatte einen Plan in der Hand, aber der Mann fragte mich nach dem Weg. Die beiden wollten durch den Wald zum Sender, der auf dem Plateau unseres Hausberges steht, um von dort durch die Weingärten weiter in die Bundeshauptstadt einzuwandern. Mir fiel auf, dass jeder einen Rucksack trug. Einer der beiden Rucksäcke war rot und ich weiß nicht mehr, ob es der des Mannes war. Ich hielt mein Rad an und wies ihnen den Weg über die Felder, die von Büschen umrandet waren. Dort stieg die Erhebung an und der Mischwald bedeckte die Hänge mit grünen Schatten. Auf dem Plateau ragte der Sender aus dem bauschenden Laub und stach in den Himmel mit Wolken. Es hatte zu nieseln begonnen. Die Schalen der Parabolantennen klebten am Sender wie Saugnäpfe.
Die Frau bewegte den Blick auf mich zu und fixierte mich. Sie hatte klare Augen, eine scharf umrandete Iris gegen das Weiß. Vielleicht war sie keine Frau, dachte ich plötzlich, vielleicht war sie ein Ingenieur, der mich mit einem Instrument vermaß. So ertappte ich mich dabei, dass ich einen Blick als männlich ansah, der nicht gütig, sondern prüfend auf mir lag. Umgekehrt prüfte ich ja zurück, nicht gütig, weil die Prüfung erst ergibt, ob Güte angebracht ist. Die Skepsis dieser Frau durchdrang mich und ich erhob sie zur beurteilenden Instanz, gegen die ich mich zu bewehren hatte.
Hätte sie mich mit trüben Augen erfasst, wäre sie vielleicht als mütterlich durchgegangen. Als Krankenschwester sicher nicht, weil ich ja gesund gewesen war. Täter und Opfer, so seh ich das, lassen sich schwer identifizieren, weil sie ein System bilden, in dem ich stecke.
Der Mann sandte freundliche Signale. Er rückte die Mundwinkel ins Lächeln. Er bewegte die Lippen. Er sprach. Ich konnte ihn nicht hören. Meine Ohren waren verschlagen. Zudem hatte ich den Eindruck, dass er mich nicht mochte, weil ich mich lieber mit der Frau unterhalten hätte. Er schnitt ein Gesicht und stieß einen verächtlichen Ton aus, was mich unangenehm berührte. Ich bewahrte die Fassung, um auf mein und ihr Gemüt positiv zu wirken, und dachte plötzlich, ohne es zu wollen oder die Gedanken steuern zu können, an Wundpolster. Er formulierte und ich kapierte, dass er nach einem sicheren Weg fragte. Ich lächelte, erleichtert, weil nun meine Ohren wieder funktionierten, oder doch nur aus einem Ehrgefühl heraus, da ich seinen strengen Ton auch einzuordnen wusste, ohne ihm blind folgen zu müssen. Die Worte separierten sich in meinem Ohr zu aufeinanderprallenden Sinneinheiten, überschwemmten die Knöchelchen mit Knistern, zerbröselten die Hügel, den Sender, das Gras. Ich beschrieb die Geröllhalde, über die der sichere Weg führte, durch die Wüste, die, mit Plastik verdreckt, ein Wasserloch bot. Ich brachte ihn zum Lachen vielleicht wegen der Wüste, die mir einfiel und trocken über die Lippen kam. Er suchte einen sicheren Weg und nicht den kürzesten, wiederholte er, was ich dem Rauschen der Luft entnahm. Er sprach etwas abgehackt, oder stotterte mein Gehör, als ich nur mehr Bahnhof verstand, dorthin also, zum Bahnhof.
Die Frau trug Turnschuhe. Praktisch alles an ihr war Importware. Ihr Körper war es und seiner auch. Beide Personen waren gleich alt. Seine grauen Schläfen glänzten, als würde er an diesen Stellen silbern. Er hatte große Hände und brauchte eine Brille. Er hielt sie in der Hand und setzte sie auf, um auf den Plan zu schauen, den die Frau festhielt. Es war mir erst jetzt aufgefallen, so gewöhnt war ich schon daran, dass die Frau ein Kopftuch trug, das ihr Haar vollkommen abdeckte und nur das Gesicht freiließ. Dass ich eines Tages so daran gewöhnt war, dass mir ein Kopftuch gar nicht mehr auffiel, war schon bemerkenswert.
Ich finde Kopftücher meistens übersehenswert. Mir fallen sonst nicht mal Nonnen auf, diese Religionsbräute par excellence. Sie gehören auch einem Harem an. Ihre Uniform ist Ausdruck höchster Geziemtheit, jeder Rausch wird bezwungen, der Exzess geregelt, erfolgt im Schlucken der Hostien. Die Ordnungshüterin trägt die Reizwäsche des Schattens, sie läuft auf Gottes Erdboden herum, versprochen, solange sie an den Aufschub der heiligen Nacht glaubt. Die Kopftuchträgerin hier vor mir trägt die gleiche Maske. Sie ist ein Zeichen, das der Mann setzt. Sie ist die Trägerin eines Geheimnisses, denn was denkt sie jetzt? Nonnen kleiden sich nach christlicher Ordnung und stehen im Schatten der prächtig gewandeten Priester. Als ich dieses Spiel begriff, war es leicht mit dem Kirchenaustritt und der Entfernung aller Kopftücher. Nun stand diese Verschleierte vor mir, die dem Mann gehörte, der seine Brille auf den Nasenrücken sinken ließ und sich dem Walde zudrehte.
Er steckte die Daumen unter die Gurte seines Rucksackes. Mein Blick tastete seinen Handrücken ab und kletterte über den Gurt hoch, die Kragenkante des T-Shirts entlang und blieb an seinem Gesicht hängen. Er trug keinen Schmuck, aber ein Streifen Licht, eine Art weiße Spur, sie lief quer über seine Stirn, strahlte auf und erlosch. Ich stierte gleich wieder auf seine Pfoten, als wäre etwas Ungewöhnliches auch daran zu sichten. Ich schüttelte den Kopf und konzentrierte mich auf die realen Umstände, dass es sich um Hände und nicht um Pfoten handelte. An den Händen war nichts Auffälliges zu entdecken, oder doch? War das nicht eine weiße Spur, die ich sah? Hatte er seinen Ehering von seiner gebräunten Hand abgenommen? Vielleicht weil er fremdging mit der Dame? Wie passte das mit dem Kopftuch zusammen? Die Turnschuhe waren weiß und mir schien, die beiden standen nicht wirklich auf dem Boden, sondern schwebten über der Erde.
Der Mann legte den Kopf schief und ich wiederholte die Wegbeschreibung. Der Graben, der Hohlweg, der Sender, es gebe andere Wege, aber die seien matschig.
Wolken türmten sich zu blaugrauem Tüll. Es wurde kühl und während ich den Weg noch einmal zeigte, in die Mulde hinein, auf den Hügel zu, den Kurven nach und in eine Kehre, fragte der Mann, ob der Weg durch den Graben gefährlich sei. Ich hob mein Spielbein und setzte den Fuß auf das Pedal, und verneinte die Frage.
Dann zeigte ich auf die Uhr und meinte, mich nach Hause verfügen zu müssen. Ehrlich gesagt war ich verwirrt, weil dieser Mann mich lange und scharf ansah, als läse er von meinen Augen ab, dass ich log. Sie können gleich nach Hause fahren, sagte er. Im Rasenmäher wird genug Benzin sein. Wie bitte? Hörte ich recht? Woher wusste er, dass ich zur Tankstelle fahren wollte, woher wusste er vom Rasenmäher, und vom Rasen? Ich musste mich verhört haben. Er legte seiner Frau den Arm um die Schulter und zeigte auf den Wald. Dort ist der rechte Weg?, fragte er. Sicher, sagte ich. Gehe hin, sagte er. Ich musste ein Lachen unterdrücken, wollte ihn nicht provozieren. Es hatte hier einmal eine Irrenanstalt gegeben. Ich war ein wenig perplex über seinen weihevollen Ton und stand noch eine Weile auf der Straße. Ich sah dem Paar nach und als er am Waldrand seine Hand nach den Büschen streckte, reiften die Himbeeren im selben Augenblicke, dass mir der Mund offen blieb. Ob die Füße in den Turnschuhen den Boden berührten, das konnte ich nicht sehen, aber mir schien, sie schwebten wirklich.
Ich fuhr zur Tankstelle, zapfte Benzin und fuhr mit dem Kanister nach Hause. Hätte ich seinen Worten Glauben geschenkt, hätte ich mir den Weg zur Tankstelle und den Benzinkauf ersparen können. Niemals wieder, so sagte nun eine Stimme in mir, wirst du diesen Rasenmäher mit Benzin füllen müssen. Du kannst Rasenmähen bis in alle Ewigkeit und wirst kein Benzin mehr benötigen. Doch praktisch fand ich diesen Gedanken nicht, denn eigentlich wäre es klüger gewesen, das Gras nicht mehr wachsen zu lassen. Ich mähte also mein Rasenstück und wartete ab. Es regnete, es schien die Sonne, alles im richtigen Wechsel.
Wochen später rumpelte ich über den Weg, in die Mulde, über den Hügel, in den Hohlweg. Die Büsche, die Zweige, das Laub. Das Paar war längst über alle Berge. Aber mir war, als sähe ich das rote Ding durch das Geäst. Der Boden war weich und feucht vom Tau. Der Rucksack lag verheddert im Gesträuch. Ich lehnte mich noch an den Stamm der Buche und nahm einen Stock vom Boden. Sollte ich stochern und die Schlaufe aus der Verschlingung lösen? Minutenlang stand ich da und überlegte, den Rucksack zu schnappen.
Und wieder Wochen später geschah Folgendes. Das Gras war seit dem letzten Mähen nicht gewachsen und der Rasenmäher blieb mit Benzin gefüllt. Ich beschloss, nun zur Stelle zurückzufahren, wo ich den Rucksack liegen gelassen hatte.
Ich hatte ihn kaum zwischen den Fingern, da zerflossen die Fasern und legten sich auf die Kuppen. Als ich meine Brille aufsetzend die Augen scharfstellte, sah ich, dass der Rucksack nur Papier enthielt. Ich kenne viele Pläne unserer Gegend auswendig wie die Schaltkreise der Stromanlagen in den umliegenden Häusern, die Parzellen und den Grundstückskataster, die Baupläne, die ich als Baumeister zeichnete. Aber noch nie sah ich eine Art Schatzkarte, die zu mir, auf mein Grundstück führte.
Ich hatte nichts mit diesem Mann und dieser Frau zu tun und doch war mein Haus von den Punkten umzingelt und mit einem Kreuz gekennzeichnet.
Ich schwieg, aber ziemlich beunruhigt. Alles okay?, fragte die Stimme in mir. Mein Herz raste.
Es ist Jahre her, dass ich diese Zeichnung mitgenommen hatte. Damals waren die Kinder noch klein und spielten im Garten. Ich war zum Schluss gekommen, dass der Schatz die Kinder waren. Ich hatte die Karte in mein Büro mitgenommen. Ich steckte den Schlüssel in das kleine Loch, öffnete den Safe und legte das Blatt hinein. Freilich, zuvor hatte ich die Karte studiert und dann den Garten vermessen. Ich will jetzt keine Geschichte von Wundern erzählen, aber der Feigenbaum, der am Verdorren war, wuchs genau an der Stelle, die auf der Karte eingezeichnet war. Ich musste tief durchatmen, als ich diesen Krüppel Tage später blühen und im kommenden Jahr Früchte tragen sah. Muss ich noch ergänzen, dass sie süß waren? Die Kinder und der Feigenbaum. Selbst wenn ich meinen Job verlöre, der Feigenbaum würde uns ernähren.
Nun war die Karte in meinen Händen gleichsam zurückgekehrt, aber wo waren meine Kinder?
Mein Blick war alt geworden, er kroch über das Papier.
Nun sah ich, dass der Garten nicht mein Garten war. Er gehörte dem Rasen und dem Baum.
Ich blickte aus dem Fenster, das nicht mein Fenster war, sondern ein Rahmen, den Menschen bewanderten. Freilich war ich von meiner Fremdenangst angestachelt. Aber nun bekam ich Bekanntenangst. Ich kann mich nicht mehr sicher bewegen und bin in meinem Garten mit meinem Haus ein leichtes Opfer für diebische Bettler. Ein Mann mit einer Frau stand am Zaun. Sie trug ein Kopftuch. Wo waren meine Kinder denn hin? Sie leben in fremden Welten und ich bin geblieben. Andere sind gekommen. Aber wieso ist dieses Paar nicht gealtert? Oder doch? Trägt sie den Vollschleier? Sie war so verhüllt, dass ich sie nicht erkennen konnte. Und wenn jetzt dieses Paar den Baum umschlägt und seinen Schatz holt, dann bin ich aber neugierig auf meine alten Tage.
Im Esszimmer lag meine Brieftasche auf dem Tisch. Ich steckte sie ein, doch bevor ich das Haus verließ, um das Gartentor zu öffnen, war das Paar weitergewandert.
Ich brauchte ein paar Atemzüge, um mit dem Rollator nachzuzuckeln.
Ich ging die Straße hinan, den Hügel hinauf in die Mulde hinein, den Kurven nach und in die Kehre. Ich fragte mich, ob der Weg noch matschig war, dann würde ich Spuren hinterlassen. Der Rollator stotterte.
Kuss
I
Wieso vaterlose Kinder bedauert werden, wo sie doch Realität sind und in dieser zu Hause, ist mir unerklärlich. Auch ich bin ohne Vater aufgewachsen, noch dazu in Armut, mit einer Mutter, die Ausländerin war und einen Krankenschwesterndienst zu leisten hatte. Noch dazu in einer wirklichen Großstadt, wo die Anonymität hinzukam, in der ich mich zur Realität machen musste, um in ihr überhaupt vorzukommen. Selbst innerhalb der Familie. Denn wir waren acht Kinder und ich das jüngste. Meine Geschwister kamen im Ausland zur Welt. Ich bin auf englischem Boden geboren und aufgewachsen. Vielleicht fühle ich mich deshalb englischer als meine Geschwister.
Heute leben wir über den Globus verstreut und das Schöne ist, die Familie wurde dadurch noch größer. Ich werde auch von den Schwagern und Schwägerinnen als Sister begrüßt. Ich weiß sofort, ob ich jemanden mag oder nicht. Ich habe eine große Familie und bin noch dazu eine angesehene, selbstständige Frau in Österreich, die dem Land nützt: Ich singe.
Telefoniere ich mit meinen Freunden, bemühe ich mich um gute Laune. Niemand will öfter von Geldsorgen und Lampenfieber hören als nötig. Ein paar Lebensgrundsätze befolge ich, die mir meine Mutter mitgegeben hat.
Wenn dir jemand nicht zuhört, schweig und vergiss ihn.
Bist du auf Reisen, hab immer zwei Unterhosen bei dir, eine zum Waschen, eine zum Tragen.
Wenn du Tee trinken willst, nimm dir deine Teebeutel immer selber mit.
Wenn du deine Nägel schützen willst, trage stets ein Paar Latex-Handschuhe bei dir, du weißt nie, ob du zum Beispiel den Abwasch zu erledigen hast, um Hilfsbereitschaft gegenüber einer Freundin, die dich zu sich nach Hause zu einem Essen eingeladen hat, zu beweisen.
Gepflegte Hände sind deine Visitenkarte, wie dein gepflegter Mund. Sprich deutlich und ohne Slang, so gut du kannst.
Mum ging mir nie auf die Nerven. Viel zu früh ist sie verstorben. Die Debatten in den Zeitungen und die Untersuchungen über die prekären Verhältnisse der Alleinerzieherinnen, die erwachsenden Probleme in der Ablösungsphase ihrer Kinder, bewirken, dass ich meine Mutter für ihre Dienste an uns, die Rastlosigkeit und Fürsorge, noch mehr bewundere. Aus uns Kindern ist etwas geworden. Jeder lebt unabhängig, niemand belästigt den einen oder pumpt den anderen um Geld an. So erkenne ich heute, dass Mutter den Preis für unsere Lebenstüchtigkeit mit ihrem Leben bezahlt hat. Sie starb mit fünfzig.
Ich werde in drei Jahren fünfzig. Habe keine Kinder und fühle mich reif für einen täglichen Mittagsschlaf.
Ich habe schwimmen erst mit dreißig gelernt, Rad fahren mit fünfunddreißig. Als Kind hatte ich niemanden, der es mir beibringen konnte. In der Schule war nur Handball gefragt.
Ich arbeitete bereits früh als Kellnerin und das zu einer Zeit in London, in der die Jugendkultur keine Revolution hervorbrachte, doch friedlich die Punk-Szene auf der King’s Road inszenierte. Ich war niemals Punk. Ich wäre mir nicht cool vorgekommen, sondern verschrien. Meine Idee von „anders sein“ war die eindeutig identifizierbare Queen. Ich mochte nichts Cross-Gender-Mäßiges, sondern wollte einfach durch Eleganz und Können wirken. Ich wollte mit Recht auf meinen naturgemäßen Status verweisen. Ich wollte gut sein und gut aussehen – das sein, was ich bin.
Vielleicht war ich in Deutschland auch nur wegen seiner Geschichte gut aufgehoben. Ich galt als Exotin und weil ich gut war, sang ich bald in Clubs, und wenn man jung war und aus London kam, galt London als Zeugnis für Weltläufigkeit. Ich erhielt musikalischen Kredit. Wenn ich in deutsche Städte reiste – bis auf Frankfurt oder Offenbach, wo der Jazz der amerikanischen Besatzungssoldaten herrschte – und weil ich sehr schnell gut deutsch sprach, da ich Gehör besitze und wohl strukturierte neuronale Komplexe im Kopf habe, ließ ich mir mein Exotentum als Londonerin mit haitianischen Wurzeln angemessen bezahlen.
Selten bewege ich mich in legerer Freizeitkleidung aus dem Haus. Ich will positiv beeindrucken und das sofort und unmissverständlich. Mit wehendem Seidenmantel, Highheels und aufgedrehtem Haar sehe ich wie eine fliegende Holländerin aus.
Na ja, es steht nun das Wochenende auf dem Programm, und es ist höchste Zeit, die Stadt zu verlassen. Die Hitze ist unausstehlich.
Ich fahre jedoch ungern mit dem Zug, da ich Bahnhöfe nicht mag, entweder weil sie überwacht sind, oder weil sie nicht überwacht sind. Jedenfalls ist nicht zu erwarten, dass jemand eingreift, wenn ich blöd angesprochen werde. Daher hoffe ich, dass Klaus ein Auto ausborgen kann.
Klaus ist mir sehr lieb. Sind Paare länger zusammen, als die Begeisterung füreinander anhält, gibt es welche Gründe dafür?
Klaus ist mir vor Jahren über den Weg gelaufen, hat mich auf der Straße angesprochen, in seiner draufgängerisch ungeschickten Art. Ob ich Lust und Zeit auf Kaffee habe? Jawohl, Blind Date, wenn man so will, auf den blinden Fleck unserer Beziehung zuschreitend. Manchmal frage ich mich, ob er auf mich oder auf meinen Style steht.
Seine Haut und sein so früh ergrautes, fast schon weißes Haar passen, ästhetisch gesehen, zu seinem Hemd und mir. Eine Brille aus Titan. Er lief mir über den Weg und interessierte sich für meine Geschichte. Bewunderung für meinen Gesang, meinen Erfolg, Zielbewusstheit und Blick für die Faktizität. Ich mochte ihn, vielleicht weil ich seine Unerbittlichkeit missverstand, und diese sogar ein Missverständnis seinerseits war. Er haderte mit der Welt.
Seither sind wir ein Paar. Scheidung von altem Partner, und nun vereint mit ihm, was uns beiden bisher eine gute Zeit beschert hat.
Seine Freunde behielten ihn, weil sie meine Person mochten. Zugänglichkeit, Freundlichkeit, Ehrlichkeit. Der einzige Mensch, den Klaus nie abwertete, das war ich. Wenn er mal mit der Faust auf den Tisch hauen mochte, dann von unten.
Bei mir ist er zahm und frisst mir aus der Hand. Ich koche auch gut. Und versöhnte ihn mit seiner Mutter, die ganz schön rebellisch ist und ebenso acht Kinder großgezogen hat. Allerdings in der Provinz und mit Witwenpension.
II
Während ich auf der Couch im Wohnzimmer vor mich hindachte und schlummerte, saß Klaus bereits im Cabrio. Ausgeborgt. Weil er mit dem Business auf die Schnauze gefallen ist. Schätze ihn gerade deshalb, er geht keine Kompromisse ein. Hinterfragt alles scheinbar Bedeutsame, um zum Kern der Dinge durchzudringen und sie in ihrer Seele zu befragen. So wie meinen Körper. Der hat auch Seele und bringt meine Gesinnung in Gesten hervor. Kriege Gänsehaut, wenn ich an das Gesindel und an die Polizei denke und zum Bahnhof muss. Es läutet. Klaus holt mich ab.
Kuss.
Nebeneinander sitzend fahren wir durch das Grün. Äste überdachen die Straße, das Blattwerk frisst das CO2. Klaus beutete keine Arbeiter aus und keine Arbeit, auch nicht seine und nicht sich selber, und deshalb sind seine Designermöbel Einzelstücke. Hatte er früher sogar Erfolg, kräht jetzt kein Hahn mehr nach ihm, auch kein Kapaun. Ich singe für uns beide. Unser Bett ist aus Nuss und geformt wie eine Welle. Als der Eiserne Vorhang fiel, stürzten in seiner Branche die Preise in den Keller, und die Löhne der hiesigen Tischler waren bald nicht mehr zu bezahlen. Klaus meldete vor ein paar Jahren den Konkurs an. Das war bitter. Nun ist er mein Manager. So geht es.
Doch heute ist Wochenende. Ein paar Leute werden zusammenkommen. Wir werden ein Mädchen begrüßen, die Neue von Franz. Sie hat, wie alle von Franz, geblondetes Haar – er behauptet, die Farbe sei ihm egal, Hauptsache echt.
Für mich zeichnet sich schon an den Backenknochen ab, was echt ist. Ich komme aus dem westlicheren Westen und schaue mir die Gesichter auf ihre kosmetischen Eingriffe hin an. Ich habe nichts gegen Botox-Behandlung. In Würde zu altern heißt, sich so lange wie möglich jung zu halten. Illona wird uns berichten, dass sie aus der Slowakei kommt, wo man Mauern gegen die Zigeuner errichtet hat, oder war das in Tschechien? Wieso Zigeuner ihre Kinder nicht in die Schule schicken wollen – ja, das geht mir in den Schädel rein, denn ich lernte auch ohne Schule Deutsch und natürlich lesen und schreiben. Ich bin auch Musikantin und gehöre zum fahrenden Volk.
Klaus blickt mich jetzt mal fragend an, wieso ich so konzentriert nachdenke. Ist er beruhigt darüber oder ist es eine Beschwerde? Es geht mir gut. Doch weiß ich, dass er sich schweigend fragt: Und wie könnte es ihr besser gehen? Er fragt das nicht, um mich nicht zu verlieren, eher um mich zu behüten.
III
Das Dorf liegt vor uns. Am Rande werden wir noch andere Freunde treffen, die sich gerne dem Sprechgesang widmen und Gitarren zupfen. Ich kann nicht Laien an mir messen, daher klinge ich nur abfällig, bin es aber nicht. Lediglich korrekt, wenn ich von mir als Professionistin spreche.
Im Übrigen werden wir auch Leute treffen, die zwar prinzipiell freundlich, doch mit meiner Putzfrau nicht nett umgegangen sind. Dieses Ehepaar mit dem Kind. Sie haben meine Putzfrau gleichsam ausgeliehen und sie für ein paar Wochen engagiert. Bis eines Tages die Frau die Putzfrau zu sich bestellte und ihr einen Pullover unter die Nase hielt und damit herumfuchtelte. In der anderen Hand hatte sie eine Schere und brachte das Instrument mit dem Pullover in Zusammenhang und dann beides mit meiner Putzfrau. Da waren Löcher in den Pullover geschnitten und die Frau dachte, das habe meine Putzfrau getan, und deshalb stellte sie sie zur Rede. Der Seitenblick meiner Putzfrau auf das unschuldig im Zimmer herumsitzende, Pokemon spielende Kind genügte, dass die Frau vollends ausflippte und zu kreischen begann, sie solle nicht die Schuld auf das Kind schieben. Meine Putzfrau flüchtete aus diesem Irrenhaus. Ich kenne die Geschichte nur aus ihrer Perspektive. Die Familie selbst, die wir nun treffen werden, weil es eben Verwandte von Freunden sind, gibt sich immer wohlerzogen und vernünftig. Ich werde es damit gut sein lassen. Freunde kann man sich ja aussuchen, deren Verwandte aber nicht.
Außerdem freu ich mich auf Josef. Seine Fürsorglichkeit ist beispiellos, sieht man vom Neuen Testament ab. Er hat den Sohn seiner Freundin adoptiert und hält ihm die väterliche Treue. Er kümmert sich um ihn, als wäre er sein eigen Fleisch und Blut – wie ich es mir halt vorstelle mit dem eigenen Fleisch und Blut. Wenn ich an meine Ahnen denke, hat sich eigentlich niemand so aufgeopfert, bis auf meine Mutter. Es ist ihre Stimme, die ich noch immer erinnere, und sie reicht über den Fluss in meine Existenz, die nicht ohne Echo vergehen soll. Deshalb ist jetzt schon mal der Augenblick zu besingen.