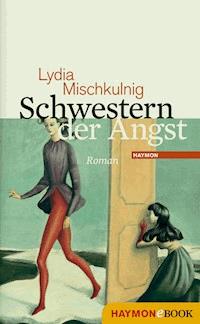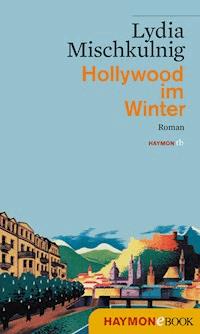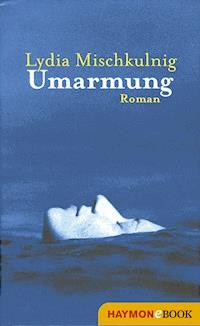
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist Abend. Draußen wütet ein Schneesturm. Eine Frau ist allein zu Haus, nimmt sich ein Buch zur Hand, liest und denkt. Da läutet es. Eigentlich erwartet sie niemanden mehr. Aber aus Neugier steht sie auf, geht und öffnet die Tür. Ihre Freundin prescht in die Wohnung. Sie sagt, sie sei in eine arge Geschichte geraten, aus der sie allein nicht entkommen könne. Sie stecke fest. Sie habe in eine Figur schlüpfen wollen und sei nun gefangen im Körper ihrer Romanfigur. Eine immer irrer werdende Geschichte entspinnt sich, in der die Konturen des Selbst verwischen. Wie Ingeborg Bachmann oder Elfriede Jelinek lotet Lydia Mischkulnig in ihrem neuen Roman die Grenzen weiblicher Identität aus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lydia Mischkulnig
Umarmung
Roman
© 2014
HAYMON verlag
Innsbruck-Wien
www.haymonverlag.at
Überarbeitete E-Book-Ausgabe
Originalausgabe: Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart München 2002
ISBN 978-3-7099-3574-3
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Weitere Titel von Lydia Mischkulnig finden Sie unter www.haymonverlag.at.
Inhalt
Inhalt
Weitere E-Books aus dem Haymon Verlag
Als ich mich abends hinsetzte, um das Buch von Ernst H. Kantorowicz über »The King’s Two Bodies. A Study in Mediaeval Political Theology« endlich in die Hand zu nehmen und durchzuackern, und mir einen Schwarztee einschenkte, der mich über das muffig madige Wort Bergamotte nachdenken ließ, während sich das Aroma wie ein Geist aus der Kanne entfaltete, der mir das Lesen der Studie so behaglich wie möglich gestalten sollte, um so lange wie möglich durchzuhalten, läutete es plötzlich an der Tür.
Erst wollte ich mich nicht bemerkbar machen. War froh, allein zu Hause zu sein, hatte eine anstrengende Nacht und einen anstrengenden Tag hinter mir. Draußen wüteten heftige, ja katastrophenartige Schneefälle. Wer schlittert bei solchen Witterungsverhältnissen ausgerechnet zu mir? Die Haustür hatte offen gestanden, das Schloß funktionierte nicht. Deshalb das Geläute gleich heroben an meiner Tür. Ich horchte und konnte nichts hören. Da ich noch im Velourslederkleid steckte, das mir wie eine zweite Haut paßte, die ich nicht ausbeulen wollte durch das Herumlungern auf dem Sofa, also ohnehin noch einmal hätte aufstehen müssen, um mich umzuziehen, und da ich auch noch nicht angefangen hatte, mich mit den »Two Bodies« dieser unauflöslichen Körpergemeinschaft einer persona ficta und non ficta zu beschäftigen, nichts mehr essen wollte, mich aber unterhalten vielleicht und meine Neugier stärker war als jedes Interesse, schlug ich das Buch zu und legte es neben den Earl Grey, erhob mich und ging und öffnete die Tür.
Sofort sprang mich die Kälte an, wie ein starkes, wildes Tier krallte sie sich in mein Gesicht. Sie wünschen? höre ich mich noch fragen. Eine schwarze Gestalt stand auf der Schwelle, völlig vermummt. Freudig überrascht, sagte ich noch: Du?!, denn es war meine Freundin LM. Ich hatte die Tür noch gar nicht richtig aufgemacht, da stellte sie ihren Fuß herein und stieß mich wie ein Rüpel beiseite und preschte, unaufgefordert und sich überstürzend, herein. Ihr Atem ging schnell wie der Atem eines gehetzten Tieres, der Blick flitzte über meine Wände, stürzte sich hinein in die dunklen Löcher meiner Zimmer. Sie raste, den Atem in immer kürzeren Intervallen ausstoßend, raste im Zickzack durch die Wohnung und sagte: Wo bin ich? In jedem Zimmer machte sie Licht, sah sich blitzartig um, stürmte ins nächste Zimmer, zuerst systematisch, eins nach dem anderen, dann, immer irrer, schoß sie kreuz und quer hin und her und schien nach irgend etwas für sie Elementarem zu suchen.
So geht das nicht, dachte ich. Seit Jahrzehnten führen wir Gespräche, hauptsächlich über Literatur und LMs Arbeit, die ich über alle Maßen schätze, ich dies LM aber niemals mitteilen dürfte, da ich sonst ihr Vertrauen, das sie in mich als ihre wichtigste Kritikerin setzt, verlieren würde. Ich wunderte mich über ihr plötzliches, panisches, aufdringliches, überrumpelndes und völlig aus ihrer Art schlagendes Verhalten. Bis ins Ausruhzimmer drang sie vor, wo Roger sich einen kleinen Arbeitsplatz eingerichtet hat, sich sonst aber nur der Fernsehapparat und das bequeme Sofa mit dem Beistelltischchen befinden, auf dem der Tee dampfte neben der noch immer daliegenden Studie.
Ich versuchte LM aufzuhalten, da schlug sie nach mir aus. Ich schreckte zurück und wurde wütend, denn Gewalt verachte ich. Was erlaubst du dir, höre ich mich noch fragen, meine Wohnung so aufgebracht zu betreten und dich hier zu verhalten, als wärst du in den eigenen vier Wänden?
Mein Haus steht immer offen für LM, doch nicht so offen, daß das Chaos der ungemachten Betten, der herumliegende Krimskrams des Kindes, das mit dem Mann zum Skiurlaub in die Berge gefahren ist, zu beleuchten und zu beäugen sind. Ich hatte weder Lust noch Zeit, das Chaos fortzuschaffen. LM ist mit den Augen nur so darübergeflitzt. Ich weiß, daß sie jedes Detail wahrnimmt und schamlos benützt, um einen Text zu erarbeiten. Sie wird über mich schreiben, wie ich jetzt über sie.
Ich schloß die Türen und folgte ihr, löschte hinter ihr die Lichter. Im Vorzimmer kam sie endlich zum Stillstand. Es war eiskalt, und der Wind heulte durchs Haus. Die Wohnungstür stand noch immer offen. Ich wartete. Sie betrachtete ihr Spiegelbild. Also auch mich im Hintergrund. Ich gebe zu, ich fürchtete mich oder war zumindest sehr verunsichert durch diesen Auftritt. Ich hätte über meine Schwelle springen und durchs Stiegenhaus davonlaufen können. Aber ich schämte mich meiner Furcht. Schließlich kenne ich LM. Ich zeigte mich kontrolliert. Hielt Stand dem Blick und fror dabei in der Tür. LM streifte den Mantel ab und gab der Tür einen Schubs, und ich sagte noch, das sei eine gute Idee, weil so nicht die ganze Wohnung auskühle. LM stieß ein verächtliches Lachen aus. Sie entdeckte die hervorgetretene Ader auf meiner Stirn, die ich aus ein paar Metern Entfernung im Spiegel selbst sehen konnte. Ich erschrak über diese Ballung, das Blut, das in mein Gesicht geschossen war. Erregung entstellt. LM sagte, geschieht dir recht, und ich wußte nicht, wieso sie das sagte.
Was hast du denn? fragte ich. Blitzschnell drehte sie sich zu mir um und sagte: Verarsch dich bitte selbst.
Da ich nie einen negativen Gedanken über sie gedacht, geschweige denn geschrieben, ihr also keinerlei Anlaß gegeben hatte, durch den sie sich verarscht hätte fühlen können, sie nie mißbraucht hatte, um mir vielleicht nur die Langeweile zu vertreiben, obwohl ich an Langeweile extrem leide und mich dann oft eine Sehnsucht nach dem Geist der LM packt, nach ihrem Witz und nach ihrem angenehm distanzierten Wesen, das mich aus der Reserve zu locken und mir, ja, ich muß es so ausdrücken, auch einen Erkenntniswillen, trotz aller Aussichtslosigkeit, daß Erkenntnis meine Langeweile vertreiben konnte, zu geben vermag, einen unsinnigen Lebenssinn, und ich sie deshalb nicht nur schätze, sondern geradezu liebe, war ich getroffen und wußte plötzlich, daß ich dennoch eine Grenze überschritten haben mußte und sie zu verlieren drohte.
Sie wußte, daß ich allein war in dieser Woche, und ich hatte ihr versprochen, sie gleich, nachdem ich meine Lieben zum Zug gebracht hatte, anzurufen, um sie zu einem gemeinsamen Frühstück einzuladen, es auch versucht hatte, doch war sie nicht zu erreichen gewesen. Auch nachmittags nicht, und weder am Sonntag noch am Montag noch am Dienstag. Heute noch hatte ich versucht, sie zu erwischen. Aber nur das Band war an, und zurückgerufen hatte sie nicht. Freilich, auch sonst war sie nie mit Anmeldung aufgetaucht. Ich wußte nicht, was sie hatte.
Setz dich doch, sagte ich.
Wohin? fragte sie spitz, mit einem unguten Ton, den ich nicht von ihr kenne. Sie folgte mir ins Ausruhzimmer. Sie setzte sich ohne weitere Aufforderung auf das Sofa. Ich blieb reserviert und goß ihr erst einmal Tee ein. Beruhigte mich selbst, um meine Unnahbarkeit zu erhalten. Ich bin, wer ich bin, dachte ich und gedachte das auch LM gegenüber zu bleiben.
Ich wollte mich gerade einlesen, sagte ich. Da ich wußte, daß sie an einem Roman arbeitete, in dem sie Geister, Doppelgänger und Psychotiker auftreten lassen wollte, um das Entrische, das Gespenstische der sich vollziehenden Jahrhundertwende, der Wirtschaftswende, der Kommunikationswende, der Politwende, der Kriegsführwende, der Fortpflanzungswende, der Menschheitswende darzustellen, hatte ich mich entschlossen, ein Buch über Identität und mich in ihrer Gestalt zu verfassen. Eine Art Ich-Wende hatte ich in Angriff genommen, um den Übergang von etwas Altem zu etwas Neuem zu beschreiben. Um mich nicht zu zerfransen, legte ich mich quer, also hin, und dachte nach. Wertesysteme fallen. Man muß wissen, wer man ist. Man ist, wohin man sich wendet. Man ist, wohin man gezählt wird. Wer sind die anderen? Was wollen diese von mir? Was will ich von diesen? Komfort? Meinen Frieden? Meine Geschichten? Neue Ingenieure betreiben Gesellschaftskunst. Sie schichten die Gesellschaft um. Wo bin ich? Wo lande ich? Wer sind sie, daß sie mich stören dürfen? In einem Brei von Material hatte LM eine Form gesucht, ein Konstruktionsprinzip, bei dem ich ihr gerne mit Rat zur Verfügung gestanden hätte und deshalb auch, auf ihren Tip hin, in die Nationalbibliothek gegangen war, um den sterblichen und unsterblichen Körper der englischen Könige zu ergründen, unter deren Herrschaft die Gesellschaft ein stetig wachsendes Rechtssystem, Parlamentarismus und Demokratie entwickeln konnte.
LM suchte eine Figur. Einen seelisch-körperlichen Überbau. Einen Schädel, der so groß war, daß er ihre Gedankenmasse fassen konnte. Agathe gehört aber mir. Ein Mensch, eine Frau, ein dreidimensionales Gebilde, das stirbt, oder auch nicht. Ich stand nicht nur Pate bei der Entwicklung Agathes. Ich habe sie gezeugt. Jeden kleinen Einfall, jedes Erlebnis dieser Agathe habe ich dank LM gefunden, den Fragen, die sie mir stellte, entlockt.
Wer ist Agathe? hat sie mich jahrelang gefragt und mich mit dieser Frage bis zur Hirnerweichung gequält. Dabei war klar, daß ich Agathe bin. Aber weil mir LM so nahestand, kann ich sagen, daß Agathe auch mit ihr zusammenfallen hätte können. Sie vereint alle Stimmen in sich, die der Mutter und Tochter, der Restauratorin und Zerstörerin, der Freundin und Feindin, der Ehefrau und Betrügerin, des Gesellschaftstieres und der Individualistin. Aber was, so wollte sie wissen, ist das Österreichische an dieser Agathe?
Wieso das Österreichische? fragte ich zurück.
Sie muß eine Kultur in sich haben. Wie bewegt sie sich? Sieht sie schlampig aus? Welche Haltung hat die gnädige Frau?
Als Österreicherin könnte sie die Musik lieben. Doch Agathe hört nicht. Sie ist wie ich.
Und sie muß fühlen, sagte LM. Genau das ist der Punkt. Was fühlt sie denn?
Da ich LM für meine Schriftstellerin halte, gebe ich ihr gern meine Stimme und alle Stimmen, die ich mir denken kann, die meine Biographie und mein Leben wiedergeben. Vielleicht ist es Eifersucht, die sie hergetrieben hat, um mir die Meinung zu sagen, da sie in ihrem Innersten weiß, daß sie nichts erfindet, sondern nur abschreibt, und das von mir, einer Unbekannten, im Verborgenen Wirkenden. Ich schätze ihre schriftstellerischen Fähigkeiten, aber ich kenne auch die Komplementärseiten. Sie hat mir Imaginationsschwäche vorgeworfen und Visionslosigkeit, dabei kam sie nicht weiter. Was ist das Österreichische? Sentimentalität oder Ressentiment?
Das alte Haus Österreich. Ich mag das Träumerische daran. Der Traum eines Häuselbauers. Wer ist der Häuselbauer? LM zimmert in den Trümmern ihrer Geschichte herum. Die Trümmer meiner Geschichte liegen in der Kapuzinergruft, wo die körperschaftlichen Relikte des alten Hauses Österreich in Särgen aufgebahrt sind.
Ich möchte nicht begraben sein wie ein Hund. Das Haus Österreich ist eine Gruft. Das ewige Jerusalem, wo Gott wohnen soll, ist auch eine Gruft.
Glaubt Agathe an die Dauer oder an die Ewigkeit? Was davon hat einen Beginn? Glaubt sie an Gestaltung? Würde sie einem tausendjährigen Reich zustimmen, um ein ewiges Leben vorzukosten? Würde sie einem heiligen Jerusalem zustimmen? Ist dies umsetzbar, wenn man an die Autorität von Ingenieuren glaubt?
Im Grunde ist Agathe eine Ungläubige. Eine faule Heidin, die ihren Aberglauben nicht verlieren kann, wie es dem katholischen Gehabe entspricht.
Ich würde, wenn ich könnte, Sichel und Hammer mit Weihwasser von den Sünden reinwaschen und mit Königswasser die Macht zersetzen.
Geist besitzt der Österreicher, wie auch den Glauben an Geister. Das sei in England nicht so und auch nicht in Frankreich, und wie es in Deutschland sei, interessiere LM nicht, weil die Deutschen sich von einem Österreicher in die Hölle haben führen lassen.
Ich wollte verstehen, was sie mit ihrem in Arbeit befindlichen Roman zum Ausdruck bringen wollte. Da sie das Österreichische nicht greifen konnte, wollte sie Agathe begreifen.
Mein Ich ist ein Zufall. Mein Zellhäuflein hat sich auf österreichischem Boden herausgebildet. LM schätzt mich als Neurotikerin ein, da ich mich gegen die Heimat wehre, ihr dabei aber so verbunden bin, daß ich mich mit vierzig noch wehre. Und jetzt sitze ich im Schrankraum und bin froh über die altdeutsche Anrichte, in der ich die Kerzen gefunden habe. Ich sage, daß ich keine Neurotikerin bin, aber LM für eine halte, da sie mir einzureden versuchte, die altdeutsche Anrichte sei ein Sarg.
Agathe sitzt neben mir, und sie wird mich vielleicht befreien. Sie war bereits erfolgversprechend angelegt, von mir erfunden, von LM gefunden. Sie ist mir zum Greifen nah. Aber ich blicke zurück, und Schritt für Schritt gehe ich vor und fetze die Geschichte hin.
LM schaute an mir vorbei und stieß den Atem durch die Nase. Ich holte mir den Fauteuil vom Arbeitstisch meines Mannes und schob ihn heran. Vorsichtig, leise, damit ich meine aufgewühlte Schriftstellerin nicht weiter aufstörte oder gar zerstörte. Ich setzte mich hin und warf ihr einen kurzen Blick zu. Ich war stolz darauf, als Vorbild von meiner Autorin aufgesucht worden zu sein. Ich werde dir die beste Agathe sein, die es gibt, dachte ich. LM hätte nichts erfinden müssen, nur adaptieren ein wenig.
Es geht um Agathe? fragte ich die verstörte LM.
Niemand versteht etwas von Literatur, nur die, die sie erleben, stieß sie aus sich heraus. Aber wer will Literatur erleben? Denn wenn ich Literatur sage, meine ich das Erschütternde. Den Brief an den Vater, de Profundis und Teile aus Malina. Was bitte soll Agathe schlachten, damit der Text stark ist?
Sie hat oft und immer um Rat gefragt, sie hat sogar um Kritik gefleht. LM hatte sich aber immer taub gestellt, hatte dagesessen, unbewegt, und hatte mich reden lassen. Das wunderte mich nie. Ich ahnte, daß sie meine Ideen benützen würde. Daß sie mich aushorchte. Daß sie mich beobachtete. Agathe sah sie in mir. Ich sollte sie profilieren.
Ich weiß, daß sie das weiß. Aber trotzdem wußte sie heute mehr als ich.
Ich weiß, daß du zur Kritik zu faul geworden bist, zu faul zum Einwand, zu faul, mich zu stoppen, zu faul, mich aufzuklären, zu faul, mich zu einer Umkehr, zu faul, mich zu einem Neuanfang anzuregen, zu faul, mich zu prügeln, zu faul, mich mit mir und diesem Kasperltheater zu konfrontieren. Das sagt ja schon alles.
Welch ein Ende für eine Hauptfigur, die unbelebt im Regal sitzt. Ich schreibe ihr mit dem Bleistift ein »Agathe« auf die Stirn, damit jeder weiß, um wen es sich handelt, falls man den Körper findet.
LM sagte mehrmals »Agathe« vor sich hin, als wollte sie sich auskotzen. Sie hielt die Hände auf und sagte die Agathe-As, und die Vokale sammelten sich auf den Handtellern und verbreiteten sich mit dem Ä am Schluß. LM klatschte alles zusammen. Wen interessiert eine Figur, die sich schon in der Melodie ihres Namens für bedeutungslos erklärt, sich also selbst vernichtet! A-A-Ä. Ich bitte dich!
An einem Namen scheitert die Geschichte nicht, sagte ich und zeigte mich verständnislos.
LM warf den Kopf in den Nacken. Glaubst du, ich schreib über Brustkrebs? fragte sie.
Mir wird schlecht, wenn ich an Brustkrebs nur denke, sagte ich. Du wirst ihr doch nicht einen Brustkrebs andichten. So etwas Unappetitliches, sagte ich. Du schreibst doch nicht an einer Brustkrebsgeschichte? fragte ich.
Wenn sie Agathe heißt, entsteht automatisch eine Brustkrebsgeschichte. Agathe ist die Schutzheilige der Brustkranken. Also wird sie unweigerlich an Brustkrebs denken müssen, und deshalb hat sich der Brustkrebs schon eingeschlichen in die Geschichte.
Ich will keine Brüste, keine Mammographie, keine grapschenden Frauenärzte und schon gar keine Geschwüre, mir vielleicht auch noch offene, stinkende, unheilbare Brustkrebsgeschwüre vorstellen müssen, um sie gleich wieder wegzudenken und nicht darüber zu schreiben. Gewiß sind Namen nicht prägend, oder sie müssen nicht prägend sein. Eine Agathe muß sich den Teufel um Brustkrebs scheren, sie muß auch nicht leiden. Aber gerade dann, wenn jemand keine Symptome hat, ist es ernst um ihn bestellt. Nicht umsonst beginnt spätestens ab vierzig ein flächendeckendes Krebsvorsorgeprogramm. Agathe wird sich ihr sexistisch ausgenütztes Fleisch zwischen Glasscheiben quetschen lassen, und natürlich wird sie währenddessen über die Bedeutung ihres Namens nachdenken. Ich würde mir ja etwas verschenken, wenn sie Agathe heißt und ich die Schutzheilige der Brustkranken einfach außer acht lasse. Nach Jahren sinnloser Arbeit komme ich dahinter, daß Agathe eine Puppe ist.
Laß das Kasperltheater mit der Puppe, der Sissi, dem Hitler und der Kapuzinergruft, hättest du sagen müssen, aber da du nichts gesagt hast, mich im Gegenteil sogar bestärkt hast, daß eine österreichische Gruftgeschichte zu mir paßt, hast du mich zum Narren gehalten. Ich bin nicht bockig, ich bin verzweifelt. Ich habe meine Zeit verschwendet, meine kostbare Energie in die Gruft getragen und mich vergiftet.
Vor den Särgen der Erzherzoginnen und der Schar von Kindersärgen erinnere ich mich, daß man über Tote nicht schlecht sprechen soll, sonst kommen sie und holen einen. Als Studentin der Archäologie hatte ich eine Kommilitonin abgelöst, die in Ägypten bei Ausgrabungen von Mumien volontierte und plötzlich zurück mußte. Diese Frau hätte eine Schutzheilige brauchen können.
Als Frau nach Ägypten gehen, sagte der Restaurator, bei dem ich damals in die Lehre ging, und brach ab und setzte fort, daß er also ihre Stellung, und er räusperte sich und korrigierte, ihre Stelle bei den Mumien nicht angenommen hätte.
Wochenlang schlief ich in einer Baracke, an einem Platz, an dem niemand sonst sein Bett aufgestellt haben wollte. Ich glaubte an keine Geister, Flüche oder Götter. Ich fand den Platz besonders geschützt, da ich die Wand im Rücken hatte. Wochenlang litt ich unter schrecklichen Beklemmungen und Ängsten, deren Ursache ich auf die Existenz in einer Nekropole zurückführte. Ich schlief mit dem Rücken zur Wand. Ich atmete schnell, pumpte die Luft in mich, und meine Lungen waren voll. Bevor ich platzte, trank ich eiskaltes Wasser, das das Luftvolumen in mir schrumpfen ließ. Durch die Mauern sickerte was, durch die Laken und meine Wäsche, durch die Haut an meine Knochen und Eingeweide. Ich war durchtränkt von etwas. Ich lag wach und hörte dem Schnarchen und Röcheln meiner Kollegen zu, inhalierte die schwarze, geruchlose, durchsichtige Luft und begann an immer ärger werdenden Bauchkrämpfen zu leiden, bis ich mich in medizinische Betreuung begeben mußte und man eine Nekrotisierung meines Darminhaltes feststellte und glücklicherweise noch etwas dagegen tun konnte.
Ich räumte meine Baracke und packte mein Werkzeug aus dem angrenzenden Geräteschuppen. Der Schuppen war direkt an der Wand zu meinem Bett angebaut. Ich stöberte im Regal nach meinen Sachen. Hinter dem Werkzeug entdeckte ich prallgefüllte Nylonsäcke. Gliedmaßen, Köpfe und Rümpfe von uninteressanten Mumien waren da reingestopft. Ich kann sagen, daß ich jede Nacht Kopf an Kopf mit tausende Jahre alten Schädeln schlief, getrennt durch eine dünne Bretterwand. Ich war entsetzt, daß mich diese Gebeine so affizieren konnten.
In Ö spezialisierte ich mich auf Metalle. Schmuck, Orden, Münzen. Bei den Zinnsärgen bin ich gelandet. Ich wollte Substanz, das schöne Leben in den Händen spüren, die Schönheit dem Tod entreißen und der Vanitas des Todes ins Antlitz sehen.
Mein Chef ist ein Mann, aber kein Unmensch. Er erzählte die Geschichte der vergewaltigten, eingesperrten, wer weiß wie oft vergewaltigten Kommilitonin, die sich angeblich, kurz nach ihrer Auslöschung, umgebracht hatte. Er verwendete in seiner Erzählung nicht das Wort »vergewaltigen«. Statt »vergewaltigen« sagte er »mausen«. Zurück in Ö, wurde die gemauste Kommilitonin von einem Waschzwang befallen. Angeblich duschte sie den ganzen Tag, mit immer heißer werdendem Wasser. Sie war unansprechbar und in einer Klinik. Man ließ sie duschen, so oft und so lange sie wollte. Man kontrollierte nur die Temperatur, damit sie sich nicht verbrühte, und damit sie sich nicht erhängte, war der Duschkopf einzementiert. Doch eines Tages – irgendwo und irgendwie hatte sie sich die Tauchsieder organisiert – verlangte sie nicht nach einer Dusche, sondern nach einem Vollbad. Niemand in der Anstalt war daraufhin stutzig geworden. Man gewährte es ihr, und sie war allein im Bad. Sie steckte die Tauchsieder ins Wasser, und als es wild kochte, stieg sie hinein. Der Kreislauf kollabierte. Über eine Stunde lag sie im kochenden Wasser, war gar und eigentlich konserviert.
Über sie wollte ich schreiben. Aber sie ist fort. Krebsrot war ihre Leiche. Schamrot, stelle ich mir vor. Das ist nun die Strafe. Alle sind ein bißchen von Geistern gejagt, aber wer ist schon so gequält wie diese Agathe? Vielleicht hat sie sich in mein Leben geschwindelt, mich kooptiert. Sie hat sich halt abgelagert. Ich nannte sie Agathe. Ich benenne sie nun um.
LM ist keine Vergewaltigte, eher eine Vergewaltigerin. Sie ist keine Verfolgte, sondern eine Verfolgerin. Deshalb ist sie bei mir. Sie sucht ein Dilemma.
Nebensächlich, sagte LM. Soviel muß gesagt werden zu einer weiblichen Hauptdarstellerin, die nicht jung, sondern erwachsen ist und in einem Alter, wo sie Stellung zu beziehen hat: Ob sie Kinder hat oder nicht, und wenn ja oder nein, wieso ja oder nein, ob sie einen Mann hat oder nicht, oder mehrere oder nicht, und wenn nicht, wieso nicht, und ob sie arbeitet, und wenn, wieso überhaupt nicht was ganz anderes.
Mit einer Frau ist man gebunden. Ein Jahr habe ich mir darüber den Kopf zerbrochen, wie ich Agathe auftreten lasse. Was sie anstellt und wie ich ihre Stellung erzähle, um ihr alles andichten zu können, was mir nahegeht. Ein Mann tut etwas, und das ist dann die Geschichte. Mit Agathe bin ich eingeschränkt. Und dabei ist sie die willfährigste Puppe.
Zuerst muß ich den Körper verschwinden lassen, dachte ich. Ihn zerschreiben, von innen nach außen wenden, dachte ich, und dann kam die politische Wende, und mit der Wende kamen die Habsburger in die Geschichte, und mit den Habsburgern Österreich und Hitler, und die zweite Republik, und wieder die Wende, und mit der Wende das Ende meiner Agathe-Geschichte. Und in das Ende der Agathe-Geschichte krachte der Terror, und mit dem Terror brach Agathe wieder auf, dabei krachten phallische Türme zusammen, aber da es zwei waren, waren die Türme für mich keine phallischen, sondern lactalische Symbole. Und ich wußte, mein Problem ist die Frau.
Ich riß die Fenster auf, als ich die Türme im Fernsehen einstürzen sah. Ich saugte die modrige Luft aus dem engen Hinterhof tief in die Lungen. Ich war dankbar, daß Wien so uninteressant und friedlich war, trotz grassierendem, radikalen Rechtspopulismus. Schreibzwang befiel mich. Agathe soll auferstehen. Der männliche Geschichtskörper, der immer terroristisch ist, wird sie nicht mausen. Ich fing mit ihrem Busen an.
Ihr Busen, ehrlich gesagt, stört mich. Ich bin eben überhaupt nicht lesbisch gepolt. Selbst herumliegende BHs stören mich. Wenn ich jemanden Agathe nenne und eine Hauptperson aus dieser Agathe mache, kann ich mir ihren Busen gar nicht vorstellen, aber wenn Agathe eine Frau ist, wird sie einen Busen haben müssen, es sei denn, sie ist eine Brustamputierte, also eine Lädierte, sagte LM.
Eine gesichtslose Frau wäre ja schnell gefunden. Aber eine geschichtslose? Eine körperlose Frauengeschichte. Was sagst du? Milch? Nein, danke, keine Milch. Ich trinke den Tee lieber schwarz. Wenn es schneit, denke ich, daß es die flockige Milch einer Göttin ist, die uns zudeckt und erstickt. Ist das nun weiblich oder bloß verrückt? Finde das milchgebende Organ appetitlich und du hast keine Probleme, dich in Agathe zu versetzen und aus ihr heraus zu schreiben. Wäre ich gestillt worden von meiner Mutter und nicht nur an ihr weiches, nährendes Organ gedrückt und fast erstickt, würde ich den Körper der Agathe annehmen können und aus ihrer Geisteswelt schreiben.
Ihre Augen sind nackt und starren. Die weißliche Haut ist käsig, schlaff, unterfettet. Die Nase ist zu fleischig, der Bauch zu breiig. Die Brust betrachtete ich gar nicht, der Po war verbeult, »durchgesessen« würde man zu einem Sitzmöbel sagen. Ich besorgte Messer und Spitze und näherte mich aus dem Hinterhalt. Schlich mich von hinten an die Hauptfigur heran.
Jetzt sitze ich in meinem Schrankraum und wundere mich über die Größe. Schaue nicht in die Augen der Agathe, sondern in die glotzenden Brüste und zücke die Spitze, mit der ich mich schriftlich bei Trost halte. Gehe ich so mit weiblichen Hauptfiguren um, weil ich nicht gestillt worden bin? Die Frauenmilchforschung besagt, daß dreiundachtzig Prozent der männlichen Nachkommen und nur ein Bruchteil der weiblichen Nachkommen gestillt werden in der österreichischen Sozialisation. In den meisten Fällen leiden die Tochtermütter an Stillhemmung. Sie fürchten durch das Stillen von Töchtern auf das Kreatürliche reduziert zu werden. Die Knäblein hingegen säugen sie ausgiebig, und da haben sie nichts dagegen, als Muttertier zu gelten. So wie meine Mutter sich erfreute am forschen, wachen, durchschauenden Blick des noch blinden, weiblichen Säuglings, so fühlte sie doch auch eine tiefe Befremdung angesichts meines nach ihrem Busen schnappenden Munds. Sie hat die Milch nicht vom Fleisch trennen können.
Wie die Stillhemmung sie befiel, befällt mich eine Schreibhemmung, wenn eine weibliche Hauptfigur von mir beschrieben werden soll. Ich richtete den Blick auf sie. Stift und Papier und eine Skizze. Sehe ich Agathe geschrieben, fallen mir Alter und Schönheit und eine Art Aufrichtigkeit an den Lettern dieses Namens auf. Oder ist es Redlichkeit? Redlichkeit nervt. Redlichkeit ist ein betuliches Wort. Ich fühle, wie mir jemand das Haar aus der Stirn pustet. Agathe ist mir sehr nah. Sie sitzt ja gleich neben mir und ist ziemlich schwer, und das Regal wird sie hoffentlich tragen, sie schaut auf das Blatt. Beobachtet, wie ich schreibe. Da sie so nah ist, berührt mich ihre Nähe überall. Ich flüsterte in ihr Ohr und sagte zu ihr, einer Lactalphobikerin, daß wir einander nähren könnten und voneinander schöpfen, daß die eine der anderen etwas zufließen lassen kann, daß wir einander säugen sollten.
Ich ging aus dem Zimmer, sagte LM, mir erklärend, daß ich die Frauen wie ein Mann lieben müsse, denn richtige Männer verfallen keiner Schreibhemmung.
Ich streifte mein Kleid glatt, vertrat mir die Füße und ging wieder zurück.
Da stand Agathe wie angewurzelt im Zimmer. Sie rührte sich nicht von der Stelle. Wie eine leere, starrende Hülle stand sie im Zimmer herum. Ich sprach sie an, sie antwortete nicht. Ich stupste sie an, und sie rührte sich nicht. Ich kommandierte sie wie einen Hund. Das Verständnis reichte nicht zur Befolgung eines Kommandos. Die Augen waren stumpf und leer und dumm. Wie eine Puppe stand sie da, erstarrt wie zur Salzsäule. Sie transpirierte. Die Haut glänzte wie Plastik. Sie war aber nicht aus Plastik, denn ich roch die Körpercreme, mit der sie sich eingerieben hatte. Ich leckte ihr über die Wange. Ich schmeckte das Salz. Da Agathe eine militante Nichtraucherin ist, provozierte ich sie mit einer Zigarette. Ich zupfte mir eine Zigarette aus der Schachtel, direkt vor ihren Augen. Ich deutete mit der Zigarette nach dem frischen Obst, hielt die Zigarette und beschrieb im großen Bogen wie mit einem Stift den herrlichen Duft der reifen Himbeeren in der Schale auf dem Tisch, der von dort bis zu mir und um mich herum den ganzen Raum erfüllte. Dann zündete ich die Zigarette an, nahm einen langen, noch die letzte Bronchie verteerenden Lungenzug, lehnte mich zurück in den Fauteuil, schlug die Beine übereinander und blies den krebserregenden Rauch in ihre Richtung.
Ich selbst schwieg und verbot mir, die Nase zu rümpfen. Ich bin eine militante Nichtraucherin.
Respektlosigkeit hatte ich für Mut gehalten. Und ich fühlte mich stark, weil ich mir den Mut leistete, respektlos zu sein, und die Wohnung verstank, sagte LM.
Mitten im Raum stand LM, mit kurzgeschorenen Haaren, farblos, aschblond, von einem nebelfarbenen Grau durchsetzt, und spielte Agathe. Immerhin starrte sie mich an, sagte LM. Weil sie mit mir und mit einer Zigarette nicht gerechnet hatte.
Agathe schwieg, stand da, wie eine Puppe, ein leeres Kästchen in Menschenform, ein Sarkophag in Fleischfarbe und Lederkleid. Freilich hat Agathe Angst, denn sie mußte sich für wahnsinnig halten, weil ich bei ihr aufgetaucht war, eine Erscheinung, ein Geist in ihrer Wohnung, in ihrem liebevoll eingerichteten Wohnzimmer. Wie aus dem Koma erwacht, ganz ohne Gedächtnis, stierte sie. Ich trällerte ein Liedchen zur Zerstreuung. Pfiff eine fröhliche Melodie und guckte mich um und entdeckte auf dem Kaminsims die glasäugigen Vögel ihres angetrauten Tierpräparators. Es sind Trophäen und Pokale in einem. Die Tierpräparation ist eine Kunst mit eigener Fachwelt. Diese Fachwelt hat ihre eigenen Gesetze. Und nach diesen Gesetzen wird geurteilt und verurteilt. Die zwei ausgestopften Exemplare sind auf jeden Fall Prachtstücke. Das sieht sogar ein Laie wie ich. Wie aus dem Leben gerissen ist der Bruchteil einer Sekunde in Dauer übergegangen. Die Vögel drehen ihre Köpfe voneinander weg und schauen links und rechts in die Wand. Die Spannung ihrer sich gerade hebenden Flügel wird mit Draht unterstützt. Wohin immer sich die beiden Wendehälse gerade aufmachen wollten, la mort subite hat sie erwischt. Zu den Krallen der Vögel glänzten Metallplättchen. Von meiner Warte aus war es jedoch unmöglich zu lesen, was darauf stand.
Welche Trophäen könnte Agathe nach Hause bringen, und welche Preise pflegt sie abzustauben? Für Särge, die sie restauriert. Auch hierfür gibt es eine Fachwelt mit Gesetzen und Wettbewerben. Medaillen? Pokale? Oder Grabbeigaben? Ist sie eine Leichenfledderin? Sie verdient zumindest gut, seit sich diese Nische, in die gerade ein paar Särge passen, für sie aufgetan hat. Sie hätte sich die toskanische Silberschale auf dem Tisch kaufen können und die Früchte. Aber kauft sich Agathe privat irgendwas aus Metall? Vielleicht sollte ich die Silberschale gegen einen Marmorteller eintauschen. Das Zimmer ist dunkel und hölzern und irgendwie englisch durch den Kamin und den Sims und die Vögel und das Eisenbahnbild darüber. Es ist totenstill, könnte man sagen, nur ein Holzwurm tickt, und die Zigarette knistert. Ich rauche und verstinke die Wohnung. Agathe starrte entgeistert, was ich mir aber auch nur einbilden kann. Hast du Sägespäne im Kopf? fragte ich und zeigte die Zigarette, sie aufrecht zwischen zwei Fingern haltend, zeigte, wie der rauchende Phallus zu Asche würde, sich verkrümelte und abfiel. Da nirgends ein Aschenbecher bereitstand und Agathe keine Anstalten machte, auch nur den kleinen Finger zu rühren, um mir einen zu zeigen oder zu holen, oder die marmornen Obstschüsselchen zweckzuentfremden, schnippte ich die Asche einfach weg. Ich achtete darauf, daß die Asche nicht auf den Perser fiel, sondern auf das Blech vor dem Kamin.
Mein Blick glitt nochmals zu den ausgestopften Wendehälsen hin. Der eine schien seinen Blick mehr ins Zimmer gerichtet zu haben, starrte nicht mehr in die Wand, sein Schnabel zeigte auf mich, während der andere nun wirkte, als wollte er von dem Geschehen um Agathe überhaupt nichts mehr mitbekommen, er hatte seinen Kopf um hundertachtzig Grad nach hinten gedreht und starrte ins Eisenbahnbild. Kann es sein, daß man sich in diesem Zimmer, in dieser Wohnung, sehr wohl bewegte, bloß in einer entsetzlich gestreckten Zeitlupe? Darauf fiel mir das kurze Leben einer Eintagsfliege ein. Vielleicht vergeht auch für mich die Zeit irrsinnig schnell. Vielleicht bin ich die Fliege hier und sollte schleunigst verschwinden, bevor es zu spät ist, vielleicht bin ich diesen Himbeeren auf dem Tisch entflogen, wurde eingekauft und verschleppt von Agathe und habe mich jetzt hier auf dem Fauteuil niedergelassen und bilde mir ein, weiß Gott wer zu sein. Da fiel mir ein Vers von Klaus Merz ein: Jede Glut kürzt den Docht. Ich versuchte also ruhig zu bleiben, stürzte mich nicht in die Vorstellung einer Welt, die für mich nicht gedacht war. Warum sollte ich auch ein anderes Tempo empfinden und an den Tag legen als Agathe. Ich konzentrierte mich auf die beständigen Werte, die die Wände verkleideten: Poe, Kafka, Wilde, Barnes, Bachmann. Wer aber ist die Anonyma, dachte ich. Ich erinnere mich an meine Verwunderung. Weshalb wunderst du dich? Steht eben bei Agathe das Werk einer Anonyma herum. Ich flitzte über die Titel. Ich hegte sogar den Verdacht, daß Agathe unter diesem Pseudonym schrieb. Ich musterte sie argwöhnisch. Dann hätte LM eine Konkurrentin erfunden. Sie starrte stumpfsinnig vor sich hin. Agathe wäre mir bestimmt sympathisch, stünde sie nicht weiterhin wie eine Tote in einer Geisteswelt herum. Ich glaubte nicht, daß sie tot ist. Konkurrenten sind doch höchst lebendig. Sie denkt sich was. Diese Verstellung macht einen Sinn. Dabei könntest du so hübsch sein, sagte ich Agathe. Sie rollte nicht einmal mit den Augen. Sie blieb regungslos. Ich hätte mir zumindest eine Schreibschwierigkeit verpaßt. Ich hätte mich aufgefordert, sofort die Zigarette zu töten und zu verschwinden, wie ich aufgetaucht war. Sie brauchte nur das Buch, das sie in der Hand hielt, zuzuschlagen. Ich hätte die Polizei gerufen oder wäre hinaus in den Flur gelaufen und hätte um Hilfe geschrien. Es wäre so leicht gewesen, ein Lebenszeichen von sich zu geben. Aber Agathe schwieg und dachte wohl, ich sei wahnsinnig.
Ich mag das nicht. Ich bin nicht nichts. Ich bin Gestalt, und sogar Gestaltung. Ich bemühe mich um Geduld, werde meine Hauptfigur mit Logik stopfen und beseelen, nicht bloß als Konstrukt behaupten. Denn alles trug sich zu, genau wie ich es schreibe. Ich stellte mich freundlich und sagte: Hallo, wie war dein Tag? Vielleicht kann sie nicht antworten, überlegte ich, vielleicht hat sie kein Sprechwerkzeug. Ihre Augen sind nach wie vor stumpf, als hätten sie noch nie ein Licht empfangen oder sonstwas reflektiert. Haben Sie Ihre Tage, vielleicht? fragte ich. Schlagen Ihnen Ihre Tage auf die Ohren? fragte ich. Nach wie vor machte Agathe keinen Mucks. Sind Ihnen die Tage zu Kopf gestiegen, oder handelt es sich eher um eine Umnachtung?
Was kann diese künstliche Hauptfigur reizen? Auf dem Kaminsims stehen Photos. Ihre unleibliche Tochter, ihr alter Mann interessieren mich nicht. Woher weiß ich eigentlich, daß die Dame Restauratorin ist? Mein Blick fällt auf einen Serviettenring. Zwischen den Wendehälsen. Der Serviettenring ist aus Elfenbein? Welch ein politisch unkorrektes Material! Das ist gut für Agathe. Fährt sie auf Safaris in Afrika und schießt illegal Elefanten? Ich erhob mich und machte einen Schritt, zeigte also Agathe, was Bewegung sein kann, wiederholte es für sie Schritt für Schritt und schnappte mir diesen Elfenbeinring. Er war ganz glatt und kühl, ich fühlte, da war mal Leben darin. Ich mag dieses Material, ich bewundere es regelrecht, und ich will es um jeden Preis besitzen, nicht umsonst würde ich beim Kauf eines Klaviers auf Elfenbeintasten bestehen. Viel lebendiger käme meine Musik dann daher, und doch ist mir persönlich Elfenbein politisch viel zu unkorrekt. Ich mag kein Schießen und Töten. Ich rutschte mit meinem Finger über den Elefantenzahn und schabte den vergilbten Belag ab. Das Material splitterte, und als ich weiterkratzte, splitterte es weiter ab und wurde politisch noch unkorrekter. Ich warf Agathe einen mißtrauischen Blick zu, bevor ich weiterdachte. Der Ring war nicht aus Elefantenbein, sondern aus einem menschlichen Knochen.
Genauer: Welchem Rückgrat hatte Agathe diesen Wirbelknochen entnommen? Und weshalb hat sie ihn poliert und ausgestellt zwischen den Wendehälsen? Fleddert sie Leichen und ist sie stolz darauf? Gibt es auch dafür eine Fachwelt? Oder halte ich ein Pars pro toto Agathes in Händen? Oder ist es ein habsburgischer Wirbel womöglich? Fürchtet sie Rache für den Diebstahl, die Leichenschändung, die Störung der Totenruhe? Deshalb die Totstellung?
Ich halte den Knochen fest. Ich gehe auf sie zu. Wie bleich diese Agathe ist. Ich halte ihr den Knochen unter die Nase. Woher stammt denn der, frage ich streng wie eine Mutter, mit stechendem Blick, der vielleicht zu stechend ist und Agathe einschüchtert und sie deshalb zu keiner Widerrede finden läßt. Meinem Ton konnte sie ja schon entnehmen, daß ich alles wußte und was ich nicht wußte ihr eben andichten würde. Und dennoch ist es mir unbegreiflich, weshalb sie sich nicht einmal einen Versuch leistet, eine Ausrede für die Fledderei zu erfinden.
Stimmt, dachte ich.
Stimmt doch, sagte LM in die Pause, in der ich stumm geblieben war und sie bloß fixiert hatte.
Woher hat sie das mit dem Knochen? Einem Alleswisser vorzuwerfen, daß er nicht alles weiß, lähmt.
Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe in vollem Bewußtsein, aus reiner Boshaftigkeit den Ehrenkodex der Restauratoren der Kapuzinergruft, niemals etwas aus den Särgen zu entfernen, verletzt und meine Vertrauensstellung dadurch ins Wanken gebracht, daß ich einen habsburgischen Wirbel gestohlen habe und nicht einmal wußte, wozu.
Der Schrein Agathe blieb geschlossen. Sie rührte ihre Zunge nicht.
Ich klemmte den Wirbelknochen wie ein Monokel in ihr Auge. Ich richtete ihren Kopf so ein, daß sie das ganze Zimmer sehen mußte. Dann führte ich mich wie ein Einbrecher auf.
Ich räumte den Kaminsims ab. Ich holte mit dem rechten Arm aus und fegte die Sachen herunter. Die Wendehälse flogen durchs Zimmer. Ich rechnete mit Protest. Oder vielleicht wäre Agathe bereit, ein Wirgefühl zu entwickeln, und mitzumachen, aber im Gegenteil. Sie behielt ihren Schweigestil bei.
Ich ging zu ihr hin, und Aug in Aug standen wir uns gegenüber. Soll ich weitermachen? fragte ich. Da sie schwieg, machte ich weiter. Ich warf die Möbel um. Auch die altdeutsche Anrichte wollte ich umwerfen, natürlich war sie zu schwer. Ich riß die unterste Lade heraus und leerte sie aus. Dann die nächste und die nächste, und zum Schluß kam die oberste dran. Ich wühlte in dieser Lade. Ein Schrei entfuhr mir. Ein Lustschrei des Erfolgs. Was mußte ich entdecken: Serviettenringe, Menschenknochen. Das konnte ich nicht wissen, auf diese Idee wäre ich allein nie gekommen. Agathe muß ein Eigenleben besitzen, und ich werde es schon herauskitzeln. Ich packte den ersten Wirbel und hob an und zog das auf eine Kordel gefädelte Wirbular eines kompletten Rückgrats hervor. Was bringt jemanden dazu, sich mit so etwas Grausigem auszustatten? Was bedeutet das Rückgrat in der Lade dieser schweigenden Agathe? Sag doch was, sagte LM und senkte den Kopf und schaute mich von unten an, flehentlich und doch mit dem lauernden Blick eines Raubtiers. Als hätte ich sie an den Knochen schnuppern lassen, den Appetit erweckt auf eine Inkorporation.
Tut mir leid, sagte ich, woher soll ich das wissen? Ich bin nicht deine Agathe.
Es war schwach von mir, mich aus der Affäre zu ziehen. Ich fühlte mich wie ein Verräter. Beim besten Willen war ich nicht imstande, ihr die Erklärung für den habsburgischen Wirbel zu liefern.
Auch ich besitze eine Anrichte, das einzige alte Möbelstück in der Wohnung, das wir längst hinauswerfen wollten, da es ein wuchtiges, tiefbraunes, altdeutsches Stilmöbel ist, das sich bereits in der Wohnung befand, als wir einzogen. Längst schon hatte ich Fotos gemacht und diese auch dem Dorotheum geschickt, um die scheußliche Anrichte unter den Hammer zu bringen. Ich hatte bereits mit dem Schätzmeister telefoniert und ihm die Ausmaße des Ungeheuers bekanntgegeben. Er hatte geseufzt und gesagt, daß es in Wohnungen kaum noch Platz für einen solchen Raumfresser gebe. Er wäre bereit gewesen, den Brennholzwert zu bezahlen. Da wir aber selbst einen Kachelofen besitzen, beschloß ich, das altdeutsche Unding privat zu zerhacken. Bis heute bin ich nicht dazu gekommen. Die Anrichte befindet sich nun im Schrankraum. Früher stand sie frei im Wohnzimmer, prominent und brutal wie ein alter Altar.
Als wir einzogen und die Wände abspachtelten, um alles neu auszumalen, fiel uns ein frisch gefärbelter Fleck genau über der Anrichte an der Decke auf. Ich war es, die sofort auf die Anrichte kletterte, und weil ich sehr groß bin und lange Arme habe, erreichte ich die Stelle mühelos mit dem Spachtel und schabte ein bißchen herum. Schon bald spürte ich einen Widerstand. Ich stocherte weiter und war begeistert, als die Splitter von menschlichen Schädelknochen und etwas weiter entfernt ein Projektil aus der Decke zu kletzeln waren. Die Anrichte steht noch heute an diesem Platz. Sie war zu schwer, um weggerückt zu werden. Trotzdem ist sie unsichtbar, denn nun sind Wände rundherum gebaut. Hier drin ist unser Schrankraum. Auch der Fleck ist versteckt. In der Lade der Anrichte liegt ein unvollständiges Silberfischbesteck. Wie LM bloß auf Menschenknochen kam?
Es ist zum aus der Haut Fahren, sagte LM, ich bin über die Seite dreißig nicht hinausgekommen.
Du machst dir zuviel Druck, sagte ich
Jeder normale Mensch, erwiderte LM und brach plötzlich ab.
Ich betrachtete meine Handinnenflächen und dachte an Hausfriedensbruch unter Freunden. Ab wann handelte es sich um Verrat?
Agathe, sagte LM, schaut mich nur an, wenn ich mich so positioniere, daß ich ihr in die Augen stiere. Sie ist genauso groß wie ich, aber halt kein Funke Grips. Vielleicht hat ihr Mann sie mit Gips vollgestopft. Vielleicht liebt er nur ihre Hülle. Vielleicht ist sie innerlich lange tot. Vielleicht ist das Rückgrat ihr Rückgrat. Wieder tauchte ich die Arme bis zum Ellbogen in die Lade und fischte ein Hechtmesser mit scharfer Klinge heraus, das zum Abhacken eines Menschenkopfes reicht.
Ich hielt es Agathe unter die Nase und wendete es. Nur das Messer blitzte und ihre Augen nicht. Der Blick war unerschreckbar. Ich setzte ihr die Spitze an und ritzte den Hals an. Ich rutschte mit der Spitze ins Genick, kräuselte mit der Klinge die graumelierten Haare. Ich fuhr mit der Spitze ihre Kurven entlang, zum schmalen Becken, das nie das Gefängnis eines Kindes war. Unbewohnt ist Agathe immer gewesen, und da Agathe unzugänglich ist, bleibt sie leer. Es geistert höchstens in ihr.
Ich lächelte blöde. Was LM mir da erzählte, war mir peinlich. Sie hielt die Hände an ihren Körper gepreßt. Sie modellierte an sich rum und stöhnte. Röchelte und stieß komische Laute aus, wie ein Geisterbeschwörer. Sie klopfte sich auf die Brust. Hörst du? fragte sie mich. Ich mußte genau hinhören. Sie bat mich, mein Ohr auf ihre Brust zu legen. Ich tat es und lauschte, während sie sich weiter auf die Brust klopfte. Ich hörte einen satten Klang. Nichts Hohles. LM raunte. Sie war so nah, daß ich die großen Poren ihrer sonst so fein wirkenden Haut sehen konnte, Schlaglöcher, Krater, Abgründe. Aus nächster Nähe sah sie fremd aus. Sie schlug sich mit der Handkante aufs Brustbein. Und sie sagte: Ich habe Agathes Thorax geknackt.
Ich wagte kaum zu atmen, um sie nicht von ihrer Idee abzubringen.
Ich habe Agathe berührt, sagte LM. Sie war aufgeladen, und ein elektrisches Knistern entlud sich. Ich überlegte, sie in eine Zwangsjacke zu stecken. Aber wo sollte ich eine Zwangsjacke besorgen können um diese Zeit? Vielleicht fesseln, um ihren Charakter zu verdichten, ihren Kern festzuzurren. Ich ging ins Schlafzimmer. Ich wühlte in ihren Kleidern. Ich wollte ihr etwas Enges anziehen. Ich fand nur elegante Sachen, ein Velourslederkleid und weiße Arbeitsmäntel, T-Shirts und Strümpfe. Ich nahm das steife Kostüm. Ich ging damit zu ihr hin. Ich zog sie aus. Ich schälte sie aus der Seide. Sie stand da, reizend, und in mir regte sich was. Mir floß der Speichel zusammen. Ich konnte nicht anders. Ich hatte eine unbändige Lust auf den Mann, der dieses appetitliche Stück Frau besaß. Wie von fremder Macht, die man vielleicht Eifersucht nennt, besessen, raste ich zur Anrichte, nahm das Hechtmesser und hackte ihr den Thorax auf. Ohne einen Muckser, wie gewohnt, blieb Agathe stehen. Nun halt aufgeschlitzt. Ich staunte über meine Kaltblütigkeit, meinen Mut und meine Treffsicherheit. Ich spaltete das Brustbein genau in der Mitte. Der Spalt klaffte die Fallinie entlang. Agathe ging es gut. Sie war so sanft. Ich steckte meine Finger in den Spalt und klappte diese Puppe auseinander.